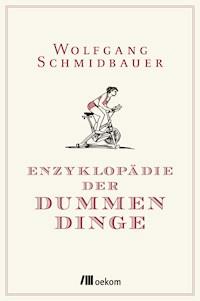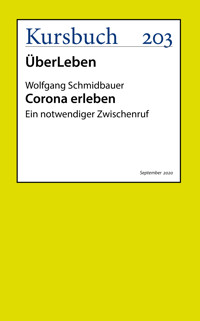18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecowin
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie wir lernen, gelassen älter zu werden Wie gehen wir damit um, dass wir älter werden? Was können wir schon weit vor der Rente tun, um uns darauf vorzubereiten? Der renommierte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer hat sich den großen Fragen des Alterns angenommen. Er packt die Probleme am Schopf und zeigt auf, wie wir unseren Ängsten begegnen und die Lebensqualität im Alter bewahren können! - In Würde altern: Wie kann ich das Unausweichliche akzeptieren? - Kann ich mich mit meinem alternden Körper befreunden? - Lebensfroh im Alter: was zu einem positiven Lebensgefühl beiträgt - Wie bleibt die Erotik im Alter lebendig? - Das Leben genießen: So erreiche ich die »alterslosen Inseln«! Glücklich alt werden: Selbstvergessenheit hilft! Wolfgang Schmidbauer weiß, wovon er spricht. Die Lebensphase Alter kann Unsicherheiten und Ablehnung hervorrufen. Auch er selbst hat, obwohl vom Fach, so lange wie möglich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Älterwerden gescheut. Dabei ist die Lebensmitte der ideale Zeitpunkt, die Weichen positiv zu stellen und uns auf die Veränderungen im Alter vorzubereiten. Den Herausforderungen spielerisch zu begegnen und immer im Tun zu bleiben, hilft. Wie es uns gelingen kann, mit unseren Ressourcen bewusster umzugehen, erklärt Schmidbauer kenntnisreich. Sein Buch unterstützt uns dabei, weder jung noch alt, sondern einfach im Einklang mit uns selbst zu sein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
DIE GROSSEN FRAGEN DES ALTERNS
Seelisch im Gleichgewicht bleiben Dem Leben spielerisch begegnen Das Glück im Tun finden
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
Gendererklärung
Der besseren Lesbarkeit wegen verwendet der Autor im nachfolgenden Text zumeist die Sprachform des generischen Maskulinums. Personenbezogene Aussagen beziehen sich auf alle Geschlechter.
1. Auflage (vollständig überarbeitete und erweiterte Neuauflage von »Altern ohne Angst«, 2001, Rowohlt)
© 2022 Ecowin Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, eine Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Gesetzt aus der Palatino, Transat Text
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagmotiv: © Anna Kucherova/shutterstock
Autorenillustration: Claudia Meitert/carolineseidler.com
ISBN: 978-3-7110-0310-2
eISBN: 978-3-7110-5332-9
INHALT
Einleitung
Wie altern wir im 21. Jahrhundert?
Wie begegne ich dem Alter?
Wie kann ich das Unausweichliche akzeptieren?
Wie gehe ich mit Kränkungen um?
Was kann mich im Alter vor dem Verzagen bewahren?
Kann ich mich mit meinem alternden Körper befreunden?
Wie kann ich die Langsamkeit für mich entdecken?
Wie finde ich das rechte Maß der (Vor-)Sorge?
Wie finde ich Zuversicht?
Können wir lernen, die Aufmerksamkeit zu lenken?
Wie erreiche ich die alterslosen Inseln?
Warum fühlen wir uns schuldig?
Wie können wir der Weisheit des Körpers vertrauen?
Wie lässt sich Zwang in Freiheit verwandeln?
Was kann mir Sicherheit geben?
Wie bleibt die Erotik lebendig?
Wer braucht im Alter noch Psychotherapie?
Was kann ich im Alter gewinnen?
Wie finde ich Heimat im (Pflege-)Heim?
Epilog
Anmerkungen
Interview im ZEITmagazin
Dank
Der Autor
EINLEITUNG
Beim Wandern habe ich eine Abzweigung verpasst, die Markierungen stimmen nicht mehr, ein ungutes Gefühl macht sich breit. Weitermarschieren, wird schon gut gehen? Oder umkehren und herausfinden, wo der Fehler steckt? Um das zu entscheiden, muss ich erst einmal stehen bleiben und mich orientieren. Für solche Momente im Lebensweg ist dieser Text gedacht.
Arbeiten und lieben können ist Sigmund Freuds lakonische Definition der seelischen Gesundheit. In Beruf und Beziehung ist es gut, auf einem Weg zu bleiben, der beide Fähigkeiten erhält, die Freude an der Arbeit und die an der Liebe. Das gilt das ganze Leben lang, gewinnt aber im Alter an Bedeutung. Es wird dann schwieriger, Fehler zu korrigieren. Klüger wäre es gewesen, sie nicht zu machen.
Das psychische Feld, in dem sich Alter und Jugend überschneiden, beginnt bei einem Leistungssportler mit fünfundzwanzig Jahren, bei anderen erheblich später. In diesem Feld können sich neue Ansätze ergeben, neue Entwicklungen beginnen. Die körperliche Basis des Selbstgefühls stellt das Ich in jedem Fall vor die Aufgabe, sich damit abzufinden, dass die Spielräume enger geworden sind. Künftig besteht die Aufgabe darin, standzuhalten und nicht unter ein erreichtes Niveau zu sinken, was ebenso viel Energie beanspruchen wird wie die Steigerung der Leistung in jungen Jahren.
Früher oder später hören wir den Spruch: Das einzige Mittel gegen Altwerden besteht darin, jung zu sterben. Er stellt sich in seiner drastischen Banalität den Rezepten in den Weg, die mit dem Schlagwort forever young einem vielleicht noch älteren Mythos huldigen: Es gibt irgendwo einen Ort, wo göttergleiche Gestalten in ewiger Jugend leben. Wer sich gesund ernährt, Sport treibt und rechtzeitig, aber auch regelmäßig den plastischen Chirurgen aufsucht, nähert sich diesen Unsterblichen.
Säugetiere beginnen zu altern, sobald sie erwachsen sind; wir Menschen machen da keine Ausnahme, was den Körper angeht, wohl aber in der Art, wie wir dieses Geschehen erleben. Wir wissen vom Altwerden, und sobald wir erwachsen sind, ist uns auch klar, dass es uns bevorsteht. Auf der anderen Seite ist nur ein Teil unserer Psyche von Reifungsprozessen beeinflussbar; ein nicht weniger wichtiger Teil bleibt ewig jung. Wir können uns ewig jung denken, wir haben Anlass dazu, denn auch ein Achtzigjähriger kann sich verlieben oder, alltäglicher, »kindisch« freuen, wenn ihm etwas geglückt ist.
Ein Kind idealisiert das Leben eines »Großen«;Erwachsene aber tun gut daran, diese Idealisierung infrage zu stellen, denn sie begründet einen gefährlichen Prozess, der uns hier in seinen vielen Facetten beschäftigen wird: die manische oder auch optimistische Abwehr, die sich mit dem Bild einer idealisierten, ewigen Stärke und Jugend verbindet und uns blind macht für einen realistischen Umgang mit uns selbst und unseren Mitmenschen. Wenn die manische Abwehr zusammenbricht und wir erkennen müssen, dass wir nicht so stark, sicher und unverwundbar sind, wie wir es uns eingebildet haben, empfinden wir heftige Angst, Leere und Mutlosigkeit, fühlen uns im Bett nicht wohl und fürchten doch, es zu verlassen. Es ist schwierig, aus solchen Zuständen herauszukommen, die sich in der modernen Gesellschaft häufen. Denn die Depression lähmt auch die Mittel, die das Ich bräuchte, um sie zu bezwingen.
Möglich ist es jedoch, die manische Abwehr zu erkennen und ihr den kritischen Blick auf ihre Verblendung entgegenzusetzen. Das haben Künstler, Komiker und jene Kinder schon immer getan, die als Einzige wagten, den Kaiser nackt zu sehen. Nicht die Prediger des Erhabenen schützen uns vor der Depression, sondern die Kritiker, die Spötter, die Zyniker. Sie warnen uns vor dem Sirenengesang der Verleugnung.
Eine technische Lösung, die den Menschen zum »Prothesengott« (das Wort prägte Freud) macht, kettet ihn in eben dem Versprechen, es aufzuhalten, an das Alter. Wer sich jeden Tag davon bestimmen lässt, möglichst jung zu erscheinen, gar sich jung zu fühlen, zahlt mit der dauernden Sorge, alt zu werden. Er kann nicht in einen Zustand finden, der – statt eine Antwort zu geben – die Frage nach dem Jungbrunnen außer Kraft setzt: die Selbstvergessenheit.
Für sie gibt es viele Namen. Der antike griechische Dichter Homer nannte sie Muse und beschrieb sie als Göttin, die den Sänger zu seinen Versen inspiriert.1 Weltlicher fasst es Friedrich Schiller: »Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.«2 Friedrich Nietzsche schwärmt von der Macht selbstvergessener Ideen beim Wandern im Engadin. In der modernen Psychologie hat sich Mihály Csíkszentmihályi mit seiner Beschreibung entsprechender Erlebnisse als »Flow« einen Namen gemacht. Er siedelt den selbstvergessenen Zustand zwischen Überforderung und Langeweile an – ein Tätigsein, in dem wir ganz bei der Sache sind und störende Reize ebenso wie Erfolgsdruck ausblenden.3
Selbstvergessenheit ist zugleich erhaben und alltäglich. Sie wird uns geschenkt, ohne dass wir uns um sie bemühen; erst nachträglich begreifen wir, was wir an ihr hatten. Wir können sie nicht machen, sie entsteht spontan und endet ebenso. Sie lässt sich also nicht technisch herstellen; das verbindet sie, ebenso wie ihre Nähe zum Spiel, mit dem künstlerischen Tun.
Aus dieser Überlegung ergibt sich eine Strategie: Die Vorbereitung auf das Alter ist die Pflege der Möglichkeiten, selbstvergessen zu bleiben. Das widerspricht dem Schlagwort vom Ruhestand ebenso wie dessen ironischem Konterpart, dem Unruhestand. Es geht darum, Zustände zu finden und zu bewahren, die uns sozusagen mit dem Gefühl erfüllen, lebendig zu sein, und dadurch die charakteristisch ängstlich-depressive Tönung auslöschen, mit der sonst das Alter als Dahinschwinden, Devitalisierung, Tonusverlust von Leib und Seele erlebt wird. Ob wir tanzen oder malen, musizieren oder lieben, im Garten arbeiten oder in dem Beruf tätig bleiben, der uns interessiert: Alles, was in der Mitte zwischen Stress und Langeweile liegt, sorgt dafür, dass wir uns weder jung noch alt fühlen, sondern im Einklang mit uns und unserem Tun.
Aus der Sicht der vergleichenden Anatomie ähnelt der Homo sapiens einem voll entwickelten Schimpansenfötus – ein als Neotenie beschriebenes Phänomen. Menschenaffen gleichen in den intrauterinen Stadien ihrer Entfaltung erwachsenen Menschen weit mehr als erwachsenen Schimpansen oder Gorillas, vor allem, was das Verhältnis von Gebiss und Gehirn angeht. Man kann diese Tatsache rein symbolisch auffassen oder als ein organisches Fundament des spezifisch Menschlichen betrachten – wie auch immer, sie läuft darauf hinaus, dass Menschen womöglich nie ganz erwachsen werden.
Während andere Säugetiere als Erwachsene nur noch das Nötige tun, spielen Menschen bis ins hohe Alter, was auch bedeutet: Sie sind kreativ, sie lassen sich etwas einfallen, sie finden neue Lösungen. Das betrifft auch das Altern. Denken wir rechtzeitig und gründlich über unsere Ängste vor seinen negativen Aspekten nach, entstehen Gegenkräfte. Sie helfen uns, im Ernstfall vorbereitet zu sein.
Johann Wolfgang von Goethe hat davon gesprochen, Altern sei ein »Geschäft«, das man erlernen müsse wie andere Geschäfte auch. Es geht darum, sich etwas einfallen zu lassen und sich nicht damit abzufinden, dass die Jugend dahinschwindet, dass man immer weniger wird und seinen Stolz am besten dadurch rettet, dass man Sex, Sport und Reisen schon aufgibt, bevor es wirklich nötig ist.
Um die Jahrtausendwende schrieb ich, kurz vor meinem sechzigsten Geburtstag, ein Buch mit dem Titel Altern ohne Angst. Zwanzig Jahre später befragten mich zwei Redakteure des ZEITmagazins, wie sich meine Gedanken an mir bewährt hätten. Auf das Interview hin kamen Fragen nach dem vergriffenen Text; sie unterstützten die Absicht, mich der Thematik noch einmal anzunehmen – und so ist dieses Buch entstanden. Ich wollte es ursprünglich Die Kunst des Alterns nennen, fand dann aber den sachlicheren Titel von den großen Fragen des Alters treffender.
Ein Therapeut altert mit seinen Patientinnen und Patienten. Ältere Menschen gehen nicht gern zu einem Psychoanalytiker, der erheblich jünger ist als sie selbst – und dieser erwidert solche Gefühle. Ein junger Therapeut ist recht wehrlos, wenn ihm ein alter Patient, eine alte Patientin sagt, er könne sich nicht vorstellen, wie das sei, alt zu werden. Seit mir die Kassenpraxis im Jahr 2000 genommen wurde,4 arbeite ich vermehrt mit Paaren und habe viele Erfahrungen mit der Dynamik langjähriger erotischer Beziehungen gesammelt.
Es gibt in der Auseinandersetzung mit dem Alter keine vorgefertigten Lösungen, sondern nur Unikate. Die Kunst des Alterns orientiert sich an einer Unterscheidung, die der französische Ethnologe Claude Lévi-Strauss eingeführt hat: die zwischen dem Bastler und dem Planer, dem Bricoleur im Gegensatz zum Ingenieur.5 In der Praxis müssen auch Ingenieure improvisieren. Sie tun es ungern, während Bastlern das planende Vorgehen der Ingenieurwissenschaft vom Entwurf hin zur Ausführung fremd bleibt.
Bastler-Künstler arbeiten immer mit dem, was gerade da ist, die Dinge haben keine definierte Funktion, sondern werden überraschend eingesetzt. Ein berühmtes Beispiel für diese Kunst ist Pablo Picassos »Stierkopf«. Picasso sagte dazu 1942: »Raten Sie, wie ich diesen Stierkopf gemacht habe! Eines Tages fand ich unter altem Kram einen Fahrradsattel und daneben eine verrostete Lenkstange. Blitzschnell sind in meinen Vorstellungen beide Teile zusammengewachsen … Ohne jedes Nachdenken ist mir die Idee zu diesem ›Stierkopf‹gekommen.«
Wo der Ingenieur nicht weiterkommt, weil ihm das Material fehlt, das er zur Vollendung seiner Entwürfe braucht, sucht der Bastler zusammen, was greifbar ist, und entwickelt seine Lösung intuitiv aus den Zusammenhängen, die sich während seiner Suche ergeben.
In diesem Buch werde ich immer wieder auf zwei Themen zurückkommen, die mir für die Lebenskunst im Arbeiten und im Lieben unentbehrlich scheinen. Im Arbeiten ist es die handwerkliche Haltung, die Entwicklung von Freude an der Selbstwirksamkeit im Tun. Im Lieben die Bereitschaft, den Augenblick zu genießen und sich nicht von den Menschen zurückzuziehen, mit denen das möglich sein könnte. Mit diesen Grundsätzen können wir nicht früh genug beginnen und nicht spät genug aufhören, und beide schützen uns vor den Verführungen der manischen Abwehr.
Auf der noch gästereichen Feier zu meinem sechzigsten Geburtstag sagte ich ironisch, über das Alter würde ich mir mit siebzig ernstliche Gedanken machen. Mit siebzig funktionierte das Manöver erneut – mit dem Altwerden kann ich mich mit achtzig wieder intensiver beschäftigen!6 Ich sammelte nach wie vor in meiner Praxis neben der unvermeidlichen Mühsal Flow-Erlebnisse, arbeitete an Büchern, schrieb mit Freude eine Magazinkolumne und hatte die Redaktion gebeten, mein Alter nicht in der biografischen Notiz zu erwähnen.
Jetzt, mit achtzig, erlebe ich mich verändert. Bisher konnte ich mich auf die durchschnittliche Lebenserwartung berufen. Das funktioniert nicht mehr so recht. Ich bin nicht mehr ein älterer Autor und Psychotherapeut, ich bin alt. Hochbetagt, steinalt pflegte man nach dem achtzigsten Geburtstag früher zu sagen; das Greisenalter begann. Da ich schon mit vierzig weiße Haare bekam, lebe ich dem Wortsinn nach ebenso lange als Greis wie als Mensch.
Wenn ich mir selbst zureden möchte, mit neunzig sei auch noch Zeit, sich über das Alter Gedanken zu machen, erscheint mir das sofort als Hybris. Kann ja sein – kann aber auch nicht sein. An meinen Aktivitäten ändert eine Jahreszahl nichts, wohl aber an meinem Lebensgefühl in den Zeiten außerhalb der Selbstvergessenheit.
Dieser achtzigste Geburtstag war coronabedingt der stillste in den letzten Jahren, aber ich habe ihn intensiver empfunden und die Aufmerksamkeit, die mir geschenkt wurde, mit mehr Ruhe genossen.
Dießen, im Frühjahr 2022
WIE ALTERN WIR IM 21. JAHRHUNDERT?
In den nächsten Jahrzehnten wird sich die Bevölkerung der europäischen Länder in einer Weise verändern, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat. Immer war das Bild der Bevölkerung eine Pyramide. Es gab viele Kinder und junge Menschen; je höher das Alter wurde, desto weniger Personen überlebten. Diese Pyramide ist im 19. und 20. Jahrhundert höher und schmäler geworden, weil sich die durchschnittliche Lebenserwartung veränderte.
In Zukunft wird aus dieser Pyramide ein Pilz oder ein Baum werden: unten schmäler als oben. Eine geringe Zahl junger Menschen wird von einer zwar nicht mehr wachsenden, aber relativ lange stabil bleibenden Schicht alter Menschen überlagert. Der lange europäische Frieden hat zu der »Bohnenstangen«-Familie geführt. Nicht selten kümmern sich zwei Eltern und vier Großeltern um ein Enkelkind.
Unsere gegenwärtigen Illusionen über das, was uns im Alter »eigentlich« zusteht, sind wohl im 19. Jahrhundert entstanden, zur Zeit des Biedermeiers. Greisin und Greis, einst Symbole für Tod und Verfall (so vielfach im 18. Jahrhundert), wurden zu moralischen Vorbildern, die geehrt und respektiert werden. Doch diese Altersverehrung war, ähnlich wie die Verehrung der Frauen (»sie flechten und weben – himmlische Rosen ins irdische Leben«, dichtete Schiller), an Bedingungen geknüpft, die Katharina Gröning, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Bielefeld, so zusammenfasst: »Sie (die Alten) wurden, einhergehend mit einer gewissen Verehrung, aus dem öffentlichen Raum in die Idylle der Gartenlaubenfamilie versetzt. Dort konnten sie von den Jungen verehrt und verklärt werden. Voraussetzung der Altersverehrung war allerdings auch, dass die Alten ihre Ressourcen und Güter nicht selbst verbrauchten, dass Vergnügungen und Zerstreuungen ihnen wenig bedeuteten, dass sie vor allem das Wohl ihrer Familie und Nachkommen im Auge hatten und dass sie ihren Besitz vererbten.«7
Im 19. Jahrhundert entstanden Drucke, auf denen das menschliche Alter als geordnete Abfolge von Stadien dargestellt ist. Analog zur statistischen Alterspyramide beginnt eine erste Phase vom Säugling bis zum Klein- und Schulkind. Daran schließt sich die Periode der Jugend; der Höhepunkt ist mit der Eheschließung erreicht: Auf dem Gipfel der Pyramide steht das Brautpaar. Danach folgt der Abstieg über Elternschaft, rüstiges Alter und Greisenalter. Immer sind die Personen in Familien eingebunden, die Familie ist der Ort, zu dem Kinder ebenso wie Alte gehören, alles andere ist Ersatz, zweite Wahl, Zeichen für ein Versagen der Familie.
In der Konsumgesellschaft wird es anders gesehen, da heißt es: »Man ist so alt, wie man sich fühlt!« Damit verschwindet das Alter aus dem kollektiven Raum. In den Massenmedien ist niemand alt, es sei denn, wir wundern uns, wie jung Stars aussehen, von deren kalendarischem Alter wir wissen. Das öffentliche Projekt läuft auf Leidensfreiheit hinaus. Es wird verdrängt, dass zum Leben auch Krankheit, Tod und Verfall gehören. Wir haben keine Kultur des Abschieds, nur eine Kultur der Ankunft und der Innovation.
Als die französische Schriftstellerin und Philosophin Simone de Beauvoir versuchte, die Verdrängungsschichten zu durchdringen, mit denen gerade auch die Intellektuellen das Alter ausgrenzen, erntete sie naive Einwände, wie: »Aber du bist doch noch gar nicht alt!« Wie die Individualisierungsprozesse allgemein ist auch die Freisetzung unseres Umganges mit dem Alter ambivalent zu sehen. Sie bietet Chancen und schafft Bedrückungen für jene, die diese Chancen nicht wahrnehmen können und dadurch in einer Weise beschämt, entwertet oder ausgeschlossen werden.
Unser gegenwärtiger Umgang mit dem Alter verlangt, uns nicht alt zu fühlen und dem Klischee vom Altern nicht zu entsprechen, das die Jungen uns auferlegen. Die Alten sind gehalten, sich von den »wirklich Alten« abzugrenzen, vielleicht ähnlich, wie Touristen begeistert von Orten erzählen, die nicht von ihresgleichen heimgesucht seien.
1989 sprach der Gießener Soziologe Reimer Gronemeyer von einem »drohenden Krieg der Jungen gegen die Alten« und malte ein Szenario aus, in dem im Jahr 2030 ein Berufstätiger einen Rentner durchschleppen muss wie der Schiffbrüchige im orientalischen Märchen den bösen Meergreis.8 Dann werde auch fast jede zweite Wahlstimme von den Senioren kommen; die Alten würden zu viel kosten und hätten zu viel Macht, sie seien nicht mehr finanzierbar, zumal sie der nächsten Generation die ökologischen Reparaturarbeiten aufgeladen hätten, entstanden aus ihrem bedenkenlosen Umgang mit den Ressourcen.
Die düsteren Prognosen haben sich nicht bewahrheitet. In Umfragen stimmt zwar eine knappe Mehrheit der Aussage zu, die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur seien besorgniserregend,9 aber im Alltag ist laut Umfragen die überwältigende Mehrheit der Alten (90 bis 95 Prozent) mit ihrem Leben zufrieden. Sie wären das nicht, wenn sich die Mehrheit der Bedenkenträger angesichts einer »überalterten« Gesellschaft auch tatsächlich abweisend gegen ältere Mitbürger verhalten würde. Die hohe Lebenszufriedenheit gilt nicht nur für die »jungen Alten« zwischen fünfundsechzig und fünfundsiebzig, sondern auch für über Achtzigjährige, von denen noch viele gesund und aktiv sind.
Die Realität alter Menschen passt im 21. Jahrhundert nicht mehr ganz zu dem, was die Alten heute als Kinder beobachtet und womit sie unbewusst gerechnet haben. Welcher Enkel hätte sich beispielsweise in den Sechzigerjahren vorstellen können, dass ein halbes Jahrhundert später die Schweizer Migros eine Internetplattform unterstützt, auf der eine Großmütterrevolution gefeiert wird und Omas viel mehr machen sollen, als Enkel zu hüten?
In den USA entstehen Seniorenstädte, in denen Alte in klimatisch begünstigten Gegenden Plätze in einer Eigentumswohnanlage mieten können. Manche dieser Siedlungen liegen in Mexiko, wo Arbeitskräfte billiger sind. Wie in anderen Bereichen zeigt sich auch in diesem die Spaltung der Konsumgesellschaft: Die gut situierten Alten leben aktiv und sportlich im ewigen Sommer, während unter den Armen das granny dumping grassiert: Die Polizei hat mit verwirrten Alten zu tun, die von ihren Kindern ohne Papiere ausgesetzt worden sind und sich weder an ihren Namen noch den Ort erinnern, wo diese zu finden sind. Die Nachkommen entledigen sich ihrer Pflichten gerade so, wie es Städtebewohner im Mittelalter angeblich mit Geisteskranken taten: Sie setzten diese auf ein Schiff und ließen es flussabwärts treiben; wer immer die Verirrten fand, musste sich aus Christenpflicht ihrer annehmen.
Ein weiteres Paradox ist, dass sich das Alter nicht nur nach oben ausbreitet, sondern auch nach unten. Schon Fünfundvierzigjährige können für einen neuen Arbeitsplatz »zu alt« sein und begehren dagegen auf. Nur etwa jeder zehnte Berufstätige arbeitet wirklich bis zur »Altersgrenze«. Die restlichen 90 Prozent scheiden früher aus. Es ist paradox: Während die Rente mit achtundsechzig, selbst siebzig gefordert wird, sank seit den Sechzigern das durchschnittliche Berufsaustrittsalter von damals zweiundsechzig Jahren auf gegenwärtig achtundfünfzig. Inzwischen sind psychische Erkrankungen, vor allem Depressionen, die häufigsten Ursachen für den vorzeitigen Eintritt in die Rente.
Die therapeutische Arbeit mit den Betroffenen ergibt politische Defizite. Es genügt nicht, das Rentenalter heraufzusetzen, es müssten sich auch die Personalabteilungen verstärkt um die berufliche Entwicklung und Motivation der Fünfzigjährigen kümmern. Ohne politisches Gegensteuern investieren Arbeitgeber in junge Arbeitskräfte und haben kein Interesse an der Arbeitszufriedenheit älterer Mitarbeiter.
WIE BEGEGNE ICH DEM ALTER?
Es hängt von unserem eigenen Alter ab, wie wir dem Thema begegnen, dass wir ganz unvermeidlich älter werden. Erst nach den ersten Zeichen des Alters machen wir uns Sorgen über diesen Prozess. Der Wunsch erwacht, nicht alt zu werden. Dieser Wunsch ist unerfüllbar, er ist kindlich, aber er ist keineswegs töricht. Er ist vielen nachdenklichen Menschen nahe.
Als ich Kind war, kannte ich die Angst vor dem Alter nicht, im Gegenteil: Ein Jahr älter war eigentlich auch ein Jahr besser und stärker. Ein Jahr nach meiner Einschulung musste ich mich nicht mehr vor den Zweitklässlern fürchten, die auf den Erstklässler herabblickten. Ich war jetzt selbst Zweitklässler und konnte die Erstklässler verachten, die von nichts eine Ahnung hatten.
»Ich kann mir nicht vorstellen, älter als dreißig zu werden«, sagte ich, siebzehn Jahre alt, in einer Sommernacht am Seeufer von Feldafing zu dem Mädchen, in das ich verliebt war. Ins Provokative gewendet, meinte der Spruch der Studentenrevolte nichts anderes: »Trau keinem über 30« – trau dich nicht, dreißig zu werden! Dem Jahr 2000 träumte ich als (1941 geborenes) Kind ahnungsvoll entgegen – dann bist du alt! Ob du so alt wirst?
Längst muss ich mir nicht mehr vorstellen, wie es ist, dreißig zu sein; als ich es wurde, war ich zu beschäftigt, um mich an meine adoleszente Fantasie zu erinnern, wie undenkbar es ist, erwachsen zu sein. Als Jugendlicher begehrte ich die Teilhabe an der Welt der Erwachsenen leidenschaftlich, konnte mir nicht vorstellen, sie zu erreichen, und hatte wohl auch schon geheime Zweifel, ob der Verlust der Kindheit die Mühe wert ist. Viele Jahre Arbeit als Psychoanalytiker haben mich überzeugt, dass Menschen im Grunde nicht gern erwachsen werden; sie leisten das, weil die Alternativen noch unangenehmer sind.
Inzwischen kann ich mir in aller Ruhe vorstellen, neunzig zu werden, ich kann den Gedanken stehen lassen, vorher zu sterben. Ich kenne meine statistische Lebensdauer und weiß, dass sich meine imaginäre Lebenserwartung dramatisch verkürzt hat, als meine Mutter starb. Glücklicherweise verdrängte ich den Tag, an dem ich sie sozusagen überholt habe. Sie war längst nicht so alt geworden wie meine Großmutter, deren Alter bisher den Zeitpunkt definiert hatte, an dem die Parze meinen Faden durchtrennt.
Heute kommt es mir seltsam vor, dass ich mich an diesen beiden Frauen orientiere, als ob es keine anderen Großeltern gäbe. Das hängt wohl damit zusammen, dass mein Vater noch nicht ganz dreißig war, als er 1944 an der Ostfront fiel; so verloren die Männer ihre Kraft, meine Lebensspanne zu ordnen, seit ich selbst die dreißig überschritten hatte und älter geworden war als mein Vater. Die väterlichen Großeltern starben, als ich mit meinem Abitur beschäftigt war; mein Großvater mütterlicherseits kurz danach. Die Mutter meiner Mutter, meine Passauer Großmutter, aber lebte noch, als ich die dreißig hinter mir hatte und eine neue Perspektive auf meine Lebenszeit suchte.
Sie lernte noch ihre Urenkel kennen, und ihre Beerdigung war die erste, an der ich überhaupt teilnahm. Meine Mutter hatte solche Ereignisse von uns ferngehalten, ich vermute heute, weil sie selbst vom jähen Tod meines Vaters so verletzt war, dass sie ihren Söhnen die Begegnung mit diesem Ereignis so lange ersparen wollte, wie sie es konnte.
Heute berührt mich der Tod der geliebten Deindorfer Großeltern stärker als damals, als ich so sehr mit dem Gymnasium und meinen Freundschaften beschäftigt war, dass ich nichts dabei fand, dass meine Mutter uns nicht in den Abschied von ihnen einbezog. Ich verstehe auch, warum der Tod der letzten Angehörigen dieser Generation, die alle noch im 19. Jahrhundert geboren waren, mich so viel mehr beschäftigte als die bisherigen Todesfälle.
Ich war nicht nur reifer geworden und hatte mehr Lebenserfahrung, sondern die Passauer Großmutter, die 1886 geboren worden war und 1978 starb, war zum Symbol für die Lebenserwartung meiner Mutter geworden, die wiederum mein eigenes Leben spiegelte. Meine Mutter war 1913 geboren; sie würde mindestens bis zum Jahr 2006 leben.
Als sie dann achtzehn Jahre vor diesem Termin an einem Knochentumor starb, erlebte ich, wie ich mich schutzlos fühlte: nicht nur dass ich jetzt als Nächster dran war; meine eigene Erwartung schrumpfte auf das Maß, das sie vorgegeben hatte, auf vierundsiebzig Jahre. Ich hatte dieses abergläubisch besetzte Datum überwunden und meine Mutter überholt, als der nächste Schlag kam: Mein zwei Jahre älterer Bruder starb buchstäblich über Nacht. Bis dahin hatte er noch Sport gemacht.
Mein Bruder war nach dem Tod unserer Mutter in ihr Haus gezogen; es war buchstäblich bis unter das Dach angefüllt mit Erinnerungen. Unsere prägende Kindheitserfahrung in der unmittelbaren Nachkriegszeit war, dass es nichts gab und man auch nichts wegwarf, weil es ja jederzeit wieder nichts geben konnte. So war ein gefüllter Dachboden Ausdruck eines Lebensgefühls; ich war gerührt, als ich dort, nachdem mein Bruder gestorben war, alle Bücher meiner Mutter fand, die er gehortet hatte.
Nie zuvor musste ich mich in dieser Intensität damit auseinandersetzen, dass ein alter Mensch in unserer Kultur das ordnende Zentrum einer Fülle von Dingen ist, Spuren seines Lebens und des Lebens seiner Vorfahren. Lässt die Kraft nach, verlieren – wie die Eisenspäne im Magnetfeld – die vom Zentrum entfernten Dinge als Erste ihre Ordnung. Als mein Bruder starb, war nur noch ein kleiner Teil des Hauses bewohnt und sozusagen belebt; an abgelegeneren Orten verrieten Staubschichten, dass schon lange niemand mehr versucht hatte, Bewahrenswertes zu behüten und den Rest zu entsorgen.
Glücklicherweise nahm sich meine Tochter, die das Haus erbte, der Entrümpelung an. Ich war nach meinen Begegnungen mit diesen zum Chaos gewordenen Lebensspuren so erschöpft, dass sich eine Zahnwurzel entzündete und ich nach einigem schmerzhaften Hin und Her einen Backenzahn verlor. Der Verlust eines Zahnes ist für den Analytiker ein Symbol der Kastration, wie Blendung, Amputation und Enthauptung. Vergleichsweise bin ich also noch sehr gut davongekommen.
Es überforderte mich ebenso, die alten Dinge loszulassen wie eine Auswahl zu treffen und diese vor Sperrmüll oder Flohmarkt zu retten, was bedeutet hätte, meinen eigenen Haushalt noch mehr zu belasten. Ich war doch gerade dabei, selbst zu sortieren und wegzuwerfen, ohne damit so recht weiterzukommen. Ich kämpfte gegen die Schatten des Gedankens, wie meine Erben einmal mit den vielen gesammelten Dingen umgehen würden, die nur ich genau zu schätzen weiß, deren Geschichte und Bedeutung nur ich kenne.
Eine befriedigende Lösung dieser Spannung habe ich nicht gefunden. Ich kann Sammler wie Lothar-Günther Buchheim verstehen, die nicht rasten und ruhen, bis sie ein eigenes Museum haben, aber ich habe mein Sammeln nie so ernst genommen. So vertraue ich auf die Entscheidungen meiner Kinder.
Die Vertreibung von Bildern des Todes
»Sterben – schlafen – / Nichts weiter! Und zu wissen, daß ein Schlaf / Das Herzweh und die tausend Stöße endet, / Die unsers Fleisches Erbteil – ’s ist ein Ziel, / Aufs innigste zu wünschen.«10 Der Volksmund nennt den Tod einen Bruder des Schlafes. Der Schlaf ängstigt uns nicht, im Gegenteil: Ihn zu finden, ist ein Zeichen, dass die ärgsten Ängste vorbei sind. Wenn wir vergeblich nach ihm suchen, verstärkt das in der Regel unsere Angst. Wie sollen wir mit dem Tag fertigwerden, wenn wir nicht schlafen können!
Es ist eine fesselnde und wenig erforschte Frage, warum der Gedanke, zu »entschlafen«, so wenig Beruhigendes hat. In Hamlets Monolog über das Sein oder Nichtsein gerät der todessüchtige Prinz ins Stocken, als er über die Träume nachdenkt, die den Todesschlaf belasten:
Nur daß die Furcht vor etwas nach dem Tod
Das unentdeckte Land, von des Bezirk
Kein Wandrer wiederkehrt, den Willen irrt,
Daß wir die Übel, die wir haben, lieber
Ertragen als zu unbekannten fliehn.
So vertreiben wir Bilder des Todes aus unserem Bewusstsein und finden Menschen merkwürdig, die eine Passion für Friedhöfe haben, sich als Vampire verkleiden und auf Gräbern schwarze Messen feiern.
Warum vertrauen wir darauf, dass wir nicht sterben, wenn wir einschlafen? Natürlich wissen wir, dass der Schlaf etwas anderes ist als der Tod. Wir atmen noch und können erweckt werden. Aber dieses Wissen ist Eigentum unseres bewussten Ich. Dieses hat keine Macht über den Schlaf. Dennoch scheint etwas in uns eine Zuversicht aufrechtzuerhalten, die den Ichverlust beim Einschlafen erwünscht sein lässt, den Ichverlust im Sterben aber nicht.
In vieler Hinsicht ist der Schlaf ebenso befremdlich wie der Tod. Aber er ist uns unendlich vertrauter, auch weil er uns täglich begleitet, während wir dem Tod nur selten begegnen. Wir erleben ihn als Unterbrechung einer Kontinuität, die auch einen neuen Blick auf Entscheidungen möglich macht, als Erholung und als Quelle von Träumen.
Ob wir aus dem Tod zu etwas anderem erwachen, wissen wir nicht. Viele Menschen glauben daran. Wer beobachtet hat, wie empfindlich unsere Persönlichkeit auf winzige Veränderungen in den Nervenzellen reagiert, kann sich nicht vorstellen, dass sie den Zerfall des Gehirnes übersteht. Eine Durchblutungsstörung, und aus einem lebensfrohen, fleißigen Menschen wird binnen weniger Tage ein stammelnder Invalide, der sich nie mehr ohne Rollstuhl bewegen wird. Wo ist da die Macht des Geistes über den Körper?
Unser Bewusstsein mag den Tod annehmen, aber wir können ihn nicht rufen, wie einen Hausdiener, der uns zur Tür bringt. Das vegetative Leben in uns kämpft gegen ihn, ob wir das nun wollen oder nicht. Atemzentrum und Herz geben ihr Letztes, sie wollen nicht aufgeben, ähnlich wie das Ich des angstneurotischen Schläfers ihn gerade in dem Augenblick aufschreckt, in dem seine Lider sinken und er hinübergleiten würde in das Unbekannte.
Wir werden noch öfter der Paradoxie begegnen, dass sich die Macht der Psyche zugleich behaupten und bestreiten lässt. Ich will dieses Dilemma, das dem Thema der psychologischen Lebenshilfe11 anhaftet, nicht schmälern. Wenn sich eine solche Hilfe um Ernsthaftigkeit und Selbstkritik, das heißt auch um Professionalität, bemüht, kann sie dieser Spannung nicht entgehen.
Wir müssen an die Macht der Psyche glauben, um sie optimal nutzen zu können, und wir müssen um ihre Ohnmacht wissen, um keine falschen Versprechungen zu machen oder vor dem Zusammenbruch überhöhter Hoffnungen zu verzagen. Die Situation des Autors lässt sich vielleicht mit der eines Expeditionsleiters vergleichen. Auch dieser muss beides mitbringen: Zuversicht, dass ein Ziel erreichbar ist, und Respekt vor der Übermacht von Wind und Kälte. Wenn allen klar ist, dass er keine Macht über den Schneesturm hat, werden sie sich beizeiten um die Qualität der Anoraks kümmern.
Die animalische Würde
Sigmund Freud hat in seinem Essay »Über Psychotherapie« seine analytische Praxis beschrieben und den Unterschied zwischen Auflösen und Zudecken formuliert. Um sein Verständnis von Therapie zu verdeutlichen, nutzte er einen Vergleich:
»Es besteht zwischen der suggestiven Technik und der analytischen der größtmögliche Gegensatz; jener Gegensatz, den der große Leonardo da Vinci für die Künste in die Formeln per via di porre und per via di levare gefasst hat. Die Malerei, sagt Leonardo, arbeitet per via di porre; sie setzt nämlich Farbhäufchen hin, wo sie früher nicht waren, auf die nichtfarbige Leinwand; die Skulptur dagegen geht per via di levare vor, sie nimmt nämlich vom Stein so viel weg, als die Oberfläche der in ihm enthaltenen Statue noch bedeckt. Ganz ähnlich sucht die Suggestivtechnik per via di porre zu wirken, sie kümmert sich nicht um die Herkunft, Kraft und Bedeutung der Krankheitssymptome, sondern legt etwas auf, die Suggestion nämlich, wovon sie erwartet, dass es stark genug sein wird, die pathogene Idee an der Äußerung zu hindern. Die analytische Therapie dagegen will nicht auflegen, nichts Neues einführen, sondern wegnehmen, herausschaffen, und zu diesem Zwecke bekümmert sie sich um die Genese der krankhaften Symptome und den psychischen Zusammenhang der pathogenen Idee, deren Wegschaffung ihr Ziel ist.«12
Der Gegensatz von Hinzufügen und Wegnehmen, von Expansion und Reduktion bestimmt nicht nur die künstlerische Arbeit, er ist ein Merkmal des menschlichen Lebens schlechthin und gewinnt im Alter an Bedeutung. In seinem Roman Kim beschreibt der Brite Rudyard Kipling die Begegnung eines begabten Straßenkindes mit einem ehrwürdigen Bettler, dem Abt eines Klosters in Tibet. Beide ziehen durch den Norden Indiens, Kim als Schüler des Lama, auf der Suche nach einem Fluss, der alle Sünden abwäscht. In einer anderen Erzählung hat Kipling das Thema des Loslassens im Alter variiert: Irgendwann wird ein erfolgreicher Mann, der lange Zeit Schicht für Schicht an Bedeutung und Reichtum um sich gelegt hat, des Wachstums müde. Vielleicht spürt er, dass die Schichten dünner werden, auf jeden Fall verlieren sie ihren Wert für ihn. So legt er all das Angesammelte ab, verlässt Reichtum sowie Familie und lebt als Bettler in einer Höhle.
Nackt sind wir in die Welt gekommen. Es scheint weise, sich darauf vorzubereiten, dass wir sie ebenso nackt verlassen werden.
Die beiden Prinzipien, das Hinzufügen und das Weglassen, sind uns bekannt, seit wir denken können. Da gegenwärtig die weitaus meisten Menschen in Kulturen aufwachsen, die vom Eigentum geprägt sind, ist das Loslassen erschwert. Eltern möchten, dass ihre Kinder sich möglichst viel aneignen, sie sollen es besser haben, was meist bedeutet: mehr haben, mehr Bildung, mehr Einkommen. Sie machen sich Sorgen, wenn ein Kind um seine Würde ringt und nicht alles annehmen mag, was nach ihrer Überzeugung gut für es wäre. So prägt sich in jungen Jahren der Wunsch aus, sich den eigenen Erfolg zu beweisen.
Wie sich dieses Lebensgefühl verankert, zeigen die großen Gedichte des Vorwärtsstrebens, der Expansion. Goethe hat in seinen Faust-Dramen das Thema in vielen Nuancen dargestellt, angefangen von der Unersättlichkeit des expansiven Wissen-Wollens bis hin zur materiellen Expansion in Faust II mit der Erfindung des Papiergeldes und den »drei Gewaltigen« Raufebold, Habebald und Haltefest. Ganz subjektiv findet sich im lyrischen Ich Rilkes die gleiche Botschaft:
Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen,
die sich über die Dinge ziehn.
Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen,
aber versuchen will ich ihn.13
So wird nur ein mutiger und kreativer Kopf auf den Gedanken kommen, ehrgeizigen Erwachsenen anzuraten, sie sollten werden wie Kinder.14 Ich habe eine feste Vorstellung, in welchem Alter das Kind war, das Jesus seinen Jüngern als Vorbild zeigte: Es war so jung, dass es den Begriff des Eigentums noch nicht kannte. Es wollte das Himmelreich nicht haben, und wenn es ihm in den Schoß fiele, würde es das Geschenk weiterverschenken. Es ist das Alter der frühen Großzügigkeit, in dem Eltern die Handschuhe des Kindes festbinden, weil sie zu oft liegen bleiben.
Es gibt Wesentliches, das wir uns mit den vertrauten Mitteln der Expansion und des Festhaltens nicht verschaffen können. Jesus sagt nicht: Ihr müsst das und das machen, um euer Ziel zu erreichen. Er sagt: Ihr habt es schon, es steckt in euch, aber ihr habt den Zugang verloren. Das Alter belebt die kindliche Freiheit, das Erworbene zu verschenken.
Wir sammeln Wissen, profitieren davon und geben es weiter: Der handwerkliche Dreischritt von Lehrling, Geselle und Meister ist ein ehrwürdiges Stück Lebenskunst. In der modernen Gesellschaft muss er sich gegen die Ausbeutung der Arbeitskraft wehren. Schulen und Universitäten liefern in einer Art pädagogischen Fabrik Arbeitskräfte, deren persönliche Entwicklung den Betrieb nicht interessiert.
Der italienische Philosoph Niccolò Machiavelli hat im 16. Jahrhundert das zentrale Problem der Politik in eine medizinische Metapher gefasst. Politische Probleme, so meinte er, seien wie Krankheiten: Solange sie leicht zu behandeln sind, sind sie schwer zu erkennen; wenn sie aber leicht erkannt werden können, ist die Behandlung sehr schwierig und oft unmöglich. Hinzuzufügen ist: Die Erkenntnis einer Problematik ist nicht per se schwierig, sie wird aktiv durch Verdrängung und Verleugnung abgewehrt. Wir denken nicht nur deshalb nicht an das Alter, weil wir uns noch nicht alt fühlen, sondern wir wollen nicht an die negativen Bilder erinnert werden, die sich mit dem Alter verbinden: Abhängigkeit, Hilflosigkeit, Schmerz und Tod. Wir gleichen Kindern, die lieber am Strand mit den Muscheln spielen, die der Rückzug des Wassers freigelegt hat, als darauf zu achten, dass eine Flutwelle auf uns zurast.
Rede ich konfus, wenn ich an die frühe und aufmerksame Vorbereitung auf das Alter erinnere und gleichzeitig die Selbstvergessenheit preise? Der Widerspruch lässt sich auflösen. Wie der Schauspieler gut daran tut, seinen Text zu lernen, ihn aber nicht bis zur letzten Minute vor seinem Auftritt angstgeplagt zu memorieren, so gilt es, sich vorzubereiten. Wenn das geschehen ist, ist es sinnvoll, sich nicht weiter mit Gefahren zu befassen, die noch nicht da sind, auch wenn sie irgendwann einmal kommen werden.
»So macht Bewusstsein Feige aus uns allen«, lässt Shakespeare Hamlet in seinem Monolog über das Sein oder Nichtsein sagen. Er verwendet das Wort conscience, das sich auch mit (Ge-)Wissen übersetzen lässt. Er beklagt den Verlust der selbstvergessenen Würde des Tieres, das entweder sogleich zur Aktion schreitet oder sich einem neuen Gegenstand zuwendet, während der Mensch Energie im Grübeln über Vergangenes und Zukünftiges vergeudet. Das Vergangene kann er nicht ändern; das Zukünftige ist vieldeutig, unsere Bilder sind von Furcht und Hoffnung geprägt.
Die eindrucksvollsten Philosophen sind jene, die den Zugang zur animalischen Würde des Menschen nicht verloren haben und sich kritisch mit den stolzen Gehäusen befassen, die mit so viel Grausamkeit gegen sich selbst und andere gebaut wurden und werden. Ich denke an Buddha und Jesus, an Diogenes und Sokrates, an Rousseau und auch an Freud. Sie alle haben sich mit der Kunst des Loslassens befasst, Diogenes von Sinope mit dem Verzicht auf Besitz und Komfort, Sokrates mit dem auf voreilige intellektuelle Sicherheit, Jean-Jacques Rousseau mit dem Verzicht auf den Glauben an einen moralischen Fortschritt durch Ehrgeiz und Besitzdenken, Freud mit dem auf die scheinheiligen Lügen, welche Eros und Thanatos bemänteln.
Unter animalischer Würde verstehe ich den unerreichbaren Vorsprung des Tieres, das sich keine Sorgen um die Zukunft macht und daher weit besser als der Mensch dem philosophischen Gedanken folgen kann, den Augenblick zu genießen (oder ihn wenigstens nicht zu verderben). So ist das Tier auch ein Vorbild an Selbstvergessenheit, an Flow.
Doch nun zum Altern in meiner Familie: Meine Passauer Großmutter war noch rüstig, als sie nach dem Tod meines Großvaters ihren Haushalt auflöste, die Jugendstilmöbel und den größten Teil der Bibliothek an Studenten verschenkte und in ein Altersheim nahe der Wallfahrtskirche Mariahilf zog. »Ich gehe ins Heim, solange ich das kann und nicht muss«, sagte sie in ihrer energischen Art.
Sie richtete ihr Zimmer mit dem Wenigen ein, das sie aus dem großen Haushalt behalten wollte, und lebte dort noch zwanzig Jahre. Anfangs hatte ich diesen Schritt vorbildhaft gefunden. Als sie an einer Durchblutungsstörung erkrankte und immer unbeweglicher wurde, wuchsen meine Zweifel an der Weisheit ihrer Entscheidung.
Sie hatte ihren Garten am Südhang geliebt, in dem die besten Tomaten gediehen. Es war manchmal mühsam gewesen, Einkäufe aus der Stadt heraufzutragen, aber dafür hätte es Hilfe gegeben, wenn es die Grenze zur heilsamen Übung überschritt. Gegen die Ordensschwestern im Altersheim, die der alten Dame jede Mühe abnahmen, war sie machtlos.
Vom Tag ihres Umzugs an hatte sie außer Korrespondenz mit der Verwandtschaft und dem Kaffeekränzchen mit den anderen Beamtenwitwen nichts mehr zu tun. Früher war sie im Sommer, bergauf und bergab, zur Ilz gegangen und in ihrem akkuraten Stil geschwommen. Das ging vom Altersheim aus nicht mehr.
Wenn ich heute an sie denke, glaube ich nachzufühlen, was es ihr schwer gemacht hat, anders für sich zu sorgen. Es war das Kriegstrauma meines Großvaters, eines Juristen aus einer Klavierbauerfamilie. Er war ein guter Tänzer und Musiker, charmant und eloquent, in den sich meine Großmutter, die älteste Tochter einer Kaufmannsfamilie, verliebte.
Zwei Töchter waren geboren, dann kam der Große Krieg, und ein Schatten legte sich über die Familie. Der Vater musste in Antwerpen in einem Kriegsgericht Deserteure und Männer verurteilen, die sich selbst verletzt hatten, um dem Schrecken der Grabenkämpfe zu entkommen. Er war 1918 ein gebrochener, nervöser Mann. Als er zurückkam, verbrachte er einige Monate in einem Sanatorium und fand nur mühsam in seinen Beruf als Richter zurück.
Er führte nur noch Zivilprozesse, er tanzte nicht mehr, er konnte nicht mehr Klavier spielen, weil ein Ohrgeräusch ihm den Genuss an der Musik verdarb. Er war reizbar, jähzornig, misstrauisch, sah alles schwarz (als ich Keuchhusten hatte, stand er neben mir und sagte: »Aus dem Buben wird nichts, aus dem wird nichts!«). Er ging mit fünfundfünfzig in Pension, die Kriegsjahre wurden doppelt gerechnet.
Kinder und Enkel kamen nicht gern zu Besuch; er wollte vor allem seine Ruhe haben, war sehr hypochondrisch, füllte Alben mit penibel nachgezeichneten Ansichtspostkarten. Ich habe ihn nie lachen sehen.
Meine Großmutter ertrug das, so gut es ging, sie sprach von ihm als »der Vater« und versorgte ihn mustergültig mit Schonkost und gewärmtem Kompott als Nachtisch. Ich vermute, dass sie den großen Haushalt auch deshalb aufgab, weil ihre drei Töchter weitab wohnten und Besuche von ihnen und ihren Enkeln selten waren – was sicher auch mit dem Vater und Großvater zu tun hatte.
In den langen Jahren der Pflege ihres Mannes war sie ausgebrannt und hatte ihr Selbstvertrauen verloren. Ursprünglich ein optimistischer Mensch, war sie risikoscheu geworden. Als meine Mutter versuchte, sie von einem Heim nahe unseres Hauses in Feldafing zu überzeugen, wollte sie in Passau bleiben. »Sie behauptet, ich sei ihr zu energisch«, sagte meine Mutter und schüttelte den Kopf. Augenscheinlich hatte die traumatische Störung des so lange gepflegten Ehemannes ihre Psyche infiltriert.
Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass unser Leben von Brüchen geprägt ist. Das hat lange vor den gegenwärtig Lebenden begonnen.
Mein bäuerlicher Deindorfer Großvater war ebenfalls von einem Kriegstrauma beschädigt, das jedoch nicht ihn persönlich getroffen hatte, sondern seinen Vater, einen bis zu seiner Teilnahme am Feldzug gegen Frankreich im Jahr 1870 tadellosen Bauern in Kirchdorf am Inn. Nach dem Soldatenleben fand er nicht mehr in den Alltag, vertrank seinen Hof und ließ seine Kinder mittellos zurück.
Mein Großvater arbeitete als Fuhrknecht. Er konnte gut mit Pferden umgehen, kutschierte lange Jahre einen Tierarzt. 1914 war er schon zu alt für die Front, er wurde im Transportdienst beschäftigt. Danach, beim Eindämmen des wilden Inn, hatte er so viel verdient, dass er sich ein Gütchen kaufen konnte, eine Subsistenzlandwirtschaft. Keiner seiner beiden Söhne und auch keiner der Enkel – einer davon bin ich – sollte Bauer werden.