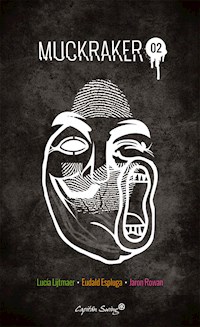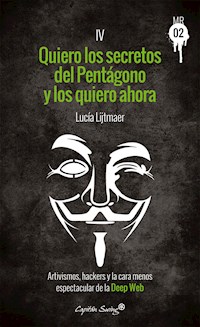21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Es gibt Bücher, die liest man, und es gibt Bücher, die man spürt. Dieses hier ist von der zweiten Sorte.« Jarka Kubsova, Autorin von Marschlande
Die Häutungen ist ein Fest der Verdammten – zwei Frauen, die vier Jahrhunderte versetzt leben, streben nach der Befreiung aus dem Patriarchat und gehen dafür waghalsige Risiken ein. Sie sind entschlossen, Feuer mit Feuer zu bekämpfen.
1639 sieht sich Deborah Moody gezwungen, England zu verlassen und in die nordamerikanischen Kolonien, in die Nähe von Salem, zu flüchten. Sie trägt ein Geheimnis mit sich, und versteht es, sich aus den patriarchalen Strukturen zu befreien. Mit ihrer Gründung einer von Frauen geführten Kirche geht sie für die männlichen Glaubenshüter ihrer Zeit einen Schritt zu weit. Sie wehrt sich – und wird als die »gefährlichste Frau der Welt« in die Geschichte eingehen.
Sommer 2014. Eine junge Spanierin befreit sich aus einer toxischen Beziehung und flieht von Barcelona nach Madrid. Auch sie trägt ein Geheimnis mit sich und die Überzeugung, dass die Apokalypse nah ist.
Was verbindet diese beiden Frauen? Ihre sich kreuzenden Geschichten handeln von Hexen und Heilerinnen, von einem frühen und einem späten Feminismus. Mit furioser Erzähllust und einem Sinn für Humor und Horror entführt uns Lucía Lijtmaer in eine Orgie der Rachelust.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Lucía Lijtmaer
Die Häutungen
Roman
Aus dem Spanischen von Kirsten Brandt
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der deutschsprachigen Erstausgabe, 2024
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Nurten Zeren, Berlin
Umschlagabbildungen: Collage aus Porträt einer Frau in Schwarz von Johannes Conerlisz Verspronck, 1643, und Porträt einer jungen Frau mit weißer Haube, Umkreis von Pieter Pourbus, 16. Jh. (Gemälde Frauenkopf); CSA-Printstock/iStock (Flammen); Darius Bashar/Unsplash (Foto Frauenporträt); Nurten Zeren (Aquarell)
eISBN 978-3-518-77846-3
www.suhrkamp.de
Motto
In baiting a mouse-trap with cheese, always leave room for the mouse.
The Square Egg, SAKI
You’d better hope and pray
That you’ll wake one day in your own world.
Stay, SHAKESPEARS SISTER
Someone once told me that explaining is an admission of failure.
I’m sure you remember, I was on the phone with you, sweetheart.
RICHARD SIKEN
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Motto
1
. Plaza de les Glòries (vorher)
I. Deborah unter der Erde
2
. Calle del Calvario (jetzt)
II. Deborah und die graue Taube
3
. Paseo de la Castellana
11
(jetzt)
III. Deborah und der Kauter
4
. Calle Almirall Barceló (vorher)
IV. Deborah und das Quecksilber
5
. Calle Hermosilla (jetzt)
V. Deborah und das Fieber
6
. Plaza Jaume Sabartés (vorher)
VI. Deborah und der schwarze Marmor
7
. Carrer Nou de Sant Cugat (vorher)
VII. Deborah und das Wasser
8
. Calle dels Valero (vorher)
VIII. Deborah und das gläserne Haus
9
. Plaza Jaume Sabartés (vorher)
IX. Deborah und Salem
10
. Calle del Carme (vorher)
X. Deborah und Anne in der Morgendämmerung
11
. Turó de Monterols (jetzt)
XI. Deborah, Anne und die Frauen
12
. Plaza Jaume Sabartés (vorher)
XII. Deborah und das Danach
13
. Calle Santa Teresa (vorher)
XIII. Deborah und das goldene Zimmer
14
. Calle del Judici (vorher)
XIV. Deborah und das Bild vom Fluss
15
. Paseo de la Castellana
11
(jetzt)
XV. Deborah und Mr. Cotton
16
. Calle Verdi (vorher)
XVI. Deborah und die Liebe
17
. Paseo de l’Exposició (vorher)
XVII. Deborah, Margaret und das Wasser
18
. Plaza de la Virreina (vorher)
XVIII. Deborah und Susanna
19
. Paseo de la Castellana
11
(jetzt)
XIX. Deborah, Susanna und die Bäume
20
. Paseo de la Castellana
11
(jetzt)
XX. Deborah: Das Tier verharrt reglos, dann flieht es
21
. Calle Puig d’Ossa (jetzt)
XXI. Deborah, das Kreuz und der Platz
Epilog: Deborah in der Calle Puig d’Ossa
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Informationen zum Buch
Die Häutungen
1. Plaza de les Glòries (vorher)
Lange Zeit will ich mich einfach nur umbringen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, nicht mehr zu existieren, keinen Körper mehr zu haben, und die Idee erscheint mir unausweichlich und friedlich. Anfangs träume ich von der Stille eines Meeres aus Barbituraten, ein Meer wie nach einem Sturm, wie an einem wellenlosen karibischen Strand. Aber nach und nach werden meine Vorstellungen ausgefeilter, und schließlich setzt sich in meinem Kopf das Bild fest, wie sich der Fußboden meiner Wohnung an den Rändern nach unten wölbt, wie die Ecken zu Rutschbahnen werden, wie ich mich nicht mehr halten kann und hinuntersause, bis ich, als wäre das Ganze Teil eines sadistischen Experiments, in den Abgrund stürze und im Innenhof auf dem Asphalt aufschlage.
Aber ich bin feige und bringe mich nicht um.
Ich bin feige. Das ist wichtig für diese Geschichte.
Während ich mit dem Bus Nummer sieben zur Arbeit fahre, wandelt sich meine Fantasie nach und nach. Als ich eines Morgens an einer öden Kreuzung lauter Menschen mit verschlafenen Gesichtern und Tupperdosen im Rucksack stehen sehe, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn die ganze Stadt als Folge des Klimawandels im Wasser versinkt.
An meinem Arbeitsplatz angekommen – einem Großraumbüro in einem Klotz aus Sichtbeton an der Plaza de les Glòries, einem dieser Meisterwerke der Sozialisten aus den Neunzigern –, wird das Bild konkret, und während ich Anrufe entgegennehme, male ich mir das Ende aus.
Während ich im Geiste Geraden zwischen der Diagonal Mar und der Calle Llacuna ziehe und Kommunikationspläne erarbeite, die erläutern sollen, welche der heruntergekommenen Gebäude in der Calle Pallars zu schicken Hubs mit Wänden voller Farnkaskaden oder Logistikzentren umgebaut werden sollen, vernebeln braune Wassermassen meinen Blick und überschwemmen mein Gehirn.
Wenn die Polkappen schmelzen, wird Barcelona nach Venedig und Amsterdam als eine der ersten Städte von der Bildfläche verschwinden. Aufgrund seiner Hanglage mit zehn bis fünfzehn Prozent Gefälle erwischt es zuerst die Armen, die pakistanischen Taxifahrer im Raval, die Filipinas aus der Bäckerei in der Calle Sant Vicenç, Señora Quimeta in ihrem Kurzwarenladen, die Touris in der Barceloneta, und zwar ausnahmslos alle: die Niederländer und die Franzosen und die Engländer und die Italiener – niemand wird die Italiener vermissen. Securityleute, U-Bahn-Angestellte und die Verkäufer vom Mercado de Santa Caterina treiben in den Fluten. Der Llobregat versinkt mitsamt seinen Schilfhainen, der Besòs tritt über die Ufer, und seine Gewässer vereinen sich mit der Wasserfläche, die von Sant Adrià im Osten bis nach Cornellà im Westen reicht, die den Flughafen unter sich begräbt und Castelldefels hinwegfegt. Durch eine Laune des Schicksals bleibt der Sakya Tashi Ling, der buddhistische Tempel von Garraf, verschont, und die Häuser der Hippies in La Floresta stürzen nur deshalb nicht ein, weil sie auf Kalkböden stehen. Scheiß Hippies.
Das schlammige Wasser bedeckt alles. Die Snob-Weiber von El Putxet erwischt es garantiert zuletzt, die blöden Zicken, aber auch für sie gibt es kein Entrinnen. Mit ihren schimmernden Perlenketten, den milchkaffeefarben lackierten Fingernägeln und den perfekt gestylten Betonfrisuren schaukeln sie wie Gondeln die Calle Balmes hinunter, blau, tot und aufgedunsen, auf dem braunen Wasser, das alles, alles verschlingt, selbst die Jugendstilhäuser im Eixample. Es reißt die Filialen von Pans and Company hinweg, das Liceu und die Tattooläden in der Calle Tallers. Es verschwinden die Bodegas, die mit ihrem Vintage-Mobiliar und den Fliesenböden mit aufgeklebtem Muster einen auf rustikale Dorfschänke machen. Das trübe, nach Kloake stinkende Wasser bedeckt uns alle. Ich weiß, dass die Toten es uns schon seit Jahrzehnten zuflüstern, aber wir wollten es nicht hören. Die reißenden Fluten verwandeln das Einkaufszentrum Maremagnum in einen Schutthaufen, genau wie die Fakultät für Audiovisuelle Kommunikation der Universität Pompeu Fabra. Und das Kino Icària Yelmo mitsamt seinen Matineevorstellungen.
Nachts erstelle ich Listen von allem, was der Anstieg des Meeresspiegels zerstören wird. Ich kann einfach nicht damit aufhören. Die Colònia Güell, das Nationaltheater, die Bingohalle Billares, das Kunstzentrum Hangar, den gesamten Freihafen, das Finanzamt an der Plaza Letamendi, die Bar Lord Byron in der Calle València, das Theaterinstitut, die Kaserne in der Calle Bruc.
Das Sutton wird genauso verschwinden wie die Schokoladengeschäfte in der Calle Xuclà. Die »Golondrinas«, diese kleinen hölzernen, nach Diesel stinkenden Touristenboote, werden nicht mehr im Hafen liegen, sondern in irgendeinem Baum auf dem Montjuïc hängen. Dort wird das Wasser auch ein Liebespaar erwischen, das gerade voll zugange ist und deshalb mit heruntergelassenen Hosen stirbt.
Und weil ich dieses Bild im Kopf habe, verlange ich von jetzt an jedes Mal, wenn ich auf dem Rückweg von der Arbeit noch beim Supermarkt vorbeigehe, nach noch mehr Plastiktüten. Weil ich es kaum erwarten kann, dass wir alle ertrinken, lasse ich sämtliche Lichter in der Wohnung an und weigere mich, den Müll zu trennen. Könnte ich Auto fahren, würde ich mit Vollgas die Carretera de les Aigües entlangbrettern, mit hundertfünfzig Sachen über die Stadtautobahn rasen, im Tank einen hochgiftigen Treibstoff, von dem Pflanzen welken und Wildschweine ersticken, irgendetwas, was den Prozess beschleunigt. Wollen wir uns nicht alle gemeinsam vergiften? Los, legen wir uns bei diesem gemeinsamen Ritual doch mal so richtig ins Zeug, geben wir alles, once more with feeling.
Aber ich schaffe es nicht. Also ziehe ich nach Madrid. Was ja im Grunde fast das Gleiche ist wie zu sterben.
I. Deborah unter der Erde
Bin ich noch am Leben?
Ich glaube nicht. Die Erde rings um mich herum ist staubtrocken, ganz anders als der dunkle Lehmboden meiner Kindheit. Die Erde auf meiner Stirn ist salzig, warum, verstehe ich nicht. Auch die Erde auf meinen Armen und zwischen meinen Beinen schmeckt nach Salz und Meer, ich kann kaum die Augen öffnen, bin von oben und von unten von Erde umgeben. Es heißt, dass Salz Blutungen stillen kann, aber im Laufe der Jahre habe ich gelernt, dass es auch alles zerfrisst und zerstört, was mit ihm in Berührung kommt.
Ich kann eigentlich gar nicht am Leben sein, auf meine Schultern drückt eine gewaltige Last, und trotzdem spüre ich keine Schmerzen, in meinen Lungen ist nichts, ich kenne diese Erde nicht, erinnere mich nicht an sie. Die Weiden meiner Kindheit waren feucht, von einem ausgewaschenen, stets von Wasser durchströmten Grün; die Wälder hingegen waren im Winter dunkel, und die schneidende Luft nahm dir den Atem, schabte wie ein Messer in dir. Jetzt ist in mir weder Luft noch Wasser, nur Zeit.
Nein, ich bin ganz bestimmt nicht am Leben, denn um mich herum kriechen die Würmer, weich wie Chinaseide, und kitzeln meine Haut.
Chinaseide. Der Duft nach exotischen Früchten. Die Erinnerung an unsere erste Nacht, nein, nicht jetzt, unser Blut hat keinen Platz in dieser mausgrauen Erde, jetzt, da ich leer bin, jetzt, da jemand mir die Eingeweide herausgerissen hat und mein Körper die ganze Last der Zeit und dieser fremden Erde trägt.
Ich muss mit dem Nachmittag beginnen, an dem er zu mir nach Hause kam und um meine Hand anhielt, oder vielleicht noch früher, mit dem Tag, an dem wir uns kennenlernten. Das war drei Monate davor, bei den Pferdeställen. Meine Haare waren lang, sehr lang, ich hatte sie mir nie geschnitten, obwohl Mutter mich immer wieder drängte, ließ ich sie mir nicht schneiden. Ich hatte sie am Hinterkopf zu einem straffen Dutt zusammengebunden, der groß und schwer war, mein Rock war parfümiert, meine Hände waren sorgfältig mit Seife geschrubbt, ich war schon älter, zwanzig Jahre. Zu Hause ließen sie mich nicht zu Bällen gehen, alles, was ich kannte, waren grüne Felder, der Sonntagsgottesdienst, die Kirche aus kaltem Stein und die Landkarten in den Büchern, die mein Vater mir zeigte. »Siehst du die Straßen, Deborah, siehst du sie?« Und ich fuhr mit dem Finger die Straßen der Städte nach, und sie erschienen mir wie kupferfarbene Flüsse, gewunden wie Schlangen, wie Maserungen im Holz. Der Mann betrat den Stall auf der Suche nach dem Vorarbeiter, aber nur die Hausdame und ich waren da und fütterten gerade die Pferde. Es war November, wir verbrachten einen Teil des Herbstes und des Winters auf dem Land, weit weg von London. Ich vermisste die Stadt, aber Vater bestand darauf, zu der Zeit, wenn im Wald die Pilze wachsen und die Astern blühen, im Monat der Kastanien und der Hirschjagd, in das Haus zurückzukehren, in dem er geboren war. Ich bemerkte, dass der Mann hochgewachsen war und einen blonden Bart und neugierige Augen hatte. Er bat meine Begleiterin, sich zu uns auf eine Bank vor den Ställen setzen zu dürfen. Welche Zügel benutzt Ihr, erkundigte er sich, ohne nach meinem Namen zu fragen, denn den kannte er schon. Er hatte kleine Hände, war ganz anders gekleidet als die Männer des Dorfes und trug einen Ring mit einem kleinen Stein, den ich noch nie gesehen hatte und den er »Saphir« nannte. Wir redeten über das Wetter, über die Kastanien, über die Pferde. Ihre Mähnen schimmerten, mein Körper brannte, das Blut rot, so rot, ich fühlte, wie es zerplatzte und in winzigen Tröpfchen aufspritzte wie geschmolzenes Metall, rot und orange, wie glühend heißes, flüssiges Glas, wie es mir ins Gesicht stieg. »Euer Gesicht hat die Farbe von Äpfeln«, sagte er und lachte auf, und als die Hausdame sich einen Moment lang entfernte, flüsterte er mir etwas Unanständiges ins Ohr. »Seid Ihr auch so ungestüm wie die Pferde, wenn Ihr geritten werdet?«, und mir wurde schwindelig, und ich schüttelte den Kopf, und da war die Hausdame auch schon wieder zurück und sagte: »Das reicht, Henry, es ist genug, das Mädchen kommt aus einer guten Familie, geh nach Hause.«
Jetzt, viele Jahre später, fühle ich, wie mein Körper mir nicht gehorcht, fühle die gewaltige Last, die auf meinem Kopf und meinen Schultern ruht. Ich nehme an, das bedeutet, dass man mich aufrecht und mit über der Brust gekreuzten Armen begraben hat. Darum drückt das ganze Gewicht auf meinen Kopf und mein Rückgrat, genau an der Stelle, an der der Nacken in die Wirbelsäule übergeht. Diese ganze Erde um mich herum, über mir und unter mir, besteht aus irgendeinem Material, das ich nicht erkennen kann. Etwas brennt auf meiner Haut, es ist das Salz dieser Erde, die so hart ist, dass sie mir in die Arme, die Hände und Füße schneidet, Schnitte, so klein wie eine Ameise, wie die Schnitte, die man sich an einem Blatt Papier am Finger zufügt. Und obwohl das Gewicht, das mir gegen Hals und Schläfen drückt, eigentlich unerträglich sein müsste, fühle ich mich stark. Ich packe eine Handvoll Erde und halte sie fest. Jetzt verstehe ich. Diese Erde ist mit Sand vermischt, sie ist aus den fein zermahlenen Schalentieren am Strand entstanden, über mir muss alles Wasser und Salz sein.
Was tue ich hier unter der Erde? Wenn sie mich aufrecht begraben haben, heißt das, dass niemand meinen Leichnam haben wollte. Dass ich verdammt bin. Und, was am schlimmsten ist: dass ich nicht nur tot, sondern auch nicht erlöst bin. O Herr, ich bin tot. Ich habe auf Dich vertraut, und Du hast mich verlassen. Ganze Ozeane habe ich für Dich überquert, nur um in der Erde vergraben zu werden wie ein Regenwurm, nicht einmal ins Fegefeuer bin ich gelangt, wie konntest Du mir das nur antun, Allmächtiger, gütiger Gott, mein Schicksal hat Dich nicht erbarmt. Deine Augen waren wie Juwelen, ich habe sie trotz allem angebetet und nichts dafür zurückbekommen. Ich war eine gute Ehefrau, zumindest möchte ich das glauben, und Du hast mich dazu verdammt, in salzigem Sand zu enden, wo nichts wächst und nichts gedeiht. Warum? Warum hast Du mich verlassen?
Und plötzlich erscheint mir das Antlitz von Anne Hutchinson, bleich, mit tiefen Ringen unter den Augen, ihr loses Haar, ihre weißen Hände, direkt vor mir, hier unter der Erde, und ich verstehe.
2. Calle del Calvario (jetzt)
Und so beginne ich diese Geschichte auf der sonnenverbrannten Hochebene. Ich finde eine Wohnung in einer Straße, die wie alle Straßen in Madrid nach irgendeinem katholischen Kaff in Kastilien benannt ist. Ich glaube, in Madrid wird es mir besser gehen. Ich hoffe es. Beinahe bin ich optimistisch. Beinahe. Ich bin dermaßen abgestumpft, dass ich lange brauche, um die Unterschiede zu erkennen, obwohl sie sofort ins Auge fallen.
Zum Beispiel: In Madrid sind alle freundlich. Vor allem nachmittags. Es dauert eine Weile, bis ich kapiere, dass es daran liegt, dass nachmittags alle betrunken sind. Der Erste, dem ich auf die Spur komme, ist der Portier unseres Hauses, ein Belorusse mit gegeltem Haar und Prince-of-Wales-Anzug. Morgens grüßt er nicht mal, aber nachmittags überschlägt er sich fast. Er zwinkert mir zu und erzählt mir leicht schwankend dreckige Witze. Ich brauche ungewöhnlich lang, um zu verstehen, was mit ihm los ist, weil man Wodka nicht im Atem riechen kann. Der alte Fuchs.
Mit dem restlichen Viertel ist es das Gleiche. Morgens ist es kühl, und bis um zwölf Uhr mittags scheint jeder zu schlafen. Dann recken und strecken sich alle, wehleidig und verkatert. Die Kellner, die Verkäufer, die Frau vom Tabakladen, die ganze Nachbarschaft ist verschlafen wie ein Dorf. Ganz anders am Abend. Nach kurzer Zeit stelle ich fest, dass ich einen Anfängerfehler gemacht habe: Ich habe eine Wohnung über einer Bar mit Terrasse gemietet. Jede Nacht dudelt Manzanita, und wenn die Nachbarn verlangen, dass endlich Ruhe einkehrt und die Bar schließt, legen die Autoradios mit Cumbia und Reggaeton los. Abfeiern ist das oberste Gebot der Stadt, und meine Straße ist ihr Tempel: eine Karaokebar im Vollrausch, die um fünf Uhr morgens zur Hochform aufläuft.
Eine Karaokebar im Vollrausch und im Dauerfieber. Niemand hat mir gesagt, wie heiß es in Madrid ist, vielleicht habe ich auch alle Warnungen ignoriert. Ich bin Mitte August hierhergezogen, was bedeutet, dass ich in einem Backofen sitze, der ununterbrochen läuft und den Asphalt bis in die Nacht hinein aufheizt, sodass ich nicht schlafen kann. Die Umzugskartons bleiben wochenlang unausgepackt, weil ich zu matt bin, um auch nur einen Finger zu rühren. Zur Aufheiterung kaufe ich in einem modernen Laden um die Ecke Pflanzen, die in null Komma nichts eingehen. In Madrid will einfach nichts gedeihen. Alles, was nicht schon verdorrt ist, tut es über kurz oder lang.
Eines Tages komme ich im Aufzug mit der Frau ins Gespräch, die über mir wohnt. Sie ist ein wenig älter als ich – was man ihr nicht ansieht –, hat dunkles Haar, leicht schrägstehende Augen und helle Haut. Ich betrachte sie: Pferdegebiss, freundliches Lächeln, rot geschminkte Lippen, geblümtes Kleid. Ihr Name ist Sonia. Mir fällt auf, dass sie straffe Schenkel, zarte Haut und müde Augen hat. Sie trägt goldene Ohrringe. Mit hoher, müder Stimme fragt sie mich, ob ich wegen der Hitze auch nicht schlafen könne. Ich sage, nein, kann ich nicht. Sie lädt mich auf eine Limonade in ihre Wohnung ein, und ich nehme an. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun.
Die Wohnung ist hübsch und hell. Bücherregale aus Obstkisten, überall Pflanzen, der Fußboden mit Büchern übersät. Ich frage mich, ob die Pflanzen aus Plastik sind oder ob sie hexen und Leben erzeugen kann. An den Wänden hängen Teppiche – »um den Lärm abzuhalten«, sagt sie.
Sonia schenkt mir eine Limonade ein und erzählt weiter. Ihre hohe Stimme stört mich ein bisschen, aber vielleicht liegt das daran, dass ich so lange nichts mehr mit anderen Menschen zu tun hatte. Ich bin es nicht mehr gewohnt, mehr als eine Stimme im Raum zu hören.
»Lebst du allein?«, frage ich mit geheucheltem Interesse.
»Ja.«
»Super.« Ich betrachte die Bücher, die überall herumliegen, in den Regalen, auf dem Boden, zwischen den Möbeln. »Arbeitest du an der Uni?«
»Nicht wirklich. Zurzeit studiere ich nur.«
Sie rutscht unruhig auf dem Stuhl herum. Die Antwort scheint sie nervös zu machen. Ich lächle und sage, um sie zu beruhigen: »Ich arbeite nicht.«
»Ach nein? Wieso nicht?«
»Weil ich nicht arbeiten muss.«
Sonias Lider flattern wie die Flügel eines Kolibris. Bsss.
»Und was macht dein Mann?«, fragt sie.
»Ich bin nicht verheiratet.«
»Aha.«
Bsss.
Endlich hat sie kapiert, was ich meine. Ich will ihr zu verstehen geben, dass ich reich bin.
Schade, dass es nicht stimmt. Ich habe nur ein bisschen Geld von dem übrig, was ich gemacht habe. Was ich mit mir habe machen lassen. Genug, um ein ganzes Jahr nicht arbeiten zu müssen. Trotzdem macht es Spaß, ihren Gesichtsausdruck zu beobachten, als ich es andeute. Reich. Es macht Spaß, die unterschiedlichen Regungen zu beobachten, die sie durchlaufen: leichte Verblüffung, gefolgt von mühsam beherrschtem Neid, der, wenn er vorbei ist, zu etwas Unsichtbarem, aber Hartnäckigem kondensiert, das an ihr klebt wie Gestank: Jeder, der dich für reich hält, will etwas von dir. Sie wollen dein Geld. Oder zumindest etwas Vergleichbares. Wenn ihnen das bewusst wird, fühlen sie sich beschämt und ein bisschen schuldig. Wie ich gelernt habe, ist Schuldbewusstsein ein äußerst unangenehmes Gefühl, das wir alle wieder loswerden wollen. Und diese Welle von Empfindungen, die innerhalb von Sekunden über deinen Gesprächspartner hinwegschwappt, verleitet ihn oder sie unbewusst dazu, dir ständig etwas anzubieten, um sich von diesem unangenehmen Gefühl zu befreien.
»Hättest du Lust, diese Woche mal mit mir essen zu gehen? Ich kenne einen großartigen Peruaner«, sagt sie. »Du bist eingeladen.«
Hab ich’s nicht gesagt? Klappt immer.
In dieser Nacht, als die Erde glüht und mich mal wieder Schlaflosigkeit quält, sitze ich im Licht des Bildschirms vor meinem Computer und surfe stundenlang im Netz, wie so oft auf der Suche nach etwas, was mich beruhigt. Heute finde ich es in Flussbetten, im Meer, in alten Landkarten und in den Geschichten derjenigen, die schon lange vor uns ertrunken sind. Um sechs Uhr morgens stoße ich auf das Porträt einer Frau, die 1642 erlebte, wie ein Mädchen ertrank. Sie beschreibt das in einer Chronik, die jemand in einen Blog eingestellt hat. Der Post trägt den Titel »Die Chroniken der Kauterisation«, das Bild zeigt eine Frau mit ernstem Blick und geschürzten Lippen. Ich lese, mit welcher Seelenruhe sie schildert, wie ein totes Baby aus dem Fluss gezogen wurde. Ich lese ihren Namen, Deborah Moody, eine Puritanerin, die im siebzehnten Jahrhundert in die nordamerikanischen Kolonien auswanderte. Ich betrachte ihr Gesicht, das an ein gemästetes Ferkel erinnert, die hervorstehenden Augen wie zwei hartgekochte Eier. »Die erste Frau, die eine Kolonie gründete. Die Erste, die in der Neuen Welt eine Stadt plante«, steht in den Foren über historische Verbrechen.
Ich stelle mir vor, wie sie eine Furche in den Boden zog, als würde sie ein Tier zerlegen, effizient, mit nur den allernötigsten Handbewegungen, eine Frau, die genau weiß, was sie tut. Ein Kreuz auf dem Boden, in der Mitte ein Platz. Fertig. So hat sie ihr Dorf erschaffen. Heute ist das viel komplizierter, du kannst nicht einfach aus Lust und Laune irgendwo Löcher buddeln. Schade. Wenn das ginge, würde ich höchstpersönlich eine Bohrmaschine zur Hand nehmen und mir einen Tunnel graben, um von hier zu verschwinden, ich würde mich in ihn einbuddeln, dann wäre ich sicher und hätte meine Ruhe und müsste nicht atmen.
Am nächsten Tag esse ich mit Sonia in einem mittelmäßigen Restaurant im Zentrum zu Abend und erfahre, dass sie als Escort-Dame für Bauunternehmer arbeitet. Zementfabrikanten, Aluminiumproduzenten. Männer mit Zigarre, die millionenschwere Verträge unterzeichnen, während sie ihnen im Separee eines Restaurants unter dem Tisch mit bodenlanger Decke einen bläst. An der Plaza de les Glòries habe ich mal über Begegnungen dieser Art mit Stadtverordneten reden hören, aber ich hielt das für eine Stadtlegende. Stadtplanerlegenden, nannten wir sie im Büro. Haha. Aber jetzt widert mich Sonias Vertraulichkeit an, nicht wegen dem, was sie erzählt, sondern weil sie mich nicht kennt. Es gefällt mir nicht, dass sie es mir erzählt hat, jetzt pappt ihr Geheimnis an mir wie eine feuchte Qualle. Eine Woche später beschließe ich, mir eine Wohnung zu suchen, in der ich mit niemandem reden muss. Ich ziehe in ein Bürogebäude an der Castellana, in dem ein paar Dachgeschosswohnungen zur Vermietung stehen. Ich will keine Freundinnen haben. Ich hatte mal Freundinnen, hat mir auch nichts genutzt.
II. Deborah und die graue Taube
Am Tag, als Anne Hutchinson starb, saß in der Morgendämmerung eine graue Turteltaube auf meinem Fenstersims. Ihr Gurren weckte mich, und ich drehte mich noch einmal in meinem Bett um, versuchte, wieder einzuschlafen. Aber meine Haut brannte. Im Alter wächst einem eine gewaltige Menge Haut, die man mit sich herumschleppt wie eine Bürde. So ist das nun einmal: Altern bedeutet Schwäche. Schlaffe Haut, lose Zähne, hervorstehende Adern.
Kurz vor Sonnenaufgang gab ich auf, erhob mich und kochte mir in der Küche einen schwarzen Tee. Das Dienstmädchen schlief noch, unnötig, es zu wecken, der Tag würde lang genug werden. Nach all den Jahren vermisste ich immer noch die faden Kräutertees meiner Kindheit. Aber in den Kolonien schmeckte und roch alles stark, die Dinge waren dazu geschaffen, alles Schmerzhafte und Zarte abzutöten.
Als ich fühlte, wie schwer mein Körper war, fiel mir ein, dass Mutter einmal zu mir gesagt hatte: Deine breiten, kräftigen Hüften sind zum Gebären wie geschaffen. Es war das einzig Gute, was sie jemals über meinen Körper sagte, sie, die mich immer zwang, Kleider zu tragen, die ihn kleiner machten, meine Haut reizten, ich hatte zu viel Brust, zu viel Hüfte, zu viel von allem. Aber an jenem Tag bei den Pferden sah ich, wie er meinen Körper unter dem Kleid erahnte, wie er ihn sich nackt und bloß vorstellte, und da wusste ich, dass ich ihm Söhne würde gebären müssen, und all mein Blut sammelte sich da unten, das Blut, das nach Kupfer schmeckt, aber in Wirklichkeit geschmolzenes Eisen ist, und ich sah ihm in die Augen, und er hielt meinem Blick stand.
»Kommt doch einmal zum Nachmittagstee«, sagte ich, als ich es nicht mehr ertrug, und die Hausdame flüsterte: »Sei still, Kind, eine Frau redet nicht und lädt niemanden ein, sei still«, aber er sagte: »Ja, ja, ich komme.« In jener lange zurückliegenden Nacht dachte ich an seine Hände und an den kleinen Stein in seinem Ring, dunkelblau wie das Auge der Pfauen, die es angeblich im Königspalast gab, ich dachte an seine Finger, wie sie über den Edelstein strichen, bis ich einschlief.
Wir heirateten drei Monate später, an einem Tag Ende Februar, in diesem Monat, der nichts weiter ist als die Verlängerung einer dunklen Nacht.
Ich bestand darauf, ein perlgraues Kleid zu tragen, eine Farbe, die meine Mutter hasste. Die Tüllärmel reichten bis über die Handgelenke, und die Anproben mit der Näherin dauerten einen Monat. Zwischen unserer ersten Begegnung und der Hochzeit sahen wir uns nur zwei Mal, und immer in Begleitung. Es war eine überstürzte Hochzeit, aber niemand wandte etwas gegen sie ein. Ich wusste, dass mein Vater froh war, mich endlich unter der Haube zu haben.
Ich erinnere mich nicht an die Trauung, nur, dass es sehr kalt war und regnete und dass das Grau des Himmels sehr viel dunkler war als mein Kleid und dass er mir beim Verlassen der Kirche sagte, ich sähe aus wie eine Feldtaube mit meinem grauen Kleid, den Tüllärmeln und den parfümierten, silberbestickten Handschuhen, dem einzigen Luxus, den ich mir gegönnt hatte. »Du bist eine Taube, die man jagen muss, peng, ich werde dich mit Schrot spicken, peng, peng«, sagte er und lachte laut.
Als ich in meinem neuen Heim ankam, das so ganz anders war als mein Zuhause, groß, dunkel und vollgestopft, berührte ich sämtliche Gegenstände, einen nach dem anderen, und sagte zu mir selbst: All das ist mein. Diese Vorhänge, diese Möbel, sogar die Besen. Alles mein. Die Dienstmädchen senkten den Kopf, als ich an ihnen vorüberging, aber dann hoben sie ihn sogleich wieder und starrten mich an. Ich las, was in ihren Augen stand, vor allem in denen der hübschesten unter ihnen. Ihr Blick sagte: Warum hat ein Mann wie er sich eine so nichtssagende Frau ausgesucht? Ich klammerte mich an den Arm meines Mannes, um mich zwischen all diesen Räumen, all den Dienern und all dem Neuen aufrecht zu halten. Am Abend, als alles vorüber war und wir im Bett lagen, sagte ich zu ihm: »Sie glauben, du hast mich wegen meines Geldes geheiratet.« Und er entgegnete nichts, schob nur mit dem Knie meine Beine auseinander.
Das Grau meines Kleides, denke ich, das Grau des Himmels meiner frühesten Jugend, so fern, so viele Jahre zurück, war genau wie das Grau der Turteltaube an meinem Fenster, die mir verkündete, dass Anne sterben würde, vierzig Jahre nach meiner Hochzeit.
3. Paseo de la Castellana 11 (jetzt)
Ich war nicht immer so.
So durchgeknallt, meine ich.
Ich war nicht immer so feige.
Ich mache mir eine Coca-Cola Zero auf, werfe eine Alprazolam ein und setze mich unter die Klimaanlage. Die Kohlensäure bläht meinen Magen auf, aber sie täuscht ihn auch. Ich esse nichts mehr. Schlage eine ganze Woche lang Sonias Einladungen aus. Betrachte mich im Spiegel. Könnte mein früheres Ich mich so sehen, es wäre stolz auf mich. Jetzt, wo es mir egal ist, habe ich es endlich geschafft, ganz dünn zu sein. All die Jahre, in denen ich wie besessen meinen Hüftumfang gemessen habe, das Fett, das sich dort ablagerte, das sich Schicht um Schicht auf meinen Bauch legte und das ich abgekratzt hätte, wenn ich könnte. Die Kotzerei, die Abführmittel, die Selbstkasteiung. Diese ganze Zeit, in der ich herumgejault habe wie ein geprügelter Hund. Wie dumm ich war. Man muss einfach nur aufhören, Hunger zu haben. Wenn ich wirklich hier wäre, wenn meine Freundinnen hier bei mir wären, könnten wir uns gemeinsam daran erfreuen, wie der Umfang meiner Schenkel mit jedem Tag abnimmt, wie mein Schlüsselbein hervortritt, wie ich Muskelmasse verliere. Bestimmt würden meine Freundinnen mir Beifall klatschen, aber sie sind nicht hier bei mir, ich habe sie schon vor langer Zeit verloren.
Beruhigungsmittel sind eine Zeitbombe. Meine Nackenmuskeln entspannen sich, und ich kann fühlen, wie mein Hirn löchrig wird wie ein Badeschwamm, sich mit den dringend notwendigen Hohlräumen füllt.
Durch die getönten Scheiben meiner Wohnung beobachte ich die Büroangestellten in Anzug und Kostüm, die vor dem Eingang des Gebäudes Kaffeepause machen. Es ist später Vormittag. Ein etwa dreißigjähriger Mann mit kobaltblauer Krawatte und ungewöhnlich langen Koteletten – bestimmt ist er der Rebell in der Versicherungsfirma, bei der er arbeitet – flirtet mit einer langhaarigen Blondine in einem cremefarbenen Kleid. Im Geiste sehe ich ihre Nägel vor mir, französische Maniküre im gleichen Farbton wie ihr Kleid. Braungebrannte Füße, weiße Zähne. Das Haar mit Keratin geglättet. Ich lasse meiner Fantasie freien Lauf. Sie lebt in Chamberí, stammt aber ursprünglich aus Valladolid, wohin sie mit ihrem Renault Twingo alle zwei Wochen zurückfährt, um ihren Freund zu sehen, mit dem sie schon seit Ewigkeiten zusammen ist. Er kommt aus einem Vorort von Madrid und zeichnet sich dadurch aus, dass er Vetusta Morla hört. Er würde sie gerne gleich beim ersten Date von hinten nehmen, fühlt sich deshalb schuldig, begnügt sich damit, sich einen runterzuholen, und bekommt beim dritten Treffen, was er will. Sie gibt nach, fährt am Wochenende nicht nach Valladolid und am darauffolgenden auch nicht, sagt, sie müsse arbeiten. Von da an ist sie offiziell mit dem fortschrittlichen Typen zusammen, der ihr nicht sagen kann, was er wirklich will, nämlich, dass sie so tut, als wäre sie ein zwölfjähriger Junge, der scharf auf Sperma ist.
Ich war nicht immer so.
Es gab eine Zeit, da wachte ich nicht morgens um viertel vor fünf auf, so wie ich es jetzt tue, und zwar immer exakt um die gleiche Zeit, um auf der Webseite von Anthropologie den Teppichkatalog zu durchforsten. Da dachte ich nicht jeden Tag, ich würde sterben. Jetzt suche ich wie besessen meine Haut nach Symptomen des Kaposi-Sarkoms ab. Messe meine Temperatur. Beobachte, wie durch den Vitaminmangel mein Zahnfleisch schrumpft. Nur wenn ich das Gefühl habe, ich müsste etwas dagegen unternehmen, verlasse ich das Haus, kaufe im Supermarkt immer den gleichen Ceasar Salad und schlinge ihn bei vierzig Grad im Schatten auf einer Bank hinunter, dann gehe ich zurück nach Hause und lasse mich wieder aufs Sofa fallen. Auf meiner Zunge bilden sich Blasen, weil ich zu viel Salz esse und zu wenig trinke. In Online-Shops kaufe ich Klamotten, ich häufe Plastiktüten an, dann falle ich in das schwarze Loch chemischen Schlafs.
Ich glaube, es gab mal eine Zeit, da hätte man mich als glücklichen Menschen bezeichnet. Das sehe ich an den digitalen Spuren, die ich in den sozialen Netzwerken hinterlassen habe wie die durchsichtige Schleimspur einer Nacktschnecke. Ich erinnere mich nicht daran. Aber anscheinend hatte ich einen normalen Job, einen Tagesablauf, traf mich mit Leuten zum Abendessen, hatte Freundinnen, schnitt mir das Haar. Ich hatte wohlbegründete Ansichten zur nationalen und internationalen Politik. Ich las Bücher und sammelte Ausgaben des New Yorker.
Meine Erinnerungen sind weg, mein Hirn ist ein Schwamm, nur eine Geschichte aus jener längst vergangenen Zeit klingt mir wie eine Litanei in den Ohren: eine Geschichte, die meine Freundinnen und ich über ein Mädchen gehört hatten, das tatsächlich durchgedreht war. Das war für uns das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte: durchzudrehen und öffentlich gedemütigt zu werden. »Sie ist diesem verheirateten Typen völlig ausgeliefert«, erzählte meine Freundin, »und macht sich jetzt überall lächerlich. Sie geht zu ihm ins Büro und heult dort rum, heult sich bei jedem aus, der ihr zuhört. Der Typ hat sie sitzen lassen, er hat sich gelangweilt und wollte einfach nur ein bisschen mit ihr die Zeit totschlagen.«
Die Zeit totschlagen, sie häuten und mit ein wenig Salbei in Butter braten, denke ich. Sie auf den Teller legen und mit einem guten Bordeaux servieren. Das hat der Typ gemacht. Gut für ihn. Während die Tussi, die ich nicht kannte, bei allen Konzerten, bei jedem Abendessen allen etwas vorjammerte, überall tauchte sie auf, mit verschmierter Wimperntusche, flatternden Händen, einem Kunststoffkleid und löchrigen Strümpfen, und weigerte sich, wieder zu verschwinden.
Ich war so glücklich, dass ich über sie gelacht habe, weißt du? Ich war so glücklich, so ruhig, dass ich mich auf dem Heimweg bei dir einhängte und dir die ganze Geschichte erzählte.
Ah ja. Du.
Wir sollten von dir reden, stimmt‘s? Das sollten wir.
III. Deborah und der Kauter
In meiner Erinnerung sind die Augen der Heilerin weiß, milchig wie die der Afrikaner, die völlig verloren in der Kolonie umherwanderten, ohne ihre Umgebung zu kennen. »Ein Hafen ist wie ein offener Mund, der sich mit den wundervollsten Dingen füllen kann, aber auch mit Infektionen«, sagte Anne Hutchinson, die stets versuchte, alles, was sie sah, zu retten, zu säubern, zu desinfizieren, unbedacht und unbekümmert um das, was um sie herum geschah.