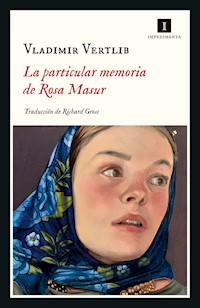17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vladimir Vertlib erweist sich erneut als Meister des Erzählens: Linas Roadtrip durch die Sowjetunion ist ein Füllhorn unglaublicher Geschichten. "Die Heimreise" ist die berührende Hommage des Autors an seine Mutter, eine kämpferische Frau mit unverwüstlichem Humor, und zugleich eine gnadenlose Satire auf die Absurdität der sowjetischen Diktatur in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts: Lina, eine junge Studentin aus Leningrad, die der Mutter des Autors nachempfunden ist, leistet im Sommer ihren verpflichtenden Arbeitsdienst im fernen Kasachstan, als sie eine Nachricht von zu Hause erreicht. "Vater schwer krank! Komm rasch!" Mit Hartnäckigkeit, Verzweiflung und wechselnden Weggefährtinnen wird Lina ihre Reise durch das sowjetische Riesenreich antreten, das von absurden Regelungen und willkürlicher Polizeigewalt beherrscht wird. Wird sie rechtzeitig nach Hause kommen, um ihren Vater noch lebend zu seh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Vladimir Vertlib
Die Heimreise
Roman
Der Verlag dankt für die Unterstützung.
© 2024 Residenz Verlag GmbH
Salzburg – Wien
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Jessica Beer
ISBN ePub:
978 3 7017 4714 4
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 1783 5
Dieser Roman hat einen realen historischen Hintergrund.
Er ist in besonderem Maße von den Erzählungen meiner Mutter und anderer Verwandter inspiriert.
Ihnen allen ist dieses Buch gewidmet!
Vladimir Vertlib
Inhalt
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Zweiter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Quellenangaben zu den im Roman verwendeten Liedtexten und Gedichten
Erster Teil
1
Es war kleiner als das Deckblatt eines Personalausweises, hellgrau, schwarz liniert und dünn wie Löschpapier. Die Nachricht war als Streifen aus dem Fernschreiber gekommen, in Teile von passender Länge geschnitten und auf dieses Blatt geklebt worden. Nun war die Schrift verwischt, weil das Telegramm dem Fahrer, der es vom fünfzehn Kilometer weit entfernten Postamt in diesen verlorenen Winkel der Steppe befördert hatte, aus der Hand und auf die vom Regen durchnässte Erde gefallen war. Der Mann, ein korpulenter Kasache in mittleren Jahren, brummte verdrießlich eine Entschuldigung, lehnte sich mit dem Rücken gegen das linke Hinterrad seines Traktors und zündete sich eine Zigarette an. Während er rauchte, versanken seine Stiefel ganz langsam im Schlamm.
Die Nachricht war zwar nass und schmutzig, aber immer noch lesbar. Sie lautete: Vater schwer krank. Komm rasch! Rückreise von Hochschule bewilligt. Mutter.
Ich wurde blass und ließ mich auf die Trittstufe des Traktors fallen, weil es sonst nichts gab, wo ich mich hätte hinsetzen können. »Krank?«, flüsterte ich leise und rief dann laut, nach einer Schrecksekunde: »Aber was? Was hat er? Wieso schreibt sie das nicht?«
»Genau. Was soll das heißen, Lina?« Meine Freundin Olga hatte mir über die Schulter geschaut und mitgelesen.
Ich drehte das Blatt um, schaute auf die Rückseite und hielt es gegen das Licht, als würden sich die Wörter dadurch ändern oder etwas anderes preisgeben oder als würde plötzlich etwas Verborgenes zum Vorschein kommen. Doch weder verschwanden dadurch die weiterhin gut lesbaren Wörter noch vermehrten oder verwandelten sie sich. Ich starrte das Telegramm trotzdem noch eine halbe Minute an, prägte mir jeden Quadratzentimeter des Zettels ein: die Überschrift mit den Worten Kommunikationsministerium der UdSSR, das Staatswappen, den Stempel, die Linien, den Namen, das Datum – 21. August 1956 –, den Ort des Absenders – Leningrad – und den Zielort in der Kasachischen SSR, eine Nummer, den Namen der Sowchose, in der ich arbeitete, und eine unleserliche Unterschrift, offenbar die der Postbeamtin, die das Telegramm entgegengenommen hatte. Doch darin war gleichfalls keine geheime Botschaft auszumachen.
»Wenn deine Mutter schreibt, dass Chaim Abramowitsch schwer krank ist, dann …«, Olga stockte.
»Wenn Rosa Borisowna mir so etwas schreibt …«, murmelte ich. »Rosa Borisowna würde nicht wagen, mir das zu schreiben … Niemals würde jemand in meiner Familie so etwas schreiben, wenn nicht …« Das Ende des Satzes brachte ich nicht über die Lippen.
Olga legte mir den Arm um die Schultern, seufzte, holte tief Luft und schwieg. Ich hatte den Eindruck, als überlegte meine beste Freundin krampfhaft, was sie sagen sollte, ohne die richtigen Worte zu finden. Fast hätte sie mir leidgetan. Wenn ich nicht selbst so irritiert und verstört gewesen wäre, hätte ich vielleicht versucht, die Situation mit einem Scherz oder einer belanglosen Bemerkung zu überspielen. Es gab kaum eine Lebenskatastrophe, für die ich damals nicht irgendeine logische Erklärung, eine Lösung oder eine schlüssige Begründung gefunden hätte. Wer verstanden werden wollte, wandte sich an mich, wer getröstet werden wollte, mied mich hingegen. Aus gutem Grund wahrscheinlich.
Reiß dich zusammen!, sagte ich mir. Was soll es denn bringen, wenn du jetzt zu heulen beginnst? Sei erwachsen!
»Nehmen Sie mich mit, wenn Sie zurück in den Ort fahren«, bat ich den Fahrer. Dieser nickte, schnalzte den Zigarettenstummel mit Zeigefinger und Daumen über meine rechte Schulter in die Weiten des Ackers hinter meinem Rücken, zog mit sichtlichem Kraftaufwand die Stiefel aus dem Schlamm und stapfte über einen schmalen Weg aus alten, verfaulten Brettern Richtung Haus – dem einzigen, das hier weit und breit zu sehen war. »Ich fahre erst morgen«, sagte er.
»Morgen erst?«, riefen Olga und ich, die dem Fahrer hinterherliefen, beinahe gleichzeitig aus. »Warum erst morgen?«
»Es ist spät, Mädchen«, sagte er.
»Mein Vater ist krank«, erklärte ich. »Ich muss nach Leningrad zurück. Dringend!«
»Sehr schwer krank«, meinte Olga. »Die Mutter meiner Freundin hat ein Telegramm geschickt. Wenn sie ihre Tochter Tausende Kilometer entfernt mit einem Telegramm belästigt, was so gar nicht ihre Art ist, und das Dekanat der Hochschule die Heimreise bestätigt und bewilligt hat, muss es sich um etwas wirklich Dramatisches handeln.«
»Ich weiß.« Der Mann ging die drei Stufen zum hölzernen Vorbau hinauf, streifte die Stiefel ab, bevor er an die Haustür klopfte, während Olga und ich unten blieben und zu ihm hinaufschauten. »Es ist spät«, wiederholte er. »In der Dunkelheit bleibe ich bei diesem Schlamm sicher irgendwo stecken, und dann gute Nacht. Wenn es wieder zu regnen beginnt, und es soll wieder regnen in der Nacht, kommt hier nicht einmal ein Panzer durch. Außerdem bringt es dir nichts, wenn du heute noch in den Ort kommst. Das Postamt ist geschlossen. Bis zur Bahnstation sind es mehr als hundert Kilometer, und die nächste Mitfahrgelegenheit hast du frühestens übermorgen.«
»Wieso erst übermorgen?«, schrie Olga und wollte schon die Stufen hinauflaufen, ich aber hielt sie am Ärmel zurück. »Lass«, sagte ich leise. »Es hat doch keinen Sinn.«
»Morgen, pünktlich um halb sieben Uhr früh«, bemerkte der Fahrer lapidar, ohne zu lächeln und ohne uns beide anzuschauen.
»Einverstanden«, sagte ich.
Die anderen Studentinnen hatten ihre Briefe und Pakete schon abgeholt. Wasser und Proviant waren ausgeladen. Ich war die Letzte, die zu dem Traktor gegangen war, weil mir das Gedränge, das Schreien und Kichern meiner Kommilitoninnen und die zotigen Bemerkungen des Fahrers zuwider waren. Es spielt keine Rolle, ob ich zehn Minuten später oder früher an der Reihe bin, hatte ich gedacht. Sollen doch die anderen Mädchen zuerst holen, was sie brauchen.
Nach Wochen der Trockenheit hatte es stark geregnet, der Boden war aufgeweicht, und die einzige Straße versank im Schlamm. Der Fahrer hätte schon vor drei Tagen kommen sollen, doch das schlechte Wetter hatte sogar ein Durchkommen mit dem Traktor unmöglich gemacht. Die Lebensmittel wurden knapp und mussten rationiert werden. Die Auf- und Zuteilung hatte Rina übernommen, mit einunddreißig Jahren eine der jüngsten Dozentinnen meiner Hochschule, aber die älteste Bewohnerin des aus einer großen Strohhütte und zwei Zelten bestehenden »Lagers«. Ihr waren von allen anderen – unausgesprochen zwar, aber wie selbstverständlich – solche Aufgaben zugewiesen worden. Rina, deren voller Name Oktjabrina (benannt nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution) lautete, eine landesweit anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Infinitesimalrechnung, hatte eine schwere Kindheit und eine noch schwerere Jugend gehabt und demzufolge auch einen schweren Charakter, den manche Leute mit einer Mischung aus Schaudern und Respekt als »gewichtig« bezeichneten. Als ich sie kennengelernt habe, wollte ich von ihr wissen, wie sie als Kind in der Schule gerufen und wie sie heute genannt werden wollte: Oktja oder Ktjaba? Weder noch, sondern einfach nur Rina, hatte sie mir geantwortet. So gab es in unserer Gruppe also eine Rina und mich, eine Lina. Äußerlich wie auch in unserer Sprechweise und unserer ganzen Art waren wir ähnlich wie unsere Namen, auch wenn wir gut zehn Jahre auseinanderlagen. Beide waren wir blond, blauäugig, üppig, aber nicht dick, trugen unser Haar lang und offen und hatten buschige, imposante Augenbrauen, weil die Unsitte, diese auszuzupfen, damals noch lange nicht Mode war. Rina war allerdings etwas größer als ich, hatte markantere Gesichtszüge und eine längere, leicht gebogene Nase. Wenn man Leute fragte, wer von uns beiden wohl Jüdin sei, tippten alle auf Rina, die in Wahrheit Petrowa hieß und die Enkelin eines Landpopen aus der Gegend von Jaroslawl war, während meine Vorfahren aus einem Schtetl in der Nähe der weißrussischen Stadt Mosyr stammten. Elina Chaimowna Blank – so lautete mein voller Name, auch wenn ich von jenen, die schon damals förmlich und per Sie mit mir kommunizierten, mit »Elina Konstantinowna« angesprochen wurde. Mit meinen zwanzig Jahren war ich für die meisten Menschen aber einfach nur »Lina« oder »Linotschka«, und für Fremde war ich oft schlichtweg ein »Mädchen« oder ein »Fräulein«.
Olga und ich machten uns also auf die Suche nach Rina und entdeckten sie bald im Wäldchen, wo sie gerade einem dringenden Bedürfnis nachging. »Wäldchen« war allerdings eine eher ironisch gemeinte Umschreibung für die fünf armseligen Bäumchen, mehr Sträucher als Bäume – die einzigen Pflanzen in dieser Steppe, die etwas höher waren als reifer Weizen oder Mais. Sonst sah man bis zum Horizont nicht einmal eine Bodenerhebung, es war, als befände man sich auf einem gigantischen kontinentalen Ozean. Die Ernte war eingefahren, wobei »fahren« zweifellos nicht das richtige Wort war. Was nicht rechtzeitig geerntet worden war, und das war das meiste, verrottete nun oder wurde von Mäusen gefressen, und sogar das, was abtransportiert worden war, blieb oft irgendwo unterwegs liegen und verrottete dort – in alten Getreidesilos, auf offenen Ladeflächen, in Güterwaggons auf Nebengleisen oder in anderen Sackgassen und falschen Abzweigungen. Man munkelte zudem von Heuschrecken, die im Anflug waren, doch war wenigstens dies nur ein böses Gerücht.
Das Gras war durch die sengende Sonne verbrannt. Was blieb, war eine Ebene aus verschiedenen Brauntönen, geteilt durch einen schnurgeraden, dunklen Strich, wie der Schatten eines gigantischen Turmes, der hinter dem Horizont verborgen zu sein schien – es war die staubige, nach dem Gewitter schlammige Trasse, welche diesen Außenposten der Zivilisation mit dem Bezirkszentrum verband.
Das »Wäldchen« diente uns Mädchen tagsüber als Toilette. Es bot nicht nur notdürftigen Schutz vor den Blicken anderer sowie einige Mulden in der für die Verrichtung des Geschäfts richtigen Größe und Tiefe, sondern auch genügend Laub, nach dem man überall nur die Hand auszustrecken brauchte, um es zu pflücken und sich damit zu säubern, und jetzt, nach dem Regen, sogar – welch Luxus! – eine Pfütze, um sich die Hände waschen zu können. Hinter dem Haus, in dem gerade der Fahrer verschwunden war, gab es zwar ein Plumpsklo und einen Brunnen, doch die Bauernfamilie, die darin wohnte, hatte uns, den Erntehelferinnen, schon am ersten Tag erklärt, dass beides den Studentinnen aus der fernen Großstadt nicht zur Verfügung stehe. Nur Rina dürfe als Dozentin und somit »Chefin« der Gruppe großzügigerweise die Toilette benützen, hieß es. Rina verzichtete auf dieses Privileg mit dem Hinweis, sie sei keine Chefin und jegliche Bevorzugung sei ihr peinlich. Die Senkgrube der Toilette stinke ohnehin so erbärmlich, dass sie das Wäldchen oder einfach die Felder rund um das Lager bevorzuge.
Schon auf der neun Tage und acht Nächte dauernden Fahrt im Güterzug, der uns Studentinnen und Studenten sowie das Lehrpersonal der Hochschule von Leningrad ins ferne Kasachstan brachte, hatte Rina auf die ihr als Dozentin zustehenden Sonderrationen verzichtet. »Ich habe Blockade und Krieg überlebt, ich werde auch diesen Ausflug ohne Sonderzuteilungen überleben«, hatte sie gemeint. Die anstrengende Anreise konnte ihr tatsächlich nichts anhaben. Einige ihrer Kollegen hatten weniger Glück.
»Ich hoffe, es klappt alles, und du kommst rechtzeitig nach Hause, um deiner Mutter beizustehen«, meinte Rina, nachdem sie das Telegramm gelesen hatte. Sie streifte Ameisen, Käfer und sonstiges Getier, das im Wäldchen über sie hergefallen war, von ihrem Kleid und den Beinen ab und ging nun langsamen Schrittes zurück zur Strohhütte, in der sich ihr Nachtlager befand – dicht gefolgt von ihrer besten Freundin Natascha und einer jeden Augenblick größer werdenden Gruppe anderer Mädchen. Ich war erstaunt, wie schnell sich die schlechte Nachricht herumgesprochen hatte.
»Aber sicher ist sie rechtzeitig zu Hause!«, erklärte Olga selbstsicher.
»Rosa Borisowna hätte mir nicht geschrieben, wenn es zu spät gewesen wäre«, sagte ich.
»Gewiss nicht«, meinte Rina, aber es klang nicht überzeugend. »Ich habe deine Mutter nur einmal gesehen, habe aber sofort erkannt, was für eine starke und resolute Frau sie ist.«
»Die in Leningrad außerdem noch einen Sohn und eine Schwiegertochter hat«, ergänzte Olga. »Es muss ja nicht immer Lina für alles zuständig sein!«
»Das Erste, was ich mache, wenn ich morgen auf dem Postamt bin, ist, zu Hause anzurufen«, erklärte ich.
»Vorausgesetzt, das Telefon funktioniert«, meinte Natascha, »weil bekanntermaßen die Postämter in diesen Käffern …« Rina warf Natascha einen vernichtenden Blick zu, und diese verstummte sofort.
»Seit ich mich erinnern kann, ist Chaim Abramowitsch krank gewesen«, murmelte ich und erschrak selbst über den gebrochenen Klang meiner Stimme. »Wahrscheinlich ein angeborener Herzfehler, und alles, was an seinem Herz noch gesund war, hat er sich später selbst ruiniert. Das hat ihm während des Krieges die Einberufung erspart, aber …« Während ich sprach, musste ich an den letzten Kreislaufkollaps meines Vaters denken und daran, wie meine Schwägerin und ihre Geschwister aus der Ukraine, die in diesen Tagen bei uns zu Besuch gewesen waren, feuchtfröhlich und lautstark seine »Wiederauferstehung« gefeiert hatten. »Möge er hundertzwanzig Jahre alt werden!«, hatten sie ausgerufen, als es ihm wieder besser ging, so als hätte er Geburtstag. Diese Fröhlichkeit der angeheirateten Verwandten erschien mir damals übertrieben und überflüssig. Ihr Verhalten hatte etwas Albernes und Beängstigendes zugleich, fand ich, während mein Vater mit schmerzverzerrtem Gesicht lächelte und schließlich die Bemerkung machte, seine Krankheit habe also doch auch etwas Gutes, wenn sie andere Leute zu so viel Freude und Ausgelassenheit animiere.
»Ich frage mich schon lange, warum du deine Eltern eigentlich nicht Papa und Mama nennst wie normale Menschen, sondern mit Namen und Vatersnamen ansprichst«, bemerkte Natascha. »Das ist so seltsam! Ich wüsste nicht, dass das irgendwo bei uns oder in jüdischen Familien üblich wäre.«
»Jetzt halt doch die Klappe!«, herrschte Rina sie an. Natascha zog schuldbewusst den Kopf ein, senkte den Blick, presste die Arme fest gegen den Körper und sah plötzlich wie ein Schulmädchen aus der siebenten Klasse aus. Sie war klein und feist und wirkte, auch ohne sich kleiner zu machen, als sie war, noch nicht ganz erwachsen, obwohl sie schon vier Jahre in einer Fabrik gearbeitet hatte, bevor sie den Schulabschluss in einer Abendschule gemacht und mit ihrem Studium begonnen hatte.
»Als mein Bruder und ich ganz klein waren, haben wir die Eltern noch Mama und Papa genannt«, erzählte ich. »Dann ist etwas passiert, und seitdem haben wir sie nur mehr mit Namen und Vatersnamen angesprochen, eine Marotte, nichts weiter, aber das ist eine lange Geschichte; ich erzähle sie ein anderes Mal.«
Rina blieb stehen und nahm mich in die Arme. »Ich würde dir gerne etwas wirklich Kluges und Tröstliches sagen«, flüsterte sie, »aber wahrscheinlich gibt es nichts, womit ich dir helfen könnte.«
»Nein«, meinte ich und wich zurück. »Aber das macht nichts. Bitte keine Umstände, ich brauche nichts.«
Rina ließ mich nicht los, drückte mich noch stärker an sich und flüsterte mir leiser als zuvor, sodass es niemand anderer hören konnte, ins Ohr: »Ich wäre froh, wenn ich mir um meine Eltern noch Sorgen machen könnte. Als sie abgeholt wurden, war ich zwölf Jahre alt. Ich werde nie vergessen, wie sie mich angeschaut haben. Vater wollte noch etwas sagen, aber man ließ ihn nicht. Mutter sagte: Häschen, du sollst … Dann wurde die Wohnungstür zugeschlagen. Von ihrem Tod erfuhr ich dann ziemlich bald, was natürlich gut war. Andere mussten die Ungewissheit jahrelang ertragen. Du bist einundzwanzig und hattest deine Eltern die ganze Zeit. Trotz allem, was war. Weißt du, die scheinbar selbstverständlichen Dinge sind oft das größte Glück.«
»Du irrst dich«, sagte ich trocken und befreite mich mit einer heftigen Bewegung aus Rinas Umarmung. »Ich bin noch nicht einundzwanzig. Das werde ich erst im November.«
Bis vor wenigen Monaten hatte Rina kaum jemals über ihre Familie oder ihr Privatleben gesprochen. In der Hochschule hatten alle gedacht, ihre Eltern wären Anfang 1942 während der Blockade verhungert; jedenfalls hatte sie das einmal angedeutet, danach aber so schnell das Thema gewechselt, dass niemand weiterzufragen gewagt hatte. Plötzlich jedoch, es war irgendwann im letzten Frühjahr, erzählte sie einigen Studentinnen, darunter auch mir, ihre Eltern seien keineswegs im Krieg umgekommen, sondern 1937 während der »Großen Säuberungen« als sogenannte »Volksfeinde« verhaftet und hingerichtet worden. Der Vater sei ein alter Bolschewik und Revolutionär gewesen, die Schuld der Mutter habe darin bestanden, seine Frau gewesen zu sein. Nun allerdings, knapp zwanzig Jahre später, habe man sie rehabilitiert. Die Zeiten änderten sich. Millionen Menschen kamen aus Gefängnissen und Lagern frei, das halbe Land war unterwegs, verließ entlegene Gegenden mit Stacheldrahtpanorama, Verbannungsorte im hohen Norden und Baustellen in der Tundra, zog in Städte und in wärmere, zivilisiertere Gegenden, und Stalin galt auf einmal nicht mehr als der größte Führer, Lehrer und Vater aller Zeiten und Völker, sondern mutierte zu einem normalen Sterblichen, einem Menschen mit Fehlern, der Verbrechen begangen hatte. Die Staatsanwaltschaft, erzählte Rina ein paar wenigen Studentinnen ihres Vertrauens, habe das Verfahren gegen ihre Eltern eingestellt, da »keinerlei strafbare Handlung vorliege«. Auch die Parteimitgliedschaft der Eltern und die ihrem Vater einst verliehenen Titel und Ehrungen seien posthum wiederhergestellt worden. Ein höherer Beamter der Staatssicherheit habe ihr die Hand geschüttelt und sich bei ihr sogar entschuldigt, erzählte Rina. Es sei, so der Mann mit himmelblauen Schulterklappen und goldenen Sternen auf seiner Uniform, »leider ein bedauernswerter Fehler passiert«. Das mache die beiden Genossen zwar nicht mehr lebendig, aber wenn sie noch am Leben wären, dann wären sie zweifellos stolz auf ihre Tochter und auf ihr Land.
Ich hatte mich oft gefragt, wie es Rina, obwohl sie aus einer Familie von »Volksfeinden« stammte, gelungen war, nicht nur ihr Studium erfolgreich abzuschließen, sondern sogar eine Stelle als Dozentin an einer Pädagogischen Hochschule zu bekommen, doch traute ich mich nicht, ihr jemals eine solche Frage zu stellen. Die Zeiten änderten sich, und doch war es immer noch besser, zu wenig als zu viel zu fragen, so viel hatte ich gelernt. Wissen ist Macht, diese Macht kann aber auch tödlich sein, das wusste ich damals schon.
Damals war ich von der persönlichen Bemerkung der älteren Kollegin, die zudem seit drei Jahren meine Lehrerin war und dies wahrscheinlich noch weitere zwei Jahre bleiben würde, unangenehm berührt. In diesem Moment war ich zu verstört und zu aufgewühlt, um noch Kraft für die Gefühle anderer aufzubringen. Es überkam mich die immer bitterer und beängstigender werdende Ahnung, dass mein Vater tot war. Tot. Krampfhaft versuchte ich, das Bild zu verdrängen, das vor meinen Augen entstand. Ich sah Vater tot auf seinem Bett liegen, während Mutter auf einem Stuhl zu seinen Füßen saß und eine Kerze in der Hand hielt.
»Wenn die Hochschule deine Rückreise bestätigt, wirst du im Bezirkszentrum dein Taggeld und das Reisegeld bekommen. Achte darauf, dass sie dir ja alles auszahlen«, sagte Rina. »Sie sind Gauner.«
»Ja«, murmelte ich. »Ich denke allerdings nicht …«
»Und ich hätte noch eine kleine Bitte«, fiel ihr Natascha ins Wort. »Könntest du einen Brief für mich nach Leningrad mitnehmen? Die Post braucht ewig lang, du bist sicher früher dort.«
»Natascha!«, ermahnte Rina sie streng, machte ein böses Gesicht und hob die Augenbrauen, doch ich nickte und murmelte mit einer Mischung aus Gleichgültigkeit und Resignation: »Ja, gut, her damit.«
»Großartig!«, schrie Natascha freudig und schien auf einmal um zehn Zentimeter gewachsen zu sein. »Ich muss ihn noch schreiben. Du bekommst ihn morgen in der Früh.«
»Ich fahre um Punkt halb sieben.«
»Du bist die Allergrößte!«, rief Natascha, noch lauter und freudiger als zuvor, umarmte mich und gab mir einen Kuss auf die Wange, noch bevor ich sie wegstoßen konnte.
»Ach, könntest du meinen Brief auch mitnehmen?!«, fragte eine weitere junge Frau, und plötzlich war ich von einem Dutzend und bald von noch mehr Kommilitoninnen umringt, die alle auf mich einredeten, mir Briefe, fertig oder halb fertig verpackte Pakete entgegenhielten, Adressen auf Papierfetzen kritzelten, sich dabei aber ohne Unterlass dafür entschuldigten, dass sie mir mit ihren »Belanglosigkeiten« so viele Umstände machten.
»Jetzt hört endlich auf, ihr widerwärtigen Blutsauger!«, brüllte Olga und schob sich zwischen mich und die anderen. »Seht ihr denn nicht, in welchem Zustand sie ist, ihr Vampire? Wo soll sie dieses Zeug außerdem in ihrem Gepäck unterbringen? Was glaubt ihr denn, wer sie ist? Ein Postkutschenpferd? Also bitte: nur Briefe! Keine Päckchen und schon gar nicht etwas anderes.«
Was mache ich nur ohne Olga, dachte ich. Ich hätte viel dafür gegeben, den langen Weg durch vier Zeitzonen und die halbe Sowjetunion, der mir bevorstand, zusammen mit meiner besten Freundin machen zu können statt allein. Doch wusste ich, dass dies nicht möglich war. Die Reiseerlaubnis galt nur für mich. So wie wir Studentinnen und Studenten fast alle gezwungen worden waren, uns im Sommer »freiwillig« für diesen Einsatz zu melden, so zwang man uns nun auch, bis zum Ende der festgelegten Zeit an unserem Bestimmungsort zu bleiben, auch wenn die Ernte inzwischen längst eingebracht war und die Sowchose nicht mehr wusste, was sie mit uns, den ihr aufgezwungenen Hilfskräften, anfangen und wo sie uns einsetzen sollte. Arbeit hätte es wohl genug gegeben, doch fehlte es an dem notwendigen Werkzeug, an Maschinen oder schlichtweg an Transportmitteln.
Mit Olga zusammen wäre mir der Abschied von hier jedenfalls noch viel leichter gefallen. Ich erinnerte mich an den ersten Tag meines Studiums, als ich einer streng aussehenden, etwas verloren wirkenden jungen Frau mit dunklen Haaren und Pferdeschwanz in der Aula der Hochschule begegnet war und sie gefragt hatte, ob sie vielleicht ebenfalls auf dem Weg in das Mathematikinstitut und in die Einführungslehrveranstaltung für Studienanfänger sei. »Ja«, hatte die junge Frau geantwortet. »Ich studiere Mathematik und Defektologie – Arbeit mit blinden und sehbehinderten Kindern.«
»Gut, dann komm, gehen wir, worauf wartest du denn noch«, hatte ich gesagt und die neue Freundin, die sich als Olga vorstellte, resolut, als wäre es die selbstverständlichste Sache der Welt, an der Hand genommen und die Treppe hinaufgezogen.
2
Die Strohhütte war auf dem Gerippe eines alten Lastwagens errichtet worden: verrostete Querstangen, Reste der Fahrerkabine, der Ladefläche und der Motorhaube, die Radachsen, ein paar Bretter und Seile, die alles zusammenhielten, ein großes Segeltuch und viel Stroh bildeten ein kompaktes Ganzes, das – zumindest jetzt im Sommer – den starken Winden der Steppe zu trotzen vermochte. Die Konstruktion sollte wasserundurchlässig sein, doch wenn der Regen sehr stark wurde, tropfte es ins Innere, wenn auch nicht so stark wie in den beiden Zelten daneben, die in solchen Fällen bald unter Wasser standen. Dort schliefen die Mädchen aus der Literatur- und Russischgruppe der Pädagogischen Hochschule. Sie hatten viel zu ertragen. Die Strohhütte war den Mathematikerinnen und Naturwissenschaftlerinnen vorbehalten. Vielleicht hielt man sie für wichtiger als andere, schließlich brauchte man in erster Linie Techniker und Ingenieure und keine Grammatiker und Literaten, um das Plansoll zu erfüllen, das Land zu entwickeln und den Westen zu überflügeln, noch wahrscheinlicher aber war die Entscheidung, wer wo schlafen sollte, völlig willkürlich getroffen worden. Jedenfalls blieben alle an den Plätzen, die man ihnen anfangs zugewiesen hatte, und niemand beschwerte sich.
Rechts und links des Eingangs, nur durch einen schmalen Mittelgang getrennt, standen in der Hütte Stockbetten – dreistöckig, eng, aber immerhin geräumig genug, dass man bequem zu zweit in einem Bett schlafen konnte. Ein Luxus im Vergleich zu den Verhältnissen auf der Zugfahrt von Leningrad nach Kasachstan. Im Güterwaggon hatten auf jeder Liege neun Mädchen übernachtet. Wenn sich eine von ihnen umdrehen wollte, mussten das die anderen acht ebenfalls tun, und wenn eine pinkeln wollte, wachten alle auf und gingen ebenfalls pinkeln. Doch die Zugfahrt hatte nur neun Tage gedauert, hier, in der Steppe, mussten wir aber inzwischen mehr als sechs Wochen zubringen. Vier weitere Wochen standen uns noch bevor.
Petroleumlampen und Kerzen waren in der Strohhütte verboten, genauso wie Streichhölzer oder Zigaretten. Die wenigen noch funktionstüchtigen elektrischen Taschenlampen waren längst ausgeschaltet. Die Mädchen schliefen oder unterhielten sich halblaut. Ich spürte Olgas Haar im Gesicht und in der Nase. Die Freundin hatte mir den Rücken gekehrt und schnarchte leise. Sie war – wie immer, so auch diesmal – sofort eingeschlafen, während ich neben ihr auf dem Rücken lag und in die Finsternis starrte, zwischen den Silhouetten der Betten und der Körper meiner Studienkolleginnen nach den Geistern der Vergangenheit und den Erinnerungen an sie suchte und bald überzeugt war, ich würde in dieser Nacht kein Auge zutun.
Krampfhaft versuchte ich, an besonders schöne Momente zu denken, die ich mit meinem Vater erlebt hatte, musste dabei aber schließlich bis vor den Krieg zurückgehen, als ich noch ein Kleinkind war. Dort verschwamm alles in einem magischen Ungefähr, einer Welt, als der Himmel gelb wie Eidotter und das Wasser in den Kanälen blau wie der Himmel war und in den Fischgeschäften noch echte Fische mit glänzenden Schuppen in Aquarien herumschwammen und keine Fischattrappen aus Watte und Pappe oder gar Fotografien in den Auslagen zur Schau gestellt wurden. Ich wusste noch, wie mich mein Vater, den ich damals noch »Papa« und nicht »Chaim Abramowitsch« nannte, hochhob und auf seine Schultern setzte, wie ich mich an seinem pechschwarzen, dichten Haar festhielt und diesen sehr spezifischen Geruch von Seife, Schweiß und Rasierwasser einsog, den ich so mochte, wie ich den Kopf hob, durch die Vitrine schaute, plötzlich die großen, dicken Fische im Aquarium sah, so nah, als würden sie jeden Augenblick an mir vorbeischwimmen, und zu schreien begann, und ich wusste weder damals noch später, ob ich eher aus Entzücken oder Entsetzen über die riesengroßen, lid- und wimpernlosen Augen der Tiere, die mich von der Seite anstarrten, geschrien hatte. Mein Vater sagte etwas Beruhigendes, Fröhliches und Scherzhaftes, nur konnte ich mich später nicht mehr an seine Worte erinnern, sondern nur an den Tonfall. Auch heute noch, als Erwachsene, habe ich den Geruch von Vaters Haar in der Nase und seinen damaligen Tonfall im Ohr, wenn ich große, lebende Fische sehe.
In Kasachstan hatte ich noch keinen einzigen Fisch gesehen. In meinem Stockbett liegend, dachte ich an damals, an Leningrad vor dem Krieg, das mir um so vieles adretter und sauberer vorkam als in der furchtbaren Kriegs- und schäbigen Nachkriegszeit, an große Fische und an Vaters Geruch und seine Stimme, doch statt Vaters Bild kam mir plötzlich Professor Semjon Markowitsch (in Wirklichkeit Srul’ Mowschewitsch) Kagan in den Sinn, Leiter der Fakultät für Theoretische Mathematik, der mich am Beginn meines Studiums sehr beeindruckt hatte, als er mit Hilfe simpler, logischer Ableitungen nachweisen konnte, dass es im Unendlichen mehr ganze Zahlen als Brüche gibt. Es war Semjon Markowitsch, Parteimitglied seit 1919 und immer noch so begeisterungsfähig wie wahrscheinlich schon in seiner Jugend, der den Studenten feurige Reden hielt – gegen Zionismus und Kosmopolitismus (als Jude musste er das noch viel überzeugender vorbringen als andere), gegen die westdeutsche Wiederaufrüstung, gegen die NATO und die Aggressivität Israels, gegen die kapitalistische Ausbeutung, die großen Konzerne, den Kolonialismus, den amerikanischen Imperialismus und noch gegen einiges mehr. Die von Chruschtschow propagierte Neulandgewinnung in Kasachstan, die große Agrarrevolution, die Züchtung neuer Getreide- und Maissorten und die Urbarmachung einstiger Steppenregionen, die Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts immer noch so aussahen wie in den Zeiten Dschingis Khans und Tamerlans, lobte er hingegen euphorisch. Das gehörte zu den Dingen, bei denen er »dafür« und nicht »dagegen« war, aber in Zeiten wie diesen war er viel öfter gegen etwas als für etwas. Er war es auch, der den Studenten nahelegte, sich im Sommer freiwillig zu melden, um bei diesem »großen, ja epochalen Projekt«, wie er sich ausdrückte, mitwirken zu dürfen. Die Teilnahme sei natürlich freiwillig. Niemand, betonte er, werde dazu gezwungen. Aber! Junge Menschen aus dem ganzen Land hätten sich schon gemeldet, um zusammen diesen großen Sprung nach vorne zu bewerkstelligen und der hellen Zukunft ein paar Schritte näher zu kommen. Er hätte das nicht zu erklären brauchen. Man hatte ihn schon verstanden. Fast die gesamte Hochschule meldete sich »freiwillig« zur Neulandgewinnung – Studenten, Dozenten, Professoren, Angestellte. Ein Zug mit fünfzig Güterwaggons, einem Sanitäts- und einem Verkaufswagen sowie zwei Lokomotiven wurde zur Verfügung gestellt. Trotz zweier überstandener Herzinfarkte meldete sich Semjon Markowitsch ebenfalls für diesen Einsatz. Am dritten Tag, irgendwo zwischen Wolga und Ural, hatte er seinen dritten Herzinfarkt und starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Er sollte nicht das einzige Opfer dieser Reise bleiben.
Ich vermutete, dass mein Vater ein paar Jahre nach dem Krieg einen Herzinfarkt erlitten hatte. Es war ihm sehr schlecht gegangen, er hatte alle typischen Symptome – Atemnot, Beklemmungen, Schmerzen in der Brust, Schwindel, Schwäche. Aber er erholte sich rasch und weigerte sich, einen Arzt aufzusuchen. Es gehe ihm gut, betonte er, es sei nichts weiter als eine wetterbedingte Kreislaufschwäche gewesen. In der Arbeit sei viel los, der Direktor habe ihn seit langem schon im Visier, einen Krankenstand könne er sich nicht leisten. Als Jude könne er sich weniger erlauben als andere. »Solange ich ihnen unersetzlich erscheine, halten sie mich im Betrieb«, erklärte er. »Wenn ich längere Zeit im Krankenstand bin, ersetzen sie mich, und der neue Chefbuchhalter wird bestimmt kein Jude sein.«
3
Gegen Morgen nickte ich ein, es war mehr ein Dösen als ein Schlaf, und in diesem Zustand zwischen Traum und Wachsein schien es mir, als stünde die Strohhütte mitten in einem alten Leningrader Innenhof, und zwar direkt vor dem Hintereingang zu unserem Haus. In allen Fenstern brannte Licht, und nach einiger Zeit begann die Hütte aufzusteigen, schwebte durch die Lüfte und glitt im dritten Stock durch das Korridorfenster in die Kommunalwohnung hinein, in der ich mit meinen Eltern, dem Bruder, seiner jungen Frau und deren sechs Monate alten Tochter zwei Zimmer teilte. Die Großmutter, die ebenfalls mit uns gewohnt hatte, war vor zwei Jahren gestorben. Ganz leise, auf Zehenspitzen schlich ich aus der Hütte in unser Wohn- und Schlafzimmer. Das Baby lag mit offenen Augen in seinem Gitterbett, lächelte, nein, grinste mich schelmisch an, war aber seltsam still; alle anderen schliefen, und nur aus einem Zimmer der Nachbarn (es lebten noch drei Familien in der größten Wohnung dieses einst großbürgerlichen Hauses, das zehn Jahre vor der Revolution erbaut worden war) drang lustvolles Stöhnen. Seltsam, dass Julia um diese Zeit noch einen Kunden hat, dachte ich. Üblicherweise empfing Julia ihre »Gäste« in den frühen Abendstunden. Ihr Mann war dann meist, von Julia rechtzeitig in ausreichendem Maße mit harten Getränken versorgt, schon betrunken und wartete auf der alten Couch im Korridor, bis die Gattin ihre Termine abgearbeitet hatte. Dass jemand um fünf Uhr morgens bei ihr verkehrte, war allerdings ungewöhnlich. Ich überquerte – wiederum auf Zehenspitzen – den Korridor, schob die auf Spielzeugformat geschrumpfte Strohhütte auf die Seite, griff nach der Türklinke der Nachbarn, zuckte zusammen und … erwachte. Aus einem Bett schräg vis-à-vis drang leises Stöhnen. Zwei Mädchen küssten und streichelten einander. Das war nicht das erste Mal, und diese beiden waren nicht die Einzigen, doch um diese Uhrzeit war das, was sie taten, gleichfalls höchst ungewöhnlich. Ich schloss die Augen und hielt mir die Ohren zu. Ich wusste, dass die beiden Studienkolleginnen keine »widernatürliche Veranlagung« hatten, beide waren mit Studenten von anderen Universitäten liiert, eine von ihnen wollte demnächst heiraten. Doch die Veranlagung meiner Kommilitoninnen war mir ohnehin gleichgültig. Ich war der festen Überzeugung, dass jeder Mensch nach seiner eigenen Fasson glücklich werden sollte. Was mich störte, war der mehr oder weniger öffentlich praktizierte Körperkontakt, der bei mir einen so starken Ekel auslöste, dass ich würgen musste. Ich selbst war noch nie von jemandem auf den Mund geküsst worden und hätte dies auch niemals zugelassen. Dass meine Eltern aber immer fest umschlungen in ihrem Bett schliefen und sich morgens nach dem Aufwachen einen Kuss gaben, gefiel mir sehr. Es war das einzige Küssen auf den Mund, dem ich gerne und in Ruhe zuschauen konnte, ohne ein unangenehmes Gefühl zu haben und mich wegdrehen zu müssen. Nun aber empfand ich das Schmatzen und die Maunz-Geräusche von Lisa und Irina unerträglich, diesem Ort, dieser Nacht und vor allem meiner eigenen Stimmung so unangemessen, dass ich aufstand, hastig Pluderhose und Stiefel anzog, den Pullover über die Bluse und die wattierte Jacke drüber, mir das Kopftuch umband und aus der Hütte ins Freie lief. Der Regen hatte aufgehört, doch war es bitterkalt, so kalt, dass ich es bereute, kein zweites Paar Strümpfe angezogen zu haben. Die Wolken hatten sich verzogen. Man sah die Sterne wie Lichter von Scheinwerfern aus einer anderen Welt, die näher kamen, und den Mond wie eine gelbe Sichel, die am Himmel klebte und jeden Augenblick herunterfallen konnte, die Felder, die im Zwielicht surreal wie mit blauer Farbe bemalt wirkten, und irgendwo, in weiter Ferne, mitten in der Finsternis, teilte ein kaum erkennbarer, nur erahnbarer Horizont Himmel und Erde, Schwarz von Dunkelgrau. Der Herbst kündigte sich an. Einige Tage noch, und am 1. September würden für die Kinder im ganzen Land zwischen Kaliningrad und Sachalin die Sommerferien zu Ende gehen. Sie würden ihre Schuluniformen anziehen, die überall, ob am Eismeer oder unter Palmen am Schwarzen Meer, gleich aussahen, und zur selben Uhrzeit am Morgen in die Schulen eilen, und plötzlich wollte ich gerne wieder ein Kind wie damals sein, als Vater mich an meinem ersten Schultag zu der Blockhütte begleitete, die der Arbeitersiedlung, in die unsere Familie aus dem immer noch belagerten Leningrad evakuiert worden war, als Schulgebäude diente. Ich erinnerte mich, wie Vater mir mit der Hand durch das Haar strich und meinte, wenn ich brav sei und eine gute Schülerin würden, bekäme ich am Ende des Monats einen großen, roten Apfel. Einen Apfel? Ich wusste nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Apfel gegessen hatte, und dennoch sagte ich: »Ich werde sicher eine gute Schülerin werden, ganz sicher, das verspreche ich dir. Auch ohne Apfel!«
Der Traktorfahrer war am Morgen um einiges gesprächiger als am Abend. Während der ganzen Fahrt schimpfte er über die Organisation »dieser ganzen Sache«: Man liefere Traktoren, aber keine Ersatzteile, man habe Lastwagen in großer Zahl erhalten, aber keinen Treibstoff, seit zwei Jahren baue man Mais auf einem Gebiet an, das halb so groß wie die Ukraine sei, weil Chruschtschow davon überzeugt sei, vom heiligen Kukuruz hänge die Errettung der ganzen Menschheit vor Hunger und Not ab, aber man baue keine Straßen, um die Ernte abzutransportieren. Wäre Genosse Stalin noch am Leben, hätte er hart durchgegriffen und bald auf die bewährte Art alles in Ordnung gebracht, meinte der Fahrer.
»Schon möglich«, murmelte ich. »Kann sein.« Es gab Themen, bei denen man auf der sicheren Seite war, wenn man sich nicht festlegte.
Olga hatte mir nicht nur die von den Kommilitoninnen eingesammelten Briefe, sondern auch unzählige Ratschläge mit auf den Weg gegeben, doch kaum war ich abgefahren, hatte ich das meiste wieder vergessen – die Abschiedsworte von Olga, Rina und den anderen, Nataschas Weisheiten und Irinas lustige Geschichte über irgendeine Zugfahrt, über Kwas, Limonade und faschierte Laibchen, die genauso überflüssig und unpassend war wie Lisas vergeblicher Versuch, mich zu umarmen. Unglaublich, was sich manche Menschen für Freiheiten herausnehmen!, hatte ich gedacht, nachdem ich die lästige Person weggestoßen hatte.
Wie lange würde ich wohl bis nach Hause brauchen? Sechs Tage?
Als der Traktor nach einer holprigen Tour durch die schlammigen Felder im Bezirkszentrum ankam und über die einzigen asphaltierten hundert Meter im Radius von hundert Kilometern rollte, war es acht Uhr morgens. Das Dorf war erst vor wenigen Jahren entstanden und bestand aus zwei Straßen, zwei Dutzend aus Lehmziegeln erbauten Häusern sowie einem einzigen zweigeschossigen grauen Gebäude aus Stahlbeton mit Türen aus Metall, in dem sich die regionale Verwaltung, das Postamt, ein Laden und ein medizinischer Versorgungsposten befanden.
Mit dem Anruf zu Hause wollte ich noch eine Stunde warten. In Leningrad war es erst fünf Uhr, also fast noch mitten in der Nacht, und meine Mutter wachte üblicherweise um viertel vor sechs auf. Ich wischte notdürftig den Schlamm von meiner Jacke, der Hose und den Stiefeln ab, erledigte alle Formalitäten, meldete mich offiziell vom freiwilligen Ernteeinsatz ab, ließ einige alberne Witze und zweideutige Bemerkungen über mich ergehen, kommentierte diese nicht, erhielt ein Papier mit Stempel und Unterschrift, mein Taggeld für sechs Wochen und das Geld für die Rückreise, erkundigte mich nach einer baldigen Mitfahrgelegenheit zur Bahnstation (eine solche würde es am nächsten Tag, vielleicht aber auch schon an diesem Nachmittag geben, wurde mir versichert) und betrat schließlich das Postamt.
Das Postamt bestand aus einem kleinen Zimmer mit einem Pult, einem Schreibtisch, einem Schrank, einer Truhe, außerdem gab es eine in der Ecke neben der Tür stehende Posttasche, einen schwarzen Telefonapparat mit einer überdimensional groß wirkenden Wählscheibe, einem Fernschreiber und einen schwarzen Sessel mit hoher Lehne. In dem Sessel thronte Dascha, Darja Iwanowna Kuropatkina, die Leiterin und gleichzeitig einzige Angestellte des Postamts. Sie war eine blonde, füllige Frau undefinierbaren Alters, die ihren Pflichten mit würdevoller Selbstzufriedenheit nachging. Ihr dunkelblauer Uniformkittel war glattgebügelt, das Haar so fest hochtoupiert, als wäre es betoniert, ihr dicker Hals schob sich wie ein parfümierter Reifen zwischen Kragen und Kinn. Die wässrigen, blauen Augen schielten mich an, als blickten sie durch mich hindurch.
»Nummer!«, sagte sie, so feierlich, als würde sie zu einer Audienz bei der englischen Königin rufen.
Ich gab ihr die Leningrader Telefonnummer.
»Fünf Rubel!«
Ich reichte Dascha das Geld. Diese wählte die gewünschte Nummer, presste den Hörer an ihr rechtes Ohr, wartete, wartete, machte ein gelangweiltes Gesicht. So vergingen vier endlos lange Sekunden, in denen mein Herz im Hals und in den Schläfen pochte. Dascha reichte den Hörer schließlich langsam wie in Zeitlupe an mich weiter.
Julia, die Nachbarin, war am Apparat. »Hallo?« Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang verschlafen. Dumpf und in weiter Ferne war sie aber dennoch gut hörbar.
»Hallo Julia, Lina spricht«, sagte ich.
»Lina! Ach Linotschka, mein Gott!«, quietschte Julia und klang plötzlich hellwach und mindestens tausend Kilometer näher.
»Könntest du bitte …«
»Du willst mit Rosa Borisowna sprechen! Ich hole sie sofort.«
Ich hörte, wie Julia Rosa Borisowna rief, hörte nervöse Stimmen, klapperndes Geschirr, eine Tür, die zugeschlagen wurde, schweres Atmen, Knistern, einige Hintergrundgeräusche, die ich nicht zuordnen konnte, Schritte …
»Ja?!« Fast hätte ich die Stimme meiner Mutter nicht erkannt, so heiser, gehetzt und fremd klang sie.
»Rosa Borisowna, hier Lina. Ich habe dein Telegramm erhalten. Was ist los mit Chaim Abramowitsch? Ist er am Leben?«
»Lina? Lina! Ich kann dich leider sehr schlecht hören. Bitte komm, komm schnell! Fahr nach Hause!«
»Rosa Borisowna? Ich höre dich ausgezeichnet. Kannst du mir sagen, was los ist?!«
»Ich kann dich nicht hören. Die Verbindung ist so schlecht. Komm bitte. Fahr gleich los!«
»Rosa … Rosa?«, schrie ich in den Hörer. »Aufgelegt«, murmelte ich dann entgeistert. Warum hatte sie mich nicht hören können, warum hatte sie plötzlich aufgelegt? »Könnten Sie dort noch einmal anrufen?«, bat ich die Postbeamtin.
»Fünf Rubel!« Es klang noch getragener und förmlicher als zuvor – fast wie eine Urteilsverkündung bei Gericht.
Diesmal dauerte es sechs Sekunden, bis abgehoben wurde, doch dann konnte ich nicht mehr warten und riss Dascha den Hörer aus der Hand.
»Rosa Borisowna, bitte, bitte, sag mir nur, ob er noch lebt!«, schrie ich. »Was ist los?«
»Es tut mir leid, Linotschka, ich kann dich nicht hören. Die Verbindung ist katastrophal. Ich freue mich, dass du anrufst, erkenne deine Stimme, aber ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst. Bitte entschuldige. Hörst du mich?«
»Ja! Jedes Wort. Ich höre dich ausgezeichnet.«
»Komm nach Hause! Komm! Komm schnell!«, rief Rosa Borisowna, und bevor sie wieder auflegte, glaubte ich ein Schluchzen zu vernehmen. Vielleicht aber war das auch nur ein Rauschen in der Leitung oder das immer stärker werdende Pochen in meinen Schläfen.
4
Die eine Bahnstation sei zweiundneunzig Kilometer entfernt, eine andere, viel größere, hundertvierzehn Kilometer weit weg. Etwas näher gäbe es eine weitere Bahnlinie, die allerdings, wie mir von allen Menschen im Ort, mit denen ich sprach, versichert wurde, im Nirgendwo begann und irgendwo (niemand wusste, wo genau) endete, weshalb sie von vernünftigen Menschen nicht benützt wurde, obwohl dort angeblich regelmäßig Züge verkehrten. Allerdings waren die Straßen durch den Regen so aufgeweicht, dass keine Lastwagen, sondern nur bestimmte Traktoren mit besonders breiten Reifen und Kettenfahrzeuge unterwegs sein konnten, und diese fuhren keine neunzig Kilometer weit. Ich solle warten, hieß es, oder aber …
»Oder aber«, erklärte mir der Stellvertretende Direktor der Sowchose, den ich im Verwaltungsgebäude angetroffen hatte, »Sie fliegen mit Wanjka mit. Dann geht alles noch viel schneller.«
»Das ist eine gute Idee!«, pflichtete ihm seine Frau bei, ihres Zeichens Leiterin einer »sowchosinternen Kontrollbehörde«.
»Wanjka fliegt heute Nachmittag los, um Schädlingsbekämpfungsmittel zu versprühen«, erklärte die Frau. »In Perdilowo – das ist noch etwas weiter weg, Richtung Süden – muss er landen und auftanken und einiges abholen, bevor er zurückfliegt. Dort gibt es einen großen Bahnhof, weil an dieser Stelle zwei Bahnlinien aufeinandertreffen, und eine dritte in Planung ist.«
»Danke, Klarissa Matwejewna«, sagte ich. »Es wäre großartig, wenn ich mitfliegen könnte.«
»Kiril bringt Sie zum Außenposten Sieben, dort ist unser Flugplatz.«
»Eine richtig betonierte, ordentliche Trasse«, erklärte der Stellvertretende Direktor der Sowchose mit hörbarem Stolz in der Stimme. »Heute noch Flugplatz, morgen schon Flughafen. Außerdem entsteht dort gerade ein Dorf. Inzwischen gibt es bereits fünf Häuser!«
»Sechs!«, korrigierte ihn seine Frau.
»Gut, sechs. Und eine Straße.«
»Sie sollten nur Mund und Nase mit einem Taschentuch oder einem Kopftuch bedecken, wenn Sie mitfliegen«, meinte Klarissa Matwejewna. »Was Wanjka dort versprüht, ist pures Gift. Wenn er nicht so viel saufen würde, hätte ihn das Gift längst umgebracht. Aber die Alkoholmengen, die er zu sich nimmt, neutralisieren jede andere Substanz und töten alle Bazillen.«
»Vor allem dieser selbstgebrannte Fusel, den er in sich hineinschüttet. So etwas trinke nicht einmal ich«, meinte ihr Mann.
»Manchmal kommt es mir vor, als würde er auch das Kerosin trinken, mit dem sein Flugzeug betankt wird.«
»Jaaa«, murmelte der Stellvertretende Direktor nachdenklich, während er seine Pfeife stopfte. »Als Wanjka aus dem Krieg zurückkam, war er nicht mehr derselbe wie früher. Jähzornig, unberechenbar. Das ist er sogar, wenn er nüchtern ist. Was allerdings sehr selten der Fall ist. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Fräulein, fliegen kann er noch, auch wenn er ein Säufer ist und nur mehr ein Auge hat.«
Der Außenposten Sieben befand sich sieben Kilometer vom zentralen Ort der Sowchose entfernt. Auf meine Frage, wie viele weitere Außenposten es gebe, und ob denn der Außenposten Acht acht und der Außenposten Sechs sechs Kilometer vom Ort entfernt sei, erhielt ich keine Antwort. Kiril, ein Neffe von Klarissa Matwejewna, erwies sich als mürrischer Zeitgenosse. Der junge Mann runzelte die Stirn, umklammerte das Lenkrad, als würde er sich daran festhalten, und bemühte sich sehr, mich nicht anzuschauen. Sein rundes Gesicht wurde feuerrot, auf der Stirn perlte der Schweiß, obwohl es an diesem herbstlich anmutenden Augusttag alles andere als heiß war, und sein imposanter Bauch drückte von unten gegen das Lenkrad, sodass er den Atem anhalten und den Bauch einziehen musste, wenn er das Lenkrad drehte.
»Was macht eigentlich die sowchoseigene Kontrollbehörde?«, fragte ich.
»Sie kontrolliert«, antwortete Kiril trocken.
»Wen denn?«
»Den Direktor der Sowchose, seinen Stellvertreter, die Leiterin des Post- und Telegrafenamtes, die Lehrerin, die ehemaligen Strafgefangenen, die hier in der Verbannung leben, und alle anderen auch.«
»Klarissa Matwejewna kontrolliert ihren eigenen Mann?«
»Na und? Bist du etwa gegen die Sowjetmacht?«, fragte er herausfordernd.
»Nein.«
»Die Sowjetmacht weiß immer, was richtig ist und was sie zu tun hat«, knurrte er.
Daraufhin schwiegen wir beide einige Minuten. Ich versuchte, auf der ausgedorrten und dann vom Regen aufgeweichten Steppe die Trasse auszumachen, auf der wir unterwegs waren, konnte aber nichts erkennen. Trotzdem schien Kiril genau zu wissen, wohin er fuhr.
»Wieso ist der Flughafen so weit vom Ort entfernt?«, fragte ich. »Ganze sieben Kilometer!«
»Frag nicht so viel«, brummte der Bursche. »Eine Henne hat eines Tages zu viel geredet, gegackert und viel gefragt, gefragt, nachgefragt und landete schließlich im Suppentopf.«
»Du bist aber freundlich«, meinte ich und lachte.
»Ich bin überhaupt nicht freundlich«, zischte er.
»Das war ironisch gemeint.«
»Was?«
»Ironie!«
Nun drehte er den Kopf zu mir und schaute mich ernst an.
»Vergiss es wieder«, murmelte ich, zuckte mit den Schultern und drehte meinerseits den Kopf zur Seite, um dem durchdringenden Blick des jungen Mannes zu entgehen. »Bring mich einfach nur rechtzeitig zum Flugplatz. Ich werde schweigen.«
Während wir auf dem Rest des Weges schwiegen, betrachtete ich wieder die Landschaft und sah – nichts. Hier wuchs nirgends ein Baum oder ein Strauch. Es gab keine Bodenerhebungen oder Gräben, keine Tümpel, keine Felsen, keine Wege, keine Behausungen oder irgendwelche Markierungen und Wegweiser – nur Schlamm, der langsam trocken wurde und sich in eine schorfartige, hässliche Kruste verwandelte, und braungelbes Gestrüpp bis zum Horizont. Die Erde, ob Feld oder Steppenwiese, war von der Sonne verbrannt worden. Ob hier etwas gesät und geerntet worden war, konnte ich nicht erkennen. Ich fragte mich, wo, warum und gegen wen hier überhaupt Gift versprüht werden sollte, doch traute ich mich nicht, meinen Fahrer ein weiteres Mal mit Fragen zu belästigen.
Ich war erschöpft und saß gleichzeitig wie auf Nadeln. Wann, fragte ich mich, wann erreichen wir endlich dieses armselige Flugfeld, wo ein betrunkener, einäugiger Kriegsveteran in einem kontaminierten Flugzeug auf mich wartete. Ich schloss die Augen, doch änderte dies nichts an meiner Aufgeregtheit und Verstörung, die viel stärker waren als mein Erschöpfungszustand. Wieder suchte ich in meiner Erinnerung nach einem Bild meines Vaters, an dem ich mich festhalten konnte. Als er mir schließlich erschien, drehte er mir aber sogleich den Rücken zu. Scharf und klar erstanden vor meinem geistigen Auge seine Glatze, die abstehenden Ohren, die Muttermale auf seinem Kopf, der abgewetzte Kragen seiner blauen Jacke und die beigefarbenen Bügel seiner Brille. Doch sobald ich versuchte, ihn an den Schultern zu packen und umzudrehen, um sein Gesicht sehen zu können, entzog er sich mir mit raschen, geschickten Bewegungen, so flink, wie er im wirklichen Leben niemals gewesen war.
Ich habe keine Angst vor dem Fliegen, erzählte ich dem Rücken meines Vaters. Technik hat mir nie Angst eingejagt, solange es sich nicht um Militärtechnik handelte. Wenn es mein Schicksal ist, mit einem Flugzeug abzustürzen, werde ich nicht ertrinken. Und umgekehrt.
Mit solchen Phrasen hast du mich schon als kleines Mädchen zur Weißglut gebracht, bemerkte mein Vater. Seine Stimme klang traurig, seltsam tief, dumpf und verzerrt. Es schien, als komme sie aus seinen Ohren oder seinem Nacken.
Wieso hast du denn nie etwas gesagt, wenn du dich über mich geärgert hast?, fragte ich.
Was hätte ich denn sagen sollen? Sei nicht so altklug und verschone mich mit Weisheiten, die ohnehin jeder weiß.
Ja, das hättest du sagen sollen. Vielleicht hätte auch ein beherztes »Ach, halt doch die Klappe!« gereicht.
Ich bin ein guter Vater, aber ich war ein lausiger Erzieher. Das weißt du doch. Ich halte mich stets zurück. Ich habe deinen Bruder ein einziges Mal in meinem Leben geschlagen – eine sanfte Ohrfeige, mehr symbolisch als schmerzvoll. Damals war er fünf Jahre alt; du warst noch nicht auf der Welt. Kurz darauf lag ich im Schockzustand mit Krämpfen und Atemnot auf dem Boden, der Notarzt musste kommen. Mein kleiner Sohn hat geweint und immer wieder gesagt: »Aber Papa, es hat doch überhaupt nicht wehgetan, es geht mir gut!«
Ich kenne die Geschichte.
Sogar unsere Bürokatze hat ihre Jungen nicht irgendwo, hörte ich die Stimme meines Vaters weitersprechen, sondern ausgerechnet unter meinem Schreibtisch zur Welt gebracht, weil ich sie im Unterschied zu den anderen im Büro nie angefasst habe, sondern immer gewähren ließ bei allem, was sie tat. Tiere verdienen unseren Respekt. Mehr als so manche Menschen.
Ich weiß. Ich hätte mir nur manchmal gewünscht …
Niemand kann aus seiner Haut heraus, sagte er.
Verschone du mich mit solchen Weisheiten!, erklärte ich und lachte. Wer von uns beiden ist denn nun der Sprücheklopfer?
»Fünf Minuten noch!«, verkündete Kiril plötzlich. »Vielleicht auch vier oder sechs.«
Ich öffnete wieder die Augen, schaute mich um und erspähte in der Ferne einige Bodenerhebungen, die auf den ersten Blick wie Grabhügel aussahen. Erst bei genauerem Hinsehen erkannte ich, dass es sich um eingeschossige Häuser handelte, deren Farbe sich kaum von jener der sie umgebenden Steppe unterschied.
»Und der Flugplatz?«, fragte ich.
Der Fahrer wies schweigend mit dem ausgestreckten Zeigefinger der linken Hand in eine bestimmte Richtung, ohne selbst hinzuschauen. Es dauerte ein wenig, bevor ich dort etwas erkennen konnte, weil ich in die Sonne schauen und die Augen zusammenkneifen musste, doch schließlich sah ich es – das Flugzeug: eine Doppeldeckermaschine mit einfachem Propeller und einem gut sichtbaren, roten Stern auf dem Heckruder. Der Stern war das Erste, was ich sah. Es schien, als würde er langsam über der Erde dahinschweben, und erst einige Augenblicke später verstand ich, dass der Stern zu einem hellgrauen Flugzeug gehörte, welches vom gleißenden Sonnenlicht eingehüllt war und dadurch beinahe unsichtbar schien. Als ich es schließlich ausmachen konnte, wurde mir bewusst, dass es sich bewegte, dass es sich mit zunehmender Geschwindigkeit entfernte und nicht mehr einzuholen war. Kiril drückte aufs Gas und begann unflätig zu schimpfen, erwähnte dabei die Mutter und den Vater des Piloten, dessen Geschwister, Onkel, Tanten und Haustiere; als er bei Wanjkas Großmutter angelangt war, hob die Maschine ab, flog knatternd dem Licht der Sonne entgegen, bis sie in einer dichten Wolke aus dunklen Abgasen und dem langsam aufziehenden, die gesamte Landschaft einhüllenden Nachmittagsnebel verschwand.
Dass wir das Flugzeug um wenige Minuten verpasst hatten, war ärgerlich, denn die Maschine sollte, so Kiril, erst in ein paar Tagen wieder zurückkommen und nicht so bald zu einem nächsten Flug starten. Es konnte zudem nicht verhindert werden, dass sich Wanjka zwischen den Flügen besoff und danach seinen Rausch ausschlafen musste, bevor er wieder einsatzfähig war.
»Nun bleibt dir nichts anderes übrig, als auf einen Lastwagen und eine Mitfahrgelegenheit zu warten«, meinte Kiril mürrisch. »Ich kann’s leider auch nicht ändern.«
»Wann wird das sein?«, fragte ich.
»Übermorgen. Morgen. Vielleicht auch in einer Woche. Oder noch später. Keine Ahnung. Frag die Leute hier. Irgendwann fährt sicher ein Lastwagen zur Bahnstation. Früher oder später.«
Das Wort »irgendwann« bereitete mir Sorgen, die Worte »früher oder später« noch mehr, aber ich hatte keine andere Wahl, als mich mit meinem gesamten Gepäck ins Dorf zu begeben.
Der Stellvertretende Direktor der Sowchose und seine Frau hatten sich geirrt. Das Dorf bestand bereits aus sieben eingeschossigen Häusern und einer Straße, die – wenig überraschend – den Namen Lenins trug. Ein achtes Haus wurde gerade gebaut. Als Baumaterial diente Lehm, der mit Stroh vermischt, geglättet, in Quadrate – Ziegel – geschnitten und in der Sonne getrocknet wurde. Mischen und Schneiden waren harte Arbeit, der Bau des Hauses ohne Baumaschinen eine noch härtere. Jemand fragte mich, ob ich bei den Bauarbeiten mithelfen könnte, und ich willigte sofort ein. Bis mich ein Lastwagen zu einem der nächsten Außenposten der Sowchose und damit zwanzig Kilometer näher an die Bahnstation heranbringen würde, sollten, so versicherte man mir, noch ein oder zwei Tage vergehen. Anderen Menschen beim Arbeiten zuzuschauen, selbst aber müßig zu bleiben, war noch nie meine Art gewesen und würde es auch nie sein.
Eine alte Frau namens Aglaja bot mir eine Ecke im großen Zimmer ihres Hauses an. Man gab mir Stroh, das ich in meinen Matratzen- und den Kissenüberzug stopfte, und eine Steppdecke für die Nacht, von der es hieß, dass sie diesmal besonders kalt sein werde. Aglaja und ihr Mann schliefen auf dem Ofen, ihr Sohn und die Schwiegertochter im Doppelbett, deren Tochter gleich daneben im Kinderbett und ich in meiner Ecke. Noch bevor die Petroleumlampe gelöscht wurde, war ich eingeschlafen.
Als ich aufwachte, waren alle längst auf den Beinen. Während ich zusammen mit einer anderen jungen Frau die fertig getrockneten Ziegel in einer Schubkarre zur Baustelle beförderte, erfuhr ich, dass die Bewohner des Orts eine Art internationale Brigade bildeten. Hier lebten eine russische und eine kasachische Familie, ein »Bandera-Bandit« aus der Westukraine, der 1946 hierher deportiert worden war, eine verwitwete Koreanerin in mittleren Jahren, deren Deportation schon 1937 erfolgt war, als Stalin alle russischen Koreaner aus ihrer Heimat am Stillen Ozean vertrieben und nach Mittelasien verfrachtet hatte, ein deportiertes wolgadeutsches Geschwisterpaar und ein Burjate, der nach Lagerhaft und Verbannung gerade erst rehabilitiert worden war. »Na, siehst du«, sagte die junge Frau, »jetzt haben wir hier sogar eine Jüdin – die reinste Völkerfreundschaft!«
»Und was bist du?«, fragte ich.
»Ich bin ein Waisenkind, ich war immer schon hier, und niemand weiß, wer meine Eltern waren, woher sie stammten und wer ich bin. Ist das nicht toll?«
»Nein«, murmelte ich.
»Doch!«, widersprach sie. »Ich bin sowjetisch. Nur sowjetisch und nichts weiter. Ich habe keine Vergangenheit. Ich bin der neue Sowjetmensch.«
Mir war nicht ganz klar, ob sie das scherzhaft oder ernst meinte.
Das kasachische Ehepaar und seine Kinder hatten noch nie einen Juden gesehen. Als sie erfuhren, dass ich Jüdin bin, wollten sie das zuerst nicht glauben. »Aber Juden sind doch dunkelhaarig und haben lange Nasen!«, meinte die Frau erstaunt.
»Das ist ein Klischee«, erklärte ich.
»Wieso? Es ist doch kein Klischee, dass Kasachen Schlitzaugen haben«, meinte das älteste der vier Kasachenkinder. »Wieso soll es dann ein Klischee sein, dass Juden lange Nasen haben und geizig sind?«
»Aber es gibt Kasachen, die schlitzigere Augen haben als andere«, bemerkte ein anderes Kasachenkind. »Und bei manchen muss man schon genau hinschauen, um überhaupt etwas zu erkennen.«
»Ja und? Es gibt sicher auch geizige und weniger geizige Juden. Wesentlich ist, dass sie nun einmal geiziger sind als Nichtjuden.«
»Geizige Menschen gibt es unter allen Völkern, überall«, erklärte ich mit einem pädagogischen Tonfall in der Stimme, der mir selbst sogleich albern vorkam. »Juden sind nicht anders als andere Leute.«
»Wir sind nicht geizig!«, verkündete ein drittes Kasachenkind stolz. »Wir nicht.«
»Wir haben ja auch wenig zu verlieren und noch weniger festzuhalten«, meinte seine Mutter. »Wenn ich wenigstens einen Esel hätte, würde ich mich glücklich schätzen.«
»Stattdessen hast du uns«, meinte ihr Mann. Alle lachten, und das »jüdische Thema« wurde nicht wieder aufgegriffen.
Nach zwei intensiven Sonnentagen war die Erde trockener geworden. Ein Lastwagen, der die Sowchose von Ost nach West und wieder zurück durchquerte und gleichermaßen Menschen, Tiere und Waren beförderte, brachte mich nach zwei Übernachtungen im Außenposten Sieben zum nächsten Dorf. Dort sollte ich auf die nächste Mitfahrgelegenheit warten. Die Bahnstation war von hier nur mehr sechzig Kilometer entfernt.
Das Dorf bestand aus einem gut sieben Meter hohen Getreidesilo aus schmutzig grauem Beton, einem Brunnen, einer Sickergrube, einer Rampe, einigen Maschinen und Geräten zum Entladen und Beladen von Lastwagen, einem kleinen, mit Kerosin betriebenen Dynamo, einem Gemüsegarten, einem Kaninchenstall mit ein paar Dutzend Tieren, drei Ziegen und zwei Häusern. In einem davon wohnte ein alter kasachischer Agronom (jedenfalls behauptete er, ein solcher zu