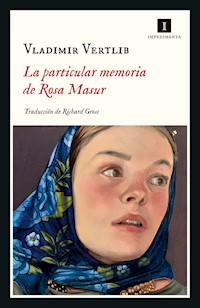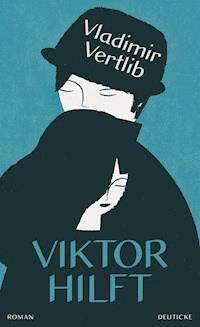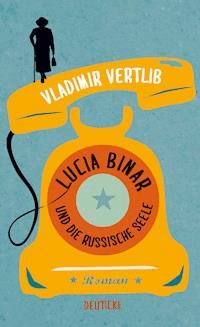
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucia Binar ist 83, und sie ist verärgert. Die Große Mohrengasse, in der sie seit langem lebt, soll aus Gründen der politischen Korrektheit in "Große Möhrengasse" umgetauft werden. Und die soziale Einrichtung, die sie versorgt, hat versagt: Ihr Essen wurde nicht geliefert. Der Telefondienst ist in ein Callcenter ausgelagert, dort rät ihr eine Mitarbeiterin, sich von Manner-Schnitten zu ernähren. Lucia ist empört. Sie will die Frau aufsuchen und zur Rede stellen. Dabei hilft ihr ausgerechnet Moritz, ein Student, der die "Anti-Rassismus-Initiative Große Möhrengasse" unterstützt. Mit viel Humor erzählt Vladimir Vertlib die Geschichte einer alten Dame, die entschlossen ist, ihre Würde zu bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke E-Book
Vladimir Vertlib
LUCIA BINARUND DIERUSSISCHESEELE
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06286-3
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2015
Umschlag: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Fotos: © Fiedels – Fotolia.com (Telefon) und © majivecka – Fotolia.com (Frau)
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf
www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Will all great Neptune’s ocean wash this blood
Clean from my hand? No, this my hand will rather
The multitudinous seas incarnadine,
Making the green one red.
WILLIAM SHAKESPEARE, MACBETH, ACT II, SCENE II
Nicht loszumachen ist das unvertäute Boot,
Des Schattens Schuh und Schritt – nicht zu erlauschen,
Die Angst im Lebensdickicht hier – nicht zu bezwingen.
OSSIP MANDELSTAM, AUS MEINEN HÄNDEN
(DEUTSCH VON PAUL CELAN)
[…]
aber ich wollt ich wär
ein Rad
und das könnte durch eine
leichte Kinderhand geschoben
seine gute Rolle spielen
ZEHRA ÇIRAK, GELENK1
TEIL 1
IM MÄRZ
1
Wenn ich jetzt sterbe, dann kann ich damit leben. Was mir früher die Sicht auf den Tod verstellte, habe ich längst umgangen oder aus dem Weg geräumt. Mein innerer Frieden wäre ein Hort der Langeweile, wenn ich nicht gelernt hätte, Langeweile ab und zu als Zufriedenheit wahrzunehmen. Das ist in meinem Alter ein Privileg. Demzufolge kann ich nicht behaupten, dass ich sterben möchte, auch wenn ich mit mir selbst im Reinen und für die letzte Reise gerüstet bin. Doch bevor es so weit ist, würde ich gerne wieder die Kraft haben, auf die Leiter zu steigen, um aus dem obersten Bücherregal Wisława Szymborskas Gedichtband Hundert Freuden2 herauszuholen und es auf Seite 102 aufzuschlagen.
Das Nichts hat sich umgenichtet, auch für mich. Es drehte sich tatsächlich auf die andere Seite …
Früher berührte mich das Wort »Umnichtung«, und ich versuchte, mir die Umnichtung des Nichts bildlich vorzustellen. Heute habe ich das Gefühl, als ob ich selbst schon auf einer der vielen anderen Seiten wäre, die wir in jungen und mittleren Jahren immer mit anderen Menschen in Verbindung bringen.
Wo bin ich nur hingeraten – Kopf und Fuß in Planeten, unbegreiflich, dass ich einmal nicht da sein könnte …
Ich kenne das Gedicht auswendig. Manchmal stelle ich ein paar Worte um oder lasse eine Zeile aus. Gute Lyrik ist immer anpassungsfähig. Was ich vermisse, ist die Sinnlichkeit jener Augenblicke, in denen ich mit dem Zeigefinger der rechten Hand über die Seite streiche, umblättere, ein Lesezeichen suche, das Buch schließe, weglege, wieder aufschlage, wie beiläufig von Zeile zu Zeile springe und wie immer an dem Satz Gestirnt aufs Geratewohl! hängen bleibe. Dafür lohnt es sich, wieder gesund zu werden.
Der Arzt meinte, dass es mindestens drei Wochen dauern wird, bis ich aus dem Haus gehen darf. Als ich von ihm wissen wollte, wann ich wieder auf die Leiter steigen kann, um an die Bücher der beiden oberen Regale zu gelangen, runzelte er die Stirn und sagte: »Ach, wissen Sie, gnädige Frau, in Ihrem Alter …« Der Rest des Satzes blieb in seinem grauen Bart hängen. Ich fragte noch einmal nach, aber er gab mir keine Antwort.
Vor meinem Unfall blieb Szymborska oft wochenlang unberührt, so lange, bis ich auf die Idee kam, die Bücher abzustauben und die Spinnweben zu entfernen. Dann fiel mein Blick wieder auf den erwähnten Gedichtband, und wenn ich in der entsprechenden melancholischen Stimmung war, genoss ich jene Augenblicke, die ich heute so schmerzlich vermisse. Seit dem Unfall starre ich unentwegt nach oben und zähle die Tage, bis Karla von ihrer Kur zurückkommt. Dann steigt Szymborska in Begleitung von Jan Skácels Wundklee und Joseph Brodskys Hügeln hinunter zu mir und auf einen Ehrenplatz am rechten Rand des Sofas, griff- und blätterbereit, Wegbegleiter in der Not, Freunde auch in besseren Zeiten.
Mein Sprachhunger ist stärker als das Verlangen, mir etwas Substanzielleres als Gedichte zuzuführen. Am Tag vor ihrer Abreise hat Karla den Kühlschrank und die Küchenregale vollgeräumt, doch fühle ich mich außerstande, etwas zu kochen.
Ich bin nicht anspruchsvoll. Zur Not könnte ich mich tagelang von trockenem Brot oder Snacks, die es in den großen Abfütterungsketten wie McDonald’s zu kaufen gibt, ernähren. Es gibt kaum etwas, das ich abstoßend finde. Was andere Menschen anwidert, ist mir gleichgültig. Die sechs fabriksmäßig in eine luftdichte, durchsichtige Plastikfolie verpackten Äpfel, die mir Karla vorbeibrachte und auf den Wohnzimmertisch legte, bevor sie nach Badgastein aufbrach, rühre ich jedoch nicht an, weil diese Äpfel nach einer Woche noch genauso giftgrün aussehen wie am ersten Tag. Ein solches Wunderprodukt möchte ich meinem schwachen Magen nicht zumuten.
Karla ist eine ehemalige Arbeitskollegin, die erst vor wenigen Jahren die privilegierte Position meiner besten Freundin eingenommen hatte, weil sowohl meine als auch ihre Freundinnen eine nach der anderen gestorben waren. In meinen mittleren Jahren fürchtete ich manchmal die Einsamkeit des Alters und machte mir Gedanken, wie ich dieser vorbeugen könnte. Dann ist vieles von dem eingetreten, wovor ich mich gefürchtet hatte, und ich war zu sehr mit der Bewältigung dieser Schicksalsschläge beschäftigt, um darüber zu grübeln, ob ich einsam war oder nicht.
Während ich über Szymborska und das Essen nachdenke und darüber, was Szymborska wohl gegessen hatte, bevor, während oder nachdem sie ihre Gedichte schrieb, läutet es an meiner Tür. Endlich! Das Mittagessen hätte zwischen halb eins und eins geliefert werden sollen. Inzwischen ist es drei viertel drei. Ich werde die beiden jungen Herren, mit deren Arbeit und Umgangsformen ich bis jetzt sehr zufrieden war, diesmal rügen müssen. Zwei oder drei freundliche, aber deutliche Sätze. Die beiden sind sympathisch, auch wenn sie immer so unter Stress sind, dass ich es niemals wagen würde, sie zu bitten, mir das Szymborska-Buch vom Regal herunterzuholen. Der eine heißt Selim, der andere Erwin oder Erich. Wenn sie eine halbe Stunde zu spät kommen, macht mir das nichts aus, doch eine Verspätung von zwei Stunden kann ich nicht tolerieren. Schon in jungen Jahren war ich davon überzeugt, dass wir im Leben den Rollen, die wir spielen, gerecht werden müssen, und wenn wir einmal aus der Rolle fallen, so muss es sich auch hierbei um eine überlegte und glaubwürdige Inszenierung handeln.
Die beiden Burschen tragen alberne weiße Jacken mit gelben Knöpfen, die auf den ersten Blick vergoldet aussehen, Stehkragen, in die stilisierte Kronen gestickt sind, und Schulterblätter mit goldenen Sternen und Streifen, so als wären sie Offiziere der amerikanischen Marine: viel Aufwand, um einer von der Stadt Wien geförderten Sozialeinrichtung den Anstrich eines noblen Catering-Services zu geben. Wenn man mir diesen Hauch von Noblesse vorzugaukeln versucht, erwarte ich zumindest Pünktlichkeit.
Der Klingelton wird länger, insistierender. Das ärgert mich. Die beiden Knaben wissen doch, dass ich kaum gehen kann. Glauben sie, ich bin immer noch jung und dynamisch wie mit sechzig? Szymborska schrieb kurz vor ihrem Tod ein Gedicht über eine altersschwache Schildkröte, die davon träumt, tanzen zu können: Als sie endlich das Risiko eingeht, ein paar Tanzschritte zu machen, und sich übermütig im Kreis dreht, rollt sie auf den Rücken und kann sich nicht mehr bewegen. Wie hieß das Gedicht doch gleich?
Ich bin froh, dass im Vorzimmer immer noch die Kommode steht, an der ich mich abstützen kann. Was für ein Tanz!
Vier kurze Klingeltöne, dann ein langer und wieder ein kurzer.
Oder war es nicht von Szymborska? Manchmal kommt es mir vor, als hätten die Würmer längst Löcher in mein Gehirn gefressen.
Wenn ich wenigstens noch die Kontrolle über meinen Körper hätte, aber mein linker Fuß macht gegen meinen Willen eine halbe Drehung nach rechts, die Finger verkrampfen sich, während ich mich damit abmühe, die Sicherheitskette zu lösen, und wenn ich versuche, den Kopf zu drehen, ist es, als ob mir jemand mit einem Holzknüppel gegen den Hinterkopf schlagen würde. Die Schmerzen, die ich an jenem sonnigen Februarmorgen erlitten hatte, waren harmlos im Vergleich zu dem Preis, den ich tagtäglich zu zahlen habe, um mein Sichtfeld zu erweitern.
Oder war es Urszula Kozioł, die das Gedicht geschrieben hat? Ich weiß es nicht.
»Ja, Himmelherrgott! Ich kann nicht schneller!«
Vielleicht sogar Ewa Lipska. Der ist alles zuzutrauen.
Vor fünfzig Jahren war ich genauso ungeduldig. Wie sehr mir doch die alten Leute auf die Nerven gingen, wenn ich zur Straßenbahnhaltestelle hastete, eine enge Treppe hinauf- oder hinunterlief oder meine Großtante in der Czerningasse besuchte und fünf Minuten gegen die Tür hämmern musste, bevor sie mir öffnete.
»Entschuldigen Sie bitte die Störung, Frau Binar …«
Eine junge Person. Höchstens zwanzig.
Es ist wirklich ein Skandal, dass die beiden uniformierten Jünglinge immer noch nicht da sind.
»Es geht um eine Unterschrift …«
Das Gesicht der jungen Frau kommt mir bekannt vor. Wahrscheinlich bin ich ihr irgendwann im Treppenhaus begegnet.
»Entschuldigen Sie, kennen wir uns?«
»Oh, Verzeihung, ich heiße Hasler, Entschuldigung, ich wollte …«
»Dafür brauchen Sie sich doch nicht zu entschuldigen. Sie können ja nichts dafür, dass Sie Hasler heißen.«
»Äääh, nein …« Ein verlegenes Lächeln, rührend – rote Ohrenspitzen und ein Blick, der abgleitet und erst an meinen Hausschuhen zur Ruhe kommt.
»Ich wohne auf Nummer sechs A.«
»Seit wann gibt’s dort ein A im Mezzanin?«
»Äääh … Da müsste man den Vermieter fragen. Als ich eingezogen bin …«
»Lassen Sie nur, so wichtig ist das auch wieder nicht.«
Nein, keine zwanzig, achtzehn, höchstens neunzehn – zierlich, schmal, fast ätherisch. Eine angenehme Stimme: dieser samtweiche, etwas getragene Unterton. Ihrer Aussprache nach zu schließen kommt sie nicht aus Wien, sondern aus dem Westen, allerdings nicht aus dem fernen Westen, also nicht aus Tirol oder Vorarlberg oder dem Pinzgau, sondern wahrscheinlich aus Oberösterreich. Oder ist sie keine Sie, sondern ein Er? Solche Jeans und weiten Pullover tragen Burschen wie Mädchen, und auch der kurze Haarschnitt sagt nichts über das Geschlecht aus. Ihr (oder sein) Gesicht, Haare, Körper verschwimmen vor meinen Augen. Vielleicht erscheinen mir deshalb alle Konturen noch weicher, als sie sind, und so bleibt das blondblauäugige Wesen für mich oberösterreichisch androgyn. Mehr kann ich nicht erkennen, meine Brille liegt auf dem Nachtkästchen, weil ich in den letzten Tagen zwar viel über Szymborska-Gedichte nachgedacht, aber nichts gelesen habe.
»Was soll ich unterschreiben?«, frage ich. »Wenn es um die Obdachlosen geht, die seit neuestem vor unserem Haus herumlungern …«
»Ich bin Mitglied des Vereins Straßennamen gegen Rassismus«, unterbricht mich das Wesen. »Wir haben eine Petition verfasst, in der auch unsere Straße als eine umzubenennende gelistet ist.«
»Als eine umzubenennende gelistet«, wiederhole ich und lache. »Ich als wahrscheinlich bald Abzulebende habe kein Problem mit dem Namen unserer Gasse, so wie ich in den letzten acht Jahrzehnten kein Problem damit hatte. Außerdem ist es mir noch nie untergekommen, dass Straßennamen gegen den Rassismus protestieren, geschweige denn sich in einem Verein organisiert hätten. Das klingt für mich wie der Verein Katzen gegen Kastration.«
»Aber es ist doch ein Affront gegenüber unseren dunkelhäutigen Mitbürgern, wenn Bezeichnungen wie Große Mohrengasse weiterhin wie selbstverständlich …«
»Warum soll die Große Mohrengasse ein Affront sein?«, unterbreche ich. »Das ganze vorige Jahrhundert hieß sie so, auch als hier noch hauptsächlich unsere jüdischen Mitbürger gewohnt haben. Als Kind habe ich erlebt, wie sie entbürgert worden sind. Man hat sie hier, in dieser Gasse, zusammengepfercht und später deportiert. Zuerst waren sie keine Mitbürger und dann keine Menschen mehr. Haben Sie die Steine der Erinnerung vor dem Eingang zu unserem Haus gesehen?«
»Ja, natürlich, aber …«
»Aber was? Sollen wir jetzt alle Judengassen umbenennen? Und alle Straßen, die nach Antisemiten benannt worden sind? Oder alle Straßen und Plätze, die nicht mehr politisch korrekt klingen? Irgendwann bleiben nur mehr Straßen mit Tier- und Blumennamen übrig.«
»Das ist ein sehr komplexes Thema. Einiges wurde ja in den letzten Jahren tatsächlich umbenannt. Der Dr.-Karl-Lueger-Ring zum Beispiel heißt jetzt Universitätsring. Das Ganze ist in wenigen Sätzen schwer zu erklären. Es ist … kompliziert.«
»Kommen Sie mir nicht mit diesem Sinowatz-Zitat.«
»Was für ein Zitat?«
»Ach, oje. Vergessen Sie’s. Sie haben recht: Alles ist kompliziert, wenn man es verkompliziert.«
»Wir dachten eigentlich nur, dass der Ausdruck Mohr, ähnlich wie der Ausdruck Neger …«
»Wie sollte unsere Gasse denn Ihrer Meinung nach heißen? Große Afroösterreichergasse? Oder – besser noch – Straße des Großen Schwarzen? Dann würden wir hier alle miteinander ein Kaffeehaus eröffnen.«
Sie – es wird wohl doch eine Sie sein – schmollt, spitzt die Lippen, schüttelt den Kopf. »Ich hoffe, dass ich niemals so zynisch werde«, murmelt sie.
»Man soll die Hoffnung niemals aufgeben.«
»Es ist doch nur eine symbolische Geste. Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.«
»Schon gut, ich verstehe. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Was ist Ihr Vorschlag? Nelson-Mandela-Gasse?«
»Es gibt mehrere Vorschläge, sie sind alle in unserer Petition nachzulesen.«
»Übrigens sind die Kaffee-Bezeichnungen Großer und Kleiner Schwarzer oder Brauner gemäß Ihrer Vorstellung sicher auch nicht mehr tragbar, weil diskriminierend.«
Diese Bemerkung ignoriert sie und sagt: »Die Benennung nach Nelson Mandela ist eine der Möglichkeiten, die wir befürworten.«
»Fein, dass Sie das befürworten. Nelson Mandela hätte das sicher zu schätzen gewusst.«
»Einige Bewohner unserer Gasse sind der Stadtverwaltung übrigens zuvorgekommen und haben Freundinnen, Bekannte und Kolleginnen gebeten, Briefe oder Pakete nicht mehr an die Große Mohrengasse zu adressieren …«
»Sondern?«
»An die Große Möhrengasse. Mit ö. Die Post stellt es trotzdem korrekt zu.«
»Große Möö – h – ren – gasse!?«
»Genau!«
»Oooch …«
»Frau Binar? Frau Binar!!! Ist Ihnen nicht wohl? Soll ich Ihnen helfen?«
»Nein, nein«, sage ich und wische mir die Tränen aus den Augen. »Es geht schon.«
Seit mehreren Monaten habe ich nicht mehr so gelacht, und während ich lache, werden die Schmerzen unerträglich, es wird mir schwarz vor den Augen, die Gangfenster, die auf den Innenhof gehen, werden enger, der Fußboden kippt weg, die Decke kommt auf mich zu, und ich kann mich nicht mehr halten vor Lachen, so als hätten sich die Schmerzen im Nacken und im Kopf und der Schmerz der letzten Jahre in diesem Lachen verdichtet, aber nach kurzer Zeit fühle ich mich plötzlich leicht und frei, und als ich wieder zu mir komme, liege ich auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer und spüre eine Hand über meine Wange streichen und gleich darauf die sanfte Berührung der Fingerkuppen auf meiner Stirn.
»Frau Binar! Soll ich jemanden rufen?«
»Es gibt niemanden«, sage ich und wundere mich, dass ich es so schnell bis ins Wohnzimmer geschafft habe, dass ich mich an die letzten Sekunden (oder waren es Minuten?) nicht erinnern kann und dass ich mich auf einmal, obwohl ich seit Stunden nichts gegessen habe, kräftiger fühle als zuvor. Das Mädchen wird mich gestützt, aber sicherlich nicht getragen haben. Sie kann sich ja kaum selbst tragen.
»Wollen Sie nun unterschreiben?« Ihre Stimme ist nicht mehr so freundlich wie zuvor. Sie hält mir ein eng bedrucktes Blatt Papier vors Gesicht, doch ohne Brille kann ich kein Wort lesen.
»Ganz bestimmt nicht. Ich mag keine Karotten, besonders dann nicht, wenn sie Möhren heißen. Aber Sie könnten mir ein Glas Wasser bringen.«
»Ich muss weiter.«
»Nur ein Glas Wasser! Wenn Sie so freundlich wären.«
»Gut, aber dann …«
»Die linke Tür. Die Gläser stehen im Regal direkt über dem Waschbecken.«
Sie geht in die Küche. Es fällt mir auf, dass sie zu jenen Menschen gehört, die Karla als »figurlos« bezeichnet. Das erkenne ich auch ohne Brille. Von den Schultern bis zu den Hüften könnte man gerade Linien ziehen. Einzig die Tatsache, dass sie so dünn ist, lässt sie apart erscheinen.
Ich höre, wie etwas auf den Boden fällt. Sie dürfte den leeren Topf, der seit Tagen auf der Ablage neben dem Herd stand, umgeworfen haben.
Wenn ich etwas freundlicher zu ihr gewesen wäre, hätte ich sie bitten können, auf die Leiter zu steigen und mir Szymborskas Gedichtband herunterzuholen, und wenn ich von Anfang an in die Rolle der hilfsbedürftigen, freundlichen Oma geschlüpft wäre, hätte sie für mich vielleicht sogar Spaghetti gekocht.
Sie knallt das Wasserglas mit beleidigter Geste auf den Tisch. Das Wasser schwappt über den Rand und rinnt in Schlangenlinien zur Einbuchtung in der Mitte des Tisches, dorthin, wo jahrzehntelang das Stövchen und die Teekanne gestanden waren. Seit mein Mann gestorben ist, trinke ich Tee nur mehr in der Küche.
»Tschüss, Frau Binar. Wenn Sie sich’s anders überlegen und doch noch unterschreiben wollen, wissen Sie, wo Sie mich finden. Sechs A.«
Sie wendet sich ab.
»Wo sind Sie aufgewachsen?«, frage ich schnell.
»In Oberösterreich, in Schärding.«
»Dürfte ich auch Ihren Vornamen erfahren?«
»Moritz.«
2
In der Großen Mohrengasse wurde ich geboren. In der Großen Mohrengasse werde ich sterben. Anderswo stirbt es sich bestimmt nicht so leicht. Die Vierzimmerwohnung, in der ich seit meiner Geburt zu Hause bin, wurde von meinen Großeltern väterlicherseits gemietet, und zwar kurz, nachdem das fünfstöckige Zinshaus in den neunziger Jahren des vorletzten Jahrhunderts errichtet worden war. Davor, so erzählte man mir, war an dieser Stelle ein gelbes, zweigeschoßiges Gebäude mit schrägem Dach, niedrigen Decken und staubigem Innenhof gestanden, das von bösen Zungen »Gasthof zur Läuseschaukel« genannt wurde, weil es fast ausschließlich von Kaftanjuden mit langen Pejes bewohnt wurde. Die Juden waren aus dem Osten der Monarchie in die Hauptstadt gekommen. Auch die wenigen Mieter, die nicht der »Läuseschaukelfraktion« angehörten, also nicht orthodox waren und somit auch keine Pejes hatten, sollen Juden aus der Provinz gewesen sein. Meine Großmutter, die selbst aus Galizien stammte, erzählte mir, sie habe einmal einen jüdischen Nachbarn, den sie aus ihrem Dorf kannte, aus diesem Haus herauskommen gesehen. Hier in Wien habe er genauso verhärmt und schmuddelig ausgesehen wie in jenem Kaff, wo die Sommer stets nach Kot und Krankheit und die Winter nach Rauch und Tod gestunken hätten. Den Namen ihres Geburtsortes hat Großmutter niemals erwähnt. Erst meinem Vater gelang es, diesen in Erfahrung zu bringen, als er sich Ende der dreißiger Jahre um einen Ariernachweis kümmern musste, um als Bewohner der Großen Mohrengasse nicht automatisch für einen Juden gehalten zu werden.
Großmutter war stolz darauf, »gnädige Frau« genannt zu werden und der sogenannten »besseren Gesellschaft« anzugehören. Großvater war in ihren Augen ein »mittlerer Beamter«, hatte er es in seinem Leben doch bis zum stellvertretenden Postamtsleiter gebracht.
Bevor Itzig Apfelbaum, der Besitzer des Grundstücks, das alte Gebäude abtragen und an seiner Stelle ein stattliches Zinshaus mit Medusenköpfen, Girlanden und Halbsäulen als Stuckdekoration, mit hohen Decken und den Mogelstockwerken Hochparterre und Mezzanin errichten ließ, hatten meine Großeltern in der Rotensterngasse, gleich um die Ecke, in einer Kellerwohnung zur Miete gewohnt. Sie waren, genauso wie später meine Eltern und ich, niemals aus unserem Bezirk weggezogen. Es schien die meiste Zeit, als brauchten wir die große weite Welt nicht. Die Welt kam zu uns, auch wenn sie einige Male zerstört und wiederaufgebaut wurde, ihre Konsistenz, ihre Farbe und ihre Aura wechselte, ergoss sie sich dabei jedoch stets in dieselbe Form wie eine Flüssigkeit in einen Krug. Wie viele Menschen im Habsburgerreich, die der vermeintliche Reichtum der Hauptstadt anzog, waren auch meine Groß- und Urgroßeltern am Nordbahnhof ausgestiegen und hatten nur wenige Straßen weiter ein billiges Quartier gefunden, das ihnen ein Landsmann vermittelt hatte, der es einige Jahre zuvor seinerseits durch einen anderen Landsmann bekommen hatte.
Als unsere Straße mit Hakenkreuzfahnen beflaggt wurde, war ich fünf Jahre alt. Als die letzten Juden unseres Viertels deportiert wurden, war ich neun, als die ersten Bomben fielen, war ich zehn, als der Kampf um Wien tobte und der Krieg bald danach zu Ende ging, war ich zwölf, als Österreich wieder frei wurde, war ich zweiundzwanzig, als die ersten Gastarbeiter in unsere Gegend kamen, war ich dreiunddreißig. Dann wiederholte sich manches, was ich von früher kannte. Irgendwann kamen sogar die orthodoxen Juden wieder in unsere Straße und richteten an der Ecke zur Schmelzgasse einen Betraum ein, dessen Eingang stets von einem Polizisten bewacht wurde. Vieles ist nun so, wie es früher war, auch wenn Ausdrücke wie »Läuseschaukel« heute nicht mehr wie selbstverständlich verwendet werden, weil sie – wie junge Leute zu sagen pflegen – nicht mehr »Piißii« sind. Und was ist mit dem wirklichen Leben? Ich fürchte, das Problem der Schwarzafrikaner in Wien ist nicht die Mohrengasse oder der Mohr im Hemd.
Wie oft habe ich umlernen müssen! Manche Nachbarn, denen ich als kleines Kind freundlich die Hand gab, durfte ich eines Tages nicht einmal mehr grüßen. Was ich mit zwölf mit Inbrust herausschreien musste, weil ich mich sonst verdächtig gemacht und meine Eltern in Gefahr gebracht hätte, durfte ich mit dreizehn nicht einmal andeuten, geschweige denn offen aussprechen. Und Barbara, meine Tochter, erklärte mir vor einiger Zeit bitter, sie habe ihre »größte Neurose« nach mehreren Jahren Therapie endlich überwinden können. Diese Neurose sei ich gewesen. Es sei schon schwer genug, eine Lehrerin als Mutter zu haben, habe ihre Therapeutin gemeint, erst recht aber eine solche Mutter wie mich. Mein Sohn sagt, ich solle mich nicht über Barbara ärgern. Ihre größte Neurose sei der Tatsache geschuldet, dass sie auch in den teuersten und schönsten Schuhen mit Absätzen aussehe wie eine schwangere Nilpferddame auf Stelzen. Markus hatte immer schon einen abartigen Sinn für Humor. Alle anderen finden ihn witzig, nur ich nicht. Mit seiner Schwester redet er nicht mehr. Vor einigen Jahren hat er sie wegen eines nicht zurückgezahlten Darlehens verklagt. Was sind dagegen schon zwei Punkte über einem o.
Die Einbuchtung in der Mitte des Tisches füllt sich mit Wasser. Vor dem Unfall hätte ich sofort ein Geschirrtuch auf die nasse Stelle gelegt. Jetzt stört mich die Pfütze nicht. Die Schmerzen kommen wieder. Ich bin müde. Ich habe Hunger. Mir ist schwindlig. Ist es nicht ein Skandal, dass mein Essen heute nicht geliefert wurde? Wozu habe ich es bestellt und bezahlt?
Ich schleppe mich vom Sofa zum Telefon, das sich im Vorzimmer auf jener schweren, dunkelbraunen Kommode befindet, die mir als Stütze dient, wenn ich zur Wohnungstür gehe.
Karla hat alles für mich aufgeschrieben: Oben auf dem Blatt steht in großen Lettern die Servicenummer der Firma, die mein Essen ausliefert. Sie heißt Rollender Esstisch à la carte Gemeinnützige Ges.m.b.H. und bringt jeden Monat eine Hochglanzbroschüre heraus, auf deren Cover meist rüstige Greise auf einer Terrasse im Grünen, auf dem Balkon einer Villa oder vor einem Swimmingpool beim Essen gezeigt werden. Neben der Servicenummer dieses gemeinnützigen und somit beschränkt haftenden Unternehmens erhielt ich von Karla zwei weitere Telefonnummern – jene des Fonds Soziales Wien und die des Sozialen Notrufs, letztere nur für den Fall, dass alle anderen Stricke reißen. Mit etwas Mühe kann ich alle Nummern, die auf dem Blatt stehen, auch ohne Brille lesen.
Karla meinte scherzhaft, ich sei der letzte Mensch in unserer Straße, der kein Handy hat. Dem habe ich nicht widersprochen, sondern gemeint, ich sei nun einmal altmodisch, eine Eigenschaft, die man einer alten Dame durchaus zugestehen sollte. Als Nächstes erwartet man noch von mir, ich solle mit irgendjemandem twittern. Immerhin habe ich einen Computer, einen Internetzugang und eine E-Mail-Adresse. Die meisten Österreicher über achtzig sind nicht einmal in der Lage, Fahrkartenautomaten oder Kontoauszugsdrucker zu bedienen. Meine Kinder, die beide mit ihren Familien schon seit Jahren nicht mehr in Wien leben, schicken mir regelmäßig E-Mails und sind wenig erfreut, wenn ich sie hin und wieder anrufe. Mein Sohn hat mir sogar ein futuristisches Programm am Computer eingestellt: Skype. Mithilfe dieser praktischen Erfindung kann ich mit meinen Kindern kommunizieren, so als säßen sie bei mir im Wohnzimmer. Nur dass die Kinder höchstens einmal im Monat bereit sind, mit mir zu skypen. Aber es ist mehr, als ich früher jemals vermuten hätte können. Wozu also braucht eine Pensionistin wie ich ein Handy?
Ich setze mich auf den Hocker, der neben der Kommode steht, und wähle die Servicenummer des Rollenden Esstisches.
»Rollender Esstisch à la carte, mobiler Essservice mit Herz und sozialem Gewissen, heißt Sie auf seiner Servicehotline herzlich willkommen. Wenn Sie schon Kunde unseres Unternehmens sind und eine allgemeine Information brauchen, drücken Sie bitte die Eins …«
Ach, oje, das habe ich befürchtet.
»… wenn Sie noch nicht unser Kunde sind, drücken Sie für Informationen jeglicher Art bitte die Zwei, für Fragen zu den Förderungen durch die Stadt Wien drücken Sie bitte die Drei …«
Dass diese Telefonfrauenstimmen doch alle gleich klingen. Doch sie hätten für diese Ansage wenigstens eine Österreicherin nehmen können und keine Deutsche. Seit es uns wirtschaftlich besser geht als dem großen Nachbarn, werden wir von Ostdeutschen überflutet. Sogar in einigen Altwiener Kaffeehäusern sagen einem die Kellner »Tschü-üss«.
»… für weitere finanzielle Fragen drücken Sie bitte die Vier, für Änderungswünsche beim Menüplan drücken Sie bitte die Fünf …«
Das darf doch nicht wahr sein! Wenn ich ihnen eine E-Mail geschickt hätte, wäre wohl längst eine Antwort gekommen.
»… für medizinische Fragen drücken Sie bitte die Sechs, für Haftungs- und Versicherungsfragen drücken Sie bitte die Sieben …«
Ich werde gleich durchdrehen! Und dieser preußische Tonfall ist nicht auszuhalten.
»… für Beschwerden und Anregungen wählen Sie bitte die Acht …«
Na endlich!
»Sie haben die Servicehotline für Beschwerden und Anregungen gewählt. Derzeit sind alle Leitungen besetzt. Bitte haben Sie etwas Geduld. Die nächste frei werdende Leitung ist für Sie reserviert …«
Als Nächstes höre ich Musik – die sanfte Instrumentalversion eines bekannten Schlagers aus den achtziger Jahren. Wie hieß er doch gleich? Als Teenager hat sich Markus dieses Lied stundenlang angehört, immer und immer wieder, bis ihm mein Mann den Kassettenrekorder weggenommen hat. Der Name der Band liegt mir auf der Zunge.
Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass meine Eltern und ich niemals aus unserem Viertel weggezogen sind, während mein Sohn heute in Adelaide und meine Tochter in Zürich leben?
Spider Murphy Gang: So hieß die Band.
Ausgerechnet Adelaide! Näher geht es wohl nicht.
Skandal im Sperrbezirk3 war der Name des Liedes. Oder Skandal um Rosi?
Obwohl ich angeblich ihre größte Neurose bin, ist Barbara nach meinem Unfall aus Zürich angereist, blieb jedoch nur zwei Tage. Sie war mir keine große Hilfe, aber ich habe mich natürlich gefreut, sie wiederzusehen.
In München steht ein Hofbräuhaus, doch Freudenhäuser müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat …
Dass dieser Schwachsinn dreißig Jahre in den Niederungen meines Gedächtnisses gespeichert war und ausgerechnet heute und aus einem solchen Anlass wieder an die Oberfläche kommt.
Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert …
Warum gerade die muffigen achtziger Jahre bei jungen Leuten en vogue sind, kann ich nicht nachvollziehen.
Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut, dass es die Rosi gibt …
Diesen Blödsinn bekomme ich bestimmt stundenlang nicht mehr aus dem Kopf.
Und draußen vor der großen Stadt …
Besetztzeichen. Ich presse den Hörer noch einige Sekunden an mein Ohr, bevor mir klar wird, dass das ganze Warten umsonst war. Sollte ich nicht doch lieber eine Mail schicken?
Nach einigem Zögern hebe ich wieder ab und drücke die Wiederholungstaste.
»Rollender Esstisch à la carte, mobiler Essservice mit Herz und sozialem Gewissen …«
Ja.
Jaa.
Jaaa.
Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ich hab ihre Nummer schon …
Verflixt und zugenäht! Ich habe Hunger!
Ich habe weder die Kraft noch die Lust, den Computer hochzufahren. Außerdem sind bei meinem Gerät seit etwa einem Jahr immer deutlicher die Anzeichen von Altersschwäche zu erkennen.
Die nächste Nummer auf der Liste ist jene des Fonds Soziales Wien. Dort läuft kein Tonbandgerät. Die Leitung ist auf simple und traditionelle Art und Weise ständig besetzt. Nach fünf Versuchen gebe ich auf.
Seltsam, wie viele Déjà-vu-Erlebnisse ich in letzter Zeit habe. Schon vor fünfzig Jahren habe ich mich ständig ärgern müssen, wenn ich in Ämtern anrufen musste.
Es bleibt mir nur noch der Soziale Notruf. Ich weiß, dass diese Einrichtung schon lange existiert. Als ich noch unterrichtete, hatte ich einen Kollegen, dessen Schwester als Sozialarbeiterin bei der Stadt Wien beschäftigt war und oft stundenlang am Telefon saß, um diese Notrufe entgegenzunehmen. Der Kollege wusste nur Gutes über diesen Telefondienst zu berichten, während ich all die Menschen bemitleidete, die in eine so prekäre Lage geraten waren, dass sie dort anrufen mussten. Nun gehöre ich selbst zu diesen Bemitleidenswerten.
Doch ich habe keine andere Wahl.
Heureka! Schon nach dem dritten Freizeichen höre ich eine junge Frauenstimme: »Sozial, mobil und allzeit bereit, Servicecenter, Sie sprechen mit Elisabeth, was kann ich für Sie tun?«
Ich nenne meinen Namen und berichte über mein Problem.
»Es tut mir sehr leid«, sagt sie, »aber für alle Fragen, die mit den Essen-auf-Rädern-Anbietern zu tun haben, ist eine Kollegin zuständig, die heute keinen Dienst hat. Rufen Sie bitte dienstags oder donnerstags von acht bis zwölf oder von vierzehn bis siebzehn Uhr an. Die Durchwahl ist acht.«
»Was?« Das darf doch wohl nicht wahr sein! Unglaublich! »Aber heute ist erst Freitag! Bis Dienstag bin ich längst verhungert.«
»Das tut mir sehr leid, ich kann mir vorstellen, was für eine schwierige Situation das für Sie sein muss … Das heißt … Ich meine …«
Trotz meiner Verärgerung muss ich schmunzeln.
»Was soll ich denn nun machen?«, frage ich.
»Haben Sie es denn schon direkt beim Anbieter versucht? Die müssten alle eine Service-Line haben.«
»Ja, ich habe dort angerufen, aber ich höre nur Rosi im Sperrbezirk.«
»Wie bitte?«
»Ach nichts, vergessen Sie’s. Es sind einfach ständig alle Leitungen besetzt.«
»Ja, dann kann ich leider auch nichts tun. Sorry!« Ihre Stimme wird schärfer und bekommt plötzlich einen ungehaltenen, sogar ein wenig gehetzten Unterton. »Haben Sie denn keine Verwandten oder Freunde?«
»Wenn ich die hätte, bräuchte ich kein Essen auf Rädern.«
»Das ist nicht zwangsläufig so. Es gibt ältere Menschen, deren Kinder oder Enkelkinder keine Zeit haben, sich um sie zu kümmern, aber wenn’s nicht anders geht, dann nehmen sie sich die Zeit.«
»Meine Tochter hat genug eigene Probleme, und mein Sohn ist in Adelaide.«
»Wo?«
»Australien.«
»Es gibt eine Nummer der Sozialen Dienste, aber dort wird natürlich niemand mehr sein am Freitagnachmittag. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt auch nicht so recht …«
»Hören Sie, junge Frau, wenn Sie im Sozialen Notruf arbeiten …«
»Wir sind ein Call Center. Den Sozialen Notruf gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das meiste ist ausgelagert worden. Ich selbst vermittle nur weiter.«
»Ja, dann vermitteln Sie doch!«, schreie ich entnervt. »Schließlich muss ich heute und auch am Wochenende etwas essen.«
»Einen anderen Ton, bitte!«, schreit sie zurück. »Sie sind schon die Fünfte, die mich heute anschnauzt. Ich kann nichts dafür. Was soll ich denn machen? Für Ihr Essen bin nicht ich zuständig. Dann essen Sie bis Dienstag eben Knäckebrot oder Mannerschnitten. Tschüss!« Und sie legt auf. Ich aber denke, dass man nicht alt genug werden kann, um etwas zu erleben, was man nie für möglich gehalten hätte.
3
Donnerstagnacht träumte Alexander von seiner Mutter. Oder war es in der Nacht auf den Freitag? Der Traum fiel ihm wieder ein, als er eine Woche später das Hochhaus betrat und die Dame hinter dem Glas in der Portiersloge sah. Sie hatte kurzgeschnittenes, rötliches Haar und schmale Hände, die stets in Bewegung waren, etwas drehten und wendeten oder sich hin und her bewegten, als hielte jede von ihnen einen unsichtbaren Dirigentenstab. Im Traum hatte Mutter genauso ausgesehen. Oder so ähnlich. Alexander versuchte, sich zu erinnern, was am Abend vor dem Traum gewesen war, doch sosehr er sich auch bemühte, er konnte die beiden Nächte und die Abende davor nicht auseinanderhalten.
Was die Dame hinter dem Glas – noch mehr als durch alle anderen tatsächlichen oder vermeintlichen Ähnlichkeiten – mit der Traum-Mutter und seiner wirklichen Mutter verband, war der Ausdruck in ihrem Gesicht.
Als Mutter verschwand, war sie dreiundzwanzig. Alexander war damals keine drei Jahre alt, aber er erinnerte sich noch gut, wie Mutters Mädchenhand über seine Wange strich, wie er dabei den Kopf drehte und Mutters Fingernägel anschaute und wie der farblose Nagellack im gleißenden Licht der Deckenbeleuchtung aufblitzte, wenn Mutter ihre Hände bewegte, mit welcher Faszination er die Nagelspitzen betrachtete, die über die Fingerkuppen hinausragten. Er wusste noch, dass Mutters Augen grün und lebhaft gewesen waren und wie sie von einem Augenblick auf den anderen kalt und abweisend werden konnten, so als wollten sie ihn dafür strafen, dass er etwas Schlimmes angestellt hatte. Wenn er weinte, stand Mutter auf und ging, und er hörte das harte Knallen der Tür oder unverständliche Worte, die nicht an ihn gerichtet waren, deren Tonfall er aber fortan immer mit der Kälte ihres Blickes in Verbindung bringen würde.
Alexander, Alex, Sascha, Xandi. Wie hatte ihn seine Mutter genannt? Saschenjka, wie später die Tante und die meisten anderen Verwandten in Russland? Saschka? Schurik?
Die Frau hinter dem Glas hatte ein altes Gesicht, obwohl sie bestimmt noch keine dreißig war. Junge Menschen mit alten Gesichtern machten Alexander Angst. Er stellte sich vor, was sie erlebt haben mochten, und erschrak vor den Bildern, die er sich ausmalte.
»Zu wem wollen Sie?« Die Stimme war unangenehm, durchdringend.
»Diplomingenieur Wilhelm Neff Immobilien Gmbh. Ich habe einen Termin.«
»Achter Stock.«
»Ich weiß.«
Sie blickte nicht von der Boulevardzeitung auf, in der sie langsam und sichtlich ohne großes Interesse blätterte.
»Mit dem Lift hinauf, dann links und die vierte Tür rechts.«
»Ja, ja, ich weiß, ich war schon dort.«
»Sie haben einen Termin?«
»Das sagte ich gerade.«
Eine junge Frau ging vorbei. Die Dame hinter dem Glas nickte ihr zu. Alexander hörte, wie Stöckelschuhe um die Ecke bogen. Die Dame legte die Zeitschrift beiseite, hob den Kopf und schaute Alexander fragend an. In den Gesichtsfalten zwischen Nasenflügeln und Mundwinkeln hatten sich Schweißperlen gebildet. In der Mulde unter der Nase glaubte Alexander den dunklen Flaum eines Oberlippenbartes zu erkennen.
»Einen schönen Tag noch«, murmelte Alexander und hastete zum Lift.
Das Haus war vor mehr als fünfzig Jahren errichtet und seitdem offenbar niemals umgebaut oder renoviert worden. Es hatte vierzehn Stockwerke – ein stattliches Gebäude für jene Zeit. Im Aufzug roch es nach Schweiß und Parfüm. Auf den mit dunkelbraunen Resopalplatten beschichteten Wänden waren schwarze Flecken von ausgedrückten Zigaretten zu sehen. Die Flecken waren alt und verblasst. Offenbar kam seit langem niemand mehr auf die Idee, in einer Liftkabine zu rauchen. Auf der Plakette aus Blech, die rechts an der Wand unter den Knöpfen angebracht war, stand neben dem Firmennamen das Baujahr des Lifts – 1963, und wie in den meisten Aufzügen jener Zeit fehlte die Kabinentür, sodass man beim Hinauffahren die mit blassblauer Farbe gestrichene Wand des Liftschachts und die silberfarben lackierten Türen in den Stockwerken vorbeiziehen sah. Die Deckenleuchte flackerte, und auf den grauen Linoleumboden hatte jemand die Worte up and down gesprayt.
»Ich muss in den Achten«, sagte Alexander zu der jungen Frau. Sie würdigte ihn keines Blickes, drückte den Knopf und wandte ihm den Rücken zu. Der Lift gab einen Schnalzlaut von sich, rüttelte ein wenig und setzte sich in Bewegung.
Alexander versuchte, das Alter der Frau zu schätzen, schaute ihre Hände an und vermutete, dass sie Ende zwanzig war. Die breiten Hände passten, wie ihm schien, nicht zu ihren zarten Unterarmen. Er betrachtete ihre schlanke Figur, das schulterlange, dunkelbraune Haar, den weißen Mantel mit Pelzkragen, die schwarzen Strümpfe, die weinroten Lackschuhe und wünschte sich plötzlich sehr, ihr Gesicht zu sehen. Wenn sie grüne Augen hätte, würde sie ihm gefallen.
Wenn ihre Augen grün sind, bringt mir das Glück, dachte Alexander. Wenn sie blau sind, muss ich in nächster Zeit auf der Hut sein. Alle anderen Farben sind neutral. Er liebte Spielchen dieser Art, die den Alltag zur Lotterie machten. Dies verschaffte ihm die Illusion, das Schicksal herausfordern und überlisten zu können.
Zwischen dem dritten und vierten Stockwerk rüttelte die Kabine, verlangsamte ihre Geschwindigkeit für einen Augenblick, beschleunigte wieder. Die Frau schimpfte: »Scheiße, verdammte!« Ihre Stimme war hoch, aber nicht schrill. »Das ganze Haus bricht auseinander.«
»Man sollte es abtragen«, sagte Alexander.
Sie schwieg.
»Abreißen und neu aufbauen. Nicht wahr?«
Schweigen.
Wenn sie wenigstens ein paar Worte gesagt hätte. »Ja, genau.« »Abreißen und neu aufbauen.« »Allerdings.« Hätte sie etwas in dieser Art gesagt, wenn auch vollkommen nichtssagend, hätte Alexander sich gefreut, und dieser Morgen mit dem schwierigen Gespräch, das er mit Willi Neff führen sollte, und den bedrückenden Erinnerungen an den Traum und an seine Mutter wäre erträglicher geworden.
Zwischen dem siebten und dem achten Stock rüttelte die Kabine ein zweites Mal, wurde langsamer und beschleunigte wieder.
»Das darf doch nicht wahr sein!«, schimpfte die Frau.
Die Kabine wurde noch schneller.
Und dann fuhr sie am achten Stock vorbei, ohne anzuhalten.
»Heee? Was soll denn das?!«
Nun drehte sich die Frau um und starrte Alexander mit weit aufgerissenen Augen an. Die waren tatsächlich grün, nur dass Alexander diese Tatsache nun keine Freude mehr bereiten konnte. Er wandte seinen Blick vom Gesicht der Frau zur Wand des Liftschachts, die unaufhörlich nach unten glitt. Die Tür des neunten Stocks zog vorbei, dann die des zehnten …
Alexander stürzte zu den Knöpfen, doch die Frau kam ihm zuvor, drückte den Nothalteknopf, den Alarmknopf und dann auch alle anderen Knöpfe. Es nützte nichts. Der Aufzug fuhr unaufhaltsam nach oben.
»Oh, mein Gott! Ich will hier raus!«, jammerte die Frau, während Alexander dastand und kein Wort herausbrachte.
Beide stießen heftig gegen die Tür des zwölften Stockwerks, aber sie ging nicht auf. Im dreizehnten Stock griff die Frau nach Alexanders Hand.
»Was sollen wir denn tun?«, schrie sie. »Was?«
Alexander drückte panikartig alle Knöpfe der Reihe nach von oben nach unten und dann von unten nach oben. Die Frau krallte sich an ihm fest. Nach dem dreizehnten Stock glitt eine Tür an ihnen vorbei, auf der ein großes schwarzes D zu lesen war. Dachgeschoß.
»Und jetzt?«, kreischte die Frau. »Was sollen wir jetzt machen?«
»Wir werden ja nicht in den Himmel fliegen«, meinte Alexander und erschrak selbst vor seiner keineswegs überzeugend klingenden Stimme. Eine absurde Phantasie schoss ihm durch den Kopf: Der Lift würde durch das Dach stoßen und in den Himmel fliegen, immer höher und höher, so lange, bis es ihn weit oben über den Wolken in Tausende von Stücken zerfetzte. »Wir bleiben gleich stehen«, flüsterte er. »Keine Angst, es wird schon nichts passieren. Oder wir stürzen ab.«
Doch stattdessen kam ein weiteres Stockwerk. Die Tür trug die Aufschrift T.
»T! Was ist T?«, fragte Alexander und erkannte sofort die Belanglosigkeit dieser Frage in einem solchen Augenblick.
»Tod«, winselte die Frau. »Es ist der Tod!«
»Unsinn!«, brüllte Alexander. Es klang wie ein Hilfeschrei.
In diesem Augenblick blieb die Kabine ruckartig stehen. Alexander und die Frau wurden in die Höhe geschleudert und fielen auf den Boden. Ein hohes, durchdringendes Geräusch – es hörte sich an wie eine unrund laufende Kreissäge – erfüllte den Raum. Es schien, als würden sich die Wände verbiegen. Die Kabine wurde geschüttelt, so als wäre sie ein Flugzeug, das eine schwere Unwetterzone durchquerte, und dann bewegte sie sich nach unten, langsam zuerst, dann immer schneller. Alexander umarmte die Frau. Sie schlang die Arme um seinen Hals. Sie kreischten beide und klammerten sich immer fester aneinander. Alexander konnte die Lippen der Frau an seiner Wange spüren. Von oben kam ohrenbetäubender Lärm, so als würde ständig etwas reißen oder brechen. Alexander wollte beten, aber er hatte nie in seinem Leben ein Gebet gelernt. »Mama!«, schrie die Frau. »Mama!«
Nicht einmal im Angesicht des Todes fiel es Alexander ein, nach seiner Mutter zu rufen. Als die Angst unerträglich wurde, versetzte sie ihn kurzzeitig in einen Dämmerzustand, in dem ihm alles egal war, so als stünde er unter Narkose. Dann bremste der Lift plötzlich ab, blieb für wenige Augenblicke stehen, fuhr auf einmal wieder nach oben und kam endgültig zum Halt. Alexander und seine Begleiterin wurden gegen den Boden gedrückt, dann nach oben geschleudert. Man hörte das Glas der Deckenleuchte zerbersten. Ein Schnalzlaut. Ein heftiges Schlagen von Metall auf Metall. Dann war Stille und völlige Dunkelheit.
Als Alexander wieder zu sich kam, hörte er ein Pochen. Es dauerte ein paar Sekunden, bis er verstand, dass es aus seinem Inneren kam, dass sein Herz raste, während sein Atem flach ging, und dass die junge Frau auf ihm lag und gegen seine Brust drückte. Er rollte sie vorsichtig zur Seite.
»Sind wir tot?«, fragte sie mit schwacher Stimme.
»Ich glaube, der Lift ist ein bisschen abgestürzt«, antwortete er mit heiserer Stimme.
»Was Sie nicht sagen.«
»Ich denke, wir könnten angesichts der besonderen Umstände eigentlich zum Du übergehen. Nach allem, was … nach dieser Sache.«
»Bist du verletzt?«
»Ich glaube nicht. Nur mein Kopf dröhnt. Und du?«
»Irgendwas tut mir weh, aber ich weiß nicht, was. Aber ich kann mich bewegen. Glaube ich … Wo sind wir überhaupt? Im Keller? Ich sehe gar nichts. Sind wir richtig abgestürzt?«
»Dann wären wir tot.«
»Vielleicht sind wir das ja.«
»Wie heißt du überhaupt?«
»Elisabeth. Ich arbeite hier in einem Call Center. Und du?«
»Alex. Ich habe einen Termin im achten Stock. Hatte. Habe. Längst versäumt? Keine Ahnung.«
»Was ist eigentlich passiert? Wie kann so etwas überhaupt möglich sein?«
»Hast du wirklich grüne Augen?«
»Ja. Wieso?«
»Weil wir deshalb noch am Leben sind.«
»Häh?«
»Und wie alt bist du?«
»Sechsundzwanzig.«
»Gut, dann schauen wir, dass wir hier irgendwie herauskommen.«
Alexander stand auf, streckte die Arme aus, versuchte, sich in der völligen Dunkelheit zu orientieren. Er konnte kaum aufrecht stehen, hatte starke Kopfschmerzen und einen salzigen Geschmack im Mund. Seine Zunge blutete, der rechte Fuß tat weh, und das Atmen fiel ihm immer noch schwer, sonst aber hatte er den Eindruck, unverletzt geblieben zu sein. Er streckte die Arme aus, ertastete mit den Fingerspitzen Elisabeths Haare. »Mir ist schwindlig«, sagte sie. »Und ich finde meine Schuhe nicht.«
»Hast du vielleicht Streichhölzer oder ein Feuerzeug?«
»Ich rauche nicht.«
Alexander tastete die Wände der Kabine und dann die Wand des Liftschachts ab. Rauer Beton, dann etwas Kaltes, Glattes, aus Metall: eine Tür. Er drückte dagegen. Zu seiner Überraschung gab die Tür nach, ließ sich öffnen. Das Licht blendete ihn. Für einige Sekunden konnte er nichts sehen. Dennoch machte er drei schnelle Schritte nach vorne: nichts wie raus aus dieser Kabine! Als die Welt um ihn herum wieder Konturen und Farben hatte, erkannte er einen großen schwarzen Achter auf der Wand des Korridors. Er war im achten Stock.
»Meine Schuhe sind kaputt.« Elisabeth stand barfuß neben ihm und hielt ihre Lackschuhe in der Hand. Die Absätze waren abgebrochen. Das Make-up in ihrem Gesicht war verwischt. Haarsträhnen hingen ihr in die Stirn. Auf der rechten Wange hatte sie eine Schramme. An ihrem einst weißen, nun schmutzig grauen Mantel klebten Glasscherben, und die beiden oberen Knöpfe waren abgerissen.
»Ich steige nie mehr in einen Lift«, sagte sie leise und versuchte zu lächeln. Ihr Blick glitt von Alexanders Gesicht an seinem Körper hinab. Dann schaute sie verlegen zur Seite. Nun erkannte auch er, dass bei ihm im Schritt ein deutlich erkennbarer nasser Fleck zu sehen war. »Oh, verdammt!«, murmelte er. Er spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss.
»Macht nichts«, sagte Elisabeth leise und wurde ebenfalls rot. »Das kann ja passieren in einem solchen … solchen …« Sie stockte. »In einem solch dramatischen Lebensabschnitt.«
Und nun begannen beide zu lachen, und während er lachte, konnte Alexander wieder freier atmen und spürte die Schmerzen kaum mehr und hatte das Gefühl, dass es nichts Schöneres gab, als in diesem schäbigen Korridor zu stehen und festen Boden unter den Füßen zu spüren.
»Darf ich dich auf einen Kaffee einladen?«, fragte er. »Unten in der Kantine. Im ersten Stock.«
»So?« Elisabeth zeigte mit dem Finger auf seine Hose.
»Das ist mir jetzt egal. Und dir?«
»Du hast recht. Und ich kann barfuß einen Kaffee trinken. Fürs Kaffeetrinken in diesem schmutzigen Lokal braucht man keine Schuhe, und auch sonst fällt dort sicher niemandem was auf.«
»Nach einem solch dramatischen Lebensabschnitt …«
»… ist alles erlaubt.«
»Eigentlich sollten wir ja melden, was passiert ist.«
»Eigentlich.«
»Gehen wir hinunter. Gibt es hier eigentlich eine Treppe?«
Sie begannen wieder zu lachen und gingen Hand in Hand langsam durch den Korridor, an dessen Ende sich das Stiegenhaus befand.
4
Um acht Uhr abends wird mein Essen auf Rädern geliefert. Ich muss mich also nicht bis Dienstag von Mannerschnitten ernähren, zumal ich ohnehin keine auf Lager habe, und auch das von Motten angefressene Knäckebrot kann ich weiterhin im Regal lassen. Karla fragt mich jedes Mal, wenn sie mich besucht, warum ich es nicht längst weggeworfen habe. Vergeblich bemühe ich mich, eine Antwort darauf zu finden. Ich habe keine. Wie sagte doch einst der große russische Lyriker Joseph Brodsky: Der Herrgott lebt nicht in den Winkeln, wie Spötter meinen, sondern überall. Er heiligt Dächer und Geschirr, und alles and’re hebt Er auch zu sich empor und bringt es, wenn es Ihm beliebt, zu Fall …
Die beiden Burschen hatten einen Unfall. Ihr Lieferwagen war mit einem Moped zusammengestoßen. Glücklicherweise ist der Fahrer unverletzt geblieben, die Burschen kamen ebenfalls mit dem Schrecken davon. Es war vorerst unklar, wer an diesem Unfall die Schuld getragen hatte, ob der Lieferwagen zu schnell unterwegs gewesen war, oder der Mopedfahrer die Vorrangregel verletzt hatte, und bis das Polizeiprotokoll aufgenommen und alle Diskussionen beendet worden waren, hatte der Nachmittag – viel schneller als erwartet – dem Abend Platz gemacht. Warum sie mich denn nicht angerufen und Bescheid gesagt hatten, wollte ich von den beiden wissen. Das war wohl die falsche Frage gewesen. Der eine errötete und schaute betreten zu Boden. Der andere zuckte die Schultern, erzählte etwas von einer schlechten Handyverbindung und einem »unverhältnismäßigen, weil unkontrollierbaren« Gefühl von Überforderung und Hilflosigkeit, das ihn »immer, wirklich, wirklich immer« in Stresssituationen überkomme und sogleich Besitz von ihm ergreife, fragte in herausforderndem Tonfall, ob ich denn von allen Menschen erwarte, dass sie ständig erreichbar sind, ob ich selbst ständig erreichbar sei, ob wir uns denn nicht »irgendwann, wenigstens zeitweise« von den Zwängen befreien könnten, die uns auferlegt werden. Ich war zu müde, um mit ihm zu streiten.