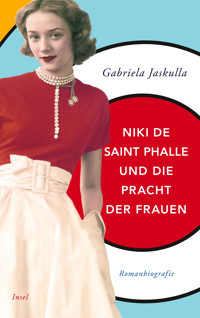9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gianna ist jung, temperamentvoll und ehrgeizig – und sie möchte unbedingt Köchin werden. Und zu den Besten gehören. So führt sie ihre Reise durch die Küchen ihrer Heimatstadt Regensburg, über Kopenhagen und Navarra bis nach New Mexico. An vier aufregenden Stationen lernt sie nicht nur die unterschiedlichen Kochstile berühmter und eigenwilliger Sterneköche kennen, sondern erlebt auch ein Auf und Ab der Gefühle: Sie ist verliebt – und gleich in zwei Männer, in zwei Brüder, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Nach und nach entdeckt Gianna, worauf es im Leben wirklich ankommt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gabriela Jaskulla
Die Herbstköchin
Roman
Insel Verlag
Die Herbstköchin
Prolog: Der Turm
Hinauf in den Turm, hinauf! Gianna läuft fast, fliegt. Nur ein paar Schritte, dann hat sie Joachim eingeholt. Joachim, der Gute, der Behäbige, der Schmied, der den Steinmetzen das Werkzeug anfertigt. Er verbringt die meiste Zeit allein in seiner Werkstatt, allein mit dem Feuer, allein mit dem Eimer Wasser, in die er die glühenden Spitzen der Eisen taucht, die Fugeneisen, Zahneisen, Spitzeisen. Je nachdem, wann Joachim die Eisen aus dem Feuer holt, je nachdem, wann er die Enden in das kalte Wasser drückt, dass es zischt und dampft, werden die Spitzen härter oder weicher. Eine zu weiche Spitze verformt sich, eine harte bricht. Das hat man im Gefühl. Der Schmied, obwohl träge und schwer, entscheidet in seiner Werkstatt in Sekundenbruchteilen. Hier aber lässt er sich Zeit. Hier stapft er vor ihr her auf eine enervierende Art und Weise.
Solong. Sein Spitzname. Weil er so lang und so breit ist. Und weil er so lange braucht für alles, außer fürs Schmieden.
Solong. Er dreht sich nicht nach ihr um. Das wäre auch schwierig; der Gang im alten Turm des Doms ist gewunden und schmal.
Solong muss sich beugen beim Hinaufsteigen. Er setzt seine Füße schwer und regelmäßig in den Sand. Rechts herum, rechts herum, rechts herum. Sie steigen und steigen. Auf einem Weg, den schon Hunderte vor ihnen, Tausende festgetreten haben. Der Turm ist der älteste Teil des Doms. Er gehört zu einem früheren Bau; er ist niedriger, gedrungener als die entschieden nach oben strebende gotische Prachtkathedrale, die sich weit über Regensburg erhebt. Der Turm lehnt sich an den späteren Bau an, demütig, wie es scheint, wie ein Diener. Und er hatte ja auch zu dienen, dient noch immer: Durch den Eselsturm wurden die Lasten nach oben geschafft, um weiterzubauen. Sechshundert Jahre dauerte es, bis der Dom fertig war ‒ und seitdem haben die Steinmetze daran zu reparieren und brauchen ihn wieder, den Eselsturm.
Als Kind hat sich Gianna vorgestellt, dass hier wirklich Esel hinaufliefen, immer im Kreis in diesem ockerfarbenen, wüstenfarbenen Turm, der keine Stufen hat, sondern nur diesen Weg, eine Rampe aus Sand, rechts und links begrenzt von Wänden aus großen, geschichteten Steinen. Das verstärkt das Einerlei, das Gleichförmige der Schritte und der Farben, das hat kein Ende, das geht immer weiter, und Gianna nimmt den breiten Rücken Solongs bald nur noch als Fläche war, als schwarzen, gestauchten Rhombus, der steigt und steigt und dabei ein wenig nach links und ein wenig nach rechts schwankt ‒ aber nicht zu viel, sonst stieße er an, sonst berührte seine Schulter die Steine. Jeder dieser Steine ist ein Unikat, jeder trägt das Zeichen des Handwerkers, der ihn geschaffen hat. Gianna hat früher mit dem Zeigefinger oft über die Zeichen gestrichen, es schienen geheimnisvolle Botschaften aus einer anderen Zeit, in einer Sprache, die niemand mehr versteht. Heute aber hat sie keine Zeit zu verlieren. Heute hat sie es eilig, sie will nach oben, denn oben ‒ wartet Quirin.
Wie lange hat sie ihn nicht gesehen? Jahre nicht. Und doch steht er ihr vor Augen. Die Ruhe in seinem Gesicht. Die breiten Schultern. Das Haar, das immer staubig wirkte, auch wenn er es nach der Arbeit sofort wusch und zu kämmen versuchte: Staubhaare, die sich sogleich erneut störrisch aufrichteten. Seine kräftigen Hände ‒ wenn er sich ungeduldig über den Kopf fuhr, sah man die Adern an den Unterarmen hervortreten. Wenn er merkte, dass sie ihn beobachtete, wandte er sich ab, verlegen, ein wenig ungehalten. Dann sah sie seinen massiven Rücken, die überraschend schlanken Beine, die seltsam schwere Anmut, mit der er sich bewegte. Es kribbelt, wenn Gianna daran denkt. Es kribbelte immer, wenn Gianna daran dachte. Aber sie hatte nicht genug nachgedacht, sie war immer nur voraus gewesen, Quirin voraus, ihrem Leben voraus. Damit war nun Schluss. Sie war zurückgekehrt.
Gianna treibt Solong zur Eile an.
Bitte!
Die Dringlichkeit in ihrer Stimme überrascht sie selbst. Solong macht eine beschwichtigende Geste. Es geht ja nicht schneller. Gianna hatte sich nur kurz gewundert, als Quirin diesen Treffpunkt vorschlug. So viel Romantik hätte sie ihm gar nicht zugetraut. Aber, gesteht sie sich beschämt ein, sie hat ihm vieles nicht zugetraut, sie hat ihn immer unterschätzt im Vergleich zu seinem Bruder, dem älteren, dem hemmungslos attraktiven Damian. Quirin ist anders, stiller. Macht nicht so viel Wind. Steht aber im Sturm. Wie hat sie ihn so lange so nachlässig behandeln können?
Solong trägt ihren Korb. Das hat er sich nicht nehmen lassen. Im Korb ist eine Flasche Wein, sind Weintrauben und Brot. Dunkles Roggenbrot, das ein wenig nach Nüssen schmeckt und nach Brand, dazu katalanischer Rotwein, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Sie hatte sich Zeit gelassen bei der Auswahl. Nie war es ihr schwerer gefallen, nie war sie unsicherer und umsichtiger gewesen. Sie hat über sich selbst lachen müssen: Ist sie nicht der Profi, die Köchin, die Küchenchefin, erfahren, gewitzt durch Niederlagen und Triumphe in etlichen Ländern? Und doch: Es soll alles stimmen bei diesem Wiedersehen.
Nur noch ein paar Schritte, dann sind sie oben. Dann wird Solong eine niedrige, schwere Tür öffnen und ihr den Zugang ermöglichen zum neuen Turm. Und dann wird er ihr den Vortritt lassen auf die Galerie. Die Galerie verbindet die beiden mächtigen Türme des gotischen Doms. Von unten ist sie nicht einzusehen, von oben hat man den phantastischsten Blick auf die Stadt. Eine feine, steinerne Terrasse ist das, ein Balkon für den lieben Gott. Spielzeugklein unten die Menschen, hingewürfelt die bunten Häuser der Altstadt. Jetzt aber, am Abend, nur ein Lichtergefunkel, bescheiden gegen das des Himmels. Jetzt sind sie da. Schwerfällig schiebt Solong sich zur Seite. Warum schaut er sie so ernst an, ja besorgt?
Gianna, hör mal …
Er will ihr noch etwas sagen, er will sie, so scheint es, auf etwas vorbereiten. Will er sie etwa warnen? Wovor? Vor dem Übergang zwischen den Türmen, der immer noch eine Baustelle ist? Ein paar Meter Bretter und Eisengerüst, und durch die Lücken rauscht die stete Gegenwart der Stadt? Oder will er sie warnen vor dem Mann, den sie doch so gut kennt, so gut, glaubt sie, wie keinen? Quirin, das ist wie Heimkommen, sie weiß das, auch, wenn sie ihn lange nicht gesehen hat, auch, wenn sie ihn verlassen hat ‒ nicht einmal, viele Male. Aber Quirin ist keiner, der zählt oder abrechnet. Quirin war immer nur schönste Gegenwart, rau und hell, so wie der Stein, mit dem er am liebsten arbeitet: grauer Granit, selten geworden in der Gegend. Sie hatte ihm den Staub von der Stirn geküsst, aus viel zu früh gewachsenen Falten. Er hatte gelacht und gesagt:
He, das ist nicht nötig, glaubst du, in der Dombauhütte gibt es kein Wasser und keine Seife? Aber sie hatte darauf bestanden, weiterzumachen, wie eine Katze hatte sie sein Gesicht geleckt, mit ihrer spitzen, kleinen, harten Zunge, und irgendwann hatte auch er sich in eine Katze verwandelt, einen Kater allerdings, einen sehr gefräßigen ‒ so hatten sie gespielt. Und dann war sie gegangen. Immer wieder. Und er war geblieben. Immer. Lange her. Sie reißt sich zusammen. Der Blick von Solong, seine Geste: Geh schon!
Sie betritt den Raum zwischen den Türmen. Unter ihr der Bretterboden des Gerüsts und darunter, in siebzig Metern Tiefe, die Stadt. Die Baustelle verbindet die beiden Türme, und da, beim anderen Turm, ist das Geviert der Galerie. Sie sieht einen niedrigen Tisch, ein Meer von brennenden Kerzen, und da ist endlich Quirin.
Gianna macht einen Schritt, will auf ihn zulaufen, will seinen Namen rufen, will wieder zwanzig sein oder, ach was, fünfzehn, will rufen, dass alles wieder gut ist, dass sie sich freut, dass ‒ aber er steht nicht auf, um ihr entgegenzugehen, er dreht sich nicht einmal um, er …
Regensburg im Herbst
1. Sonnenfänger
Sie kann die Geschichte erzählen, als ginge es um Fremde. Oder jedenfalls um andere. Und immer schön der Reihe nach. Hauptfiguren? Vier. Vor allen anderen das Mädchen Gianna. Zu Beginn der Geschichte zwölf oder dreizehn Jahre alt. Von ihren sizilianischen Großeltern hat sie den dunklen Teint. Wie ein zarter Hefeteig, in den ein wenig Safran und ein paar Mandeln geraten sind, sagt ihre Großmutter, die Bäckerin, die es gut mit ihr meint. Zart? Die? Sie hat ein heftiges Temperament, sagt ihre Trainerin. Sie ist eine schlechte Verliererin, meinen ihre Mitspielerinnen, die es missbilligen, wenn Gianna wieder einmal aus dem Kasten stürzt und zur Not foult, statt zu bleiben, wo ein anständiger Torwart hingehört und auf Glück hofft. Gianna, Torhüterin des FFC Donau, verlässt sich lieber auf ihre flinken Füße und auch mal eine schnelle Faust. Nach der gelungenen Aktion, wenn die gegnerische Spielerin sich fluchend wieder erhebt, steht Gianna schwer atmend vor der Schiedsrichterin, taub für deren Ermahnungen ‒ und sieht in ihrem Zorn und ihrer Ungeduld hinreißend aus. Findet Quirin.
Quirin, die zweite Hauptfigur dieser Geschichte. Quirin zeichnet Gianna heimlich während der Spiele. Er zeichnet auf der umgedrehten Pappe der Pommes frites, die er notgedrungen bei jedem Heimspiel in sich hineinstopft. Quirin zeichnet gut, was daran liegt, dass er es ständig tut, aber weil er so viel von Gianna festzuhalten hat, muss er sehr viele Portionen Pommes vertilgen, und das tut seiner Figur nicht gut. Quirin also, ein vorerst dicklicher, gutmütiger Junge, der immer nur mhm, mhm brummt, wenn ihn eines der anderen Kinder fragt, ob es etwas von den gelben Kartoffelschnitzen abhaben könne, und mhm, mhm kann bei Quirin alles bedeuten, also fassen es die anderen Kinder als ein Nein auf, rennen davon und haben ihn im selben Augenblick vergessen. Quirin nimmt das hin, so, wie er vieles hinnimmt ‒ auch, dass dieselben Kinder, die samstags um Pommes frites betteln, ihn am Montag einen Versager nennen oder Schlimmeres: Sie geben vor, sich nicht mehr an seinen Namen zu erinnern und rufen ihm dann die erstbesten beleidigenden Spitznamen zu, die ihnen einfallen: Pummel! Fetti! Monster! So lernt Quirin früh, schnelle Einfälle zu fürchten ‒ und Gruppen, die sich einig sind.
Damian, der ganz andere. Die dritte Person in dieser Geschichte. Damian ist Quirins älterer Bruder, aber kein Mensch weiß, wer der Familie diesen schönen Kuckuck ins Nest gelegt hat. Nein, eigentlich kein Kuckuck, sondern eher ein Raubvogel, ein Habicht vielleicht oder, noch besser, ein Turmfalke. Tatsächlich liebt Damian Vögel fast so sehr wie seine Unabhängigkeit, aber es wird eine ganze Weile dauern, bis die Tiere und Damian zueinanderfinden. Bis dahin ist Damian vor allem immer fort ‒ fort, wenn ihn sein kleiner Bruder bräuchte, fort, wenn die Mädchen, die ihn gestern auf der Party interessant fanden, heute in der Schule auf einen Blick, eine Bemerkung von ihm hoffen, fort, wenn Giannas Vater Lukas eine weitere Aushilfe zum Kellnern in der Klosterschänke braucht. Denn da treffen sich die drei, immer wieder.
Die Klosterschänke mit ihren üppigen Speisen und gescheuerten Bänken, den altmodischen Butzenscheiben und den schwer atmenden Bedienerinnen, die Sommer für Sommer wechseln. Die Schänke, in die die Besucher der absonderlichen kleinen Kirche, amüsiert und verwirrt nach den kurzweiligen Führungen, einkehren, um sich dann, wenn die Rechnung beglichen ist, mit einem letzten Glas in der Hand, an die Donau zu begeben und zu schauen. Das ist hier der Brauch.
Die Donau. Sie ist die vierte Hauptfigur dieser Geschichte, obwohl sie uns zwischendurch abhandenkommen wird. Aber wer die Donau einmal erlebt hat, dem bestimmt sie alles. Die Donau gibt den Rhythmus vor, sie wählt die Farben; der Donau mit ihrem eleganten Eilen entkommt keiner.
Die Donau, das ist kein gemütlicher, träger Fluss, an dessen Ufer Seerosen gedeihen könnten, kein ordentlicher, kontrollierter Kanal ‒ die Donau ist ausladend, gewunden, sie biegt sich in weiten Schleifen von ihren Quellen im Schwarzwald bis zur Mündung ins Schwarze Meer und wird dabei breiter, stattlicher, aber auch immer schneller, rasanter, schneidiger. Die Donau fließt nicht, sie eilt auf ganz eigene Weise: von West nach Ost, während die anderen, die anständigen Flüsse, von Nord nach Süd fließen oder umgekehrt. Die Donau aber liegt quer. Sonnentrotzerin!, so nannte sie Herodot, weil sie dem Sonnenaufgang entgegenströmt. Sonnenfängerin wäre richtig, denn natürlich hat der Fluss es auf die Sonne abgesehen, auf jeden Strahl, jeden Funken, aber es gibt, meinen Menschen, die auch die Wolga kennen, den Don, die Weichsel und die brave, graue Elbe, keinen Fluss, der mehr Glanz und Glamour entfalten kann als die Donau.
Die Donau, sagte Gianna, ist eine Bestimmerin.
Die Jugendlichen, die entlang der Ufer leben, haben sich längst damit abgefunden. Vielleicht versteht man die Donau zwischen vierzehn und zwanzig sowieso am besten, versteht ihren fortwährenden Aufruhr, ihre Ungeduld, ihre Sehnsucht nach Licht, nach dem Fortkommen. Die Donau sagt allen: Es ist möglich. Deshalb erweisen die Jugendlichen dem Fluss ihren Tribut. Auch Quirin und Damian pflegen das Ritual: In jedem Frühjahr kaufen sie sich neue Sonnenbrillen. In ganz Europa erwerben Jugendliche eiserne Schlösser, ritzen ihre Namen und die ihrer Liebsten hinein und ketten sich auf diese Weise an Brückengeländern fest. So krallen sie sich an die Dauer. Nichts wäre den jungen Leuten von Regensburg ferner: Sie kaufen im Frühjahr die neuesten Modelle in den Brillenläden der Gegend ‒ um sie am Ende der Saison in den Fluss zu werfen. So viel gesehen, soll das heißen, nun ist es genug. Und dann verschließen sich Fluss und Himmel, die Wochen des Nebels und des Regens beginnen, und so ist es dunkel und verhangen, dass im März eine allgemeine große Unruhe die Städte und Dörfer der Oberpfalz erfasst, ein geradezu gefährliches Rumoren und Fragen: Wann kommt das Licht? Wann verbünden sich wieder Sonne und Fluss? Und dann rüsten die Optiker vergnügt wieder auf.
2. Netze
Es war verlässlicher Frühling. Die jungen Leute gaben sich wieder viel Mühe mit den Brillenmodellen, ganz so, als stünde neben dem Sommer auch eine Sonnenfinsternis bevor und es käme darauf an, empfindliche Augen zu schützen. Es war aber kein Himmelswunder zu erwarten, sondern ein Flussspektakel: die Donau im Mai. Dafür rüsteten sich die Jugendlichen. Sie fanden sich in kleinen, losen Gruppen am Flussufer ein und ‒ taten nichts. Außer, sich zu zeigen. Einander und dem Fluss. Und der Fluss ließ sich nicht lange bitten und strahlte und leuchtete, während die Ulmen und Buchen am Ufer mit ihrem frischen Grün die Kontraste noch verstärkten und der Himmel über der bayerischen Stadt zeigte, was er konnte. Die tumberen Jugendlichen, solche, die keine vernünftigen Sonnenbrillen ergattert hatten, weil sie sich zu spät entschlossen hatten, versuchten, so zu tun, als bräuchten sie keine Brillen, als machte ihnen das Gleißen und Glimmen nichts aus.
Scheißhimmel!, sagte Damian, während er lässig auf einem Grashalm herumkaute. Sie lagen zu dritt im Gras: Quirin, Gianna und der Ältere, Selbstbewusstere. Eigentlich standen sie eher im Gras, so steil war die Wiese, die sich hinter der Klosterschänke aufwölbte, und so schauten sie über den Wald in den Himmel, den Donauwald, der jetzt als messerscharfe Kante zusätzlich in die Augen schnitt.
Sei doch froh, murmelte Quirin leise, ist doch ganz schön hier.
Er mochte es nicht, wenn Leute an dem herumkrittelten, was war.
Schön? Damian lachte höhnisch. Du bist so ein Gimpel! Wahrscheinlich magst du auch Zwiebeltürme und weiße Dorfkirchen?
Quirin wusste nicht, was er dazu sagen sollte.
Ist das jetzt irgendwie wichtig?
Er kannte seinen Bruder. Der brauchte nur jemanden, um sich auszuprobieren. Um seine scharfe Zunge zu wetzen. Zwiebeltürme, so beschied der ihn prompt, waren das Letzte. Ungekonnte, unbeholfene, unausgewogene Dinger! Wie Schrauben mit untauglichen Muttern dran. Die drehen sich nur ein kleines bisschen in den Himmel, und dann geben sie schon auf …
Gianna lachte. Solche Überlegungen gefielen ihr.
Das wiederum missfiel Quirin. Also widersprach er. Redete von Ausgewogenheit und Proportionen und merkte gar nicht, dass Damian ihn provozierte.
Ach, Quatsch ‒ Proportionen!, fuhr Damian also fort. Denk mal an den Dom, an die gotischen Kirchen. Die sind Spitze: Die zeigen dem Himmel wenigstens einen Stinkefinger, und zwar gewaltig …
Du bist so ein Idiot …
Nach einer Weile streckte Gianna die Arme aus. Mit ihrer linken Hand griff sie nach Damian, mit der rechten nach Quirin.
Lasst gut sein, bestimmte sie. Und da hielten die Jungen still, schon allein, damit Gianna die Hand nicht fortnähme, und lehnten sich wieder an die Wiese und sahen von oben nun sicher aus wie Jesus mit seinen Lieblingsjüngern, wobei Gianna dann der Jesus gewesen wäre. Über diese Idee musste Quirin lachen, und Damian und Gianna lachten über ihn, weil ihm fortwährend Sachen aus der Kunstgeschichte einfielen. Und schon hatten sich die Jungen wieder einmal von Gianna besänftigen lassen. Einerseits.
Wieder an der Donau, Jahre später, waren die drei zusammen, verloren sich hier aber unter den vielen, verloren sich im Ritual. Die anderen Jugendlichen nickten sich beifällig zu, wenn sich beim Schlendern ihre Wege kreuzten, während die Lässigsten unter ihnen sowieso nicht umherspazierten, sondern Baumstümpfe, die das letzte Hochwasser hinterlassen hatte, wie Sessel zum Herumlungern benutzten, als befänden sie sich nicht am Fluss, sondern in der Wartehalle eines Flughafens, als hätten sie Zeit und seien sowieso nur zufällig hier vorbeigekommen und bestellten vielleicht gleich den nächsten Cocktail. Diese Privilegierten warteten, dass die anderen vorbeidefilierten, um dann mehr oder weniger huldvoll zu grüßen. Blieben die Flaneure zu lange, wurden sie von einer ungeduldigen Hand weitergewedelt. Komm schon, lass gut sein!
Bei diesem Ritual profitierte Quirin zweifellos von Damian, dem Älteren, von Damian, dem Schönen. Wenn man Damian-der-Ältere sagte, klang das schon nach einer antiken Skulptur, und da Quirin so viel zeichnete, wusste er, was da alles mitschwang: weißer Marmor, schöne Gesten, Erhabenheit. Dass Damian schön war, konnte Quirin neidlos anerkennen. Schönheit war etwas zum Zeichnen, es gefiel ihm, Schönheit gab ihm, dem Dicklichen, Unansehnlichen, immerfort Schwitzenden, etwas zu tun. Und außerdem, wo Damian war, war Gianna nicht weit. Damian duldete das Mädchen inzwischen mehr oder weniger in seiner Nähe, vielleicht, weil er es ansehnlich fand, vielleicht nur, weil er bei Giannas Eltern sein Taschengeld aufbessern konnte. Wer wusste das schon?
Quirin hingegen musste Gianna immerfort anschauen. Offen, direkt. Quirin versteckte sein Schauen nicht, er hätte auch nicht gewusst, wie das geht, sich verstellen. Das verwirrte ihn, und am meisten verwirrte es ihn am Fluss. Worauf sollte er sich jetzt konzentrieren? Auf das braune Mädchen, das mit den langen übergeschlagenen Beinen am Ufer saß und gedankenverloren den Schorf von einer Wunde am Knie pulte? Oder auf den Fluss, der sein Recht forderte, der sich rauschend und sprudelnd holte, was ihm zustand: alle Aufmerksamkeit?
Das überforderte Quirin, und so suchte er seine Zuflucht in dem, was er am besten konnte: Er zeichnete. Und abends legte er die feucht gewordenen Blätter in eine Mappe und fand, dass selbst die nach dem Fluss rochen; eine eigentümliche Mischung aus Graphit, Feuchtigkeit und eigener Anstrengung. Das schlug ihm beruhigend entgegen, wann immer er die Mappe öffnete.
Am liebsten war es Quirin, Gianna in der Schule zu beobachten. Da fiel es nicht auf, wenn er zeichnete. Außerdem war Damian, der eine höhere Klasse besuchte, nicht in der Nähe. Die Schule ließ Quirin in Ruhe, deshalb ging er gern hin und wurde, sozusagen aus Versehen, ein guter Schüler. Als ihn doch einmal eine Referendarin ermahnte, den Zeichenstift beiseitezulegen, sagte er ernst:
Aber das geht zusammen, zeichnen und zuhören. Das eine ist innen, das andere kommt von außen.
Die Mitschüler lachten, als hätte Quirin einen Witz gemacht ‒ nur Gianna nicht.
Gianna saß ihm gegenüber im Klassenraum, auf der anderen langen Seite des U, auf einem U-Arm, wie Quirin das sah und wie er ihn manchmal zeichnete ‒ dann mit Federn und bunten Ästchen und kleinen Lampions daran ‒ oder manchmal mit einem phänomenalen Raketenantrieb, der sie weit weg bringen würde, Gianna und ihn.
Gianna saß da, jetzt im Frühjahr mit einem einfachen T-Shirt, so dass man auf den bloßen Armen all die Schrammen und blauen Flecken, die sichtbaren Spuren von den Kämpfen am Wochenende gut erkennen konnte, und Quirin versuchte sich unauffällig an einer Skizze. Gianna selbst bildete die Leinwand, mit bunten Farbklecksen darauf und einigen heftigen Strichen kreuz und quer über den Armen; Gianna, ein verletzter, aber stolzer Vogel, der auf seinem gezeichneten Astarm Platz nähme, um sich einen Moment auszuruhen. Bald würde sie mit ihrem Schnabel durchs Gefieder fahren, heftig, ungeduldig, dann würde sie sich sträuben und plustern, um schließlich ihn zu entdecken, ihn, der unscheinbar, aber geduldig unten am Baumstamm zu ihr aufsah und sie bewunderte, und dann würden sie zusammen auffliegen und weg sein. Für immer.
Dabei wollte Quirin gar nicht weg, er hätte auch gar nicht gewusst, wohin. Aber Gianna verleitete ihn zu seltsamen Träumen. Manchmal brachte ihn das gegen sie auf, meistens aber nicht. Er nahm es hin, wie das Wetter, wie die Donau, wie die Stadt, in der er geboren war und die ihm mehr als genug schien für ein Menschenleben. Schließlich war Regensburg ja nicht eine Stadt, sondern ganz viele. Das eine baute auf dem anderen auf. Regensburg war eine Burg, aufeinander getürmte Geschichte, und in ein paar Jahrhunderten würden auch die Baumärkte und Tankstellen an den Ausfallstraßen Teil dieser ewig wachsenden Burg sein und die Autos vielleicht der Mörtel darin.
Quirin schaute einen Augenblick auf sein Blatt, dann nahm er einen härteren Bleistift und strich alles wieder aus, schwärzte alles: Er wollte keine Bilder von Vögeln zeichnen, er wollte aus Gianna keinen noch so schönen Bussard oder Habicht machen, denn Vögel waren Damians Sache, darin war er ganz groß ‒ und wenn Quirin etwas nicht wollte, dann war es, dass Damian ihm und Gianna in die Quere käme. Gianna und ihm. Ihm und Gianna. Er nahm ein neues Blatt, wischte die Graphitkrümel vom Tisch, begann von vorn.
Eigentlich war sich Gianna nur nervös mit einer nicht ganz sauberen Hand durch die dicken Haare gefahren, immer, wenn sie aufgerufen wurde, ließ sie die Hand dann im Haar, als gäben ihr die dicken, langen, glänzenden Strähnen Halt, und antwortete auf die Fragen irgendeiner Lehrerin, deren Namen sich Quirin auch nach einem Jahr Unterricht nicht merken konnte. Die Lehrer behandelten ihn stets mit Nachsicht; der dickliche, stille Junge, der überraschend gute schriftliche Arbeiten abgab, störte ja nicht.
Um Giannas Haargepluster genau zu sehen, musste Quirin sie beobachten, und er merkte, wie ihn das erregte, diese roten Striche auf den braungebrannten, sehnigen Armen. Er stellte sich vor, dass sie ihn mit diesen Armen umfasste, und dann musste er den Blick abwenden, weil ihm das Ganze Tränen in die Augen trieb.
Quirin war ein seltsamer Junge. Fanden alle. Fand selbst Gianna. Die sich aber nicht damit begnügte, ihn seltsam zu finden, sondern die ihn ihrerseits beobachtete. Die Jugend, ein Gewirr aus Beobachtungen, aus Linien, die kreuz und quer hin- und hergingen, ein Knäuel aus Aufmerksamkeit, Kontrolle, Sehnsucht und Angst.
So sah Quirin das, der natürlich bemerkte, dass sie ihn ebenfalls beobachtete, so wie sie wusste, dass er sie im Auge behielt ‒ nur, dass Gianna daraus andere Schlüsse zog. Sie bezog die Blicke nicht auf sich persönlich. Sie sah sich eher als Teil dieses Blicke-Netzes, als Fußballspielerin hatte auch sie Linien im Kopf, so, wie sie auf dem Fußballplatz die Schritte ihrer Mitspielerinnen, ihre Laufwege verlängerte zu Strichlinien, die sich kreuzten, die sich gegenseitig aufhoben, die sich verlängerten und auf sie zukamen, unaufhaltsam, auf die sie reagieren musste. Aber erst, wenn es Zeit war! Morgen wieder Training. Gianna vergaß Quirin für einen Augenblick.
Sie mochte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sie ließ sich Zeit mit dem Zurückschauen und damit, zu einer Meinung zu finden. Und zwischendrin pfiff sie sich eines. Das war ihr Markenzeichen, ungewollt. Sie pfiff gern leise vor sich hin. Oder summte, wenn sie sich besonders wohlfühlte. So war es auf dem Platz: Torwarte haben normalerweise alle Zeit der Welt. Gianna konnte lange zusehen, wie sich ein Spielzug entwickelte, wie sich ein Angriff aufbaute, wie schließlich irgendeine zentrale Mittelfeldspielerin eine Mitspielerin ausmachte, die nach links ausbrach, nach vorn durchkam und dieser passgenau eine Flanke zuspielte ‒ und dann, ja dann, musste der Torwart aus seiner Stille heraus, musste die stumme Anspannung in federnde Energie verwandeln, musste den Moment des Schusses vorausahnen, lange bevor der Ball tatsächlich abhob, musste Winkel, Geschwindigkeit und Flugbahn sehen, musste den Weg, den die Kugel gleich, sofort, durch die Luft schneiden würde, verlängern und da, am Ende der Schussbahn, mussten seine fangbereiten Arme und Hände sein und sich formen ‒ formen zu einem runden, scheinbar weichen Becken, einem Nest, in das sich der Ball unwiderstehlich senkte, und dann kam er tatsächlich angeflogen, angerauscht, und nichts mehr war Berechnung, sondern alles Rennen und Hechten und Fauchen und Sprung!
Und manchmal fraß Gianna Staub, wie die anderen sagten, und damit hatten sie recht, auch wenn der Staub meistens Matsch war, schwerer Lehm, der nach Feuchtigkeit roch, Gianna schwor: nach dem Fluss, nach der Donau. Die Gegenspielerinnen sagten: nach Tod! Und zeigten der Torwartin heimlich den Mittelfinger, wenn die sich mal wieder zu viel rausgenommen hatte.
Bei Giannas Paraden stand Quirin ganz still. Er hatte, wenn sich die gegnerischen Spielerinnen näherten, längst aufgehört zu zeichnen, das hielt er nicht aus, diese konzentrierte Spannung, die Geschwindigkeit, das Unausweichliche daran, die Passivität, zu der seine Gianna verurteilt war, bis sie emporschnellte, sich zur Seite warf, dem Ball entgegenhechtete, rücksichtslos, brachial ‒ und doch mit der Eleganz eines Tieres, das den einen Moment erwischt, um aus seinem Käfig auszubrechen.
Wenn sie fiel, wenn sich um sie herum die gegnerische Wut und Angriffslust ballte, dann hielt Quirin den Atem an, dann schrie er bisweilen laut auf, laut und gequält, so dass die anderen lachten, weil sie glaubten, er habe ein Tor sehen wollen, wo keines war ‒ dabei sah er doch immer nur Gianna.
Am meisten Angst hatte er um ihre Hände. Quirin wusste, wie gefährdet die bei einem Torwart sind. Oft beobachtete er nur ihre Finger, die lang und sehnig waren, die schon ein paar Narben aufwiesen ‒ und zeichnete Hände und Hände … So, wie die anderen Gianna drohten, so sehr baute er einen Schutz auf, zeichnend. Der half aber nicht immer, schon rasten die Feinde wieder auf das Tor zu, würden, wie es schien, das Mädchen im Kasten gleich umrennen! Quirin kannte die Regeln, ungefähr jedenfalls, aber in solch einem Augenblick des Sturms konnte er nicht glauben, dass sich die Angreiferinnen wirklich daran halten würden, dann begann er innerlich zu zittern und zerbiss vor Aufregung den Bleistift, den er sich achtlos in den Mund geschoben hatte. Ein guter Bleistift, Härte 4B, eigentlich hätte man von Weiche, nicht von Härte sprechen müssen, denn Quirin war gerade dabei gewesen, das Spielfeld vor der Figur im Tor zu schraffieren, schön schwarz und glänzend, wie einen dunklen See, der sich schützend zwischen Gianna und den Angreiferinnen ausbreitete ‒ aber als der Angriff tatsächlich kam, war er schneller, härter, kälter als gedacht ‒ und dann war der schöne Bleistift hin. Schon wieder! Kalifornisches Zedernholz, Quirin hatte einen bitteren Geschmack und ein paar Krümel im Mund. Ärgerlich betrachtete er den zerbrochenen Stift, schüttelte ratlos den Kopf, stampfte ein paarmal mit dem rechten Fuß auf und spuckte kräftig aus. Die Alten hatten Schnupftabak, Quirin seine Bleistiftbrösel. Er nahm sich vor, das beim nächsten Mal zu zeichnen. Er hatte alles genau bemerkt, trotz seines Stiftekummers. Der Verlust bedeutet nichts, sagte er sich. Er bedeutete nur, dass er noch öfters bei Treutlers aushelfen musste. Quirin seufzte. Gern kellnerte er nicht.
Treutlers waren Giannas Eltern und die Pächter in der Klosterschänke. Das heißt, eine Schänke war es gewesen, immer schon, solange die Regensburger denken konnten, und immer schon oder beinahe immer hatten die Treutlers die Gaststätte betrieben: Seit zwanzig Jahren nun führte Lukas Treutler die Geschäfte, wies die wechselnden Bedienungen an, während Rita, seine Frau, mit Argusaugen über Geld und Küche wachte. Ritas Augen glommen dunkel wie Kornelkirschen, die in wilden Büschen rund um das Haus wucherten und die im Herbst, wenn die Früchte fielen, in Netzen aufgefangen werden mussten, bevor man sie zu einer köstlichen Marmelade verarbeitete, deren herbe Süße entzückte. Lukas Treutler hatte nichts unversucht gelassen, erst Ritas Aufmerksamkeit und dann ihre Liebe zu erringen. Es hatte vier Jahre gedauert, bis Rita ihm erstmals zugenickt hatte, dann war sie mit ihm ausgegangen, ins Kino, in das bröckelnde Amphitheater von Taormina, wo im Sommer antike Dramen aufgeführt wurden. Er hatte seinen Regenschirm über sie gehalten, drei Stunden lang, bei einem der äußerst seltenen, warmen, dampfenden Sommerregen, während er gleichzeitig versuchte, sich auf Medea zu konzentrieren. Der Regen hatte alle ausgelassen gemacht: die Schauspieler, die Musiker, das Publikum; der Regen machte das Küssen leicht.
Am nächsten Tag ‒ so war es ihm vorgekommen ‒, jedenfalls aber sehr bald, war Rita zu ihm nach Regensburg gezogen, ihre Mutter mit dabei: Maria Francesca Paladina de Vigilia. Ungeachtet ihres pompösen Namens war sie eine liebenswürdige Frau, eine Matriarchin, sanft und lebhaft zugleich, die Lukas Luca nannte und die alle schon bald Franzi riefen, was sie mit einem Lächeln hinnahm. Sie hatte ihrer Tochter zuliebe, die unbedingt mit Luca nach Deutschland gewollt hatte, ihre Backstube abgeschlossen und war in dieses merkwürdige Alto Palatinato geraten, in die Oberpfalz, wo die Leute noch maulfauler waren als in den Bergen Siziliens. Heimlich reiste Maria Francesca, so oft es ging, nach München, die Pumps im Handgepäck, spazierte die teuren Einkaufsstraßen auf und ab und fühlte sich ein bisschen wie früher in Palermo. Denn Maria Francesca war eine Bäckerin und eine Dame; sie hatte auch kein Allerweltsbrot gebacken, sondern Piadina, das Fladenbrot aus den Bergen, dazu splitterfeine Cannoli, Teigröllchen, in denen man allerhand cremige Köstlichkeiten verstecken konnte, sowie Piniengebäck und Cassata. Das war nun vorbei.
Wenn Maria Francesca über die Maximilianstraße flanierte, so kam es vor, dass sich immer noch Männer nach ihr umdrehten: eine Signora mit einer Aura.
Zu Hause in der Klosterschänke freilich, da galt das alles nicht. Da war sie die Suocera, die Schwiegermutter, die Schweigermutter, wie die Leute spöttelten, denn Maria Francesca tat sich lange schwer mit dem Deutschen und begnügte sich, alles, was sie wollte, mit einem Nicken zu bestätigen und alles, was sie ablehnte, mit einem leisen Neigen des Kopfes zu verneinen. Irgendwann aber legte sie ihr Schweigen ab, sprach ein grollendes, aber überraschend fehlerfreies Deutsch und verriet niemandem, dass sie in München nicht nur zum Flanieren war, sondern auch Deutschkurse besucht hatte. Dass man lernte, und zwar gründlich, war wichtig, fand Maria Francesca. ‒ Aus der Schwiegermutter wurde also die Signora und aus der Signora die Maria und irgendwann eben die Franzi, und Maria Francesca ertrug das alles und freute sich, als nach zehn Jahren Ehe von Rita und Luca aus ihr endlich die Nonna wurde, die Großmutter. Nun hatte sie wieder Grund zu backen und half sogar manchmal in der Küche, wenn der Betrieb zu hektisch wurde und die jungen Köche verzweifelten. Wohin auch immer Maria Francesca sich begab, ordneten sich Dinge, kehrte Ruhe ein, wurden Erledigungen erledigt und Aufträge erfüllt.
Lukas liebte seine Schwiegermutter, obwohl sie etwas Furchteinflößendes hatte in ihrer Perfektion, in dieser seltsamen Mischung aus Wärme und Überblick, aus Herzlichkeit und stiller Härte. Es war eine typisch sizilianische Mischung, hatte Lukas gelernt, die aber bei Rita, seiner Frau, nicht recht aufgegangen war. Die hatte ein weniger ausgeglichenes Temperament, und Gianna kam nach der Mutter, war wild und ungebärdig. Natürlich kämpften die beiden miteinander, sobald Gianna gelernt hatte, nein zu rufen und wegzulaufen ‒ und beide verließen sich auf Francescas Versöhnungskünste.
Als Gianna älter wurde, hatte es keinen Sinn, sie kellnern zu lassen, sie war zu ungeduldig, stürmte mit einem Krug Bier los, während der zweite noch gefüllt wurde, rannte also zweimal, dreimal, siebenmal, wo andere, Umsichtigere, einmal gingen. Und Gianna rannte sowieso immerzu, auch ohne Krug, einfach so ‒ und kam mit den Bestellungen nicht hinterher.
Einen Bewegungsdrang hat die Kleine!
Gut, dass sie den Quirin hatten und den Damian, sagten sich Maria Francesca und Lukas. Die beiden Brüder halfen zuverlässig aus. Kaum, dass sie das entsprechende Alter erreicht hatten, hatten sie sich bei Treutlers vorgestellt, die Mützen verlegen in den Händen gedreht. Die Anzinger-Buben.
Der Anzinger-Vater war der Dorfschullehrer gewesen, als es im Weiler an der Klosterschänke noch eine Dorfschule gab. Seit ein paar Jahren unterrichtete er in Regensburg am berühmten Dom-Gymnasium, aber die Jungen blieben vorläufig im Weiler, mehr schlecht als recht beaufsichtigt, früh daran gewöhnt, für sich selbst zu sorgen.
Wo die Anzinger-Mutter war, wusste niemand so recht. Kaum einer erinnerte sich noch an sie oder mochte sich erinnern. Der Anzinger-Vater hatte damals bei Lukas den einen oder anderen Kräuterbitter gekippt, aber als das überhandnahm, hatte ihn die Großmutter beiseitegenommen, und irgendwie war sie zu dem traurigen Mann durchgedrungen. Der Kräuterlikör wurde weniger, die Buben kamen öfters und besserten sich ihr Taschengeld mit Kellnern auf. Und manchmal zündeten sie heimlich in der Klosterkirche eines der kleinen Lichter an, mit denen man die Maria um Gnade bitten konnte, denn Maria würde doch am ehesten wissen, wo die Mutter war, aber dann wurde das verboten, wegen der Kostbarkeit der Wand und der Deckengemälde, und so hörten die Jungen auf, an Wunder zu glauben.
Einige im Dorf hatten den Anzinger-Vater im Verdacht, Lukas den Floh mit dem feinen Restaurant ins Ohr gesetzt zu haben. Denn in jenem Jahr ‒ die Buben hatten gerade das zweite Jahr Kellnern hinter sich ‒ heckte Lukas einen Plan aus.
Rita, wir müssen reden, sagte er zu seiner Frau, als ob sie das nicht ständig täten. Die Kellnerinnen in der Schänke amüsierten sich, wenn Lukas oder Rita morgens in die Gaststube kamen, schon aufeinander einredend, gestikulierend ‒ und erst nach einer Weile merkten, dass die Angestellten längst auf sie warteten, stumm, die Hände in den Schürzentaschen, in den Kulissen, bereit zum Applaus ‒ oder darauf wartend, dass sie endlich mitmachen durften. Dabei waren das Profis, alle zehn, und jede Minute, die mit der Tändelei der Chefs verstrich, fehlte hinterher bei den Vorbereitungen. Und doch: Sie warteten. Und fanden die turtelnden Chefs ganz schön. Die keine Augen hatten für die anderen.
Schau nur, wie sie wieder schwätzen!, sagte Martin.
Wie der Fluss!, bemerkte die alte Bärbel. Immer am Rauschen, immer am Tun. Haben die sich denn nie satt?
Martin, die Spülhilfe, ließ die Bürste sinken:
Glaub ich nicht. Schauen doch immer ganz fröhlich aus, ganz zufrieden. Er griff nach dem nächsten Teller, seufzte über die angetrockneten Krusten.
Was ist?, fragte Rita, die sofort den feierlichen Ton herausgehört hatte, einen Ton, der sie unruhig machte.
Anstelle einer Antwort drückte Lukas sie sanft auf einen Stuhl und zog ein paar Papiere hervor. Unverwandt schaute er Rita an. Und das verfehlte seine Wirkung nicht.
Die Angestellten seufzten: Das würde dauern. Unauffällig wandten sie sich ab, ihren Aufgaben zu, so gut das eben ging ohne Anweisungen, ohne Hinweise zur Tageskarte, zu Besorgungen, die in letzter Minute noch zu erledigen wären. Wenn Lukas einen auf diese Weise anschaute, war man verloren. Und am wenigsten Gegenwehr hatte Rita zu bieten. Selbst sie war machtlos gegen diesen Frontalangriff von Blau. Lukas' Augen. Die jetzt, im Juli, noch unverschämter leuchteten in dem sommerbraunen Teint. Wie Blaubeeren auf Toast!, hatte Gianna einmal gemeint, als sie zusammen mit Quirin nach Bildern für Papas Augen gesucht hatten. Sofort hatte Quirin das gezeichnet: Blaubeeraugen auf Gesichtstoast!
Heute aber verließ sich Lukas nicht allein auf seine Augen. Er redete vielmehr auf Rita ein und gestikulierte dabei, als käme nicht Rita, sondern er selbst aus Palermo. Und Rita folgte seinen Augen, seinen Händen. Versuchte, sich diesem Sog zu entziehen, und schaffte es nicht. Sie konnten gar nicht scheitern, meinte Lukas. Nicht hier, nicht in dieser Lage. Mit diesen Massen von Gästen! Reisebussen! Fähren! Pilger, die ihre Sorgen vor die Heiligen trugen, Kunstliebhaber, die die berühmten Gemälde in der kleinen Kirche bewundern wollten! Das Risiko war gering, lachhaft gering ‒ und hatte sie nicht auch einmal Lust auf etwas Neues? Meine Schöne! Er streichelte ihre Wange.
Martin und Bärbel versuchten, unauffällig zu lauschen. Es war klar: Die beiden beredeten etwas, was auch sie betraf. Es ging um die Küche. Es ging um die Zukunft. Neue Begriffe fielen, komplizierte. Und immer schneller redeten Lukas und Rita, immer lauter wurden sie, als könnten sie mit ihrem Reden die Zukunft schon jetzt herbeiholen. Bärbel und Martin schauten sich an: Was würde werden?
Gianna beobachtete in den folgenden Wochen und Monaten den Streit, der sich in der Küche zutrug: Osso buco gegen Schweinsbraten, Avocado-Dip mit Garnelen gegen den kleinen gemischten Salat. Boeuf à la mode und Tiramisu gegen Kaminwurzen und sahnige Quarkspeisen, in denen der frische Rhabarber ersoff. Weiterhin mogelte Hans, der Koch, seine schweren Saucen an die neuen, leichten Filets, stellte der Beikoch ungerührt Bratkartoffeln her, fand Nelly, die sich jetzt Patissière nannte, die Soufflés zu kompliziert in der Herstellung und buk lieber Pfannkuchen. Es war ein Streit, der nicht gut ausgehen würde, das ahnte Gianna, es war ein Streit, der alles verändern würde ‒ aber anders, als Lukas sich das ausgedacht hatte. Und doch, bei aller Sorge und aller Furcht, die jetzt in das Haus einzogen, fand Gianna die Küchenkonkurrenz in der Klosterschänke faszinierend: als wäre es ein Streit, den ein Mensch allein mit sich selbst ausfocht … Wohin sollte es gehen? Wie wollte man leben? Alles Alte über Bord werfen und neu anfangen? Oder das Alte behalten und das Neue dennoch Raum gewinnen lassen? Wer behielt die Oberhand? Und wer entschied über die Reise?
Immer öfter hielt sich Gianna in der Küche auf, obwohl es dort mit jedem Tag ungemütlicher und hektischer wurde. Sie probierte die seltsamen Speisekombinationen, die hier versucht wurden, sie sah das Durcheinander auf dem sonntäglichen Brunchbuffet. Kochen, lernte Gianna, war ein Feldzug, eine Schlacht, jeden Tag. Die musste entschieden werden, das duldete kein Zögern und kein Zaudern. Das Kochen ertrug keine Verwalter des Mittelmaßes, es verlangte Entschiedenheit, es verlangte einen Meister. Gianna spürte ein Zittern, wenn sie daran dachte, eine Aufregung. Um sie herum wurde es lauter, noch fahriger ‒ bis irgendwann alles zum Stillstand kam. Die Gäste waren erst verwirrt, dann besuchten sie den Gasthof seltener, wurden weniger und blieben schließlich aus. Am Ende stand die Kochbrigade stumm in der Küche. Und da wussten alle, dass es vorbei war. Lukas' Experiment war gescheitert. Der Gasthof ‒ am Ende.
3. Aufgeben
Die Suppentassen und die Unterteller, die Dessertschalen und die Saucieren, die Zuckerschalen und die Milchkännchen, die Vorlegegabeln, Löffel, Messer, die Fischbestecke und die Réchauds, die Schraubgläser für den Zucker, die Olivenöl- und die Essigflaschen, die Bierseidel, die Weißweingläser, die Sektflöten, die Karaffen, die Vasen, die Kerzenleuchter, die Aufsteller: Tagelang packten Rita und Francesca, packten, bis ihre Finger schwarz von der Druckerfarbe des Zeitungspapiers waren, packten von morgens bis abends und bis tief in die Nacht, während Lukas in stummer Verzweiflung zusah. Unter ihren Händen verschwanden Glas und Porzellan in schlechten Nachrichten, Tag für Tag schleppten Quirin und Damian neue alte Zeitungen heran. Die schweren Pastateller wurden in Wieder Flussfest mit Besucherrückgang gewickelt, die Teekännchen rollten sich in Millionenkredit für betrügerischen Bauträger. Besteck ließ sich einwickeln von Spinnenjagd: Discounter zahlt mit. Die alte und die neue Zeit stießen aufeinander. Die Geschichte der Klosterschänke verschwand in den Schlagzeilen.
Alles wurde verpackt und weggeschafft. Rita hatte das Inventar noch zu einem annehmbaren Preis verkaufen können. Und die Stühle mit den Schnitzereien, die Bänke und die Tische, die Abfüllanlage, der Tresen? Noch hofften die Treutlers auf einen Nachfolger, der das übernähme.
Am letzten Abend strich Lukas mit der Hand stumm über die alte Anrichte, strich über das Buffet, über die Wände und Türen, berührte jeden Griff und jeden Knauf, schlich umher wie ein Erblindender, der sich alles ein letztes Mal einprägen will, jeden Weg und jede Handreichung, die hier noch bis vor kurzem nötig gewesen war. Jetzt war alles stumm, die Gegenstände schwiegen, der Raum wandte sich von ihm ab.
Später saßen Francesca und Rita im Halbdunkel an einem Tisch.
Cara mia, das wird schon wieder, sagte Francesca und nahm die Hand ihrer Tochter.
Wird es nicht, sagte Rita. Sie sah zu Lukas hinüber, der ihrem Blick auswich.
Zwei Tage später war Rita abgereist. Sie hatte bis zuletzt an der Seite ihres Mannes ausgehalten, aber dann hatte sie sich von einem Taxi zum Bahnhof bringen lassen, war nach München gefahren, hatte dort ein Flugzeug nach Rom genommen, weiter nach Palermo und meldete sich ein paar Tage später mit einem Fax. Das Gerät im leeren Kontor der Klosterschänke funktionierte noch immer, es piepte kurz, dann sprang es geräuschvoll an und rückte die Botschaft schließlich schnarrend heraus. Das Fax aber rollte ins Leere, weil niemand da war, es entgegenzunehmen, und so war es ausgerechnet der Insolvenzverwalter, der es eine Woche später Francesca in die Hand drückte: Bitte sehr, eine Nachricht für Herrn Lukas.
Da war der Herr Lukas aber längst unterwegs nach Sizilien. Er konnte sich denken, wohin seine Frau geflohen war ‒ und je mehr er sich Palermo näherte, je näher die Wärme, der allgegenwärtige Dreck und der Lärm der sizilianischen Stadt kamen, umso leichter wurde sein Herz. Nein, Rita hatte ihn nicht verlassen. Rita war nur nach Hause zurückgekehrt. Das war ein Unterschied, auf den Lukas für sich bestand. Ihm war klar, dass seine Familie immer Probleme mit beidem haben würde: mit dem Weggehen wie mit der Heimkehr. Als das Flugzeug aufsetzte, rieb er sich müde die Augen; die blauen Augen würde er brauchen.
Francesca und Gianna blieben ein paar Tage allein in dem stillen Weiler. In der dunklen, leergeräumten Klosterschänke schauten sich Großmutter und Enkelin verblüfft an. Wie Tiere, die sich erst einmal schütteln müssen. Gianna pfiff eine neue Melodie, unsicher noch, unstet, die Melodie hatte keinen rechten Anfang und keine Harmonie. Zu viel war geschehen in zu kurzer Zeit.
Ein paar Tage später schon hatte sich Francesca eingerichtet. Sie ließ ihre Kontakte spielen, ganz Dame, ganz Übersicht. Ein Häuschen am Altwasser, mitten in Regensburg, wurde das neue Zuhause. Zwei Zimmer unten, zwei oben ‒ und davor der Fluss, der gemütlichere Teil der Donau, der ältere. Das Häuschen passte nicht zu ihr, es war zu großmütterlich, fand Francesca und seufzte über das kleine, bunte Stiegenhaus. Aber der Enkelin gefiel es, gerade, weil es so eng und bunt und beschwerlich ‒ eben großmütterlich war. Ein Trosthaus, ein Kummerhaus, warm und übersichtlich. Warum nur, dachte Francesca, machten sich schon Kinder ein so genaues Bild von der Welt? Und ein Kind war Gianna doch noch mit siebzehn?
Eigentlich hatte Francesca andere Pläne. Eigentlich hatte Francesca nach München gehen wollen. Sie hatte sich dort nach Wohnungen und kleinen Apartments umgesehen, ein Theaterabonnement erwogen und einen Tanzkurs, verlockt von der Aussicht auf die Großstadt, auf ein neues Leben, und verlockt möglicherweise auch von einem gut gekleideten älteren Herrn, dessen Vorrat an geistreichen Bonmots wie an eleganten Einstecktüchern offenbar unerschöpflich war. Aber dann: die Enkelin. Ihre Verlorenheit und Verwirrtheit, ihr Zorn. Und so gab Francesca ihre Pläne auf, mietete das Häuschen, renovierte und strich so flüchtig, als sei das Haus kein Haus, sondern ein hingehuschtes Aquarell, denn es war dringend, dass sie einzögen, dringend, dass sie zur Ruhe kämen. Und dann bettete Francesca den Kopf des Mädchens auf ihrem Schoß, sagte Sch … sch …, ließ sie weinen und sang ihr gelegentlich sizilianische Wiegenlieder vor, deren Texte sie allerdings, nach so vielen Jahren in Deutschland, unauffällig improvisierte.
Buona notte bambino mio, buona notte angelo mio, la mammina mai tornerà.
Ma eternamente per te lei pregherà … ‒ Nein, so etwas ging nicht. Die Mama würde wiederkommen, die Mama und der Papa auch. Dormi, bambina mia …
Francesca, die Selbstsichere, war zum ersten Mal unzufrieden mit ihrem schönen, schlanken, altgewordenen Damenkörper und hätte sich einen »richtigen« Großmutterleib gewünscht: breithüftig und warm. Dann könnte sich Gianna ausruhen, ausweinen in ihrem bayerischen Großmutterschoß. So aber war es unbequem, wie sie beide einräumen mussten, das war nichts, dieses Geliege bei der schlanken italienischen Dame, die versuchte, eine oberpfälzische Großmutter zu sein, und so saßen sie bald nebeneinander, die Großmutter und die Enkelin, beide stolz und hoch aufgeschossen und hielten einander bei den Händen. Es sah aus, als sei die Jüngere ein Spiegel der Älteren. Die Jüngere hatte immer schmutzige Hände. Und die Ältere sang. So gingen der Herbst ins Land, der Winter und ein weiteres halbes Jahr.
Rita und Lukas waren längst aus Sizilien zurückgekehrt, kleinlaut, unsicher und hatten bei der Großmutter angeklopft. Die empfing sie recht kühl, servierte Mandellikör und kleine Küchlein, und so lockerte sich bald die Stimmung, und sie kamen ins Reden. Die verlorenen Eltern. Sie hatten sich wiedergefunden, aber doch die Tochter im Stich gelassen. Wer sollte das verstehen? Dann kamen sie wieder und noch einmal wieder, und irgendwann war es beinahe normal, dass die Eltern sich als Besuch einstellten und Francesca und Gianna für sie kochten.
Sie kochten aber nicht einfach so. Nichts Unüberlegtes. Schon der Mandellikör hatte es in sich. Bitter und süß war er. Brachte den Sommer herbei, die Liebenswürdigkeit Italiens. Brachte die Erinnerung zurück, den Schmelz, gewiss ‒ aber eben auch den Schmerz. Und die kleinen Küchlein, die Francesca dazu servierte, verstärkten den schönen Schmerz noch, weil Kardamom und Kaffee darin versteckt waren: ätherische Öle einerseits, die Linderung versprachen, dazu aber Kaffee, der unruhig machte, der verhinderte, dass die aufgewühlten Sinne zur Ruhe kamen.
Nur ein kleines Dessert, meinte Francesca zufrieden. Aber es sagt alles!
Woher hatte sie das nur?, fragte sich Gianna.
Wir hatten früher nicht viel zu sagen, meinte Francesca.
Sie konnte Gedanken lesen, wie es schien. Frauen in Sizilien waren mächtig. Aber nur, solange sie sich an das allgemeine Schweigen hielten.
Schweigen? In Italien? Gianna musste lachen.
Schweigen. In Italien, sagte die Großmutter ernst.
Es gab vieles zu beschweigen. Vor allem die Unterschiede in einer Nation, die sich gerade erst mühsam zusammengefunden hatte. Da waren die Norditaliener und die armen Verwandten im Süden. Mit denen wollte man nicht viel zu tun haben. Und dann erst die Sizilianer! Diese Wilden, diese halben Afrikaner! Einig waren sich aber alle darin, dass besonders auf die Frauen achtzugeben war. Diese unberechenbaren, schönen Frauen! Ihnen gegenüber waren sie misstrauisch, die Männer. Ihre Verehrung hatte etwas Bezwingendes, etwas Kontrollierendes. Sie waren noch nicht zufrieden, wenn sie aus den temperamentvollen Schönen, den auffahrenden Mädchen genauso reizvolle Bräute gemacht hatten, verwirrte junge Ehefrauen. Nein, Ruhe konnte es erst geben, wenn die Kinder da waren ‒ viele Kinder, um die Frauen endlich zur Vernunft zu bringen, also: ins Haus.
Francesca seufzte. Es war klar, dass ihr diese Regeln nicht gefallen hatten.
Und was hat das mit dem Kochen zu tun?
Alles.
Es war Francescas Art gewesen, sich zu wehren. Es war ihr Weg gewesen, das Schweigen zu durchbrechen und sich Gehör zu verschaffen. Auf eine einzigartige Art, bei der niemand widersprach und jeder, zumeist ohne es zu bemerken, sich ihre Sicht auf die Welt buchstäblich einverleibte. Francesca lachte. Ladino hatte es verstanden.
Ladino?
Zum ersten Mal hörte Gianna den Namen ihres Großvaters. Aber Francesca machte eine abwehrende Handbewegung, als Gianna nachfragen wollte.
Ein anderes Mal …
Und so kochten sie gemeinsam. Kochten gegen das an, was man nicht erzählen konnte, das sich aber zwischen ihnen breitgemacht hatte wie ein hartnäckiger Küchendunst. Sie kochten an gegen die Verzagtheit. Sie kochten für Lukas und Rita, kochten gegen die Fremdheit an, die zwischen ihnen gewachsen war. Sie kochten, um die Wärme zurückzuholen, sie kochten um Nähe, um Verbundenheit. Sie kochten: Spaghetti à la siciliana, mit vielen Zwiebeln. Und einer sanften, tiefen Melodie, die Gianna eher brummte als pfiff.
4. Geheimnisse
Francesca und die Enkelin wurden einander vertrauter denn je. Und doch gab es etwas, das Gianna nicht erzählte. Auch beim Backen nicht.
Zunächst der Teig: Mehl, Rotwein, Zucker, das Schweineschmalz, das der alte Nachbar aus dem Weiler mitgebracht hatte, der schlachtete noch selbst. Im Schweineschmalz ein paar Nadeln: Tanne, Rosmarin. Eine Prise Zimt, so sorgfältig auf der Messerspitze balanciert, als handele es sich um eine seltene Droge ‒ und das war dieser Zimt ja auch, aus Sizilien, von Hand gerieben, mit Vorsicht und Geduld, auf der alten Reibe, auch die ein Mitbringsel aus Taormina. Sie buken Cannoli, brachten arabische Süße in den Regensburger Alltag, denn es waren die Araber gewesen, denen Sizilien seine eigentlichen Köstlichkeiten verdankt: Anis und Artischocken, Orangen, Aprikosen und Mandeln … Die Großmutter war für den Teig zuständig.
Gianna rannte nach den Zutaten für die Füllung: gehackte Pistazien, fast ein Pfund Ricotta, Schokostückchen, kandierte Kirschen im Überfluss. Die hatten im Tontopf in der Speisekammer gedämmert. Gianna hob den Deckel: Es roch betäubend, es raubte einem den Atem. Gianna trug die Sachen in die Küche. Zwei Tische für zwei Bäckerinnen: Mischen und kneten, walken und rollen, das war Francescas Sache. Durch Siebe streichen, hacken und rühren, füllen und bestreuen, das war Giannas Part. Sie arbeitete ein, sie arbeitete unter. Sie brachte, so stellte sie es sich summend vor, auch ihr Geheimnis in den Cannoli unter. Das war Frauenbrauch von jeher. So hatte es Francesca sie gelehrt. Womit man nicht fertig wurde, was einen schier umbrachte vor Sehnsucht ‒ hinein damit in die Cannoli! Und so war in manch bravem, sizilianischem Haushalt im Sonntagsdessert für den Familienvater fremde Sehnsucht untergebracht, ein diebischer Gedanke an den Nachbarn, den starken Schlosser, den durchreisenden, charmanten Händler. Cannoli, sagten die Leute auf Sizilien, machten erfinderisch. Und Erfindungsreichtum ist gefährlich.
Giannas Geheimnis war dagegen lächerlich. So wollte sie es jedenfalls sehen. Aber sie konnte nicht darüber sprechen, solange sie nicht wusste, welche Farbe sie dem Ganzen geben sollte. War das nun rotschön und schwer gewesen? Oder grünhell und leicht? Auch beim Kochen stellte sich Gianna ihr Gericht immer in Farben vor, als ein Bild, das eine bestimmte Stimmung vorgab. Auf diese innere Farbe kochte sie hin. Das hatte Francesca ihr beigebracht. Sie verstand freilich noch nichts vom Kochen, das wusste sie. Kochen war komplex, Kochen erforderte Geduld, und alles, was Geduld erforderte, machte ihr Angst. Vom Küssen verstand sie genauso wenig. Sie lachte, wenn sie darüber nachdachte. Was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Und doch? Vielleicht war es so leichter? Wenn sie sich Quirins Kuss als eine Mahlzeit vorstellte? Sie musste kichern. Das war nun wirklich nicht schwer! Wenn Quirins Kuss eine Mahlzeit war, dann war das wohl eine Quarkspeise ‒ oder nein, eher Panna cotta, die schwerere Variante, nicht so süß, harmlos eigentlich ‒, aber für eine Nachspeise doch enorm sättigend und dabei weiß und kühl. Kühlendes Brot. Ja, Weiß passte gut.
Und Damian? Gianna schluckte, als schluckte sie noch an dem Kuss, mit dem Damian sie überrascht hatte ‒ hinterher, nach Quirins Kuss. Eigentlich hatte er ihr diesen Kuss eher gestohlen, sich in ihre Arme geschmuggelt, behände wie der Panther, den sie einst im Nürnberger Zoo bewundert hatte: dunkel und gefährlich und sehr, sehr bestimmend. Damians Kuss, überlegte Gianna, hatte rot geschmeckt, auf jeden Fall Rot, die leuchtende Farbe reifer, unverschämter Tomaten. Ein Kuss … eher wie Bruschetta: eine Vorspeise, scharf, knisternd und knusprig, man weiß, dass da noch mehr kommt, und kann sich dennoch nicht beherrschen. Bruschette verführen und füllen ‒ aber sie machen nicht satt.
Spinnst du?, hatte sie zu ihm gesagt und sich wütend den Mund abgewischt.
Vielleicht, hatte er frech geantwortet. Und gegrinst.
Sie hätte ihn am liebsten … Ja, was? Sie schrak hoch:
Gianna, wo bleibst du denn?
Sie raffte die Sachen zusammen und ging zurück in die Küche.
Francesca beobachtete sie. Gianna mischte und rührte, war aber mit den Gedanken woanders.
Zunächst den Ricotta durch ein Sieb streichen. Die glatte Masse glitt hinein, sie bildete eine Mulde, tropfte. Gianna nahm einen Löffel, übte sanften Druck aus. Das fiel ihr stets schwer, diese schöne, glatte Masse zu zerstören. Es stand am Anfang jeden Prozesses in der Küche: Die besten Zutaten nehmen, die man bekommen konnte ‒ aber sie nicht lassen, wie sie waren. Drehen und wenden, überprüfen, durchstreichen, sieben, wenden ‒ manchmal kam ihr dieses ganze Kochen und Backen alles vor wie ein einziges Hinterfragen. Nun Zucker und Vanille hinzu. Wo waren die Vanillestangen? Die Großmutter hielt sie ihr stumm entgegen.
Bruschette! War das nicht viel zu gewöhnlich für Damian? Aber nein, etwas … Gewöhnliches hatte dieser Kuss schon gehabt, etwas … allzu Geübtes. Quirin hingegen …
Sie zog vorsichtig eine der schwarzen Stangen aus dem Glasröhrchen. Sahen aus wie Lakritze, diese Wunder an Würze. Waren fein wie Wurzelwerk, so nachgiebig auch. Und es war nicht so einfach, ihnen den letzten Krümel der Kostbarkeit zu entreißen. Also die Vanilleschoten auf ein nicht zu hartes Holzbrett betten, der Länge nach teilen, mit einem spitzen Löffel auskratzen. Gianna beugte sich über das Brett. So hatte sich Quirin über sie gebeugt: konzentriert, die Zunge zwischen die Vorderzähne geklemmt, als hätte er noch nicht vorgehabt, sie im nächsten Augenblick zu küssen. Aber da hörten die Vergleiche schon auf, sein Kuss hatte nichts Forderndes gehabt, er hatte nichts von ihr verlangt, nichts aus ihr herausholen oder herauskitzeln wollen, er hatte ihr vielmehr gegeben. Sich. Sein Kuss war weich und warm, aber entschieden gewesen, als hätte er lange nachgedacht und nun genau gewusst, was er sagen wollte. Gianna hatte auf dem zerschlissenen Sofa im Brüderzimmer gesessen, sie hatte, was Quirin missbilligte, bei seinem Bruder eine Zigarette geschnorrt und unbeholfene Rauchschwaden über Quirins Zeichnungen geblasen ‒ eher gepustet, denn dosieren konnte sie das alles noch nicht so recht. Es waren Zeichnungen von Donaubäumen gewesen, Quirin hatte das Grafische in ihnen gesehen, es waren Dreiecke, Trapeze, Bäume wie Segel, die auf der Donau davonfuhren. Oder kamen sie ihnen entgegen? Gianna hatte die Blätter hin und her gewendet, es war bisweilen nicht ganz klar gewesen, wo oben und wo unten war, dabei hatte sie ein wenig auf das Sofa geascht, aus Versehen, aber hier kam es wirklich nicht mehr darauf an. Quirin hatte die Asche beiseitegestreift, mit der Linken vom Sofarand in die Rechte gekehrt, dann gestutzt und die Asche auf ein Blatt Papier auf dem Schreibtisch geworfen, sich die Hände an der Hose abgewischt. Damian hatte ihn ausgelacht ‒ Damian, der wie immer im Türrahmen lehnte, Damian immer im Gehen oder gerade zurück, wer wusste das schon? ‒, und dann war Quirin plötzlich mit ein, zwei Schritten bei ihr gewesen, hatte sich über sie gebeugt, hatte ihr Gesicht in beide Hände genommen, als wollte er Maß nehmen. Tatsächlich dachte Gianna zuerst, dass er sie vielleicht zeichnen wollte, aber dann sah sie Quirins Blick, anders als sonst, sehr, sehr zärtlich und hörte, wie er sagte: Niemand schaut meine Bilder so an wie du, Gianna.
Und dann waren seine Lippen auf den ihren. Und sie hatte das Gefühl, in ein großes und weiches und festes Kissen zu sinken. Das war schön. Aber es hörte allzu schnell auf. Gerade hatte Gianna beschlossen, diesem Gefühl noch ein wenig nachzulauschen, als sie andere Hände auf ihren Schultern spürte, härtere, fast wütende. Da war so etwas wie ein kalter Wind im Zimmer.
Du bist ein Trottel, sagte die Stimme, die zu diesen Händen und dem kalten Wind gehörte ‒ und es war klar, dass die Stimme Quirin meinte und nicht sie.
Gianna, schau mich an!
Sie schlug erschrocken die Augen auf. Damian blickte ihr fest in die Augen. Geradezu finster, fand sie. Sie entdeckte kleine gelbe Flecken in seinen Pupillen.
Jetzt machen wir beide das mal richtig, ja? Gianna nickte. Dann verschwanden die kleinen gelben Flecken, denn auch Damian küsste sie, schnell, heftig, als führe gleich sein Zug ab, als wartete jemand auf ihn und er wollte ihr nur dringend etwas sagen. Ein für alle Mal! Dass du es nur ja nicht vergisst! Hatte er tatsächlich so etwas gesagt? Wohl kaum.
Gianna klaubte den kleinen Hammer aus der Besteckschublade, füllte die geschälten Pistazien in eine Tüte, verschloss sie. Ein Schlag zuerst, dann viele kleine hinterdrein. Die Pistazien tanzten. Sie hatte beide Jungen geküsst. Schwindlig war ihr nur bei einem geworden.
Wie lange brauchst du noch?, fragte Francesca.
Aber in ihrer Frage lag kein Vorwurf. Sie wusste: Gianna musste einiges unterbringen in ihren ersten sizilianischen Cannoli. Sie sah zudem die Ungeduld in Giannas Händen, das Zucken in ihrem Gesicht, das von Anspannung erzählte, ja womöglich: von einem Kampf. Sie beobachtete, wie das Mädchen hin- und herlief, erst die Pistazien holte, dann das Hämmerchen, obwohl beides doch in derselben Ecke der Küche untergebracht war. Nicht effektiv, das Kind, nicht zielgerichtet! Leicht abzulenken und eher mutig als genau. Und alles war Körper an diesem Kind, alles war Arme, Beine, Hände, Füße und immerzu in Bewegung.
Bald war wieder Samstag. Seit sie allein lebten, sehnte Francesca, das musste sie zugeben, ein wenig die Samstage herbei, die Spieltage des Fußballvereins. Denn das Training allein reichte Gianna schon lange nicht mehr. Zweimal in der Woche trafen sich die Mädchen. Aber die richtige Spannung, das Fieber, die Konzentration, die erreichte Gianna nur bei den Spielen. Dann tobten sich die angespannten Nerven aus. Anschließend kam sie nach Hause ‒ ich bin total tot, Franzi! ‒, warf sich auf einen Sessel und redete und redete. Und Francesca fragte sich, was die Welt wohl mit diesem Energiebündel anfangen sollte. Und liebte ihre Enkelin sehr.
5. Veränderungen
Quirin suchte in seinem Jungenzimmer im Weiler alle Zeichnungen, die er von Gianna gemacht hatte: Gianna spielend, Gianna tanzend, Gianna in der Schule, mehr oder weniger aufmerksam zuhörend, Gianna und ‒ er runzelte die Stirn ‒ Damian, einander zugewandt, einander abgewandt. Reine Bewegungsstudien waren das gewesen, nicht mehr. Und doch! Quirin widerstand dem Impuls, die Blätter zu zerreißen. Stattdessen stapelte er sie sorgfältig, ging einen Karton suchen, verstaute alles darin und verschnürte das Ganze.
Damit machte er sich auf. Er fuhr mit dem Fahrrad nach Regensburg. Unterwegs begann es zu regnen. Quirin zog seine Jacke aus und wickelte sie um den Karton, der auf dem Gepäckträger festgeschnürt war. Und so sahen die Männer in der Werkstatt der Dombauhütte einen triefenden jungen Mann in den Hof radeln, der das Fahrrad abstellte, eilig ein Paket losschnürte, es in die Arme nahm, in die Werkstatt eher schoss, als dass er hereingekommen wäre, und sich schüttelte wie ein junger Hund. Sie ließen die Werkzeuge sinken.
Kann es sein, dass du es ein bisschen eilig hast, junger Mann? Das war Saiblinger, der Vorarbeiter, ein baumlanger Kerl, der mit Stolz die traditionelle Kluft trug: rotes T-Shirt unter der hellen Zunftweste, die Arbeitshose mit dem hochgezogenen Bund, schwere Schuhe. Darüber ein offenes, waches Gesicht ‒ und ein Zopf, der beim Reden hin- und herwippte. Nein, konventionell waren die hier kein bisschen! Seine blauen Augen zuckten.
Der Eingang ist eigentlich dort! Saiblinger wies zur Stirnseite des Gebäudes. Quirin hatte eine Tür an der Querseite genutzt.
Hierdurch bringen wir nur die Steine.
Saiblingers Stimme war ohne Tadel, eher amüsiert. Er nahm ein paar Zeitungen, die überall herumlagen, zog einen Hocker heran, legte die Zeitungen ab, klopfte mit der Hand darauf:
Nun komm, setz dich.
Und zu den anderen: Genug geschaut. Weitermachen. Und du, Peter, hol einen Kaffee.
Der Angesprochene erhob sich, die anderen wandten sich ab, setzten ihre Werkzeuge wieder an. Quirin wischte sich das Regenwasser aus dem Gesicht und den tropfenden Haaren. Er setzte sich vorsichtig. Der Vorarbeiter Saiblinger hatte anscheinend alle Zeit der Welt. Er zog einen zweiten Hocker herbei, setzte sich zu Quirin. Der wagte kaum zu atmen. Saiblinger war eine Institution in Regensburg. Vielleicht noch besser angesehen als sein Chef, der Dombaumeister. Denn dessen Job hatte viel mit Repräsentation zu tun, er war oft unterwegs und charmierte die Politiker, so nannten es die Leute, wenn bei den offenbar zahllosen Gremiensitzungen und Ausschuss-Versammlungen geredet werden musste. Dann war der Dombaumeister ein gefragter Mann. Er sorgte dafür, dass das Geld floss. Und er machte die Pläne. Die Verantwortung, die viele Büroarbeit, die langen Sitzungen ‒ das alles hatte ihn frühzeitig altern lassen.
Dass aber schon morgens um sechs in der Werkstatt das Licht anging, dass es von da hämmerte, bohrte und feilte, dass die Skulpturen im Gärtchen der Werkstatt nicht weniger wurden ‒ dafür sorgte der Vorarbeiter. Ein ganzer Kerl, sagten die Leute anerkennend, wenn er mit seinen kräftigen Schritten eilig vorüberging.
Jetzt nahm er dem Kollegen, der den Kaffee brachte, die beiden Becher aus der Hand und stellte sie neben sich und Quirin auf den Boden.
Milch haben wir gerade keine.