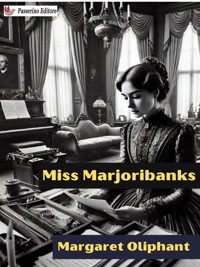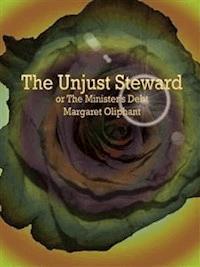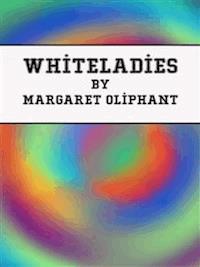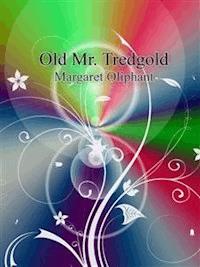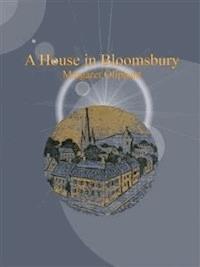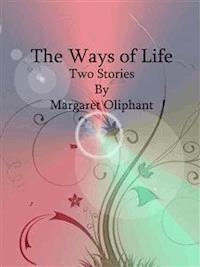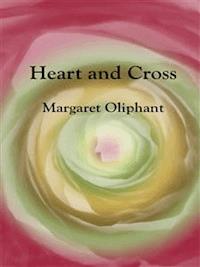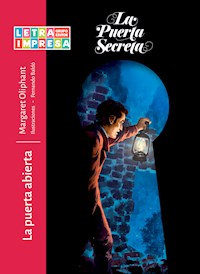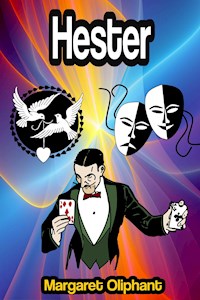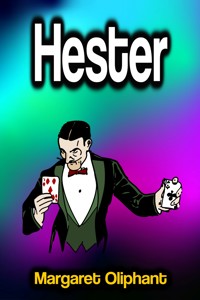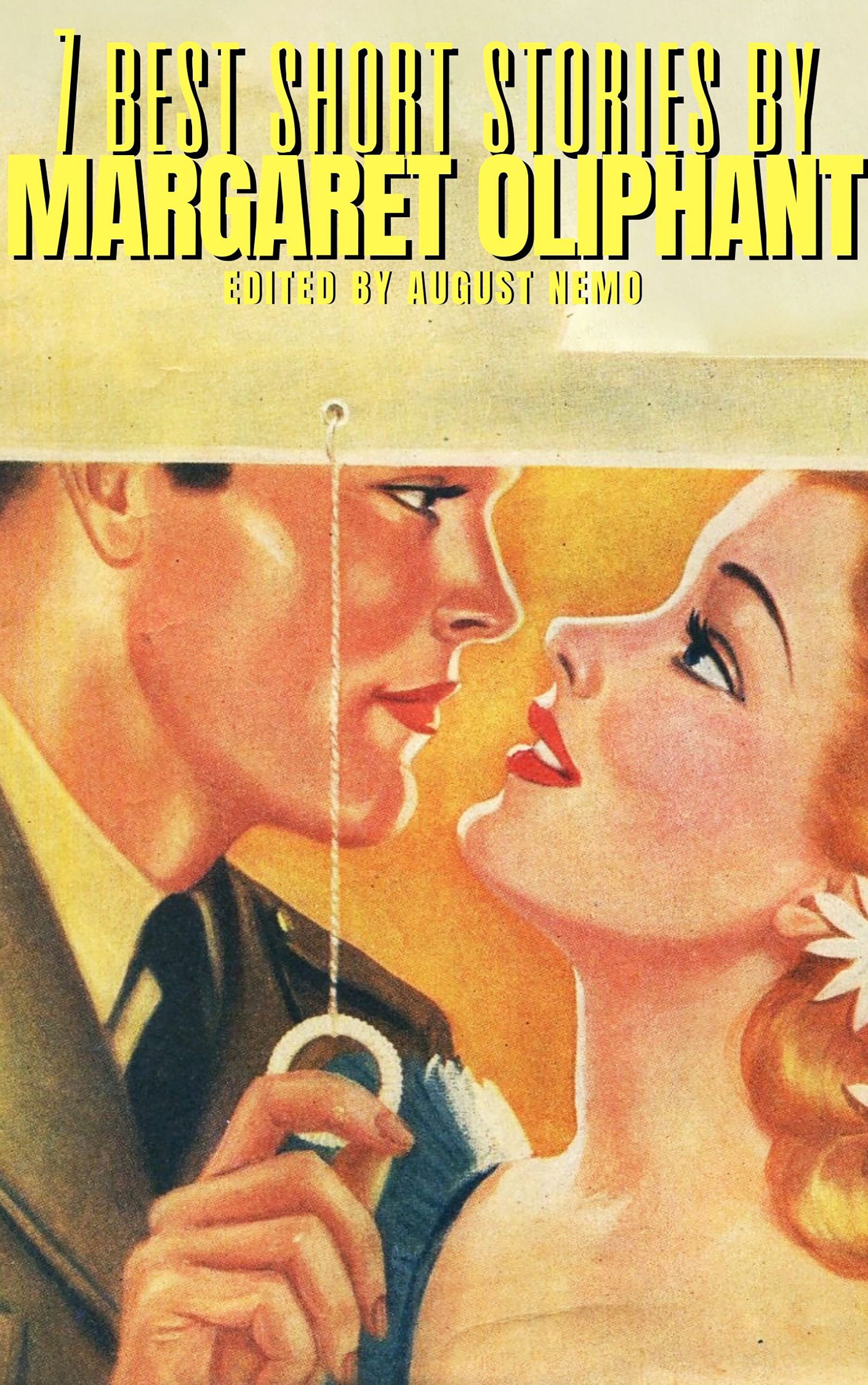Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auch für die Tochter eines Dukes kann das Leben manchmal schwer sein: Obwohl die schöne Lady Jane sich vor Verehrern kaum retten kann, weist ihr Vater, der stolzeste Mann in England, alle zurück. Doch das Herz Lady Janes ist bereits vergeben – an den attraktiven und erfolgreichen Mr. Winston, der seinerseits von Jane hingerissen ist. Doch wie nun den sturen Vater überzeugen? Denn einen Adelstitel hat Mr. Winston leider nicht ... Eine leichtfüßige und amüsante Erzählung aus dem viktorianischen Großbritannien. -
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Margaret Oliphant
Die Herzogstochter
Übersezt von Ferdinand Franz Mangold
Saga
Die Herzogstochter
Übersezt von Ferdinand Franz Mangold
Titel der Originalausgabe: The Duke's Daughter
Originalsprache: Englisch
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1894, 2022 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728447970
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
»Fräulein, seid Ihr hier, um mit diesem Grafen vermählt zu werden?« »Ja.« Viel Lärm um Nichts –
Erstes Kapitel. Ihre Eltern
Die Herzogin war eine sehr verständige Frau, das wurde allgemein anerkannt. Sie war vielleicht keine so glänzende Persönlichkeit, wie eine Herzogin eigentlich sein sollte. Schön war sie nie gewesen, ebensowenig war sie, was man gewöhnlich klug nennt, aber sie war, in vollem Sinne des Wortes, verständig. Und sie hatte, das kann nicht bezweifelt werden, diese schätzbare Eigenschaft auf ihrem Wege durchs Leben sehr nötig. Es war kein Feiertagsdasein, ungeachtet ihrer hohen Stellung an der Spitze eines der stolzesten Häuser und einer der vornehmsten Familien Englands. Der Glaube, daß ihr Reichtum und ihre bevorzugte Stellung den Großen dieser Welt wenig nützen, ist für uns eine Art von Entschädigung für ihre Größe.
»Voll Ehrfurcht grüßt die Bauerndirne tief,
Mit Staunen sieht sie mein Gewand von Seide,
Es wacht der Neid, der ihr im Busen schlief:
Ach, eine Gräfin! Sie weiß nichts von Leide!
So denkst du wohl! Es ist dir unbekannt,
Daß auch den Großen Leid bringt oft das Leben,
Und daß Zufriedenheit in jedem Stand
Das höchste Glück ist, das du kannst erstreben.«
Das möchten wir gern alle glauben. Aber schließlich ist es doch in hohem Grade zweifelhaft, ob, wie sich die Sittenlehrer des achtzehnten Jahrhunderts einbildeten, in einer Hütte größere Zufriedenheit waltet, als in einem Palast, und der Palast hat doch in vieler Beziehung große Vorzüge. Die Herzogin hatte mancherlei Verdrießlichkeiten im Leben gehabt, aber nicht mehr, als uns allen zu teil werden, noch waren sie schlimmer gewesen, und dafür hatte sie ihre Krone, ihren Staat, ihre schönen herzoglichen Schlösser und die Unterwürfigkeit ihrer Umgebung. Wenn wir also keinen Grund zum Neide haben, so fehlt es anderseits an Veranlassung, uns mit den Vorzügen unsrer bescheidenen Lebensstellung zu brüsten. Allein Herzogin oder nicht, diese Dame hatte Verstand, fürwahr eine kostbare Gabe. Und sie hatte ihn sehr nötig, wie die nachstehende Erzählung darthun wird.
Denn der Herzog besaß diese unschätzbare Gabe nicht. Er war viel stolzer, als es ein Herzog zu sein Veranlassung hat. Ein Mann, der einen so hohen Rang einnimmt, kann sich am ehesten gestatten, bescheiden von seiner Stellung zu denken und seine Größe nicht zu überschätzen. Aber der Herzog von Billingsgate war sehr stolz, und er glaubte mit fast religiöser Inbrunst, daß er selbst, sein Stammbaum und die Erdbeerblätter, die an dessen Wipfel wuchsen, die ganze Welt beschatteten. Er meinte, selbst der Sonnenschein werde wahrnehmbar dadurch beeinflußt, und was die Grafschaft anlangt, die in seinem Schatten lag, so hatte er dieser gegenüber etwa die Empfindung, wie die alten Götter den Ländern gegenüber, deren besondere Schutzgeister sie waren. Er erwartete, daß ihm an allen Altären Weihrauch geopfert und eine Art von ewiger Anbetung gewidmet werde. Es wäre ihm eine große Befriedigung gewesen, wenn die Menschen bei ihm geschworen und ihm Kirchen geweiht hätten. Entsprächen diese Dinge unsern modernen Anschauungen, dann würde er sie nur für natürlich gehalten haben. Er liebte es, wenn die Leute sich ihm mit Scheu und Ehrfurcht nahten, und obgleich er entgegenkommend und herablassend leutselig war, wie es ein englischer Gentleman heutzutage sein muß, und obschon er mit gewöhnlichen Menschen fast so sprach, als ob er übersähe, daß sie unter ihm standen, vergaß er diese Thatsache doch niemals, und es verletzte ihn tief, wenn sie sie in Wort oder Handlung außer acht ließen. Hielt er sich auf dem Lande auf, und die Damen der Grafschaft wurden zum Diner nach Schloß Billingsgate eingeladen, dann war er sehr liebenswürdig gegen sie; aber im stillen wunderte er sich, daß sie den Mut hatten, ihre kleine zitternde Hand in seinen herzoglichen Arm zu legen, und diejenigen, die wirklich zitterten und von der ihnen widerfahrenen Ehre überwältigt schienen, mochte er am liebsten. In seiner Jugend hatte er ungeheure Summen ausgegeben, um den Glanz aufrecht zu erhalten, der, wie er glaubte, für seinen Rang unerläßlich sei, und den er noch immer für notwendig hielt, trotzdem daß seine Mittel jetzt beschränkt waren. Es darf nicht verschwiegen werden, daß er der Welt zürnte, weil seine Mittel beschränkt waren, und daß er es für eine Schande für das Land hielt, daß eins der ältesten Herzogtümer sich in die demütigende Notwendigkeit versetzt sah, überflüssige Bediente zu entlassen und die Zahl der Pferde in den Ställen zu verringern. Wie viele andre Uebel, schrieb er dies dem Radikalismus der Zeit zu. Wenn die Dinge so wären, wie sie sein müßten, und eine kräftige, angesehene Regierung die Zügel in Händen hielte, dann dürften Herzöge nicht nötig haben, sich einzuschränken. Der Herzog that dies indes so wenig als möglich, und stets unter Verwahrung. Wenn die dringenden Vorstellungen seiner Sachwalter und Rechtsbeistände ihn gegen seinen Willen nötigten, eine Ausgabequelle zu verstopfen, hatte er große Neigung, bei einer ganz unerwarteten Veranlassung und in einer ganz neuen Richtung eine frische zu erschließen – eine Neigung, die es sehr schwierig machte, ihn zu behandeln, und allen, die mit ihm zu thun hatten, eine große Last war.
Dies war in der That das schwerste Kreuz im Leben der Herzogin, aber selbst ihm unterwarf sie sich in sehr verständiger Weise, indem sie sich nicht mehr Sorgen darüber machte, als unbedingt nötig war, und in dem Gedanken Trost fand, daß Hungerfords, ihres ältesten Sohns, Fähigkeiten sehr stark in der entgegengesetzten Richtung entwickelt seien. Der war ganz der Mann dazu, den Reichtum der Familie wieder auf festem Grunde aufzubauen. Er hatte schon dadurch viel in dieser Hinsicht gethan, daß er dem thörichten Widerspruch seines Vaters zum Trotze eine reiche Erbin geheiratet hatte. Der Herzog war der Meinung gewesen, sein Sohn und Erbe sei gut genug für eine Prinzessin, und er war einem Wutanfall so nahe gekommen, wie es für einen Herzog anständigerweise möglich ist, als er dieses eigensinnigen jungen Mannes Entschluß erfuhr, eine Dame zu heiraten, deren Vermögen in der City verdient worden war; allein Hungerford war dreißig, und sein Vater hatte ihm nichts mehr zu sagen. Etwas war ihm indes geblieben, und das hatte er ganz in der Hand, seine Tochter – Lady Jane. Sie besaß alle die Eigenschaften, die der Herzog in seinem Geschlecht am höchsten schätzte. Sie glich jener berühmten Herzogin, die das Glück hatte, Charles II. zu gefallen, aber sie verband damit ein stolzes, kühles und würdevolles Wesen, das jene berühmte Schönheit nicht auszeichnete. Eine so vornehme Ruhe findet man nur in den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Tagelang blieb der Ausdruck ihres Angesichts unverändert, und ebensolange blieb die Luft, die sie umgab, ungestört durch irgend etwas, was gemeiner Sprache auch nur entfernt glich. Sie war ein Kind nach ihres Vaters Herzen. Obgleich sich das Ansehen einer Familie mindert, wenn sie sich nur in der weiblichen Linie fortsetzt, würde Seine Durchlaucht sich darein gefunden haben, wenn es möglich gewesen wäre, die Nachfolge von Hungerford und seiner plebejischen Frau auf dieses ruhige, schöne und vornehme Mädchen zu übertragen. »Jane, Herzogin von Billingsgate (aus eigenein Recht)«: der Gedanke gefiel ihm. Er hatte das Gefühl, als ob es sehr passend sei, selbst wenn das Geschlecht nach diesem letzten würdigen und ehrenvollen Aufblühen ausstürbe. Aber kein wacher Traum, das wußte er, konnte nichtiger sein, denn die Citydame hatte schon drei Jungen zur Fortsetzung des Geschlechts zur Welt gebracht, und wie viele noch folgen würden, konnte niemand voraussagen. Hungerford machte kein Hehl daraus, daß sie Geschäftsleute werden sollten, wenn sie aufwuchsen, und daß seines Großvaters Geschäft Bobbys Erbe sein werde. Bobby! Der Junge war nach jenem Großvater genannt worden. Ein solcher Name war unter den Altamonts ganz unerhört. Der Herzog kümmerte sich blutwenig um seine Enkel, und ganz und gar nicht um diesen Citybalg. Aber, leider, was konnte er thun? Nicht eine einzige der ihnen zukommenden Ehren konnte er ihnen vorenthalten. Bobby würde, er mochte machen, was er wollte, einst Lord Robert sein, selbst an der Spitze der Firma seines Citygroßvaters.
Aber Lady Janes Verheiratung war eine Angelegenheit, die sich noch in die richtigen Wege leiten ließ, und ihr Vater war entschlossen, in dieser Hinsicht seinen Willen durchzusetzen. Man hätte erwarten sollen, daß eine sehr lebhafte Werbung um ihre schöne Hand stattfinden werde, das war indes nicht der Fall. Herzöge sind immer dünn gesäet, und es traf sich so, daß gerade zur Zeit kein heiratsfähiger Herzog, der eine Hand zu vergeben hatte, vorhanden war, und geringere Leute wurden durch die Großartigkeit ihrer Umgebung, den Charakter ihres Herrn Papa und die erhabene Würde ihres eigenen Wesens eingeschüchtert. Einige wenige gab es wohl, die sich an den äußern Grenzen des glänzenden Kreises bewegten, worin allein es Lady Jane gestattet war, zu erscheinen. Sie warfen bedeutungsvoll sehnsüchtige Blicke auf sie, wagten aber nicht, näher zu kommen. Der Marquis von Wodensville machte ihr einen Antrag, allein er war sechzig Jahre alt, und diese Verbindung erschien dem Herzog nicht verlockend genug, um ihn zu veranlassen, ein väterliches Machtwort zu sprechen. Auch Mr. Roundel, von Bischofs Roundel, ließ ernstliche Absichten durchblicken. Hätte Familienstellung allein genügt, den Sieg zu erringen, dann wären die Ansprüche dieses Herrn unanfechtbar gewesen, und der Herzog wies diesen großen Bürgerlichen, einen Mann, der keinen Titel angenommen haben würde, und wenn ihn die Königin fußfällig darum gebeten hätte, nicht ohne weiteres ab. Aber er zeigte eine gewisse Neigung, mit diesem großen Fisch zu spielen, die Entscheidung hinauszuschieben und ihn in Spannung zu erhalten, und das war eine Behandlung, die sich ein Roundel nicht gefallen läßt. Andre Anträge von geringerer Bedeutung kamen niemals so weit, daß sie Lady Janes Ohr erreichten, und der Herzog widmete ihnen kaum einen Gedanken. Allerdings hatte Lady Hungerford ein- oder zweimal spöttische Bemerkungen über Janes Verheiratung gemacht, eine Unverschämtheit, die bei ihrer niedrigen Herkunft nicht überraschen konnte. Allein der Herzog that nichts weiter, als daß er einen feierlichen Blick aus seinen großen grünen Augen auf sie richtete, wenn sie sich herausnahm, einen solchen Angriff gegen ein so hoch über ihr stehendes Geschlecht zu richten. Ungefähr dasselbe that er, als die Herzogin einmal seufzend eine ähnliche Bemerkung machte. Er wandte seinen Kopf und richtete seine Augen auf sie, aber die Herzogin war an ihn gewöhnt und nicht so leicht einzuschüchtern. »Ich verstehe nicht, was du meinst,« sagte er dabei.
»Das ist doch nicht so schwer zu begreifen. Ich bilde mir nicht ein, unsterblich zu sein, und ich gestehe, es wäre mir lieb, wenn ich Jane versorgt wüßte.«
»Versorgt!« entgegnete Seine Durchlaucht – schon das Wort erschien ihm, auf seine Tochter angewandt, erniedrigend.
»Nun, auf das Wort kommt's nicht an. Sie ist sehr weichherzig und einer Stütze bedürftig, wenn das die Leute auch nicht glauben. Ich wüßte sie gern unter guter Obhut, wenn ich sterbe.«
»Du kannst dich beruhigen,« antwortete der Herzog. »Jane wird niemand brauchen, der sie in Obhut nimmt, wie du dich ausdrückst. Ein solches Wort, wie ›einer Stütze bedürftig‹, wünsche ich in Beziehung auf meine Tochter nicht wieder zu hören. Ich bin hoffentlich sehr wohl im stande, für sie zu sorgen.«
»Aber, lieber Gus, du bist doch ebensowenig unsterblich, als ich,« erwiderte seine Frau. Unter keinen Umständen hörte er sich gern beim Vornamen nennen, aber »Gus« hatte ihn immer wütend gemacht, und wir fürchteten, die Herzogin wußte das sehr wohl. Auch sie war ärgerlich, sonst würde sie ihn nicht so angeredet haben.
Der Herzog blickte sie noch einmal an, gab aber keine Antwort. Gegen die Behauptung konnte er nichts einwenden; wenn es aber etwas Besseres, als Unsterblichkeit gegeben hätte, dann würde er Anspruch darauf erhoben haben, allein, da es ein Glaubenssatz ist, daß alle Menschen sterblich sind, so war er klug genug, nichts zu sagen. Solche Zwischenfälle, wie dieser, reizten ihn jedoch etwas. Die einzige Wirkung, die seiner Gattin Einmischung hatte, war die, daß er Jane mit etwas prüfenderen Blicken betrachtete. Als er dies das erste Mal that, entdeckte er nichts, was ihn beunruhigt hätte. Sie war eben von einem Spaziergange zurückgekehrt und erzählte ihrer Mutter, was sie gesehen und gehört hatte. Ihre Wangen waren leicht gerötet und ihre Erscheinung war eher zu lebhaft und jugendlich, als das Gegenteil. Sie war der großen Dame, Lady Germaine, begegnet, die mit einer zahlreichen Gesellschaft gekommen war, um das schöne Thal in der Nähe von Schloß Billings zu besuchen. Der Herzog liebte es nicht, wenn Fremde seinen Besitz betraten, aber einer Dame wie Lady Germaine, einem der ersten Sterne der Gesellschaft, konnte er die Erlaubnis nicht verweigern. »Alle Germaines waren natürlich da, und Mary Plantagenet, und – Mr. Winton,« sagte Lady Jane. Vor dem letzten Namen machte sie eine kaum wahrnehmbare Pause. Der Herzog bemerkte das nicht, er hörte überhaupt kaum auf ihre Worte. »Nicht mehr jung, sie ist zu jung!« sprach er bei sich, und verbannte Lady Hungerfords Sticheleien und den Seufzer der Herzogin mit Entrüstung aus seinen Gedanken. Sie kamen ihm nicht einmal wieder in Erinnerung, bis zur nächsten Saison, als Jane eines Morgens nach einem großen Ball spät zum Frühstück erschien und auf eine Frage ihrer Mutter in etwas müdem Tone antwortete. »Es war fast niemand da,« sagte sie mit etwas, das halb ein Seufzer, halb ein Gähnen war. Halb London war dagewesen, aber nicht, was seine Tochter gesagt, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Als er sie anblickte, bemerkte er eine schwache, eine ganz schwache Einbiegung in dem zarten Oval von Lady Janes Wange. Die bisherige vollendete Schönheitslinie war gestört. Es hätte ein Grübchen sein können, aber sie war nicht in der Stimmung, die Grübchen zu Tage treten läßt. Bei dem Anblick war es dem Herzog, als ob eine kalte Hand an sein Herz gerührt hätte. Passée?Unmöglich, noch Jahre mußten vergehen, ehe dies Wort auf seine Tochter angewendet werden konnte; und doch fühlte er, daß auch Lady Hungerford es bemerkt haben müsse. Nein, eine Höhlung war es nicht, aber mit ihrem den unteren Klassen eigenen scharfen Blick hatte sie es ohne Zweifel wahrgenommen, und nun würde sie überall sagen, die liebe Jane sei auf dem Abmarsch. Anscheinend nahm der Herzog niemals Notiz von diesen Ausfällen seiner Schwiegertochter, aber in Wirklichkeit gab es nichts, was er so fürchtete.
Der Herzogin war diese Einbiegung nur zu wohl bekannt. Es war wirklich eine Einbiegung, sehr gering, manchmal gar nicht wahrnehmbar, aber sie war nicht wegzuleugnen. Ihr Vorhandensein war ihr eines Tages ganz plötzlich zum Bewußtsein gekommen, obgleich sie sich lange dagegen gesträubt hatte. Und seitdem war sie ihr selten aus dem Sinne geschwunden. Sie zweifelte nicht daran, daß auch andre Leute dieselbe Entdeckung und boshafte Bemerkungen darüber gemacht hatten; denn wenn sie, die so daraus bedacht war, ihr Kind im besten Lichte zu sehen, sie wahrgenommen hatte, was konnte man von denen erwarten, deren Streben entgegengesetzt war? Aber was lag daran, was irgend jemand sagte? Sie war da, das war das Schlimme. Sie redete mit einer Stimme, die niemand zum Schweigen bringen konnte, von Janes dahinschwindender Jugend, von vergehender Frische, verwelkender Blüte. Sollte sie sitzen bleiben und alt werden, während ihr Vater hochfliegende Pläne für sie spann? Sie hatte der Herzogin viel zu denken gegeben, denn diese wußte sehr wohl, was das Ende dieser fürstlichen Haushaltsführung sein mußte. Hungerford konnte nicht sehr davon betroffen werden; er besaß das Vermögen seiner Frau als Rückhalt und er würde es vielleicht nicht für seine Pflicht halten, seines Vaters Schulden zu übernehmen, wenn dieser das Zeitliche gesegnet hatte. Was aber dem Herzog, wenn er am Leben blieb, und seiner Familie bevorstand, das wußte die Herzogin, die mit klarem Blick in die Zukunft sah, ganz genau. Ihr Rang konnte sie nicht retten. Er vermochte vielleicht den Bankerott bis zum letzten Augenblick hinausschieben, aber ganz abwenden konnte er ihn nicht. Sonach mußte ein Zeitpunkt kommen, der alles änderte, eine Art von anständiger Verbannung, oder wenigstens Abgeschlossenheit auf dem Lande, wenn nicht Schlimmeres, würde ihr Los sein. Und Jane? Wenn es ihrem Vater überlassen blieb, für ihre Zukunft zu sorgen, was würde aus Jane werden? Sie würde von ihrer Höhe herniedersteigen und lernen müssen, arm zu sein – das heißt, soweit Herzogstöchter überhaupt arm sein können. Die Großartigkeit und Fülle, worin sie jetzt lebte, würden von ihr abfallen, kein neuer Abschnitt konnte die Einförmigkeit ihres Daseins unterbrechen, eines Daseins, in dem jede Veränderung eher eine Verbesserung als eine Verschlechterung bedeuten würde. Die Herzogin durfte sich sagen, daß sie ihrem Gatten niemals entgegengearbeitet hatte, aber jede Pflicht hat ihre Grenzen. Sie konnte nicht ruhig dabei stehen und zusehen, wie Jane geopfert wurde. Das war die Frage, die die Herzogin zu lösen hatte. Zu dieser Ueberzeugung wurde sie ganz allmählich gedrängt, ihre Augen wurden nach und nach auch für andre Dinge geöffnet, als für die Veränderung in dem vollendeten Oval von Janes Wange. Sie fand heraus, weshalb ihre Tochter gegähnt, geseufzt und gesagt hatte: »es war niemand da,« auf einem Balle, wo sich halb London um Einladungen gerissen hatte. Am nächsten Abend machte Lady Jane einer alten Dame, die keine besondere Stellung einnahm, einen ganz gewöhnlichen Besuch, kehrte mit einem hübsch geröteten Antlitz und ohne sichtbare Einbiegung zurück, und erzählte, sie habe eine reizende kleine Gesellschaft dort getroffen und sich nie so gut unterhalten. Die Herzogin fühlte, daß sie hier vor einem Geheimnis stehe. Zum Teil war es die »Morning Post«, die ihr auf die Sprünge half, zum Teil die unbewußten Enthüllungen, die Jane in ihrer gehobenen Stimmung machte. Aus der »Morning Post« ersah sie, daß ein gewisser Name im Verzeichnis der feinen Leute fehlte, die Lady Germaines Ball durch ihre Anwesenheit verschönert hatten, und Lady Jane verriet durch hundert unbewußte kleine Bemerkungen, daß der Träger dieses Namens bei der andern kleinen Gesellschaft zugegen gewesen sei. Die Herzogin fügte dies und das zusammen. Auch sie würde es zweifellos gern gesehen haben, wenn ihre Tochter eine Herzogin geworden wäre, wie sie selbst: allein wenn sich das nicht erreichen ließ, dann wünschte sie, daß Jane auf ihre eigene Art glücklich würde. Aber hatte Jane Mut genug, ihren eigenen Weg zu gehen? Das war die Frage. Sie hatte, wie man dachte, in ihrem Leben alles erhalten, was sie sich wünschte, und war mit jeder Rücksicht umgeben worden, allein thatsächlich hatte Jane alles erhalten, was andre Leute wünschten, und war im stillen ganz zufrieden gewesen, daß es so war. Würde sie wohl einmal im Leben dahin zu bringen sein, um ihres Glückes willen ihrem Vater und der ganzen Welt Trotz zu bieten? Das war es, was die Herzogin nicht wußte.
Zweites Kapitel. Sie selbst
Eine Erbprinzessin ist stets eine interessante Persönlichkeit. Schon der Titel an sich ist reizend – es liegt eine Hinweisung auf ein stolzes Erbteil darin, wenn auch nicht gerade die Aussicht auf wirkliche Herrschaft, so doch zum mindesten die auf deren schöneren Teil: die Herrschaft des ewig Weiblichen, das Reich der Herzen und Empfindungen. Selbst wenn sie altert, bleibt dem Titel sein süßer und weitreichender Einfluß, und so lange sie jung ist, stellen schwärmerische Gemüter die Trägerin auf eine strahlende Höhe, zu der die Gemeinheit nicht hinanreicht. Lady Jane war die Erbprinzessin des Hauses ihres Vaters. In seinem Stolz lag Poesie genug, um zu empfinden, daß der verschönernde Einfluß edler Weiblichkeit den Wert seines herzoglichen Ranges noch erhöhe (wenn eine Erhöhung überhaupt möglich war). Und sie war in dem Glauben erzogen worden, daß sie andern Mädchen nicht gleich sei, nicht einmal gleich den kleinen Lady Marys und Lady Augustas, die in den Augen der Welt auf gleicher Höhe standen. Sie stand allein – das Blut der Altamonts hatte in ihren Adern die Quintessenz der Süßigkeit und Feinheit erreicht. Hungerford war ja in seiner Art ganz gut. Wenn die Zeit kam, wurde er Herzog; der ganze Besitz, Ländereien und Titel, gingen auf ihn über, allein auf so glänzender Höhe, wie seine Schwester stand er nicht. Das wußte er auch sehr wohl; er lachte darüber und war froh, der mit einer so erhabenen Stellung verbundenen Pflicht der Wahrung einer höheren äußeren Würde enthoben zu sein, allein er erkannte vollständig an, daß Jane nicht als eine gewöhnliche Sterbliche betrachtet werden dürfe, daß sie die Krone und Blüte vieler Generationen, die Verkörperung der höchsten Vollendung sei, die das Geschlecht erreichen konnte. Und mit unendlicher Bescheidenheit und Demut des Gemüts erkannte auch Jane ihre Sendung. Sehr früh wurde sie sich ihrer bewußt, in einem Alter, wo andre Mädchen noch mit dem Springseil spielen. Eine große Ehre war auf ihr noch so junges Haupt gefallen. Wenn sie in den prächtigen Wäldern von Billings umherwanderte und, wie das der Mädchen Art ist, von der Welt träumte, die sie umgab, verließ sie nicht einen Augenblick das Bewußtsein ihres Ranges, und es erschien ihr unmöglich, vorauszusehen, welchen Einfluß er auf die Gestaltung ihres Lebens ausüben werde. Sie hörte oft vom schlimmen Zustand der Welt sprechen – dem Verfall Englands, dem Anwachsen demokratischer Gesinnungen, dem nahenden Zusammensturz, der alles, was groß und edel war, unter Trümmern begraben werde; und Lady Jane nahm das alles ganz ernsthaft und hielt es für sehr möglich, daß ihr Geschick das einer auf dem Altar der Revolution geopferten jungfräulichen Märtyrerin sein werde. Eine Zeitlang bildeten ihre Lieblingslektüre die Erinnerungen jener großen und edlen, erbarmungsvollen und schwärmerischen Damen, die das Ende des alten régime in Frankreich mit einem so rührenden Glanz umgeben, und die für Verbrechen starben, woran sie ganz unschuldig waren, und mit ihrem Leben für Bedrückungen büßten, die zu mildern sie alles gethan hatten, was in ihren Kräften stand. Jane nahm, wie das natürlich war, die politischen Jeremiaden ihres Vaters und seiner Freunde mit dem blinden Glauben der Jugend hin und hielt selbst die Guillotine nicht für unmöglich. Wenn es ihr Los sein sollte – wie es ihr nach allem, was sie hörte, wahrscheinlich schien – für die Sache des Adels ihr Leben einzusetzen, dann war sie bereit, wie Marie Antoinette das Schafott zu besteigen, erhobenen Hauptes und mit einem Lächeln für ihre Mörder; oder, wenn es möglich war, das Vaterland durch eine Art der Selbsthingabe zu retten, dann war sie bereit, wenn auch mit Zittern, die Nation zu begeistern oder sich an die Spitze einer Armee zu stellen. Das waren die Träume, die sie erfüllten, als sie fünfzehn Jahre alt war, das Alter, worin junge Mädchen für die Ansprüche der Vaterlandsliebe am zugänglichsten sind und fühlen, daß auch in ihnen vielleicht eine Heldin steckt. Mit zunehmenden Jahren ward sie etwas unsicher. Sie lernte beobachten, und ihre Beobachtungen erschütterten den Glauben an ihre alten Einbildungen. Sie konnte keines der Anzeichen entdecken, die ihre Bücher ihr als die Vorläufer der Revolution in Frankreich bezeichnet hatten. Alles war sehr friedlich; wo sie sich zeigte, begegnete man ihr mit der größten Ehrerbietung. Die geringen Leute sahen staunend zu ihr empor, wenn sie mit ihrer Mama einmal durch belebte Straßen fuhr; jedermann schien bereit, ihren Rang anzuerkennen. Man grüßte sie mit freundlichem Lächeln, nicht mit mißvergnügtem Murren, kurz, Heldenmut erschien durchaus überflüssig.
Dann kam eine Zeit, wo Lady Jane es für wahrscheinlich hielt, ihre Sendung werde, wenn nicht die einer Märtyrerin, die einer Wohlthäterin der Welt sein. Es würde ihre Aufgabe sein, halb fürstlich, halb engelhaft, durch die Höhlen des Elends zu schweben und Behagen und Ueberfluß hinter sich zurückzulassen. Sie malte sich Bilder aus, wie die Zeit der großen Pest, oder der Hungersnot und des Fiebers, wo ihre plötzliche Erscheinung mit Hilfeleistungen jeder Art eine sofortige Veränderung der Sachlage herbeiführen und Finsternis in Licht verwandeln werde. Was Unsauberkeit und Elend seien, wußte sie nicht, – woher sollte sie es wissen? – und in ihren Gedanken beschmutzte sie sich bei der erfolgreichen Erfüllung ihrer großen Aufgabe niemals das Kleid im geringsten, und diese hatte durchaus nichts Abscheu Erregendes oder Abstoßendes für sie. Aber nach und nach trat auch in dieser Auffassung ihrer irdischen Sendung eine Aenderung ein. Eine Erbprinzessin hat stets das Vertrauen, daß in ihren eigenen Handreichungen ein geheimer Zauber liegen müsse, aber sie konnte ihre Augen nicht gegen die Thatsache verschließen, daß bei ihrer Mutter Mildthätigkeit nicht immer alles ganz glatt verlief. Ebenso wurde es ihr mit einem beträchtlichen Schreck klar, daß es viele Dinge gebe, die die Herzogin zu thun wünschte, ohne indes die Mittel dazu zu besitzen. Das übte eine sehr peinliche Wirkung auf Lady Janes Träume und machte ihnen ein Ende. Es verwirrte ihren ganzen Gesichtskreis und lähmte ihre Einbildungskraft. Nun hielt sie in großer Verwirrung inne und vermochte nicht gleich zu erkennen, welche Sendung ihr hoher Rang ihr zuwies. Er mußte ihr bestimmte Pflichten auferlegen, in einem Wirkungskreis, der hoch über den gewöhnlichen Geschehnissen des Lebens erhaben war. Aber was für Pflichten waren das? Lady Jane war verblüfft und sah nicht mehr, wo der ihr vorgezeichnete Weg lag. Berührung mit der gemeinen Welt war unmöglich für sie; von der Beteiligung an der geordneten öffentlichen Wohlthätigkeit schrak sie zurück. Gewiß gab es etwas andres, etwas von hochherzigerer Art, für sie zu thun. Inzwischen wußte sie nicht, was das war, und sie stand sozusagen auf den Zinnen ihres Schlosses und schaute aus, etwas verwirrt, aber erfüllt von den edelsten Empfindungen und dem Verlangen, die schönsten Thaten zum Nutzen der Welt zu verrichten.
Dies war die Form, die der Stolz aus ihre hohe Geburt in der reinen und hochgestimmten Seele der Herzogstochter annahm. Ohne zu zweifeln, nahm sie den Glaubenssatz ihres Geschlechts an, und die Thatsache, daß sie etwas der großen Menge durchaus Fernstehendes, über der Schicht der gewöhnlichen Menschheit hoch Erhabenes sei, war für sie unfraglich. Die Herzogin besaß wenig von dieser angeborenen Ueberzeugung, aber eine Herzogin ist eine Herzogin, und wenn sie nicht einen ganz ungewöhnlichen Verstand hat, wird sie sich nur schwer von den Vorurteilen ihres Ranges freimachen können. Thatsächlich sind die Glieder eines herzoglichen Haushalts auch keine gewöhnlichen Sterblichen. Beschränkungen, die uns ganz natürlich erscheinen, sind für sie nicht vorhanden. Es bedarf für sie einer ganz hervorragenden Freiheit der Auffassung und geistigen Kraft, wenn sie sich klar machen sollen, daß sie von demselben Fleisch und Blut sind, wie die Spülmagd und der Schuhputzerjunge – nein, das sind übertriebene Beispiele, die ihnen viel zu fern stehen – selbst wie der Kammerdiener und die Haushälterin, die zu ihrer näheren Umgebung gehören und ganz ihrem persönlichen Dienst gewidmet sind. In dieser Hinsicht kamen demnach Lady Jane niemals Zweifel in den Sinn, aber alles, was persönlichem Stolze glich, lag ihr gänzlich fern. Sie wußte gar nicht, was das hieß. Es gibt gar kein schöneres Feld für reine Demut des Geistes, als die Seele eines auf einen so eingebildet erhabenen Standpunkt gestellten Geschöpfes. Der Gedanke, daß ihre eigene Vorzüglichkeit ihr diese Stellung gab, kam ihr niemals in den Sinn. In jeder Schätzung ihrer selbst war sie aufrichtig bescheiden, lenksam, bereit, sich führen zu lassen, rücksichtsvoll gegen jedermann. Niemals hat es ein Kind gegeben, das gehorsamer gegen Kindermädchen und Erzieherinnen war, noch eins, das Tadel so freundlich hinnahm, oder eins, das so anmutig besorgt war, sich Lob zu verdienen. Es war überhaupt schwierig, sie zum Gebrauch ihrer eigenen Urteilskraft zu bringen. »Meinen Sie?« sagte sie wohl zu der geringsten Persönlichkeit ihrer Umgebung mit dem aufrichtigen Wunsche, die betreffende Person durch Annahme ihrer Ansicht statt der eigenen zu erfreuen. Manche Leute dachten, sie habe überhaupt keine eigene Meinung; das war indes ein Irrtum – obgleich der Schmerz, den es ihr verursachte, wenn sie jemand verdrießen, oder ihm zuwiderhandeln oder widersprechen mußte (thatsächlich machte sie sich einer solchen Lieblosigkeit mit Worten niemals schuldig), sie nur in der äußersten Not dazu brachte, ihrer eigenen Meinung gemäß zu handeln. Aber als ihr zarter Fuß an die Grenzsteine des Kreises stieß, den sie bis dahin für unbegrenzt gehalten hatte, war Lady Jane lange Zeit verblüfft, verwirrt und wußte nicht, was der Zweck sei, den sie im Leben zu erfüllen habe. Das war die Zeit, wo ihre Wange, noch so jung, die ganz schwache Abweichung vom reinen Eirund zu zeigen begann. Sie war vielleicht nur wie der leise Eindruck eines Fingers – aber sie war vorhanden. Zur selben Zeit erschien eine feine Linie über Lady Janes Augen. Sie war sorgenvoll, beinahe traurig, verwirrt und betroffen. Was sollte sie aus ihrem Leben machen? England (obgleich, wie alle sagten, dem Untergang entgegengehend) ließ durchaus keine Anzeichen nahe bevorstehenden Verfalls wahrnehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Guillotine zu Lady Janes Lebzeiten nicht aufgerichtet, und sie würde keine Gelegenheit finden, sich zu opfern. Sie sah sich in der Welt um und entdeckte nirgends Verhältnisse, wo sie sich hätte nützlich machen können. Freilich schreckte sie auch, trotz aller Träume und ihrer Ueberzeugung, daß ihrer eine große Aufgabe harre, vor jedem wirklichen Heraustreten aus ihrer Abgeschiedenheit zurück, denn sie wußte sehr wohl, daß, wenn sie einen solchen Schritt versuchte, der Herzog und die Herzogin, Hungerford, Susan und alle Verwandten und Bekannten bis zum hundertsten Grade, erschreckt herbeieilen würden, um sie zurückzuhalten. War es möglich, daß sie alles that, was zu thun sie berufen war, wenn sie ruhig, je nachdem es die Gelegenheit verlangte, lächelnd oder stirnrunzelnd (soweit sie das überhaupt konnte) auf ihrem erhabenen Throne saß? Wenn das der Fall war, dann war es, wie Lady Jane sich seufzend eingestand, kaum der Mühe wert, eine Erbprinzessin zu sein.
Der Leser wird es für sonderbar halten, daß ihr während dieser ganzen Zeit niemals der Gedanke an eine Verheiratung oder an das große Vorspiel der Heirat in den Sinn kam. Vielleicht wäre es voreilig, das so ohne weiteres anzunehmen. Allein es war ihr von ihrer Jugend an bekannt, daß es nur wenige Menschen in der Welt gebe, die um Lady Janes Hand werben konnten. Als ihr vorgeschlagen worden war, den Marquis von Wodensville zu heiraten, hatte sie gelacht: »O nein, Papa, danke schön,« hatte sie gesagt.
»Wir haben schon früher mit seiner Familie Verbindungen geschlossen. In seinen Adern fließt etwas vom besten Blut in England.«
»O nein, Papa, danke bestens,« entgegnete Lady Jane. Sie hatte niemand in der Angelegenheit um Rat gefragt. Während der Unterhandlungen mit Mr. Roundel von Bischofs Roundel hatte sie mehr Interesse an den Tag gelegt, aber doch nicht genug, um aus dem Gleichgewicht zu kommen, als er sie ärgerlich abgebrochen und die Erzieherin seiner Schwester geheiratet hatte. »Ich dachte mir gleich, daß er nicht von reinem Geblüt sei,« sagte der Herzog. Lady Jane lächelte und dachte, fürchte ich, dasselbe. Die schlimmste Folge hohen Ranges ist die, daß er den Blick trübt. Die Abstufungen in der gesellschaftlichen Stellung der Menschen unter ihr zu erkennen, war sie ganz außer stände. Es war ihr klar, was für ein Unterschied zwischen dem Rang ihres Vaters und dem eines Prinzen von Geblüt bestand, sie wußte genau, wem bei der Tischordnung der Vorrang gebührte, Marquisen oder Gräfinnen, aber von dem Unterschied zwischen Erzieherinnen und Haushälterinnen und andern »Dienstboten« wußte sie nur wenig. Die einen standen ihrem Lebenskreis gerade so fern als die andern. Ihre eigene alte Erzieherin, deren Name Strangford war, hatte sie immer Strangchen genannt und sehr gern gehabt – aber sie hatte alle ihre »Dienstboten« gern und sie dachte an alle ziemlich in derselben Weise. Dann hatte sich Lord Rushbrook, der Minister, um sie beworben. Sie fühlte zwar keine Neigung, ihn zu heiraten, aber sie empfand, daß es etwas gab, was nicht Rang war (denn er war nur Freiherr) und doch dem Range gleichstand. Es war dies fast das erste Aufflammen dieser Erkenntnis, das in ihre Seele fiel.
Um diese Zeit jedoch begann die Ueberzeugung in Lady Janes Geist zu dämmern, daß es ziemlich allgemein gebräuchlich sei, zu heiraten, und daß die meisten Frauen auf diese Weise das Rätsel ihres Lebens lösen. Vielleicht war das die Folge der Anträge, die ihr gemacht worden waren, vielleicht auch die des Zufalls, daß sie bei Lady Germaine bei einer der häufigen Gelegenheiten, die sie zu dieser Dame führten, eine Bekanntschaft gemacht hatte, die eines – Herrn. Sie hatte schon früher dort und anderswo viele Herren kennen gelernt, zu dieser Gesellschaft jedoch war sie ganz zufällig gegangen, ohne Absicht und ohne zu erwarten, dort jemand zu treffen. So lauert das Schicksal uns auf, wenn wir es am wenigsten ahnen. Der Herr war in keiner Weise hervorragend. Er hatte niemals daran gedacht, die Herzogstochter kennen zu lernen. Hätte Lady Germaine die geringste Ahnung gehabt, was die Folgen dieser Begegnung sein sollten, dann hätte sie ihn eher in einen Wandschrank eingeschlossen oder in den Fluß gestoßen, als daß sie zugegeben hätte, daß so etwas in ihrem Hause vorfiel. Sie wußte aber von der Zukunft nicht mehr als andre Sterbliche auch, und die Falle wurde von den Schicksalsschwestern ohne Beihilfe irgend eines menschlichen Geschöpfs gestellt. Sie alle gingen blind, bethört, zufällig in das Netz.