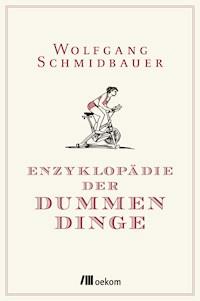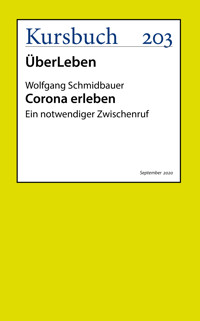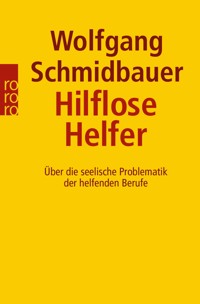
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Hilflosigkeit von Helfern entspringt ihrem überstrengen altruistischen Ideal der sozialen Hilfe. Was rigide Ideale im Leben des Einzelnen und im Zusammenleben von Gruppen und Völkern anrichten können, ist das Thema dieses erfolgreichen Klassikers. Helfen macht das Wesen zahlreicher Berufe aus. Und dass es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist, beweisen mehrere statistische Untersuchungen. Am besten dokumentiert ist diese Situation bei dem prestigeträchtigsten Helferberuf, dem des Arztes. Doch dürften Krankenschwestern und -pfleger, Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrerinnen, Psychologen, Seelsorger und andere helfende Professionen wesentliche Aspekte ihrer psychischen Struktur mit Ärztinnen und Ärzten teilen. Dazu kommt noch, dass in keiner Berufsgruppe eigene Hilfsbedürftigkeit so nachhaltig verharmlost und verdrängt wird wie in der, die Hilfsbereitschaft als Dienstleistung anbietet. Gerade darin drückt sich das «Helfersyndrom» besonders deutlich aus, dass Schwäche und Hilflosigkeit bei anderen akzeptiert und als behandlungswürdig erkannt werden, während das Selbstbild von solchen «Flecken» um jeden Preis freigehalten werden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolfgang Schmidbauer
Hilflose Helfer
Über die seelische Problematik der helfenden Berufe
Über dieses Buch
Die Hilflosigkeit von Helfern entspringt ihrem überstrengen altruistischen Ideal der sozialen Hilfe. Was rigide Ideale im Leben des Einzelnen und im Zusammenleben von Gruppen und Völkern anrichten können, ist das Thema dieses erfolgreichen Klassikers.
Helfen macht das Wesen zahlreicher Berufe aus. Und dass es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist, beweisen mehrere statistische Untersuchungen. Am besten dokumentiert ist diese Situation bei dem prestigeträchtigsten Helferberuf, dem des Arztes. Doch dürften Krankenschwestern und -pfleger, Sozialarbeiter, Erzieher, Lehrerinnen, Psychologen, Seelsorger und andere helfende Professionen wesentliche Aspekte ihrer psychischen Struktur mit Ärztinnen und Ärzten teilen. Dazu kommt noch, dass in keiner Berufsgruppe eigene Hilfsbedürftigkeit so nachhaltig verharmlost und verdrängt wird wie in der, die Hilfsbereitschaft als Dienstleistung anbietet. Gerade darin drückt sich das «Helfersyndrom» besonders deutlich aus, dass Schwäche und Hilflosigkeit bei anderen akzeptiert und als behandlungswürdig erkannt werden, während das Selbstbild von solchen «Flecken» um jeden Preis freigehalten werden muss.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 1977, 1992 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
ISBN 978-3-644-00010-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Der Begriff des «sozialen Syndroms» oder «Helfer-Syndroms» hat sich für mich aus der gruppendynamischen Weiterbildung von Angehörigen sozialer Berufe ergeben. In den Leiterteams wurde nach den Sitzungen über die Persönlichkeitsprobleme der Gruppenmitglieder gesprochen. Dabei kristallisierte sich der Typus des «Helfens als Abwehr» immer deutlicher heraus. Die emotionale Hilflosigkeit des Helfers, sein Elend hinter der stark scheinenden Fassade, das waren Eindrücke, die häufig wiederkehrten. So wurden sie allmählich zu einem Bestandteil unseres Konzepts, zumal die Leiter selbst einander aus einer oft intensiven gemeinsamen Erfahrung kennenlernten und den Parallelen zwischen ihrem eigenen Erleben und der Situation der Gruppenmitglieder nachspüren konnten,
In allen sozialen Berufen ist die eigene Persönlichkeit das wichtigste Instrument; die Grenzen ihrer Belastbarkeit und Flexibilität sind zugleich die Grenzen unseres Handelns. Michael Balint, dessen arztbezogene Konzepte wir für die Probleme der übrigen sozialen Berufe – Lehrer, Sozialarbeiter, (Heim-)Erzieher, Psychologen, Logopäden, Krankenschwestern, Soziologen usw. – und für die Arbeit in Helfer-Institutionen verändert und erweitert haben, sah in der «Droge Arzt», in der Eigenart des Helfers, den wichtigsten Einfluß in medizinischen Interaktionen. In Krankenpflege, Pädagogik, Psychotherapie und Sozialarbeit ist es sicher nicht anders. In keinem dieser Berufe berücksichtigt die Ausbildung diese Situation derart, daß sie mehr tut, als kognitive Konzepte, praktische Fertigkeiten und ethische Normen zu vermitteln. Die Auseinandersetzung mit den Wünschen und Ängsten, mit der gefühlshaften Seite der Arbeit mit Menschen, wird dem Zufall überlassen.
Vorwort zur Neuausgabe (1992)
Ich habe mich oft gefragt, weshalb dieses Buch weitgehend unverändert rund zwanzig Auflagen erlebt hat, wo doch wissenschaftliche Neuerungen immer kurzlebiger werden. Anscheinend trifft es kein von äußeren Aktualitäten abhängiges Informationsbedürfnis, sondern eine menschliche Frage, die von jeder Generation neu gestellt, von jedem Leser persönlich beantwortet werden muß. Deshalb erwog ich, «Die hilflosen Helfer» nicht mehr zu verändern. Von 1977 bis 1992 blieb der Text gleich. 1980 kam als «Nachgedanken zum Helfersyndrom» ein Vortrag hinzu, den ich auf dem alternativen «Gesundheitstag» in Berlin gehalten hatte. In der hier vorliegenden Revision versuchte ich einen Kompromiß zu finden, der das (falls es so etwas überhaupt gibt) «Zeitlose» des Buchs unangetastet läßt, aber den Text strafft, Wiederholungen tilgt, Abschweifungen begradigt und allzu kühne Ausweitungen teils streicht, teils benennt. Als ich das Buch schrieb (1976), arbeitete ich erst sechs Jahre als Psychotherapeut und Gruppenleiter; meine analytische Ausbildung war eben abgeschlossen. Ich vermute, daß diese Unerfahrenheit und das Staunen des bisher mit journalistischen Aufgaben beschäftigten Eindringlings in die Helfer-Welt der Darstellung nützen, den Autor seine Funde mit einer Frische verdeutlichen lassen, die ich heute (1991), eben 50 Jahre alt geworden und neben der Gruppentherapie mit Supervisionen und Lehranalysen beschäftigt, in dieser Art nicht mehr zustande brächte. Erfahrung macht nicht nur klug, sondern auch dumm, sie schärft nicht nur den Blick, sondern stumpft ihn auch ab.
In den «Nachgedanken» von 1980 sind Themen angedeutet, die ich später, vor allem in «Helfen als Beruf – Die Ware Nächstenliebe», weiter ausgearbeitet habe. Hier wird der sozialpsychologische Aspekt nachgetragen, der in den «hilflosen Helfern» durch einen gelegentlich unvermittelten, frühen psychoanalytischen Traditionen (etwa in «Totem und Tabu») nahestehenden Schritt von der individuellen Psychodynamik zu Fragen der Kultur und Menschheitsgeschichte schlechthin ersetzt ist. Dieses wachsende Interesse an institutionellen Bedingungen hängt damit zusammen, daß meine eigene Arbeit sich von der Selbsterfahrung außerhalb der Institutionen mehr und mehr zur Supervision in den Institutionen entwickelt hat. 1986 habe ich zusammen mit Harald Pühl ein Buch zu diesem Aspekt herausgegeben.
Hat sich das Helfersyndrom in den Jahren seit 1977 geändert? Wahrscheinlich nicht, was die grundlegende Dynamik der Motivation angeht. Sicherlich aber in der Perspektive und Dauerhaftigkeit einmal getroffener Berufswahlen. Ich kann diese Veränderungen miterleben, wenn ich versuche, mich in die Studiensituation meiner Kinder einzufühlen und sie mit meiner eigenen zu vergleichen. Während meiner Ausbildung war es relativ klar, daß die formalen Qualifikationen (Abitur, Diplom usw.) auch einen sicheren Platz in der Arbeitswelt garantieren. Ein Teil meiner Sorgen (der zu dem nomadisierenden Leben als Schriftsteller in Italien beitrug) lag darin, allzu früh von einer Gesellschaft vereinnahmt zu werden, die meine Arbeitskraft zu begehren schien. Heutige Jugendliche finden diese Sicherheit nicht mehr. Damit werden auch die Helfer-Ideale weniger stabil, an denen sie sich orientieren können, während andrerseits die Abhängigkeit von äußerer Bestätigung und Erfolgserlebnissen wächst. So bleiben auch die helfenden Berufe nicht vom Identitätswandel in der postindustriellen Gesellschaft verschont. Die Bedeutung einer stabilen, konstanten Produktion nimmt ab; auch der Helfer muß gewärtigen, daß ihn keiner braucht, weil eine Modeströmung ihre Richtung geändert hat. Der Arzt zum Beispiel muß nicht nur mit dem Heilpraktiker und dem Schamanenkurs konkurrieren, sondern auch mit einem Kunstfehlerprozeß rechnen – Ausnahmesituationen zwar, aber auch Hinweise über Entwicklungsrichtungen. Lebenslange Berufsrollen werden ebenso unzeitgemäß wie die strukturgebende Festigkeit des von Freud beschriebenen Über-Ich. Die Individuen idealisieren unterschiedliche Werte, die sich manchmal widersprechen. Sie suchen Geborgenheit, indem sie sich chamäleongleich an Ideologien kleiner Gruppen und Sekten anpassen. Das «alte» Helferideal vom Professionellen, der unabhängig von Lob und Tadel seine Pflicht tut, nur seinem Gewissen folgend, löst sich teilweise auf. Es muß weniger verleugnet werden, daß auch der Helfer narzißtische Bedürfnisse hat. «Mehr sein als scheinen» wird zum Anachronismus, zum ironischen Zitat in einer vom Dienstleistungsmarkt bestimmten Helfer-Welt. Stärkere Außenorientierungen sind die Folge. Selbst der Klient oder Patient wird oft als Partner gesucht und nicht nur einbezogen, sondern auch überfordert, wenn er aus einer für den Helfer wie für ihn unübersichtlichen, schwer entscheidbaren Situation – etwa einem breiten Angebot von Therapiemethoden, alle mit Vorzügen und Nachteilen – auswählen soll.
Vermutlich konnte ein Text wie «Die hilflosen Helfer» nur zu einer Zeit geschrieben werden, in der die traditionellen Ideale des helfenden Berufs noch so mächtig waren, daß eine konstante Gestalt des «Helfer-Syndroms» angenommen werden durfte, während sie andrerseits schon so weit in Frage standen, daß eine psychoanalytische Untersuchung möglich wurde. Eine verwandte Übergangssituation drückt sich vielleicht darin aus, daß ich damals nur wenige geschlechtsspezifische Differenzierungen aufnahm.[*] In einer noch standes- und traditionssicheren Berufswelt haben das männlich-normative und das weiblich-gefühlvolle Helfen unterschiedliche Gestalten, zum Beispiel «Wärter» und «Schwestern». Die Individualisierung löst solche Rollen auf, aber auch heute können Frauen Hilfe eher annehmen, wenn sich im Angebot das Interesse an einer Beziehung ausdrückt, Männer, wenn sie ihren Status verbessern (oder erhalten). Insgesamt sind Männer mehr an Rivalität und Funktionslust orientiert, Frauen an Bindung und Information über andere Menschen. Solche Unterschiede sind wohl weder angeboren noch anerzogen, sondern aus beiden Dimensionen gemischt, weder unveränderlich-natürliche Anlage noch beliebig-rational wandelbare Attitüde. Sie können in jedem einzelnen Fall durch besondere Qualitäten des individuellen Schicksals und der persönlichen Entscheidung außer Kraft gesetzt werden, drücken sich aber doch in den Bewegungen größerer Menschenmengen unzweifelhaft aus.[*]
1.Einleitung: Das Helfer-Syndrom
«Ich wollte mit einer Frau schlafen. Deshalb bin ich nachts in die Landsberger Straße gefahren, wo diese Prostituierten stehen. Als ich dort war und an ihnen vorbeifuhr, hatte ich Magenschmerzen und Herzklopfen vor Aufregung und Angst. Ich dachte, ich bin sicher impotent, und bin da vorbeigefahren. Da sah ich eine Frau, die eine Autopanne hatte. Als ich anhielt und ihr meine Hilfe anbot, war ich wieder ganz ruhig und sicher. Es ist schon eine verfluchte Rolle, die ich da spiele.»
Ein Arzt, 32 Jahre
«Wenn ich Menschen kennenlerne, dann setze ich mich sehr für sie ein. Meist haben sie Probleme, und ich höre mir das an und bemühe mich sehr, mit ihnen eine Lösung zu finden. Und wenn wir dann die Lösung gefunden haben, dann höre ich nichts mehr von ihnen. Ich bin dann schwer enttäuscht und denke, du schaffst es einfach nicht …»
«Sprechen Sie von Ihren Klienten oder von privaten Bekannten?»
«Ich meine natürlich die Leute, die ich privat kennenlerne. Von den Familien, die ich betreue, würde ich mir ja nie so etwas wie Dank erwarten.»
Eine Sozialarbeiterin, 40 Jahre
«Lukas hatte solche Arbeitsstörungen und Ängste im Studium, und so habe ich mich die ganze Zeit um ihn gekümmert und das Geld verdient. Als er dann Examen machte, wurde ich krank. Jetzt haben wir beschlossen, auseinanderzuziehen. Er sagt, ich hätte ihm gar keine Luft gelassen, er fühle sich so verpflichtet. Aber ich mußte ihm doch helfen …»
Eine Lehrerin, 29 Jahre
Diese Anekdoten sollen die Äußerungsformen des Helfer-Syndroms aufzeigen, um dessen Entstehung und innere Gesetzmäßigkeit es hier geht. Unter Syndrom versteht man in der Medizin eine in typischer Kombination auftretende Verbindung einzelner Merkmale, die einen krankhaften Prozeß bestimmen. Im Bereich der Psychologie ist die Grenze zwischen «gesund» und «krank» hierbei selten leicht zu ziehen. Besonders schwierig ist das angesichts eines sozial so hoch geachteten Verhaltens wie der Hilfe für andere, des Altruismus.
Mir scheint, daß schätzenswerte menschliche Eigenschaften nicht an Wert verlieren, wenn ihr Zustandekommen genauer untersucht wird. Es geht mir auch nicht darum, zu zeigen, daß dem Helfen-Wollen ein «letzten Endes egoistisches» Motiv zugrunde liegt. Die Unterscheidung von altruistischem und egoistischem Verhalten ist ihrerseits eine Folge bestimmter gesellschaftlicher Entwicklungsformen. Von ihrer Analyse aus kann sie in einer sinnvolleren Weise gestellt und beantwortet werden. Idealvorstellungen von der Persönlichkeit des Helfers sind kritisch zu sehen. Oft schaden sie mehr, als sie nützen. Es geht gerade nicht darum, durch den Hinweis auf die vielfältigen Schwierigkeiten und Konflikte der Angehörigen «helfender» Berufe (Erzieher, Ärzte, Psychotherapeuten, Geistliche, Lehrer) das Idealbild des perfekten Helfers zu entwickeln. Einfühlendes Verständnis für Schwächen und Mängel – eigene und fremde – ist gerade die Voraussetzung wirksamer Hilfe.
Als ich nach längerem Zögern den Entschluß faßte, mich einer Analyse zu unterziehen, rechtfertigte ich das als ein ausbildungsorientiertes Streben nach «Lehreranalyse», Parallel dazu suchte ich einen möglichst perfekten Analytiker – einen Analytiker ohne Fehler, mit umfassendem Wissen usw. Wenn ich zurückblicke, gewinne ich den Eindruck, daß nicht die Perfektion, sondern der Umgang mit meinen und seinen eigenen Schwächen das wichtigste war, was ich von meinem analytischen Lehrer erfahren habe.
Der Idealanspruch an den Helfer drückt sich oft in den Ausbildungsanforderungen psychoanalytischer Institute aus. Nicht selten hört oder liest man Formeln wie «Keiner kann einem anderen helfen, ein Problem zu lösen, das er selbst noch nicht bewältigt hat» oder «Niemand wird einen Patienten weiter bringen, als er selbst ist». Die Vielfalt menschlicher Beziehungen wird in solchen vom Ideal-Ich bestimmten Formeln auf eine enge, wertende Dimension gebracht, wodurch die geschichtliche Entwicklung der Psychoanalyse geradezu umgekehrt wird (in der selbst nicht oder nur ganz kurz analysierte Pioniere immer längere Ausbildungsanalysen durchführten und befürworteten). Ein Gegenbeispiel (das ebensowenig wie die oben zitierten Formeln Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat): Zu einem Psychoanalytiker kommt ein Klient. Er möchte sich einer Therapie unterziehen; seine Symptome sind Depressionen und quälende Migräneanfälle. Der Arzt sagt: «Was die Depressionen angeht, halte ich die Behandlungsaussichten für günstig. Aber in bezug auf die Migräne kann ich nicht viel versprechen; da sollten Sie sich keinen großen Erfolg erwarten.» Der Arzt spricht aus eigener Erfahrung: Seine Migräneanfälle haben durch die Analyse, die er selbst absolvierte, nicht wesentlich nachgelassen. Doch sein in dieser Weise entmutigter Klient berichtet nach einigen Monaten, er habe nun alle Medikamente gegen seine Kopfschmerzen weggeworfen. Er brauche sie nicht mehr – die Psychotherapie habe ihn von seinen Migräneanfällen geheilt.
Solche Ereignisse zeigen, wie töricht der Idealanspruch an den Helfer ist, der sich in diesem Fall so formulieren läßt (und in einem Aufnahmeinterview an einem psychotherapeutischen Ausbildungsinstitut einem dann abgelehnten Kandidaten auch entsprechend gesagt wurde): «Wie wollen Sie einen Patienten von einem psychosomatischen Leiden befreien, unter dem Sie selbst noch leiden?» Hier wird deutlich, wie Institutionen dazu neigen, in ihrer Aufnahme- und Ausbildungspolitik jene Muster zu kopieren, die in der Analyse von familiären Erziehungsprozessen bereits als neurotisierend erkannt wurden. Gemeint ist das Ideal-Ich der Eltern, das mit dem Anspruch der perfekten Erfüllung an ein Kind herangetragen wird. Dadurch entsteht die Gefahr, daß Entwicklungs- und Wachstumsprozesse durch Ausleseprozesse ersetzt werden. Auslese bringt dann eine Spaltung mit sich; das Kind erfährt, daß es seine «guten» Eigenschaften entwickeln darf, seine «schlechten» hingegen abspalten und verdrängen muß. Oft sind aber gerade diese in den Augen der Eltern «schlechten» Eigenschaften sehr wesentlich. Sie können nicht ohne Schaden abgespalten und unentwickelt gelassen werden, da sie wichtige Verhaltensweisen (z.B. Durchsetzung, Zärtlichkeit, sexuelle Potenz, Gefühlsintensität) erst ermöglichen.
In einer vergleichbaren Weise halte ich auch die Unvollkommenheiten des Helfers für potentiell produktiv. Es ist sinnvoller, an ihnen und mit ihnen einen Entwicklungsprozeß einzuleiten, als ihre Abspaltung zu erzwingen. Perfektions-Ideale lassen sich stets nur durch Verleugnung der Wirklichkeit aufrechterhalten. Dadurch verliert die Tätigkeit des Helfers leicht ihre Orientierung. Enttäuschungen, wie sie nicht ausbleiben, können nicht mehr verarbeitet, Fehler nicht korrigiert werden. Der zum Schlagwort gewordene «Burnout», das Ausbrennen des Helfers, ist nicht selten die Folge.[*] Das Helfer-Syndrom, die zur Persönlichkeitsstruktur gewordene Unfähigkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse zu äußern, verbunden mit einer scheinbar omnipotenten, unangreifbaren Fassade im Bereich der sozialen Dienstleistungen, ist sehr weit verbreitet. Ich hatte in den letzten Jahren vielfältige Möglichkeiten, es kennenzulernen – zunächst an mir selbst, seit ich aus der distanzierten, literarischen Form des psychosozialen Engagements in die unmittelbare psychotherapeutische und gruppendynamische Arbeit überwechselte. Parallel dazu auch an meinen Klienten, die zum großen Teil aus den sozialen Berufen kommen; an den Ausbildungsteilnehmern in der Gesellschaft für analytische Gruppendynamik (G.a.G.), die ich in Selbsterfahrungsgruppen und in Einzelgesprächen kennenlernte, und last but not least an den Teilnehmern der von mir geleiteten Kurz- und Langzeitgruppen. Im Gegensatz zum ausschließlich mit Einzelbehandlungen befaßten Analytiker lernt der daneben mit Gruppentherapie und gruppendynamischer Arbeit befaßte Psychologe einen breiten Ausschnitt aus der Bevölkerung kennen. Es sind nicht nur «Patienten», sondern auch Menschen, die sich als seelisch gesund ansehen, die häufig mit dem Ziel zu ihm kommen, gerade ihre Fähigkeiten als Helfer zu verbessern. Obwohl ich auch auf die Ergebnisse statistischer und testpsychologischer Untersuchungen, die im Rahmen der G.a.G. angestellt wurden, verweisen kann, ist die Methode dieser Arbeit psychoanalytisch. Sie geht von einem umfassenden, beschreibend-hermeneutischen Wissenschaftsmodell aus, nicht von einem positivistisch-experimentellen. Es geht mir darum, die Psychohygiene in den Helfer-Berufen zu verbessern.
«Früher habe ich mich oft schier zerrissen, und hatte doch das Gefühl, ich erreiche nichts. Wenn um Mitternacht ein Anruf kam, bin ich hingegangen und habe mit den Leuten geredet. Ich dachte einfach, ich darf nicht nein sagen, wenn es jemandem schlecht geht. Aber ich konnte das Gefühl nicht loswerden, daß meine Klienten das ausnützten … Seit ich die Ausbildung gemacht habe, vor allem auch die Einzelanalyse, habe ich das geändert. Ich sage jetzt solchen Anrufern, sie sollten sich während der Dienstzeit an mich wenden. Da kann ich aber auch voll für sie da sein, weil ich ausgeschlafen und nicht insgeheim wütend bin. Solche Gefühle habe ich mir früher überhaupt nicht zugestanden. Ich dachte, ich muß immer nur für die anderen da sein. Aber da ist auch die Ausbildung schuld. Man lernt nichts, als den höchsten Anspruch an sich zu stellen, und kriegt kaum konkrete Mittel in die Hand, um auch etwas zu erreichen …» (eine Sozialarbeiterin, 30 Jahre).
Daß es um die seelische Gesundheit bei den Angehörigen der helfenden Berufe nicht sonderlich gut bestellt ist, erweisen einige statistische Studien. Am besten dokumentiert ist die Situation bei dem prestigeträchtigsten Helfer-Beruf, dem Arzt. Doch dürften Krankenpflegepersonal, Pädagoginnen und Pädagogen oder Psychologen sich in diesem Punkt kaum von den Ärzten unterscheiden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in keiner Berufsgruppe (psychische) Störungen so sehr vertuscht und bagatellisiert werden wie in der, die unmittelbar mit der Behandlung dieser Störungen befaßt ist. Gerade darin drückt sich das Helfer-Syndrom besonders deutlich aus, daß Schwäche und Hilflosigkeit, offenes Eingestehen emotionaler Probleme, nur bei anderen begrüßt und unterstützt werden, während demgegenüber das eigene Selbstbild von solchen «Flecken» um jeden Preis frei bleiben muß.
Der kranke Arzt: Statistisches Material
Als vor über 30 Jahren die amerikanische Arzneimittelfirma Park-Davis Fragebögen an 10000 Ärzte verschickte, in denen der Gesundheitszustand der Mediziner geprüft wurde, bestätigten nur 0,5 Prozent der Antwortenden, daß sie an seelischen Störungen litten. Das Idealbild des seelisch stabilen, jeder Anforderung gewachsenen Arztes hatte sich als mächtiger erwiesen als die Realität; Ärzte werden öfter in psychiatrischen Kliniken aufgenommen als sozioökonomisch vergleichbare Bevölkerungsgruppen. Ihre Selbstmordhäufigkeit ist statistisch signifikant höher als die der Durchschnittsbevölkerung (nach einer englischen Statistik 2,5mal so hoch). Ebenfalls aus England stammt die Studie von M.F. Brook und seinen Mitarbeitern, die 182 Fällen der Einweisung von Ärzten in Nervenkrankenhäuser nachgingen. Es zeigte sich, daß in einem Krankenhaus einer von 82 Patienten, in einem anderen sogar einer von 46 Patienten, die neu eingewiesen wurden, ein Arzt war. Diese Zahl liegt erheblich über dem statistischen Durchschnitt, d.h. über dem Wert, der zu erwarten ist, wenn die Ärzte entsprechend ihrer Häufigkeit in der Bevölkerung aufgenommen würden.[*] Während man gegen diese Arbeit (und andere, die zu vergleichbaren Ergebnissen kommen) noch einwenden kann, daß durch die Auswahl des Ausgangsmaterials (Ärzte in psychiatrischen Krankenhäusern) und das Fehlen einer Kontrollgruppe die Ergebnisse verfälscht sein könnten, weisen die Ergebnisse einer prospektiven Arbeit von G.E. Vaillant und Mitarbeitern[*]in eine ähnliche Richtung. Diese verglichen eine Gruppe von 47 Studenten der Medizin von deren Eintritt in die Universität an mit einer Gruppe von zufällig ausgewählten Studenten anderer Fächer. Beide Gruppen wurden drei Jahrzehnte lang verfolgt. Es zeigte sich, daß von den Ärzten 47 Prozent schlechte Ehen hatten oder sich scheiden ließen; 36 Prozent psychoaktive Medikamente und/oder Alkohol bzw. andere Rauschdrogen nahmen, sich 34 Prozent irgendeiner Form von Psychotherapie unterzogen und 17 Prozent einen oder mehrere Aufenthalte in einer Nervenklinik hinter sich brachten. Alle diese Zahlen waren eindeutig höher als die der sozioökonomisch vergleichbaren Kontrollgruppe.
Die innere Situation des Menschen mit dem Helfer-Syndrom läßt sich in einem Bild beschreiben: ein verwahrlostes, hungriges Baby hinter einer prächtigen, starken Fassade.
«Ich war mit einer Gruppe anderer Studenten vor dem Haus von Prof. X. Wir sollten eine Glocke an dieses Haus montieren. Ich sehe noch die hohen, aus Kalkstein gemauerten Wände vor mir. Die Sache mit der Glocke klappte aber nicht gut. Wir brauchten noch Material, Seile und so. Deshalb ging ich zu einem Schuppen in der Nähe. Als ich herankam, hörte ich in dem Schuppen ein leises Weinen. Ich öffnete die Tür. Da sah ich etwas ganz Schreckliches: Ein halb verdurstetes, abgemagertes Kind, ganz verdreckt und mit Spinnweben überzogen, steckte eingeklemmt zwischen dem Gerümpel» (Traum eines 30jährigen Arztes).
In diesem Traum wird der Gegensatz zwischen der auf narzißtische Geltung abgestellten Fassade (der Professor, die Glocke) und den abgespaltenen, unansehnlichen, kindlich gebliebenen Bedürfnissen deutlich. Die Fassade sagt: «Ich brauche nichts, ich gebe!» Das Kind sagt: «Ich bin hungrig und durstig (nach Zuwendung und Geborgenheit), aber ich darf mich nicht hervorwagen.» Der Beziehung Helfer–Klient fehlt die volle Gegenseitigkeit; beim Helfer-Syndrom ist dieser Mangel an offener Gegenseitigkeit zum Persönlichkeitszug (analytisch gesprochen: zu einem Teil der Charakter-Abwehr) geworden. Der Klient soll seine Bedürfnisse äußern und Befriedigungsmöglichkeiten für sie finden; der Helfer muß die Äußerung seiner Bedürfnisse zurückstellen. Ich werde noch beschreiben, wie sich das Helfer-Syndrom in Freundschafts- und Liebesbeziehungen auswirkt. Das skizzierte Bild der stark wirkenden Fassade und des hungrigen, verwahrlosten Säuglings dahinter soll hier vor allem dazu dienen, die außerordentlich große Suchtgefährdung im Rahmen des Helfer-Syndroms aufzuzeigen. Während in der Bevölkerung auf etwa 600 Nichtärzte ein Arzt kommt, sind es unter den Entlassenen aus einer Klinik zur Behandlung von Rauschmittelsucht nur 50 Nichtärzte auf einen Arzt. In der Studie von Vaillant et al. benützte ein Drittel der untersuchten Ärzte regelmäßig Psychopharmaka, Alkohol oder Rauschgifte im engeren Sinn (Morphium und seine Derivate). Mindestens 1 Prozent der amerikanischen Ärzte ist rauschgiftsüchtig, was sonst in der Berufsgruppe der Akademiker außerordentlich selten ist. Wie zu erwarten, wird der Suchtmittelgebrauch durch Ärzte von der Helfer-Fassade her begründet. Nach der Untersuchung von H.C. Modlin und A. Montes über die Rauschgiftsucht bei Ärzten schreiben die Befragten den Beginn des Mißbrauchs der Suchtmittel an erster Stelle ihrer Überarbeitung, an zweiter ihrer dauernden Müdigkeit und an dritter dem Ankämpfen gegen körperliche Krankheiten zu. Die beiden Psychiater kommen zu einem anderen Ergebnis: Sie sprechen von einer «oralen Persönlichkeit», die sich bereits vor Beginn der Rauschgiftsucht äußerte. Das wesentliche Dilemma der oralen Persönlichkeit läßt sich aus dem Bild von der Fassade und dem Baby ableiten: Die eigenen Bedürfnisse nach narzißtischer Versorgung durch Zuwendung und offenen Austausch von Gefühlen können nicht angemessen befriedigt werden, weil sie sich nur indirekt – durch das starre Festhalten an der Helfer-Rolle – ausdrücken. Charakteristisch für die süchtigen Ärzte war ihre Abhängigkeit von ihren Ehefrauen in bezug auf emotionale Zuwendung, verbunden mit der Unfähigkeit, eine stabile, gegenseitige Beziehung aufrechtzuerhalten. Die Fassade sagt: «Verlang nichts von mir, ich muß für meine Patienten da sein!», während das Baby sagt: «Ich brauche dich, du mußt mich versorgen und stützen!» Die Sucht bricht nicht selten dann aus, wenn die Ehefrau diese Stützfunktion nicht mehr ausübt, weil sie selbst sich ausgebeutet fühlt. (In diesem Punkt überschneiden sich das Helfer-Syndrom und Grundmerkmale der patriarchalischen Gesellschaften, die auf Ausbeutung der emotionalen Stützfunktion der Frau für die Arbeit des Mannes ausgerichtet sind.) Doch steht die Ehefrau hier für die Befriedigungsmöglichkeiten aus mitmenschlichen Beziehungen schlechthin. Diese sind beim Helfer-Syndrom nur ganz einseitig entwickelt. Wegen der frühen, stark ausgeprägten Spaltung zwischen der Fassade und dem Kind müssen die oralen Bedürfnisse nach Zuwendung, Bestätigung, emotionalem «Gefüttertwerden» auf einer primitiven Stufe bleiben. Das Suchtmittel bietet hier eine Befriedigungsmöglichkeit, die auf ebendieser urtümlichen Stufe ansetzt. Es erlaubt dem Süchtigen, aus einer Alltagswelt zu fliehen, die ihm voller Belastungen und ohne Möglichkeit der Entspannung scheint. Die prägnante Kurzformel «Rauschdrogen sind giftige Muttermilch» drückt diesen Zusammenhang aus: Die frühen Entbehrungen, welche den Helfer veranlaßten, sein inneres Baby in einen dunklen, schmutzigen Keller zu sperren, haben die Bedürfnisse dieses Babys auf einem urtümlichen Niveau bewahrt. Dafür gibt es im Leben des Erwachsenen keine angemessenen Befriedigungsmöglichkeiten mehr. Die Regression zum wunschlosen Nirwana-Zustand des Süchtigen ist meist selbstzerstörerisch. Der oralen Persönlichkeit sind gewissermaßen die Saugwurzeln verlorengegangen, mit deren Hilfe andere Erwachsene aus ihren mitmenschlichen Beziehungen genügend Befriedigung gewinnen. Die grobe Bedürftigkeit seiner unentwickelt gebliebenen narzißtischen Ansprüche hat keinen Kontakt zu seinem Alltag, den er allein mit Hilfe seiner Fassade bewältigt. Er kann die einfühlende Zuwendung der Primärgruppe (die «gute Milch» nach der analytischen Kurzformel) ebensowenig nachträglich erfahren, wie ein vierzigjähriger Erwachsener an der Brust der Mutter Befriedigung finden könnte. Doch der Differenzierungsgrad seiner Bedürfnisse ist noch auf dieser primitiven Stufe. Aus diesem Grund brauchen psychotherapeutische Prozesse auch meist so lange Zeit. Alkohol, süchtiges Zigarettenrauchen oder Rauschgiftsucht sind kürzere Wege. Sie führen aber zu einem anderen Ziel: Die Nachentwicklung des kindlichen, wünschenden Ichs wird durch sie verhindert. Wer keine differenzierten Möglichkeiten der Befriedigung durch menschliche Beziehungen hat, wem also die oben angesprochenen feinen Saugwurzeln fehlen, der ist anfällig für so grobe Mittel wie die Rauschdrogen. Die Sucht führt dann dazu, daß die bisher entwickelten, unzureichenden Verwurzelungen in mitmenschlichen Beziehungen noch weiter abreißen. Sie wird zur bösen Mutter, die das Kind nicht leben läßt, es aber auch nicht freigibt: Die schleichende Selbstzerstörung durch das Rauschgift spiegelt eine Beziehung in der Primärgruppe wider, in der Selbstsein schrecklich war, der Aufbau einer Fassade die einzige Rettung schien. Jetzt wird der Süchtige wieder zum Kind; diesmal aber zerstört er sich selbst.
Depressionen und Selbstmordgefahr
Die häufigste seelische Störung beim Helfer-Syndrom ist die Depression. Die Selbstmordhäufigkeit in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe ist ein relativ brauchbarer Gradmesser des Auftretens von Depressionen; sie ist bei Ärzten in der Altersgruppe zwischen 25 und 39 Jahren mit 26 Prozent aller Todesfälle fast dreimal so hoch wie in der statistisch vergleichbaren Durchschnittsbevölkerung (9 Prozent).[*] Zwischen Alkoholismus und anderen Formen von Drogenabhängigkeit einerseits, der Neigung zu Selbstmordhandlungen andererseits besteht ein statistisch signifikanter Zusammenhang: Eine besonders suchtgefährdete Bevölkerungsgruppe ist auch besonders selbstmordgefährdet.
Wie Heinz Henseler[*] demonstriert hat, sind Selbstmordhandlungen sehr komplex motiviert und nicht einfach einer bestimmten seelischen Störung zuzuordnen. Sie treten bei Angstneurosen und Zwangsneurosen fast nie auf, sind bei den sogenannten «endogenen» Depressionen aber nicht häufiger als bei den «psychogenen» Depressionen mit einer leichter auffindbaren seelischen Verursachung. Gelegentlich versuchen Menschen sich plötzlich umzubringen, die in ihrer Umgebung als heitere Lebenskünstler gelten. Wahrscheinlich ist nicht die Depression, sondern die gestörte Entwicklung des Ich-Ideals und des Über-Ichs als gemeinsamer Nenner der zum Selbstmord führenden Vorgeschichte anzunehmen. Die Depression ist nur eine mögliche Folge dieser Entwicklung, die E. Ringel[*] als Ich-Verunsicherung und «Neurose der Lebensgestaltung» anspricht. Henseler analysiert sie detailliert, indem er das psychoanalytische Narzißmus-Konzept einbezieht. Da die narzißtische Thematik gerade beim Helfer-Syndrom eine zentrale Rolle spielt, haben wir sie in einem eigenen Abschnitt behandelt (S. 48f).
Wesentliches Merkmal der selbstmordgefährdeten Persönlichkeit ist die Neigung, Aggressionen nicht in angemessener Form nach außen zu richten, sondern sie gegen die eigene Person zu kehren. Freuds Bemerkung, niemand töte sich selbst, der damit nicht einen anderen ermorden wolle, bezieht sich auf den Prozeß der Identifizierung: Das Kind hat keine andere Wahl; es muß auch eine ambivalent erlebte, teilweise verhaßte Bezugsperson als Vorbild aufnehmen, um nicht verlassen und hilflos zu sein. Dabei ist festzuhalten, daß Freud in seiner Beschreibung dieser Situation nicht zwischen narzißtischen und libidinösen (auf das Selbst bzw. auf die Mitmenschen gerichteten) Antrieben unterschieden hat. Die depressive, in «Trauer und Melancholie» beschriebene Lösung des Aggressions-Abhängigkeits-Konfliktes durch Identifizierung mit dem gehaßtgeliebten Menschen setzt jedenfalls eine narzißtische Persönlichkeitsstörung bereits voraus. Die Depression signalisiert dann die Hilflosigkeit und Ohnmacht, den Anforderungen des eigenen Ich-Ideals zu genügen. Henseler verweist darüber hinaus auf die mehr oder weniger geheimen Größenphantasien depressiver, zum Suizid neigender Menschen. Ihr Selbstgefühl schwankt stark – nicht zwischen den Polen der realistischen Einschätzung und der Wertlosigkeit, sondern zwischen übermächtiger, einsamer Größe und völligem Versagen. Wesentlich ist die (testpsychologisch als Rigidität, Verletzlichkeit und Irritabilität nachweisbare, vgl. Henseler a.a.O., S. 46) Starrheit im Umgang mit den idealisierten Teilen der Persönlichkeit. Der narzißtisch einigermaßen stabile Mensch ist in der Lage, Kränkungen zu verarbeiten, indem er sie in realistischen Dimensionen sieht: Hier und da habe ich einen Fehler gemacht, aber in vielen anderen Bereichen bin ich ganz in Ordnung. Die narzißtische Störung drückt sich darin aus, daß jeder kleine Fehler einen aus früherer Zeit stammenden Speicher schlechter Gefühle anzapft, der dann die ganze Person überschwemmt und das Selbst vollständig in Frage stellt. In dieser Situation der Überforderung durch ein hochgespanntes Ich-Ideal und der inneren Bedrohung durch narzißtische Kränkungen bietet die Selbstmordphantasie Trost:
«Obs edler im Gemüt, die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks zu tragen, oder sich wappend gegen eine See von Plagen durch Widerstand sie enden – sterben, schlafen, nichts weiter» (Hamlets Monolog).
Wo nicht zum Schutz gegen diese Gefahr zwanghafte Abwehrmechanismen aufgebaut wurden, ist die Selbstmordphantasie häufig im Hintergrund des Helfer-Syndroms nachzuweisen.
«Wenn es mir zuviel wird und ich diese Leere spüre und denke: du bringst es doch nicht, dann ist es mir immer ein großer Trost, wenn ich mir vorstelle: du kannst dich ja jederzeit umbringen, und dann hast du Ruhe» (ein 36jähriger Arzt).
Die depressive und suizidale Problematik im Rahmen des Helfer-Syndroms wird noch dadurch verschärft, daß es dem Helfer extrem schwerfällt, seinerseits Hilfe zu akzeptieren. Da es zu seiner Abwehrstruktur gehört, anderen auf Kosten der eigenen, triebhaften Wünsche zu helfen, lehnt er die eigene Hilfsbedürftigkeit ab und akzeptiert Hilfe allenfalls in der Form einer «Fortbildung», um seine Fähigkeit zur Hilfeleistung noch zu vervollkommnen. Hier gilt also auch das bissige Bonmot, daß der neurotisch Kranke die Therapie nicht aufsucht, um gesund zu werden, sondern um seine Neurose zu perfektionieren. Einfühlender gesehen: Da in einer bedrohten Kindheitssituation die Ausbildung einschränkender, selbstschädigender Abwehrmechanismen die einzig erkennbare Garantie des seelischen Überlebens war, kann sich der neurotisch Kranke keine andere Form der Hilfe vorstellen als einen besseren, perfekteren Ausbau dieses Systems von Einschränkungen und Abwehr. Wenn er es aufgibt, fürchtet er, sich ganz zu verlieren.
Während die Angehörigen der helfenden Berufe danach trachten, ihren Klienten glaubhaft zu machen, daß die Annahme von Hilfe keine Schande ist, fällt es vielen von ihnen sehr schwer, selbst an diese Maxime zu glauben. Fast alle Ärzte, die sich mit dem Problem des körperlich und/oder seelisch erkrankten Arztes befaßt haben, weisen auf die großen Schwierigkeiten hin, die hier entstehen. Psychiater, die in der Öffentlichkeit allmählich Erfolg mit der Aufklärung darüber haben, daß seelische Krankheiten heilbar und kein Makel sind, können ihre Kollegen offensichtlich zuallerletzt überzeugen. Vaillant spricht von einer neurotischen Phobie vieler Ärzte, Hilfe anzunehmen. Obwohl in der medizinischen Ausbildung immer wieder gefordert wird, der Arzt solle Selbst-Diagnosen und Selbst-Behandlungen meiden, sind solche Verhaltensweisen sehr weit verbreitet. Die Schwere der eigenen Krankheit wird bagatellisiert und verleugnet; Medikamente werden unregelmäßig und in zu geringer Dosis genommen.[*]
E.M. Waring[*] schildert einige Beispiele, welche die Situation des psychisch gestörten Arztes verdeutlichen: Ein Nervenarzt in mittlerem Lebensalter verzögerte die Aufnahme einer Behandlung um sechs Monate, obwohl er an eindeutigen Symptomen einer schweren Depression mit Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust, Verstopfung, Tagesschwankungen der Stimmung, Impotenz, geistiger Verlangsamung, trauriger Verstimmung und Selbstmordgedanken litt. Er erklärte, da er nicht an Schlaflosigkeit gelitten habe, sei sein Zustand wohl nicht sehr ernst gewesen, obwohl während der sechsmonatigen Periode, in der er eine Behandlung vermied, seine Ehe zerbrach und er eine berufliche Position verlor, die ihn sehr befriedigt hatte. Daneben behandelte er sich mit antidepressiven Medikamenten in einer Dosis, die erheblich unter den allgemein anerkannten, therapeutisch wirksamen Mengen lag, und unterbrach diese Behandlung, wenn er sich etwas besser fühlte. Sein Alkoholkonsum hatte beträchtlich zugenommen.
Ein älterer Arzt verschrieb sich selbst barbiturathaltige Schlafmittel in großen Mengen (über 800 mg pro Tag) über zwei Jahre. Er hielt sich für nicht süchtig und auch nicht für psychiatrischer Hilfe bedürftig. Seine Krankenhausaufnahme wurde durch den Selbstmord seiner Frau ausgelöst, dem zahlreiche Selbstmordversuche vorausgegangen waren. Auch seine Frau hatte er für seelisch gesund gehalten.
Zusammenfassung
Das Helfer-Syndrom ist eine Verbindung charakteristischer Persönlichkeitsmerkmale, durch die soziale Hilfe auf Kosten der eigenen Entwicklung zu einer starren Lebensform gemacht wird. Es wird in der Einleitung durch anekdotische Darstellungen veranschaulicht. Daran schließt sich eine erste Analyse statistischen Materials zur Problematik der seelischen Störungen bei Helfer-Berufen, vor allem bei Ärzten, an. Die Grundproblematik des Menschen mit dem Helfer-Syndrom ist die an einem hohen, starren Ich-Ideal orientierte soziale Fassade, deren Funktionieren von einem kritischen, bösartigen Über-Ich überwacht wird. Eigene Schwäche und Hilfsbedürftigkeit werden verleugnet; Gegenseitigkeit und Intimität in Beziehungen vermieden. Die orale und narzißtische Bedürftigkeit des Helfers ist groß, doch ganz oder teilweise unbewußt. Da ihre Äußerungsformen nicht entwickelt und differenziert werden konnten, funktioniert sie auf einem urtümlichen Niveau. Das äußert sich etwa in einer wenig ausgebildeten Fähigkeit, erfüllbare Wünsche zu äußern. Wünsche werden eher angesammelt und dann als Vorwürfe gegen die Umwelt («Was habe ich nicht alles für euch getan – und so wird es mir gelohnt») ausgesprochen, wenn nicht noch indirektere Wunschäußerungen überwiegen (z.B. Sucht, Suizid oder psychosomatische Krankheit als selbstzerstörerischer Appell an andere, um deren Zuwendung und Hilfe zu erlangen).
Im weiteren Verlauf dieser Darstellung geht es zunächst um die soziale Dynamik und die gesellschaftliche Verwurzelung, dann um die individuell-biographische Entstehung des Helfer-Syndroms, Weiter soll beschrieben werden, welche Einflüsse das Helfer-Syndrom auf die praktische Arbeit in Medizin, Sozialarbeit, Psychotherapie oder (Nach-)Erziehung hat. Daran schließt sich eine Diskussion der therapeutischen und vorbeugenden Maßnahmen sowie der Psychohygiene in den Helfer-Berufen allgemein an.
2.Zur Anthropologie des Altruismus
«Bestenfalls vielleicht die Enkel (werden in der Lage sein, wie kastilische Bauern zu leben); doch sind die Eingeborenen so lasterhaft, daß man selbst dies bezweifeln muß. Einerseits fliehen sie die Spanier und lehnen es ab, ohne Belohnung zu arbeiten; andrerseits sind sie so pervers, daß sie manchmal ihren gesamten Besitz verschenken. Außerdem weigern sie sich, jene ihrer Kameraden zu verstoßen, denen die Spanier die Ohren abgeschnitten haben.»
Bericht spanischer Siedler vor einer
Kommission des Hieronymitenordens, um 1515.[*]
Altruistische Verhaltensweisen sind unter Lebewesen weit verbreitet. Ich definiere sie nach einem Vorschlag von William Hamilton[*] als die Bereitschaft, eine Gefahr für sein eigenes Wohlergehen hinzunehmen, um einem Artgenossen zu nützen, während beim egoistischen Verhalten die Schädigung eines Artgenossen in Kauf genommen wird, um die Überlebenschancen des Individuums zu verbessern. Die biologische Begründung altruistischen Verhaltens scheint auf den ersten Blick schwieriger als die des im «Kampf ums Überleben» selbstverständlichen Egoismus. Doch läßt sich mit den mathematischen Mitteln der Populationsgenetik zeigen, daß extrem egoistisches Verhalten dann zum Aussterben einer Population führt, wenn z.B. der Vorteil, den ein «Egoismus-Gen» erbringt, dazu führt, daß ein erwachsenes Mitglied einer Art mehr andere Tiere tötet, als es selbst aufzieht. Auf der anderen Seite wird altruistisches Verhalten von der natürlichen Auslese dadurch belohnt, daß die Gene des «beschützten» Artgenossen ebenfalls mit höherer Wahrscheinlichkeit in der Population weitergegeben werden. Aus diesem Grund ist altruistisches Verhalten vor allem gegenüber jüngeren Tieren von Vorteil.
Die Problematik Egoismus-Altruismus tritt in der Evolution erst dann auf, wenn ein Tier einen Artgenossen in irgendeiner Weise identifizieren kann. Daher kann das Sich-Zusammendrängen von Tieren noch keineswegs als altruistisch betrachtet werden. Die Ergebnisse einer ganzen Reihe von Untersuchern (zit. bei Hamilton a.a.O.), die sich mit dem Herden-Verhalten befaßt haben, weisen darauf hin, daß sehr viele solcher Ansammlungen (z.B. die «Schulen» von Fischen und Meeressäugern im Wasser) durch den Versuch entstehen, in Gefahrensituationen immer einen Artgenossen zwischen den Räuber und sich selbst zu bringen – ein Verhalten, das sich bei einer Gruppe von Menschen, die ein wütender Hund anbellt, in ganz ähnlicher Form beobachten läßt. Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen dem Verhalten einer Schafherde und dem Verhalten einer Herde von Moschusochsen in Gefahr: Während die Schafe dem Feind den Rücken zukehren und versuchen, in die Herde hineinzufliehen, wenden sich die Moschusochsen nach außen und kämpfen gegen den Räuber. Offensichtlich wurde im Fall der Moschusochsen ein Verhalten weiterentwickelt, das sich bei vielen sonst sehr fluchtbereiten Tieren dann zeigt, wenn ein Jungtier verteidigt werden muß. Eine von ihrer Herde getrennte Kuh ist in der Regel ängstlich und schreckhaft. Hat sie aber die Herde verlassen, um zu kalben, dann verteidigt sie sich gegen alle Raubtiere.
Viel spricht dafür, daß der Schutz der Nachkommen die wichtigste biologische Quelle des Altruismus ist. Er wird von der Selektion unmittelbar belohnt und scheint um so notwendiger, je länger und damit verwundbarer die Kindheit des Einzelwesens wird. Wenn wir die sehr komplexen, durch Geruchsstoffe und instinktive (ererbte) Verhaltensdispositionen gesteuerten Verhaltensweisen der sozialen Insekten hier außer acht lassen,[*] sind für die Klärung des Vorfeldes altruistischer Verhaltensweisen des Menschen vor allem die Beobachtungen an Primaten wichtig. Bei verschiedenen Halb- und Tieraffen (Lemuren, Heulaffen, Rhesusaffen, Makaken und Pavianen) sowie den Menschenaffen wurde ein altruistisches Interesse nichtblutsverwandter weiblicher Erwachsener an Jungtieren beobachtet. Besonders gründlich hat R.A. Hinde[*] dieses Verhalten untersucht. Es sind in der Regel kinderlose weibliche Tiere, die sich für ein Mutter-Kind-Paar interessieren. Zuerst werden sie vielfach von der Mutter noch abgewiesen, doch entwickelt sich Schritt für Schritt eine enge Zusammenarbeit. Als in einem von dem Hinde-Team beobachteten Fall die Mutter eines Rhesusaffen starb, als das Kind acht Monate alt war, übernahm die «Tante» ihre Aufgaben, ohne daß größere Störungen erkennbar waren. Die «Tanten» benützen Tricks, um das Baby schon sehr früh pflegen zu können, indem sie z.B. die Mutter «lausen» und sich dann, wenn deren Aufmerksamkeit dadurch abgelenkt ist, auch mit dem Baby befassen, bis die Mutter diesem wieder ihre Aufmerksamkeit zuwendet und die Tante zurückweist. Ähnliche Verhaltensweisen treten auch, freilich seltener, bei männlichen Makaken auf. Nach J. ltani[*] scheinen sie dort ein an bestimmte Gruppen gebundenes Phänomen zu sein. Itani fand die Versorgung eines Makaken-Kindes durch männliche, erwachsene Tiere bei drei von achtzehn untersuchten Gruppen sehr häufig, bei sieben anderen Gruppen selten und bei den restlichen überhaupt nicht. Man kann somit von einem örtlichen, «kulturellen», d.h. durch Verhaltenstraditionen weitergegebenen Verhalten sprechen.
Dieses «kulturelle» Prinzip altruistischen Verhaltens hat in den menschlichen Gesellschaften die biologischen Grundlagen sehr stark überformt. Dabei ist grundsätzlich festzuhalten, daß es sinnlos ist, die Frage nach «angeboren» oder «erlernt» als Entweder-oder-Frage zu stellen. Erlernte Verhaltensweisen sind durchweg ohne ein angeborenes, in der genetischen Ausrüstung verankertes Substrat nicht denkbar. Erbanlagen können niemals die einzige Ursache einer biologischen Struktur sein. Es müssen andere Bedingungen hinzutreten, damit sich aus ihnen diese Struktur entwickeln kann. In der biologischen und in der kulturellen Evolution wirken durchaus vergleichbare Prinzipien. Eines davon ist die Ökonomie: Wenn ein Vogel wie der Pinguin zu einem vorwiegend marinen Leben zurückkehrt, werden seine Flügel und Füße zu flossenähnlichen Gebilden; es wachsen ihm keine neuen Flossen, während er Flügel und Füße verliert. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber in der so stark von Vorurteilen bestimmten Betrachtung des Tier-Mensch-Übergangsfeldes wird diese Sichtweise oft aufgegeben. Menschliches Verhalten ist wohl nur zu verstehen, wenn wir annehmen, daß es durch «angeborene» emotionale Dispositionen, durch «erworbene» emotionale Dispositionen und durch Verbindungen beider motiviert wird. Dabei kann es durchaus sein, daß im selben Verhaltensbereich ein urtümlicher Satz genetisch verankerter Dispositionen und ein durch Identifizierung (wobei diese, d.h. die Neigung zum Nachahmungslernen, wiederum ein genetisches Fundament hat) erworbener Satz von Verhaltensanstößen zusammenwirken oder aber auch sich widersprechen. Die Ergebnisse der ethnographischen Forschung sprechen eindeutig dafür, daß in allen wichtigen Verhaltensbereichen die Identifizierung letzten Endes den Ausschlag gibt. Dadurch wird die menschliche Kultur zu einem äußerst wirksamen Medium der Lebensbewältigung: Grundlegende Veränderungen des Sozialverhaltens können in wenigen Jahrzehnten das Gesicht einer Gesellschaft vollständig verändern. Diese Wandelbarkeit ist eine sehr wichtige Folge der kulturellen Überformung unserer biologischen Evolution.
Dadurch kann auch etwas entstehen, was ich 1971 Phänokopien von Instinkten nannte,[*] ein Ausdruck, den ich trotz des Widerspruchs von K. Lorenz für sinnvoll halte.[*] Da die Anpassungsforderungen in tierischen und menschlichen Gesellschaften in bestimmten Bereichen sehr ähnlich sein können (z.B. Schutz der Nachkommen), ist es durchaus möglich, ja zu erwarten, daß ein kulturelles Ideal einen animalischen Instinkt kopiert: z.B. «Kinder und Frauen sind schutzbedürftig» oder «Wer mein Territorium betritt, den muß ich vertreiben». Es ist noch nicht gerechtfertigt, aus solchen Ähnlichkeiten auf eine ähnliche Entstehungsweise (d.h. auf menschliche «Instinkte») zu schließen, ebensowenig, wie dies aus der Spontaneität eines Gefühls oder aus der interkulturellen Verbreitung bestimmter Verhaltensmuster erschlossen werden kann. Wie ich an anderer Stelle[*] gezeigt habe, ist die biologische Seite der kulturellen Evolution eine unspezifisch wirksame Neugieraktivität, verbunden mit einer Bereitschaft, durch Identifizierung in der Kindheit bestimmte typische Gefühlsreaktionen zu erwerben (eine Folge davon ist die Übertragung in der Psychotherapie), die einen kulturell bestimmten Verhaltenstypus aufbauen. Diesem Prozeß ordnet sich das spezifische, instinktive Erbe weitgehend unter. Den als seelisch gesund angesehenen Erwachsenen zeichnet aus, daß er bereit ist, seine Triebbedürfnisse bedingungslos den jeweils gegebenen Anpassungsforderungen seiner Gesellschaft unterzuordnen, sich zu erlauben, was sie erlaubt, und zu verbieten, was sie verbietet. Doch ist an diesem Bild (wie es Freud zeichnet) zu ergänzen, daß die kulturelle Gestaltung der menschlichen Verhaltenssteuerung von Anfang an notwendige Bedingung ihrer Entwicklung ist. Der Mensch ist nicht kulturfeindlich, sondern kultursüchtig. Er kann nicht leben und sich fortpflanzen, wenn ihm die symbolische Strukturierung seiner Umwelt und die Möglichkeiten befriedigender Identifizierungen verwehrt werden. Daher ist der stärkste Antrieb des Menschen der, eine Beziehung zu anderen Menschen herzustellen und zu erhalten. Dieser Antrieb ist in der frühen Kindheit deutlich zu beobachten. Ein Kleinkind, das z.B. in einem Menschengedränge seine Mutter verloren hat, wird alles tun, um sie wiederzufinden. In der Zeit, in der die Mutter fort ist, verlieren alle übrigen Befriedigungsmöglichkeiten von Bedürfnissen – Neugier, Hunger, Durst – ihren Reiz.
Was die Mutter bzw. allgemeiner die Bezugsperson des Kindes von den übrigen Quellen möglicher Befriedigung unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, mit dem Kind in einen Dialog zu treten,[*] d.h. in Reaktion auf die Aktion des Kindes homöostatische und weiterführende Kreisprozesse aufzubauen. Homöostase besagt dabei, daß die Bezugsperson auch die Befriedigung elementarer biologischer Bedürfnisse gewährleistet (Hunger, Durst, Wärme usw.), doch darüber hinaus die Aufgabe des Reizschutzes übernimmt, indem sie das Kind vor übermächtigen Reizen bewahrt bzw. in Angstsituationen einfühlend mit dem Kind verschmilzt. Ebenso wichtig scheint aber, daß die Bezugsperson das Bedürfnis des Kindes nach Selbstverwirklichung durch den Dialog fördert. Die Aufrechterhaltung der Homöostase allein genügt in der menschlichen Entwicklung offenbar nicht.
Es ist nicht notwendig, hier länger auf die Ausnahmen einzugehen – auf jene Fälle, in denen Kinder oder Erwachsene nicht in der Beziehung zu anderen Menschen ein mächtiges Motiv sehen, sondern eher nach Distanz zu streben scheinen. Dieses Verhalten beobachtet man als fast von Geburt an nachweisbaren Mangel an sozialem Interesse bei den seltenen Fällen von frühkindlichem Autismus. Hier ist aufgrund eines noch ungeklärten Ausfalls in der Entwicklung die Fähigkeit des Kindes nicht gegeben, sich für andere Menschen zu interessieren und mit ihnen in einen Dialog einzutreten. Daher sind autistische Kinder oft an die Konstanz ihrer Umwelt fixiert und leiden unter panischer