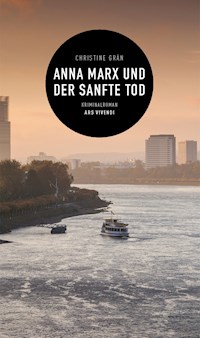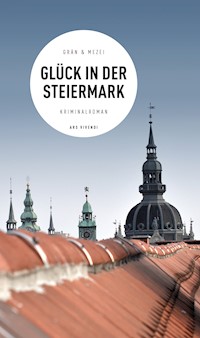2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Felicitas liebt den Luxus, doch sie hat Schulden und wenig Talent zu ehrenwerten Berufen. Als Hochstaplerin macht sie Karriere. Was sie nicht ahnt: Austern essen kann gefährlich werden …Klara, Felicitas' Ziehmutter, liebt Marx und Brecht und wird zur Komplizin im eigenwilligen Kampf gegen das Kapital. Die beiden Frauen nutzen die Spielregeln der Gesellschaft zu ihrem Vorteil. Regel eins: Armut schändet. Regel zwei: Geld stinkt nie. Regel drei: Die Eitelkeit der Männer ist grenzenlos gewinnbringend. In einer auf Lust- und Gewinnmaximierung orientierten Welt ist die Hochstaplerin ein Wesen von großer Anpassungsfähigkeit, das seine Siege genießt und aus den Niederlagen lernt. So wird aus der schonungslosen Entkleidung der Männergesellschaft auch ein Striptease der Frauen – böse, komisch und bisweilen sehr unmoralisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Christine Grän
Die Hochstaplerin
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2012 by Christine Grän
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-198-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Buch
Felicitas liebt den Luxus, doch sie hat Schulden und wenig Talent zu ehrenwerten Berufen. Als Hochstaplerin macht sie Karriere.
Klara, Felicitas’ Ziehmutter, liebt Marx und Brecht und wird zur Komplizin im eigenwilligen Kampf gegen das Kapital. Die beiden Frauen nutzen die Spielregeln der Gesellschaft zu ihrem Vorteil. Regel eins: Armut schändet. Regel zwei: Geld stinkt nie. Regel drei: Die Eitelkeit der Männer ist grenzenlos gewinnbringend. In einer auf Lust- und Gewinnmaximierung orientierten Welt ist die Hochstaplerin ein Wesen von großer Anpassungsfähigkeit, das seine Siege genießt und aus den Niederlagen lernt. So wird aus der schonungslosen Entkleidung der Männergesellschaft auch ein Striptease der Frauen – böse, komisch und bisweilen sehr unmoralisch.
1. Kapitel
Die Gier war das Fundament, über das sich die Konversation hochstaplerisch wölbte. Seine Gier: mich erlegen, hinlegen, weglegen. Der Typ des Jägers und Sammlers schwang seine Keule mit anmutigen Worten. In seiner Höhle floß Jahrgangschampagner, serviert von höflichen Pinguinen, die als Kellner verkleidet waren. Sie sahen melancholisch aus, vielleicht, weil sie mutlose Revolutionäre waren, die das feine Gesindel verachteten. Ich stellte mir vor, daß die linke Hand, die sie angewinkelt am Rücken versteckten, zur Faust geballt war. Das Gesindel lachte verhalten und tupfte sich nach jedem Bissen den Mund mit weißen Stoffservietten ab, an denen Speichel, Speisereste und Lippenstift hängenblieben. Meine Spur war kirschrot.
Sein Gesicht war rund und fahl wie Baals Mond, und aus seinem Mund flossen Sätze, die so neu nicht waren. Männer sind verhinderte Rennfahrer, Großwildjäger, Kamikazeflieger, Samuraikrieger, christliche Märtyrer. Alles, was es über das Leben zu sagen gab, reduzierte einer wie er auf Gewinn- und Lustmaximierung. Seinesgleichen saß in Chefsesseln, Vorständen, Wirtschaftsvereinigungen, Parteigremien. Las Bilanzen und Berichte, das Manager-Magazin und die Bild-Zeitung. Wußte, was in Schanghai die Nutten kosten. Der Charme war von Arroganz getränkt und dem Wissen um die ökonomische Fragwürdigkeit von Moral. Gute Habenichtse mochten einen wie ihn als Bösewicht verteufeln, doch Sein und Haben waren die Größen, die in seiner Welt zählten. War er nicht Stütze der Gesellschaft? Rückgrat der Wirtschaft? Elite? Er trank Bier nicht aus Dosen, verabscheute Polyestertrainingsanzüge und das Grölen in Fußballstadien. Er zählte zu den Menschen mit Designergeschmack, feinen Eßmanieren und kulturellen Ambitionen. Er war Spitze des Eisberges und somit der Sonne am nächsten, naturgemäß.
So sprach Johannes Brenner, und ich hörte ihm aufmerksam zu, wie es sich für eine Nehmerin ziemte, schließlich finanzierte er den Champagner und die Austern sowie prozentual das Personal des Tempels, in dem wir saßen, den Klavierspieler, die Tischdekoration, Stromkosten und Lebensmittelrechnung. Johannes Brenner gehörte zur geduzten Stammkundschaft, zu jenen, die niemals schmatzten oder schlürften, nie hungrig waren und deshalb immer souverän, übersättigt bisweilen und aus diesem Grunde ein wenig gelangweilt, was eine Art von samtvioletter Stimmung schuf oder den Glashauseffekt mit Eisblumenbelag. Das Gewicht des Geldes wog schwer, auch wenn es in Plastikkarten gepreßt war, in diamantenbesetzten Uhren verewigt, in maßgefertigten Schuhen abgefedert.
«Geld macht nicht glücklich», sagte Johannes Brenner, und ich erwiderte, daß sein Geld mich in der Tat nicht glücklich mache. Eine läßliche Lüge, die er hinnahm, weil er zu den Männern gehörte, die mit Frauen Monologe führten. Er fand mich erfrischend, so sagte er, und ich gab das Kompliment in maskuliner Färbung zurück, indem ich ihn einen sehr interessanten Mann nannte.
Johannes lächelte. Die Lippen waren wulstig, aber das Gebiß perfekt. Zuviel Gesicht für die kleinen schlauen Augen. Ich dachte darüber nach, ob die grauen Strähnen in den braunen Haaren Friseurkunstwerk waren. Die Bartstoppeln schimmerten bläulich, Millimetersprossen der dezenten Dekadenz und ein Hinweis darauf, daß einer wie er es sich leisten konnte, ein wenig außerhalb der Konfektion zu stehen. Er trug ein schwarzes Seidenhemd zum italienischen Seidenanzug, und als er aufstand, um zur Toilette zu gehen, wiegte er sich unmerklich in den Hüften, die schmal waren und nett anzusehen.
Von vorne zeigte er ein wenig Bauch, Champagnerbauch, seidenumspannt. Er rieb sich die Hände, als er zurückkam, als wolle er mir zeigen, daß er sich nach jenem intimen Vorgang mit Seife gewaschen habe. Sieh her, sagte die Geste, ich bin ein ordentlicher und hygienischer Mensch, und einer wie ich leidet nicht an ansteckenden Krankheiten, so etwas widerfährt nur Perversen und Verlierern. Er war frisch eingesprüht, ein wohlriechender, appetitlicher Mann, auf dessen breiter Stirn in unsichtbaren Lettern stand: ich bin ein Sieger.
Ich hatte nicht die Absicht, ihm zu widersprechen. Ich habe niemals die Wahrheit gesagt in der Liebe. Wozu sollte das dienen, wenn nicht der narzißtischen Kränkung, der vollkommenen Preisgabe, der Entzauberung der Illusion, daß zwei füreinander geschaffen seien? In gewisser Weise waren wir ein perfektes Paar, denn was wir voneinander wollten, bedurfte nicht des Gleichklangs der Gefühle. Johannes hatte die Absicht, einen teuren Abend mit Sex zu beenden. Geldmänner investieren in der Erwartung eines Gegenwertes, wobei er die Phase des Erlegens als durchaus reizvoll erachtete. Der Sieg war das Erotikum, der Sex nur noch Abwicklung. Aber noch waren wir nicht soweit, und er ließ nachschenken und bemerkte, daß er Frauen schätze, die trinkfest waren.
Austern waren eine lächerliche Grundlage für zwei Flaschen Champagner, aber er hatte in dieser Hinsicht recht. Ich war eine begabte Trinkerin, auch wenn ich Wein bevorzugte oder Whisky, mit eiskaltem Wasser verdünnt. Zu den seltsamen Vorurteilen, die Männer über Frauen pflegen, gehört jenes, daß wir Champagner lieben. Als ob das Prickeln auf der Zunge läge. Jede professionelle Prostituierte rührt die Kohlensäure mit dem Strohhalm aus dem Glas, um Blähungen zu vermeiden.
Mein Bauch spannte, und der italienische Kellner servierte zwei Teller mit Dessertvariationen. Hier kehrte man nicht ein, um satt zu werden. Die teure Parfümflasche auf der Damentoilette war mit einer Kette befestigt, was darauf schließen ließ, daß der Patron seine Gäste einzuschätzen wußte. Das Kostbare ist tröpfchenweise zu genießen, besagte die vergoldete Ankettung, doch wer hätte mich wohl daran hindern können, die Flasche auszugießen und den Duft in Gestank zu verwandeln? Mein Respekt vor Geld hielt mich zurück, alle zerstörerischen Instinkte unterwarfen sich diesem Diktat der reinen Vernunft. Geld bedeutet, die Wahl zu haben. Geld öffnet Türen und bereitet warme Betten, es füllt den Magen und erfüllt die Sinne mit ästhetischen Genüssen. Kleidung. Kunst. Weite Räume mit viel Licht. Sonnenuntergänge auf Bora-Bora. Geld verzaubert Menschen in freundliche Dienstleistungswesen. Hält den Rest der Welt auf Distanz. Ich war dreiunddreißig Jahre alt und wußte, woran es sich zu glauben lohnte.
Der Innenarchitekt hatte Spiegel anbringen lassen, und die Kunst an den Wänden, das waren wir, die Darsteller des guten Lebens. Mein Spiegelbild zeigte eine Frau, die jugendliche Schönheit vortäuschte, ein Maskengesicht für Johannes Brenner, glatte, schwarze, halblange Haare, das weiße Kleid der Unschuld. Das, was man verloren hat, erscheint nur im Rückblick begehrenswert. Ich wünschte mir nicht, meine Kindheit zu wiederholen, die Gehversuche auf höheren Schuhen, die weiten Sprünge und lächerlichen Stürze, die Gefühlsschwankungen zwischen dem Glanz und dem Elend menschlicher Existenz. Eines Tages würde ich Leonard Cohen wiedersehen und mit ihm auf eine griechische Insel ziehen, in ein weißes Haus an einem blauen Meer, und er würde für mich Lieder komponieren und meinen Hunger mit Oliven stillen.
Ich möchte die Direktion
darauf aufmerksam machen
daß die Drinks wäßrig sind
und das Garderobenmädchen
Syphilis hat
und die Band aus
ehemaligen SS-Monstern besteht
Da jedoch
Silvesterabend ist
und ich Lippenkrebs habe
werde ich einen
Papierhut auf meine
Gehirnerschütterung stülpen und tanzen
«Ein frohes neues Jahr», sagte Johannes Brenner, weil es zwölf Uhr war und ein altes Jahr zu Vergangenheit mutierte. Er küßte mich und streckte seine Zunge in meinen Mund. Alle küßten einander stehend. Der Wirt küßte alle. Die Kellner blieben ungeküßt. Sie warfen mit Konfetti und schenkten Champagner nach. Auf Kosten des Hauses. Drei Dudelsackspieler erschienen in schottischen Röcken, zu jung, um Cohen recht zu geben, zu spät, um die volle Gage für einen Mitternachtsauftritt zu kassieren. Ein Unfall hatte sie aufgehalten, ein abgerissener Arm von einem, der seinen Feuerwerkskörper zu früh gezündet hatte. Ein frohes neues Jahr hatte begonnen, und sie versicherten, daß höhere Gewalt im Spiel war.
«Das neue Jahr muß man mit neuen Frauen beginnen», sagte Johannes, nachdem er seine Zunge zurückgeführt, sein Glas ausgetrunken und über die Schulter geworfen hatte. Küsse leiten das Du ein. Du und ich. Zwei Parallelen, die sich in der Unendlichkeit nicht begegnen. Ein italienisches Nobelrestaurant, in dem Gäste mit Gläsern warfen und das wahnsinnig komisch fanden. Ein Kellner blutete am Arm und wurde diskret entfernt. Leichte Verletzungen wurden mit Trinkgeldern geahndet. Frauen staksten kichernd über Scherben. Männer lachten. Ein frohes neues Jahr. Ich war optimistisch und sagte ihm, daß wir Schweinefleisch und Sauerkraut essen sollten, die Symbole für Glück und Geld. Ob ich abergläubisch sei? Nur in Bezug auf Glück, sagte ich. Das Wort Glück hatte Konjunktur, wir waren alle glücklich, weil die Dudelsackspieler verstummten und ein frisches Jahr begann, in dem wir noch lebten und trunken waren, Schwestern und Brüder in byzantinischer Laune, und alle Morgen aller Jahre, jedes Erwachen im grellen Licht war weit entfernt, jeder Schmerz Utopie, jeder Tod Nonsens.
Draußen vor der Tür knallte es, doch die Gäste dieses Abends hatten auf ein Feuerwerk verzichtet, um für einen guten Zweck zu spenden. Brot statt Böller. Taschengeld anstelle von proletarischen Krachmachern. Ein wenig Güte konnte nicht schaden. Darauf tranken wir mit dem guten Wirt, der pro Tisch hundert Mark Mitgefühl kassieren würde. And a Happy New Year for Everybody.
Ein Kellner erschien mit einem silbernen Tablett, auf dem ein gekochter Schweinekopf thronte, umrahmt von Sauerkraut, in Champagner gegart. Jeder durfte sich ein Stück vom Glück abschneiden. Das Schwein sah traurig aus, und ich stellte mir Johannes’ Kopf vor auf diesem Silbertablett, mit einem Kleeblatt aus Marzipan im Mund. Grausame Königstöchter waren ein wenig ausgestorben. Johannes sagte, daß ich die schönste Frau des Abends sei. Ich hörte einen Meister singen, der eine Spielwarenfabrik mit einem Jahresumsatz von vier Milliarden Mark sein eigen nannte.
Ich hatte Johannes vor einem Juweliergeschäft in Düsseldorf getroffen. Er begegnete mir auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für einen Großkunden. «Sie wissen schon, ein Mann, der alles hat und dem Weihnachten zum Alptraum wird.» Er meinte, daß Frauen leichter zu beschenken seien, und folgte meinem Blick zu den Platinohrringen. Ich riet ihm zu einem silbernen Trüffelhobel, während ich seinen Wert einstufte: Schuhe, Uhr, Kleidung.
Man erkennt sie an den Schuhen, fast immer. Der Kaschmirmantel oder Designeranzug konnte aus dem Ausverkauf stammen, und die Uhr aus einer Fälscherwerkstatt in Hongkong. Schuhe hingegen waren zuverlässige Zeugen durchgehender Eleganz oder Hochstapelei, weshalb ich bei Männern stets nach unten sah, dorthin, wo sie mit beiden Beinen fest auf der Erde standen.
Nichts gegen braune Ledersandalen. Es gab sicherlich Frauen, die jenes Fußwerk praktisch fanden, atmungsaktiv und natürlich, und die dazugehörigen Männer begehrenswert, auch wenn es ein Zeichen für gravierenden Geld- oder Geschmacksmangel sein mußte. Selbst Männer mit roten, grünen oder weißen Schuhen, mit Gummisohlen, Schlappen oder Cowboystiefeln hatten ein Recht darauf, geliebt zu werden. Aber nicht von mir.
Seine Schuhe waren schwarz, glänzend, handgefertigt. Er nannte mich seinen Weihnachtsengel, kaufte den Trüffelhobel und mir einen winzigen goldenen Engel in Form eines Schlüsselanhängers. Nicht die Platinohrringe. Er war kein Idiot. Er lud mich zu einem Espresso bei «Tino» ein und erzählte mir von seinem Geld. Spielzeuggeld. Deutsches Spielzeug, made in Tschechien und Polen, Laos und Vietnam. Niedrige Produktionskosten, obwohl einer wie er faire Preise zahle. Was immer das bedeuten mochte. Johannes Brenner war Fabrikant in der zweiten Generation und sich seiner Verantwortung bewußt, das Vermögen der Familie zu mehren. Er war Witwer, kinderlos, zweiundfünfzig Jahre alt. Auf der Suche nach der Frau fürs Leben, wie er kühn formulierte. Daß er sie noch nicht gefunden hatte, lag selbstverständlich an den Frauen. Mit Eva hatte alle Schuld begonnen, und es waren die Mütter, die das Frauenbild der Männer formten. Also gab es keinen Anfang und kein Ende, nur die Endloskette von Mißverständnissen. Männer schien dies weniger zu berühren als Frauen.
Vermögende Männer traf man in First-Class-Lounges, bei Edelitalienern, in den Bars der Fünfsternehotels, auf Vernissagen, Golfplätzen, in den Verkaufsräumen von noblen Automarken. Vor Juweliergeschäften. Ich sagte ihm einen Namen, Fiona Lenzen, und daß ich Goldschmiedin sei, ein ehrbares, wenngleich nicht so lukratives Gewerbe wie die Spielwarenproduktion. Goldschmiedin hat etwas Künstlerisches, und Männer mögen das an Frauen. Johannes Brenner küßte meine Handwerkshand und erwähnte augenzwinkernd, daß er mein Vater sein könnte.
Ich erwiderte, daß dies unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen sei, da ich meinen Vater nie gekannt habe. Er nannte mich eine ernsthafte Person. Ich bewunderte seine Schuhe, die er in Budapest fertigen ließ. Er fragte mich nach meinen Einkommensverhältnissen, und ich erzählte ihm, daß ich freiberuflich für einige Juweliere in Deutschland arbeite. Daß ich vor kurzem erst nach Düsseldorf gezogen sei und hier sehr wenige Menschen kenne. Er mußte den Eindruck gewinnen, daß es mir schlechtging, und lud mich zum Mittagessen ein. Ich lehnte ab, nahm jedoch seine Visitenkarte entgegen, auf die er seine Handynummer kritzelte, ein Geheimcode, der nur wenigen lieben Menschen vorbehalten sei. Als ich ihm zum Abschied die Hand gab, las ich seine Gedanken. Frauen wie ich waren leichte Beute, Gazellen, die sich von Porschescheinwerfern blenden ließen und beim Knallen von Champagnerkorken zitterten. Er sagte: «Ich bin am 28. aus Zermatt zurück. Melden Sie sich noch in diesem Jahr. Ich kenne da ein paar gute Juweliere, vielleicht kann ich da was für Sie tun.»
Ein Lockruf für Fiona Lenzen, Goldschmiedin. Ich lächelte ungewiß und legte zum Abschied den Goldengel auf den Tisch. Winzige Geschenke nahm ich niemals an. Dann ging ich, ohne mich umzudrehen, hinaus in den Wintervormittag. Durchaus zufrieden mit mir, vor Kälte zitternd, denn ich fror so leicht. Freiberufliche Goldschmiedinnen tragen keine Pelzmäntel. Die Königsallee war gesäumt von blonden Nerzfrauen, die nach Trüffelhobeln suchten. Der schmutzige Schnee quatschte unter Ledersohlen, die der Nässe nicht gewachsen waren. In den Schaufenstern glitzerten Weihnachtsbäume, umsäumt von schönen, gleichwohl nutzlosen Dingen, die ich immer schon unwiderstehlich gefunden hatte. Zum Hotel war es nicht weit. Im Hotel war es warm, und die Rezeptionistin gab mir den Zimmerschlüssel mit jenem Fünfsternelächeln, das ich so mochte. Ich hatte mich vergewissert, daß Johannes Brenner mir nicht gefolgt war.
Ich rief ihn am 30. Dezember an, nach einer angemessenen Wartefrist für Zweifel und Hoffnung. Handy zu Handy, Wort zu Wort: Er warf seine Silvesterpläne um und bat mich in ein Lokal seiner Wahl. Mit einer Fremden ins neue Jahr zu gehen, fand er originell, und ich änderte meine Pläne, weil ich viel Geld für Spielzeug ausgegeben hatte und einen Fabrikanten brauchte.
Im Lokal seiner Wahl eskalierte die Stimmung in Verzweiflung, die nicht wahrgenommen wurde. Ein weiblicher Gast bot einem der Dudelsackspieler fünfhundert Mark dafür, daß er seinen Schottenrock lüfte. Ihr Ehemann oder Liebhaber erhöhte auf tausend Mark, als der Junge zögerte, und das Gesindel schrie «Ausziehen! Ausziehen!», denn nun, da nichts mehr frisch war, verlangte die rauschhafte Stimmung nach mehr. Mehr Sex für die Frigiden, mehr Geld für die Bedürftigen. Der Schottenrockträger lächelte verlegen. Wir alle wußten, daß er es tun würde, zu diesem oder einem höheren Preis. Auch er wußte es und erkannte die Demütigung, die das wahre Erotikum war. Johannes beobachtete mich. «Möchtest du höher bieten», fragte er, und ich verneinte. «Sein Schwanz interessiert mich nicht.» Es war eine Frage der Betonung. Ein wenig Derbheit für Johannes, denn einer wie er schätzte an uns die unvereinbaren Gegensätze: heilige Mutter, verruchte Frau, unschuldiges Kind. Der Part war spielbar, und auch unser Dudelsackmann erfüllte seine Rolle und hob seinen Rock, unter dem er eine weiße Unterhose trug, die in ihrer ästhetischen Aussage braunen Sandalen, Netzunterhemden und Lederhüten entsprach. Einige Frauen begannen hysterisch zu kichern, und die Männer in ihren Designerslips stimmten in das Gelächter ein. «Betrug!», schrie jemand, und die Initiatorin des Spektakels hob ihren Rock und rief «Meine ist schöner!». Sie enthüllte schwarze Spitze über Fitneßclubfleisch, und ihr Mann oder Liebhaber schob ihr einen Tausendmarkschein in den Slip. Einen Augenblick lang sah sie ihn an, als ob sie ihn haßte, möglich, daß seine Geste sie an etwas erinnerte, das sie zu verdrängen suchte. Dann lachte sie, nahm den Schein und warf ihn dem Dudelsackmann zu. Er flatterte zu Boden, und ich wünschte mir, daß er ihn nicht aufheben möge, nur eine Sekunde, bevor er zugriff und ich ihn verstand und liebte wie mich selbst. Wir waren Schwestern und Brüder, stolze Raubritter und armselige Diebe, am profanen Ende der Nahrungskette und allzeit bereit, ihre Austern zu essen und dafür ihr Gelächter zu ertragen.
Er war schön und jung, vielleicht war es das, was sie an ihm haßten. Ihr spöttisches Gejohle verfolgte seinen hastigen Abgang, und Johannes sagte, daß die Showeinlage letztlich dritt-klassig gewesen sei. Die italienische Band, die nun auftrat, fand ebenfalls nicht sein Gefallen. Er sah gelangweilt aus. Ich schlug ihm vor, daß wir gehen sollten, da die Musik zu laut sei und Tanzen eine lächerliche Leibesübung. Das verheißungsvolle Lächeln. Der Augenaufschlag. Meine Hand auf seiner, ganz leicht. Er blickte auf meine Brüste. Hundertmal gespielt. Ein Fremder auf meiner fremden Haut. Seltsame Worte, die mich nie erreichten. Wissen sie nicht, was es heißt, einsam zu sein, ohne weiche Eier in Silberbechern?
Johannes hatte seinen Fahrer nach Hause geschickt, er war ein guter Mensch. Wir nahmen eine Taxe zu seiner Penthousewohnung in der Innenstadt. Ein paar Passanten wankten grölend in das neue Jahr auf unserem kurzen Weg. Mein Atem beschlug die Scheibe. Johannes schwieg während der Fahrt, und ich schätzte seine Trunkenheit als geringfügig ein. Einer wie er wünschte nicht, die Kontrolle zu verlieren. Er gab dem Taxifahrer eine Mark Trinkgeld und öffnete die Haustür mit einem Sicherheitscode. Die Penthousewohnung entsprach meinen Erwartungen: weitläufig, modern, das Gesamtkunstwerk eines Innenarchitekten. Ich meinte, einen Kokoschka zu entdecken, und beglückwünschte Johannes zu seinem Geschmack. Ein Hinweis auf den Quell seines Reichtums saß auf einem überdimensionierten Sofa: alte Puppen, in Reih und Glied drapiert, Porzellanwesen mit starren blauen Blicken, akkuraten Locken und Spitzenkleidern. Eine absonderliche Sammlung, von der er sagte, daß sie von unschätzbarem Wert sei. Puppenfrauen für Johannes, und sie waren von unvergänglicher, austauschbarer Schönheit. Stumm, steril, wertvoll. Ich bevorzugte Teddybären, ich hatte nie gerne mit Puppen gespielt.
Nicht anfassen, schrie er, als ich nach einem Porzellanwesen greifen wollte. Es war heiliges Spielzeug, und ich verstand, daß das alte Kind nicht so unkompliziert war, wie es sich gab. Meine Hand streifte nur die weiße Spitze. Mir war kalt, ich fror so leicht, und in dieser Wohnung gab es wenig, woran man sich wärmen konnte.
Johannes’ Wohnungsfarben waren weiß und gelb. Ich setzte mich auf einen weißen Sessel, während er in die Küche ging, um Champagner zu holen. Hundertmal gespielt. Das Jahr war zwei Stunden alt, ich war fast nüchtern und überlegte, welche seiner Kostbarkeiten er am leichtesten verschmerzen würde. Geld vermutlich, es war das naheliegendste, doch der Kokoschka reizte mich ebensosehr wie der Jadebuddha. Er grinste mich lüstern an, und ich versuchte, seinen Wert zu taxieren, doch in Jadefiguren war ich keine Expertin. Und ich hatte mich noch immer nicht entschieden, welche Methode ich anwenden sollte. Johannes Brenner war unvollkommen, fast nachlässig recherchiert worden. Was zum Teil daran lag, daß ich ursprünglich einen anderen Mann im Visier hatte. Auch die Jahreszeit war schuld an einer gewissen Trägheit, die Zielperson gründlich zu studieren. Um Weihnachten trieb ich mich herum in den Straßen und verfiel dem Rausch des Sehens, Besitzenwollens, Kaufens. Zu Weihnachten wollte ich alles haben, was Raben lockte, glitzerte und funkelte und Wärme verbreitete. In mir, denn ich fror so leicht.
Johannes Brenner kam mit einem Tablett aus der Küche zurück. Er war ein Mann, der seine Angestellten fair behandelte, nach Gutsherrenart. Er mochte keinen Widerspruch und keine Unordnung. Pedantisch hatte ihn seine von mir befragte Putzfrau genannt, und ich neigte dazu, ihr zuzustimmen. Ein Mann mit regelmäßigen Arbeitszeiten und wechselnden Affären. Keine längerfristige Freundin nach seiner Scheidung; sie hatte ihn viel Geld gekostet, und das mußte einen wie ihn schmerzen. Brenner investierte in schöne Dinge, Essen und Trinken, in seine Puppensammlung, doch er war kein Verschwender im großen Stil. Und in Kleinigkeiten, Trinkgeldern zum Beispiel, war er geizig. Ich durfte nicht zu wenig verlangen.
Eitel war Johannes Brenner, doch dies war kein ungewöhnlicher Zug an Männern seines Alters und Einkommens. Er brauchte Publikum, und er behandelte Frauen liebenswürdig und auch ein wenig herablassend. Sie waren keine ebenbürtigen Gegnerinnen. Für Johannes war die Welt eine Arena, in der Männer auf unterschiedlichste Weise mit ähnlichen Motiven gegeneinander antraten. Frauen warfen Spitzentücher und gaben sich dem Sieger hin. Frauen waren die unvollkommensten Kunstwerke seiner Sammlung. Blieb die Frage, ob Johannes ein guter Verlierer war. Feige oder mutig, das lag bei einem wie ihm so nahe beieinander, daß ich diese, für die Wahl meiner Methode so wichtige Einschätzung noch nicht treffen wollte. Auf die eine oder andere Frage in die Richtung hatte er ausweichend geantwortet. Sein Bild war lückenhaft, also mußte ich improvisieren, was reizvoll war, aber nicht ungefährlich. Er saß neben mir auf dem weißen Sofa und hielt etwas hinter dem Rücken versteckt. Ein glitzerndes Schmuckstück für die Goldschmiedin? «Fiona ist ein wunderschöner Name», sagte er. Deshalb hatte ich ihn ausgesucht; die Wahl meiner Namen pflegte ich stets mit Sorgfalt zu treffen. Ich wollte eine geistreiche Antwort geben, doch als ich in sein Gesicht sah, erschrak ich. Es waren seine Augen, die Puppenaugen, zu klein, zu blau, zu unbeweglich. Sie hielten meinem Blick stand, und er lächelte, doch an meinen Händen spürte ich kaltes Metall, und ich hörte ein Klicken, Sekunden, nachdem er meine Hände zusammengefügt hatte zu einer Geste des Gebets. Er war so schnell gewesen, so zielstrebig, so klug, meine Augen festzuhalten. Ein Taschenspielertrick, der Frau Handschellen anzulegen, und ich war sicher, daß er ihn nicht zum erstenmal erprobt hatte.
Den Gedanken, einem verdeckt arbeitenden Kripobeamten in die Hände gefallen zu sein, verwarf ich sofort. Sie hätten sich nicht die Mühe gemacht, eine so komplizierte Falle auszuarbeiten. Ich blickte von meinen gefesselten Händen hoch in sein Mondgesicht. Der gute Mond oder unbewohnbare Planet? «Darf ich das so verstehen, daß ich verhaftet bin?»
Sein Lachen war zu schrill, um mich zu trösten. Angst war kein vertrautes Gefühl in Bezug auf Männer, doch ich wußte, daß mir das Spiel aus den Händen geglitten war, nicht nur im metaphorischen Sinn. Daß es ein verhängnisvoller Fehler gewesen war, ihm so unvorbereitet zu begegnen. Er lachte immer noch, der Mann hatte Sinn für gnadenlosen Humor. Und für ausgefallene Überraschungen. Ich wollte nicht darüber nachdenken, was er im Sinn hatte. Es war jetzt wichtig, meine Angst zu beherrschen und klar zu denken. Es war alles ganz normal. Ich saß mit einem Fremden in einer Wohnung im zwölften Stock. Puppengesichter starrten mich an. Auf dem Tisch standen eine Flasche Champagner und zwei gefüllte Gläser.
«Möchtest du etwas trinken?»
Ich nickte, und er reichte mir das Glas, das ich mit beiden Händen nahm, weil ich nicht anders konnte, und mit beiden Händen zum Mund führte, während die Handschellen in meine Haut schnitten. Mein Freund F. pflegte in seiner leichtfertigen Art zu sagen: Wir müssen lernen, hübsch an der Oberfläche zu bleiben. Wir müssen lernen, die äußere Erscheinung zu lieben. F. starb in einer Gummizelle, sein Gehirn war verrottet von zuviel schmutzigem Sex.
«Was denkst du, was ich mit dir vorhabe in diesem wunderschönen neuen Jahr?»
Wollte ich es wissen? Aussprechen? Nein, ich wollte furchtlos sein, leichtfertig, und hübsch an der Oberfläche bleiben. Und auf einer griechischen Insel leben mit einem, der verrückt war, aber auf eine sehr sanfte und poetische Weise. Dichter foltern sich mit Worten, sie sind harmlos. Johannes Brenner sah jetzt anders aus, sprach anders als im Restaurant. Die meisten Menschen legen ihre Masken nie ab, wofür man dankbar sein muß. Mein Erfolg hatte immer darauf beruht, die Situation zu beherrschen und kühl zu bleiben. Doch jetzt war mir kalt. «Wir haben noch nicht darüber gesprochen, ob ich eine Masochistin bin. Da das Thema relevant zu werden scheint: Ich bin keine, das weiß ich genau.»
Johannes lächelte auf eine vollkommen irre Weise. Vielleicht hatte er schon den ganzen Abend so gelächelt, doch ich hatte es nicht wahrgenommen in meiner Überheblichkeit gegenüber meinen Opfern. Die Handschellen waren nicht so schrecklich wie die Porzellanaugen. Sie sagten mir, daß er unerreichbar war für mich oder jeden anderen Menschen. Für Gefühle wie Zuneigung, Güte, Mitleid. Ich hatte viele Grenzen überschritten in meinem Leben, aber nicht diese. Die Hölle, das war die Abwesenheit von Vernunft. Ich hatte immer rational gehandelt. Wenn ich sie verletzt hatte, dann in ihrem Stolz, ihrer Eitelkeit, ihrer Anhänglichkeit an Geld. Ich hatte mich nie an Frauen vergriffen und mich selten in der Wahl der Männer geirrt. Bis jetzt.
Er blickte auf meine Handschellen, die nicht wie Spielzeug aussahen: «Ein cooles kleines Baby sind wir, nicht wahr? Und so hübsch. Ehrlich gesagt macht es mir viel mehr Spaß, wenn es dir keinen macht. Wenn du vor Angst wimmerst und vor Schmerz schreist. Das finde ich geil, Fiona, hatte ich das im alten Jahr nicht erwähnt?»
Nein, du Dreckskerl. Und ich werde einen Weg finden, dies hier zu überstehen. Ich werde dich dafür kriegen, auch wenn es jetzt dein Spiel ist. Und ich werde nicht schreien. Und dir nicht zeigen, daß ich vor Angst sterbe. «Hat dich deine Mutter mißbraucht? War dein Vater ein Prügler? Oder bist du einfach ein ganz normaler Sadist, der zur falschen Zeit am falschen Ort lebt?» Gott, war mir kalt. Ich konzentrierte mich mit aller Kraft darauf, nicht zu zittern.
Brenner ließ mich keine Sekunde aus den Augen, er beobachtete die Wirkung seiner Worte: «Ich werde dich an meinem Bett festbinden, Fiona, und dich dann mit dem Messer kitzeln, ein wenig hier, ein wenig dort, ich variiere das von Zeit zu Zeit. Aber weil es mich erregt, verstehst du, muß ich auch ein wenig schneiden. Blut ist so schön, eine himmlische Farbe hat Blut, es macht mich ganz verrückt nach mehr. Und Schreien mag ich sehr. Ich hoffe nur, daß ich nicht zuviel getrunken habe, dann dauert es immer etwas länger, bis ich komme. Manche halten das gar nicht aus.»
Welch kultivierte Beschreibung einer Folterung. Bereits die Erzählung schien ihm unendliches Vergnügen zu bereiten. Und der letzte Satz malte den Tod an die Wand, die weiße Wand mit den feinen gelben Längsstreifen, die wie stilisierte Gitter aussahen. Es fiel mir leichter, die Kontrolle zu bewahren, wenn ich ihn nicht ansah. Male mir jemand Zeichen an die Wand, wie ich diesen Irren aufhalte. Ich will nicht sterben, nicht so schnell, nicht so. Nicht blutige Schlagzeilen machen. Ich bin eine Über-lebenskünstlerin, Johannes Brenner, und ich scheue die Schmerzen, die man mir zufügen könnte. Ich bin Täterin, Johannes, und dies alles ist ein schrecklicher Irrtum. Und ich gebe mich nicht auf. «Hast du keine Angst vor AIDS? Das hatte ich vergessen zu erwähnen, Johannes: daß ich HIV-positiv bin.»
Sein Handrücken in meinem Gesicht tat weh, und mein Kopf flog von der Wucht seines Schlages nach hinten. Brenner stand vor mir und preßte seinen Körper gegen meine Knie, so daß ich nicht nach ihm treten konnte. Die Wut war größer als die Angst, das war komisch. Nicht komisch war das Blut in meinem Mund, und ich schluckte es, mein Blut, während er seine Hand betrachtete, die Schlägerhand. Mit dieser Hand umfaßte er mein Kinn und zwang mich, in seine schrecklichen Augen zu sehen.
«Du lügst. Ihr Fotzen lügt alle. Und selbst wenn es so wäre, meine liebe Fiona, spielte es keine Rolle. Ich trage Handschuhe. Und ich will ihn dir nicht reinstecken, da kannst du ganz beruhigt sein. Das brauche ich nicht. Ob allerdings mein Messer das möchte ... Manchmal tut es, was es will, verstehst du, dann verliere ich die Kontrolle darüber und ...»
Er ließ mich los. Ich war keineswegs beruhigt. Meine Wange tat weh. Ich war ein einziger großer Schmerz und kämpfte mit Worten gegen eine Form von Gewalt, die mir fremd war, von der ich glaubte, daß ich sie hinter mir gelassen hatte. Ich hatte immer mit Worten um Siege gefochten, fast immer, und darauf vertraut, daß sie wirkungsvolle Waffen waren. «Hast du schon mal jemanden umgebracht?»
Er lächelte und sagte, daß doch alles nur ein Spiel sei. Der Spielzeugfabrikant produzierte Macht in ihrer reinsten Form: die Macht über Leben. Sein Spiel, mein Leben. Seine Regeln, meine Angst. Er sah mich an, ohne mich zu sehen. Und während ich daran dachte, daß ich vielleicht doch gellend schreien sollte, um ihn zum Höhepunkt zu bringen, während ich mich schon an meinen Peiniger verriet, erzählte ich Brenner, daß ich mich in ihn verliebt hätte. Ich erzählte ihm Geschichten, die ich vielen Männern erzählt hatte, warf ihm all meine Worte zum Fraß vor, Sätze für ihre Ängste, ihre Überheblichkeit, ihre Einsamkeit, ihre Begierden und ihre Unfähigkeit, Gefühle zu leben. Natürlich waren meine Worte ohne Wahrheit, doch einmal ausgesprochen, waren sie nie wieder auszulöschen. Ich ersparte Johannes nichts: meine Jugend im Waisenhaus, die krebskranke Schwester, meinen heroischen Kampf gegen die böse Welt, in der es nichts umsonst gab und alles vergeblich war, wenn man nicht an sich selbst glaubte. Und an Wunder. Das Wunder der Bekehrung des Johannes. Ich war gut, wirklich gut, und eine Weile dachte ich, daß er mir zuhörte. Dann sagte er: «Eigentlich bist du ganz nett.»
«Eigentlich» war ein Wort, das niemals Wunder herbeiführte. Dennoch hielt ich ihm meine gefesselten Hände hin. Möglich, daß sie zitterten. Vielleicht war es der Ausdruck meiner Unterwerfung, der ihn erregte und seine Zweifel auslöschte. «Aber es ändert nichts an unserer kleinen Vergnügungstour, Fiona. Ich habe mein Bett mit einem Gummilaken überzogen. Das Blut, hinterher stört es mich. Es ist alles vorbereitet, meine Liebe. Wir sollten anfangen.»
Er hob mich an den gefesselten Händen von der Couch und öffnete den Reißverschluß meines weißen Kleides. Wir sollten anfangen zu glauben, daß die Welt schlecht ist und uns zum Verlassen derselben zwingt. Wir sollten nicht glauben, daß ein Kleid über mit Handschellen gefesselte Hände fällt. Er zerrte daran, bis es zerriß. Wie viele Jahre war es her, daß eine Frau mit schwarzer Spitze auf einem Tisch gestanden hatte und ich einen Dudelsackspieler liebte für ein paar Sekunden? Er betrachtete mein Fleisch anerkennend, der Metzger meines Körpers. Seine Hände waren kalt, und ich fror schrecklich.
Brenner ging zu einer Vitrine, mein Opfer, mein Täter. Der Mann, den ich mir ausgesucht hatte. So vieler Männer Weg hatte ich mutwillig gekreuzt und nie daran gedacht, auf das unangreifbare Böse zu treffen. Den Psychopathen. Einen, der mit Lust quälte. Wieviel fremde Lust hielt man aus? Wo lag der Punkt, an dem die Todesangst von Todessehnsucht abgelöst wurde?
Brenner kam auf mich zu mit einem Messer in der Hand. Ein antikes Stück, sehr schön, lang und schmal und mit der Spitze auf mich gerichtet. Das, wovor ich mich stets gefürchtet hatte – die Kontrolle über mein Leben zu verlieren -, kam auf mich zu. In Gestalt eines Spielwarenfabrikanten, einer genetischen Mißgeburt, die einen reichen, kultivierten Mann darstellte. Man sollte seine Puppen verbrennen und ihn auf den Scheiterhaufen werfen. Man sollte noch einen Versuch machen, auf ihn einzureden. Meine Beine waren frei, ich konnte noch laufen, treten. Ich wollte nicht sterben. Und ich schwor zu Gott, an den ich nicht glaubte, daß ich niemals wieder eine meiner Methoden anwenden würde, Männer von Geld zu befreien. Sollte ich dies hier überleben, würde ich mein Leben ändern. Hilf mir, Cohen. Ich zahle jeden Preis. Selbst den der Wahrheit. Und jetzt bist du in die mathematische Abteilung deiner Seele eingedrungen, wo du doch behauptet hast, du hättest gar keine. Ich nehme an, daß das plus das gebrochne Herz dich glauben lassen, du hättest jetzt durchaus das Recht, dich aufzumachen und die Sadisten zu zähmen.
2. Kapitel
Mit fünfzehn Jahren begriff ich, daß wir in einer geborgten Welt lebten, in der Unsicherheit die sicherste Größe darstellte. Niemand in meiner Umgebung war, was er zu sein schien. Auch nicht Claire, unsere Haushälterin, die in Wahrheit Klara hieß und aus Leipzig stammte. Claire, Klara, war Schauspielerin und Kommunistin, und sie zitierte Brecht, während sie mit achtloser Hand Staub aufwirbelte, der, begleitet von Baals Worten, zu Boden sank. Klara glaubte daran, daß die Armen die besseren Menschen seien. Sie fütterte mich mit Brecht, und mein Vater ernährte uns aus den sporadischen Profiten seines kapitalistischen Kartenhauses. Vor die Wahl gestellt, Klaras guter Mensch zu sein oder Austern zu essen, entschied ich mich für letzteres. Vielleicht war es auch nur so, daß die Umstände meine Wahl trafen. Oder der kleine Satz des BB, daß vor der Moral das Fressen käme.
Ihre Seele hätte Klara gegeben für ein Engagement außerhalb unseres Hauses, doch kein faustischer Verführer war in Sicht, mit Ausnahme meines Vaters, der sie mit dem angekündigten Besuch namhafter Regisseure zum Bleiben verlockte. Sie kamen nie, die Entdecker Claires, doch Klara hörte nicht auf zu glauben, schließlich war Vater der bessere Schauspieler. Meines Vaters Stimme zitterte nicht, wenn er log, und lange Zeit war ich davon überzeugt, daß seine Täuschungsfähigkeit jedem Lügendetektor standgehalten hätte. Vaters Art zu sprechen erinnerte an Oscar Werner: akzentuiert, arrogant, einschmeichelnd. Auch mein Vater war nicht groß, eine napoleonische Figur in dunkelgrauen Kaschmiruniformen, zu denen er grüne oder blaue Krawatten trug. Nur an heißen Sommertagen legte er sein Jackett beim Essen ab. Als ich vierzehn war, sagte ich zu Klara, daß Vater selbst in der Hölle nicht schwitzen würde, und sie antwortete, daß dieser Ort eine klerikal-kapitalistische Erfindung zum Zwecke der Terrorisierung des Proletariats sei. Ich mochte Klaras pompöse Sätze, auch wenn ich sie nicht immer verstand. Vater schienen sie zu amüsieren, und manchmal, wenn er in ausgelassener Stimmung war, diskutierte er mit ihr über Usancen des Klassenkampfes, und er war immer ungeheuer oben, und am Ende blieben alle Fragen offen.
Klara und ich waren seine Familie, loyale Staffage, jedoch nicht das zahlungskräftige Publikum, das er brauchte, um angemessen zu überleben. Hubert Wondraschek, in Brünn geboren, war Kapitalist ohne Kapital. Ein Betrüger in der Sprache der Justiz. Er habe etwas von Robin Hood, so erklärte mir Klara, als ich alt genug war, unsere Lebensumstände zu hinterfragen. Bis zu meinem fünfzehnten Lebensjahr waren wir mehr als vierzigmal umgezogen, quer durch die Republik, und ich hatte in Schlössern gewohnt, in Villen und Bungalows, in Luxushotels und leider auch in schäbigen Pensionen.
«Der Mensch braucht kein Zuhause, das ist nur etwas für Spießer», sagte Vater, wenn wir wieder einmal auf Kisten saßen, und natürlich sprach er für sich, denn Klara haßte Umzüge, die den Dreck hinter den Schränken enthüllten, den Staub auf den Bilderrahmen, kurzum die Spuren ihres unvollkommenen Wirkens in unserem Haushalt. Klara weinte stets, wenn wir ein Heim verließen, hinter dem letzten Packer mit dem letzten Karton, und sie zitterte, während Vater großzügig Trinkgelder verteilte, und blickte zurück, wenn wir abfuhren, drückte meine Hand und zitierte Shen Te, bis Vater ihr sagte, daß sie für den guten Menschen von Sezuan kein Talent habe. Ich fand das sehr ungerecht, denn Klara sorgte mehr oder weniger für mich, seit meine Mutter aus dem Haus war, dies eine Umschreibung meines Vaters für die Tatsache, daß sie uns beide verlassen hatte, als ich vier Jahre alt war.
Meine Mutter war aus dem Haus gegangen, weil sie einen anderen Mann als meinen Vater liebte. Lange verstand ich das nicht, was wissen Kinder von den Gefühlen Erwachsener, doch mit fünfzehn Jahren hatte ich lange genug mit meinem Vater gelebt, um ihr zu vergeben. Nicht ganz, nie ganz, doch wie konnte eine «Frau aus gutem Hause», wie Vater stets betonte, wie konnte sie die Fluchten ertragen, die Häutungen, all die Lügen, mit denen unsere Existenz verwoben war? Ich war ein Kind für lange Zeit und Klara eine sentimentale Kommunistin: Für mich war die Welt meines Vaters zunächst ein Abenteuerspielplatz und für Klara die natürliche Unordnung der Dinge unter dem Mond von Alabama.
Eine andere Stadt, ein anderes Haus, ein anderer Name: Kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag zogen wir nach Hamburg in eine Villa an der Elbe, die sich in aller Pracht und Herrlichkeit dem Verfall hingab. «Ein klein wenig renovierungsbedürftig», sagte mein Vater, der sie von einer alten Dame gemietet hatte, die in ein Seniorenwohnheim gezogen war. Alte Damen fanden Hubert Wondraschek, der sich zu jenem Zeitpunkt Dr. Harald Werner nannte, unwiderstehlich. Viele der Häuser, die wir mieteten, gehörten Frauen, die nicht mehr jung waren. Er blendete sie mit seinem Auftreten, seinen Titeln, seinen Berufen. Er umgarnte sie mit levantinischem Charme. Er küßte ihre Hände und erwähnte beiläufig sein Privatvermögen, seine gesellschaftsfähigen Beziehungen, seine in jeder Hinsicht hervorragenden Eigenschaften als langfristiger Mieter eines überteuerten Objekts.
«Man muß sich die Häuser aussuchen, die schwer an den Mann zu bringen sind, dann sind sie bereit, alles zu glauben», sagte Vater, und der Erfolg gab ihm recht. Wurde ein Haus drei, vier Wochen in der Zeitung angeboten, rief er an, entweder beim Makler oder Eigentümer. Möblierte Immobilien und alte Damen bevorzugt, und wenn er auf zuviel Neugierde oder Mißtrauen stieß, brach er die Aktion ab unter dem Vorwand, daß ihm das Objekt nicht zusage. Es kam vor, aber nicht allzu häufig, denn sie machten es ihm leicht, meinem Vater. Er war so liebenswürdig. Auch zu mir war er immer liebenswürdig gewesen, von einer distanzierten Freundlichkeit, die unwillkommene Gefühle nicht zuließ. Der hingehauchte Gutenachtkuß auf die Stirn. Die leichten Fragen nach meinem Wohlbefinden. Seine Scherze, über die ich auch dann lachte, wenn ich traurig war. Seine Frauen, die mir Bonbons schenkten und sich dann mit ihm zurückzogen. Die Gesellschaften, bei denen ich mit weißer Rüschenschürze bedienen mußte, nachdem ich alt genug war, als Hausangestellte durchzugehen. Vater war ein großzügiger, stets gutgelaunter Mann, der von Klara und mir nichts weiter forderte als fröhliche Komplizenschaft.
Ich glaube nicht, daß meine Kindheit unglücklich war, auch wenn Klara manchmal das für mich schreckliche Wort «Halbwaise» gebrauchte. «Mama ist nicht tot», sagte ich dann und weigerte mich, über den praktischen Unterschied zwischen verstorben und abwesend nachzudenken. Sie war eines Tages einfach verschwunden, obwohl dies in meiner Vorstellung ein ungeheuer komplizierter, gewaltiger Schritt gewesen sein mußte. Sie war aus dem Schloß gegangen mit ihrem weißen Lederkoffer (dieses Detail schien Vater wichtig zu sein) und ließ nie wieder von sich hören. Sie hatte mir nichts hinterlassen außer ein paar Fotos, auf denen eine anscheinend glückliche Mutter ein Baby im Arm hält. Auch ihm, der behauptete, sie zu lieben wie keine andere Frau nach ihr – und die Behauptung war gehaltvoll, denn es gab viele Frauen nach ihr -, hatte sie nichts hinterlassen außer ein paar Hüten und Schallplatten. Mein Vater war ein Mann, der kein Talent zur Trauer hatte. In meiner Erinnerung gab es keine Familientragödie, nur ein Vakuum, das er ausfüllte, indem er Klara fand, die fortan seine häuslichen Geschäfte führte.
Später, als ich erwachsener war, erzählte er mir von Mutters Liebhaber, der Sänger gewesen sei, ein «langhaariger Barde», wie er präzisierte. «Sie war zu romantisch veranlagt für die Ehe», sagte Vater und wies damit jede Schuld von sich. Dennoch sprach er nie schlecht über meine Mutter. Der einzige Vorwurf betraf die Tatsache, daß sie einen Schloßherrn verlassen hatte. «Die Wochen zuvor brachten es die Umstände mit sich, daß wir in einem Pensionszimmer logierten, sehr beengt mit einem Kleinkind, und dann fand ich dieses Schloß, Felicitas, genau der passende Rahmen für deine Mama. Es war ein traumhaftes Zuhause, erinnerst du dich? Der Park, die Auffahrt, das antike Mobiliar: Du konntest mit deinem Tretauto durch die Zimmerfluchten fahren, ohne anzustoßen. Und das hat deine Mama im Stich gelassen, weil sie glaubte, unsterblich verliebt zu sein.»
Ich erinnerte mich an ein rotes Tretauto. Nicht an ein Zuhause, denn die Zimmerfluchten und Parks und Gärten waren nie von einprägsamer Dauer gewesen. Genau wie Klara, wenn auch aus anderen Motiven, haßte ich ab einem gewissen Alter jeden einzelnen unserer Umzüge, auch jene aus schäbigen Zimmern in heruntergekommenen Pensionen, Aufenthalte, die Vater stets «Provisorium» nannte, obwohl mir doch alles in unserem Leben vorläufig und nie endgültig erschien.
Selbstverständlich jubelte ich beim ersten Anblick eines neuen Heims, so wie Vater es von mir erwartete. Und wenn wir wieder fortgingen, in eine andere Stadt, hob er mich hoch und versicherte strahlend, daß das Neue noch viel schöner und prächtiger sei, und ich glaubte ihm, weil ich keine andere Wahl hatte, weil er Mißmut oder Tränen nicht zuließ, weil ihm «schlechte Gefühle» zuwider waren. Vater war ein gnadenloser Optimist. Ein Clown. Ein Hochstapler. Einer, der die Gabe hatte, Menschen zu verzaubern, für eine Weile. Einer, der nicht anders konnte, als zu enttäuschen, hinterher. Wie sollte es anders gehen, zumal er in einer Welt lebte, die er nicht bezahlen konnte?
«Der Mensch ist gar nicht gut. Drum hau ihn auf den Hut.» Klara sang den Peachum, während sie das Haus an der Elbchaussee inspizierte. Sie beherrschte alle Rollen der Dreigroschenoper, seit sie die Polly gespielt hatte auf einer Provinzbühne des anderen Deutschland, das weder ihre künstlerischen noch politischen Träume zu erfüllen vermochte. Klara war eine Tunnelgängerin des zweiten Mauerjahres, und ihr damaliger Verlobter war bei der Flucht erschossen worden. Klara nannte es eine grausame Ironie des Schicksals, denn er war nur ihretwegen geflüchtet, aus Liebe, die zu allen Torheiten befähigt, so sagte Klara, die sich fortan Claire nannte und eine Karriere als Schauspielerin anstrebte, es bis zur hungrigen Statistin brachte und schließlich meinem Vater in die Arme lief, der ihr eine Rolle als Hausdame und Ersatzmutter anbot. Mutter Courage, auch diese Rolle liebte Klara, und ich liebte sie, selbst wenn sie uns immer wieder versicherte, daß sie gehen würde, sobald sie eine anständige Rolle bekäme.
Dreimal hatte sie ihre Drohung wahrgemacht, zum letztenmal, als ich zwölf war, und sie kam erst nach vier Wochen wieder. Sie sprach nicht über ihre Zeit der Abwesenheit, aber Vater meinte, daß sie einem Pornoproduzenten aufgesessen sei. «Claire liebt die Brechtschen Huren», sagte Vater, «aber für die Details dieses Berufs ist sie ungeeignet, wie die meisten Frauen.» Ganz verstand ich ihn nicht damals, aber ich dachte, daß mein Vater sich mit Frauen auskannte, mit Ausnahme meiner Mutter vielleicht. Auf den Fotos, die ich in einer Pralinenschachtel aufbewahrte, erschien sie mir überirdisch schön, ganz anders als Klara, die auf eine derbe Weise hübsch zu nennen war, öfter ihre Haarfarbe wechselte und jeder Modelaune anheimfiel, sofern Vater in der Lage war, ihr Gehalt zu bezahlen. Wenn kein Geld da war, war er besonders charmant zu ihr, zauberte Produzenten und Rollen aus seinem Zylinder der Lügen, und Claire spielte für ihn die loyale Genossin, die sich auch von finsteren Zeiten nicht schrecken ließ. Ich glaube, daß sie unsere Krisentage besonders mochte, weil er ihr soufflierte, daß sie eine Heldin des Proletariats sei, was ziemlich weit hergeholt war, da sich Vaters Krieg gegen den Kapitalismus als reiner Beutezug darstellte. Doch Klara glaubte auch daran, daß realistische Kunst kämpferische Kunst sei. An Krisentagen ging Claire ans Telefon und wimmelte Gläubiger ab; sie log an der Haustüre und überzog ihr Konto, um uns zu ernähren. An jenen Tagen war sie die Inkarnation aller Brechtschen Heldinnen, und niemand fragte nach dem Staub auf den Schränken und dem schmutzigen Geschirr. Wir wußten, daß eine Belagerung zu überstehen war; Vater war der Stratege und Claire das Bollwerk, und es galt, eine ehrenvolle Kapitulation auszuhandeln. Bis ich aus den Kindheitsträumen erwachte, erschien mir das Spiel aufregend; später empfand ich Angst und Scham, die ich zu verbergen suchte, weil solche Gefühle unerwünscht waren.
Ich durfte als erste mein Zimmer im neuen Haus aussuchen. Dies war mein Privileg, das Umzugsbonbon meines Vaters, und in der renovierungsbedürftigen Villa an der Elbchaussee wählte ich das Dachgeschoß, weil es weit weg von Klaras häuslichem Wirken und Vaters Repräsentationsräumen lag. Die Tapeten waren verblichen, doch der Holzboden knarrte aufregend, und der Blick auf den Fluß und die Schiffe entschädigte für das Mobiliar, das die Besitzerin wohl einst den Dienstboten zugedacht hatte.
Es gab nicht viel auszupacken, denn ich war keine Sammlerin wie viele Mädchen meines Alters. Ich war eine Wegwerferin, vermutlich, weil Bewahren absurd erschien in Relation zu unserem Lebenswandel, unseren Wanderungen, die nie ein Ziel hatten außer jenem, auf anderer Leute Kosten zu überleben. Spielzeug, Kleider, Kassetten, alles, was Vater im Übermaß kaufte, wenn er Geld hatte, ließ ich bei Umzügen zurück, weil ich glaubte, daß sich mit leichtem Gepäck besser reisen ließe. Klara schalt mich deswegen und führte die hungernden, spielzeuglosen Kinder der Dritten Welt an. Sie war ein guter Mensch, doch bisweilen anstrengend. Sie war meine beste, meine einzige Freundin. Aber Claire und ihr nie endendes Verlangen, auf der Bühne zu stehen, erfüllten meine Gefühle mit dem Gift des Zweifels. Als ich kleiner war, fragte ich sie jeden Abend, ob sie am nächsten Morgen noch da sei? Und wenn sie nickte, glaubte ich ihr nicht. Und wenn sie mit den Schultern zuckte, glaubte ich ihr. Jeden Morgen, als ich noch Kind war, erwachte ich mit der Angst vor ihrem Verschwinden.
«Man darf den Wert des Individuums nicht überbewerten», sagte Klara, und selbst als Kind verstand ich, daß dieser Satz überaus dumm war. Welchen Wert Klara für mich hatte, konnte sie weder ermessen noch schätzen. Und indem sie die Wirklichkeit verfremdete, schuf sie den theatralischen Rahmen für unerwiderte Gefühle. Meine Gefühle. Ihre Gefühle. Was immer mein Vater fühlte, für meine Mutter, für mich, für Klara, die Frauen, die ins Haus kamen: Das, was ich erkennen konnte, war blaß, gekräuselt und so schwerelos wie der Rauch seiner Havanna-Zigarren. Hubert Wondraschek alias Dr. Harald Werner nahm von allem das Beste. Wenn er es kriegen konnte.
Klara haßte das Haus am Fluß, weil es von einer Art war, die viele Dienstboten brauchte, um den Eindruck von Sauberkeit zu erwecken. Sie bevorzugte Neubaubungalows mit modernen kleinen Küchen, gefliesten Böden, funktionalen Einbauschränken und überschaubaren Vorgärten. Sie schimpfte auf den bourgeoisen Trödelladen, während sie die Arbeiter beaufsichtigte, die die Umzugskisten leerten. Klara mißtraute den Männern mit den schwieligen Händen und kompensierte ihre Schuldgefühle durch besondere Freundlichkeit, was in Verbindung mit ihrer prallen Ausstrahlung gelegentlich zu Mißverständnissen und sexuellen Übergriffen harmloser Natur geführt hatte. Den Geschlechterkampf sah Klara sehr pragmatisch. Männer wollen Sex, sagte Klara, und Frauen Romantik und Sicherheit. Und so würden Verträge geschlossen, die Liebe oder Ehe hießen, um das Unvereinbare zu verknüpfen. Und die Frauen würden draufzahlen, weil sie stets das Kleingedruckte in Verträgen ignorierten. Klara mochte ihre Wirkung auf Männer, aber sie mochte die Männer nicht. Mit einer Ausnahme: mein Vater. Mit sechzehn glaubte ich zu wissen, daß sie für ihn das Kleingedruckte akzeptieren würde. Doch Wondraschek, der Frauenheld, der große Verführer junger und alter Frauen, war blind für Klaras Liebe. Er kränkte sie mit seinen Affären und der Mißachtung ihrer großen Gefühle. Sie blieb bei uns, weil sie tragische Rollen mochte, zum Beispiel die der unentdeckten Schauspielerin und Liebenden.
Hubert Wondraschek oder Dr. Harald Werner stand auf der Terrasse und öffnete eine Flasche Champagner, so wie er es immer tat, wenn wir angekommen waren, und er trank mit uns auf das neue Zuhause, den vielversprechenden Anfang, den Erfolg. Die Scheu vor großen Worten kannte Vater nicht. Und wir wollten daran glauben, Klara und ich, daß dieses Mal alles gut gehen könnte. Frauen haben vor allem dies: die Fähigkeit, an Unmögliches zu glauben. Männer glauben, daß sie Unmögliches vollbringen. Zumindest mein Vater glaubte das, und er war der einzige Mann, den ich ein wenig kannte, besser als die Kurzzeitchauffeure und Gärtner, die Möbelpacker, Busfahrer, Schaffner, Lehrer, Mitschüler. In den einen oder anderen war ich verliebt gewesen in der Art junger Mädchen, doch jegliche Entfaltung der Gefühle oder Deflorationsgelegenheiten waren durch kurzfristige Umzüge vereitelt worden. Vaters Lebenswandel war mein Keuschheitsgürtel, auch wenn der italienische Chauffeur in Stuttgart der Sache sehr nahe gekommen war auf dem Rücksitz des Mercedes. Enrico hatte vergessen, die Hand bremse anzuziehen, als er mich auszog, das war die Crux, und als der Wagen durch das Schaukeln in Bewegung geriet, sah er sich veranlaßt, mit heruntergelassener Hose nach vorne zu hechten, ein komplizierter und akrobatischer Akt, den er bei nahe geschafft hätte, doch auf der leicht abschüssigen Waldstraße parkten Autos, und eines davon wirkte als Rammbock, bevor er die Handbremse erreichen konnte. Es knirschte sehr häßlich, als wir zum Stillstand kamen, und Enrico stieß italienische Flüche aus, während ich meine Jeans zuknöpfte und aus dem Wagen stieg. Ich machte mich davon und überließ dem Mann mit der beredsamen und hungrigen Zunge den Schaden. Es war mein erster Versuch eines eleganten Abgangs, und er war erfolgreich. Enrico wurde fristlos entlassen, doch sein Unglück hielt sich in Grenzen, da wir Stuttgart ohnehin vier Wochen später verließen, um nach Innsbruck zu ziehen. Von Innsbruck ging es weiter nach Bregenz, Salzburg und Wien, bis Geheimrat Dr. Weissmann, so nannte sich Vater in Österreich, beschloß, seine Zelte im Norden aufzuschlagen. Die Karawane zog murrend mit, denn Klara hatte sich in Wien ein Engagement versprochen, und ich hatte mich in meinen Deutschlehrer verliebt und ausnahmsweise gute Noten nach Hause gebracht, was zum Kauf eines Reitpferdes führte, das ich neun Wochen behalten durfte, bis das Geld für Extravaganzen zu knapp wurde. Der Geheimrat versprach mir ein neues, viel schöneres Pferd und verstand nicht, warum ich weinte. Klara sang beim Packen das Lied von der sexuellen Hörigkeit. Die Besitzerin des Hauses in Schönbrunn bekreuzigte sich, als wir auszogen.
Mein Vater reichte uns die Gläser mit seinem strahlenden Siegerlächeln. Wir waren in Hamburg, und Waterloo war noch ein gutes Stück entfernt. Die Sonne schien und wärmte den Rücken. Klara trug ein grünes Kleid zu roten Haaren, Wondraschek einen seiner grauen Zweireiher und ich Jeans und Pullover, Kleidungsstücke, die er als ärmlich einstufte und entsprechend verabscheute. Ich war in dem Alter, in dem ich seinesgleichen spießig fand. Andererseits wußte ich, daß Hubert vom Schein lebte, daß er die Uniform brauchte wie der Hauptmann von Köpenick, daß wir als Hochstaplerfamilie dem Kostümzwang des Kapitals unterlagen.
Die Kulisse war prächtig, doch die Mauern und Steinfiguren zeigten Risse des Verfalls. Das Haus ergab sich dem Alter und der Witterung, würdevoll und unausweichlich. Mein Vater rühmte den Charme und den Glanz alter Patrizierhäuser, die solide und großzügige Architektur, die liebevollen Details. Er konnte sich sehr lange zuhören, ohne an seinen Worten zu zweifeln.
«Du mußt an dich glauben, Felicitas, dann liegt dir die Welt zu Füßen.»
Ich sagte ihm, daß ich die Schule abbrechen wolle, da ohnehin keine Chance bestand, die Mittlere Reife zu schaffen.
Klara hielt ihr Glas fest und schielte auf die Packer. Vater trank sein Glas leer und stellte es vorsichtig auf einen Marmorsockel. Meine Schulverweigerung gehörte zu den Themen, die er verabscheute wie alles Konkrete, Unangenehme, wie Krankheit oder Tod. Mein Widerspruch war so uncharmant, und wußte er nicht am besten, daß akademische Titel verführerisch und gewinnbringend wirken? War ich etwa zu dumm für die Schule? Zu schwach für die Schulwechsel? Nein, ich war intelligent, aber faul, und ich hatte noch zu lernen, mich in einer feindlichen Welt zu behaupten. In einer Welt, die er um mich herum geschaffen hatte, ergänzte ich, und er sah mich mit jenem Blick an, der Gläubigerherzen zu erweichen pflegte. Der enttäuschte, gekränkte Vater war keine seiner bevorzugten Rollen, doch er beherrschte sie mit jenem Minimum ah Glaubwürdigkeit, das mich immer noch zu schwachem Applaus nötigte.
«Wissen ist Macht», ergänzte Klara die Diskussion in ihrer unnachahmlichen Art, in Phrasen oder Zitaten zu sprechen. Ich versuchte zu erklären, daß das Wissen, das man mir in mehr als einem Dutzend Schulen zu vermitteln versucht hatte, jenseits aller Machtansprüche lag. Ich war zweimal sitzengeblieben. Ich konnte lesen, schreiben und rechnen. Ich wußte, wie man Hummer aß und Rotwein dekantierte. Ich konnte iranischen von russischem Kaviar unterscheiden, und meine Tischmanieren waren makellos. Ich beherrschte die leichte Konversation und ein wenig Brechtsche Dialektik. Ich war ein Wesen von absurder, unvollkommener Bildung, doch das wußte ich nicht mit sechzehn Jahren. Man weiß nichts und glaubt, alles im Griff zu haben.
Mein Vater fragte mich, ob ich etwa arbeiten wolle? Das Wort klang unanständig, so wie er es aussprach. Wir waren eine unanständige Familie, doch in dem Gebäude seiner Lügen hätte jedes wahre Wort zum Einsturz geführt.
«Ich dachte, daß ich mir eine Lehrstelle suche. Kellnerin oder so. Die Schule interessiert mich nicht mehr.»
«Sie ist verrückt», sagte mein Vater zu Klara.
«Warum wirst du nicht Schauspielerin?» fragte sie.
«Ich werde die eine oder andere Beziehung spielen lassen. Vielleicht findet sich etwas Angemessenes für meine Tochter.»
Wenn wir zu dritt waren, sprach er mit Klara manchmal über meinen Kopf hinweg, und ich haßte es. Ich haßte es, wie er uns zu täuschen versuchte, die wir doch wußten, daß seine guten Beziehungen stets von kurzer Dauer waren und mit einer schmerzlichen Enttäuschung für seine Partner endeten. Ich haßte ihn dafür, daß ich ihn liebte, meinen Vater. Die Gefühle einer Sechzehnjährigen sind selten originell und geprägt von schmerzvollem Erwachen aus Kindheitsträumen. Wenn Klaras Version des Vertrags stimmte, der in Sachen Liebe geschlossen werden mußte, so hatte er ihn aufgesetzt zu seinen Bedingungen, und ich erfüllte ihn, weil ich ihm ausgeliefert war. Liebe braucht Bewunderung oder zumindest Respekt, und anders als Klara sah ich ihn nicht als Opfer des Systems, edlen Gesetzlosen, als Revolutionär, der das System von innen bekämpfte. Alles läßt sich glauben, verneinen, hinnehmen, bekämpfen. Wondraschek war ein Betrüger. Mich hatte er um meine Liebe betrogen.
Draußen brachten die Handwerker ein Schild an, auf dem sein falscher Name stand, und darunter das, was er als seinen Beruf bezeichnete: Vermögensberater. Dr. Harald Werner beriet Menschen, ihr Vermögen verlustbringend anzulegen, zum Beispiel in Wertpapieren, die nichts wert waren, Aktien von Scheinfirmen oder Beteiligungen an Projekten, die sich nie materialisierten. Viel Geld suchte sich seinen Weg an der Steuer vorbei in Verheißungen hoher Rendite. Alles, was über zehn Prozent lag, war verlockend, und alles unter achtzehn Prozent im Rahmen des Glaubwürdigen. Sagte Vater. Viel Geld wollte mehr Geld, und der Vermögensberater ließ teure Broschüren drucken, um die Gierigen zu ködern, und wenn er sie an der Leine hatte, ließ er die Goldfische zappeln, ja er ließ sich geradezu bitten, sie in die Geheimnisse seiner vorgeblichen Geldvermehrung einzuweihen. Sie glaubten einem, der mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank telefonierte, während sie bei ihm waren, doch in Wahrheit war es Claire, die Gute, die ihre Stimme verstellte und jene Anrufe tätigte, die Vaters Kundschaft so imponierten. Sie saßen gefälschten Briefen und fingierten Gutachten auf, weil sie glauben wollten. Der Schein war alles, und das Geld glänzte, blendete, verführte zu Illusionen, die der Gaukler aufrechterhielt, solange es eben ging.
Solange es ging, bezahlte er die Rendite aus Zinserträgen und neuen Anlagen. Solange sein Schneeballsystem funktionierte, glaubte er an die Smaragdmine in Sambia, die Ölquelle in Venezuela, die Recyclingfirma in Tschetschenien. Er glaubte, daß etwas, das er erschaffen hatte, sich materialisieren müsse, weil er das Wunder vollbracht hatte, andere davon zu überzeugen. Er glaubte, er sei Gott.
Klara glaubte an Anarchisten und Revolutionäre, die Christusgestalten unter den Kommunisten, bevor sie Funktionäre des Glaubens wurden: satt, dogmatisch, machterhaltend. Vater fütterte sie mit den Worten, auf die sie hungrig war, und so fügte sie ihn in ihr Weltbild der Wunder, in dem einer wie er die Kapitalisten das Fürchten lehrte. Claire war seine einzige Komplizin, weil er der Gier eines Partners nicht traute in einem Geschäft, das auf Gier aufgebaut war. Sie war Familie, und in seiner seltsamen Prioritätenliste mußte er gedacht haben, daß eine, der er sein Kind anvertraute, auch in Geschäften zuverlässig war. Claire spielte mit, weil sie diesem Gott glaubte. Ich war immer nur Statistin gewesen oder das Wesen auf den Wolken, die er zusammenschob. Es regnete gutes Leben, wenn die Geschäfte liefen. Putzfrauen wurden eingestellt, Köchinnen und Gärtner. Es gab Partys und Abendessen, Claire kaufte sich Kleider und Vater eine neue Limousine, und er überhäufte mich mit Geschenken, die meine Schulkameradinnen beeindruckten, die nie meine Freundinnen wurden, denn soviel Zeit ließ er mir nicht in einer Stadt, in einer Schule, in einem Haus.
Es ging so lange gut, als neue Investoren sein System finanzierten: gutsituierte Witwen, denen das Schweizer Nummernkonto zu wenig zinsträchtig schien, Ärzte und Apotheker, Handwerker und mittelständische Unternehmer. Der Vermögensberater inserierte nicht, sondern baute auf Mundpropaganda, was ihm diskreter und sicherer schien, jedoch den Kundenkreis beschränkt hielt. Und so war die Götterdämmerung vorgegeben, wenn der Kreis sich schloß. Wenn er nichts mehr auszuschütten hatte, zog er das Ende hinaus, indem er Geschichten erfand von verzögerten Transfers, Irrtümern der Bank, explodierenden Ölquellen oder politischen Intrigen in Tschetschenien. Je unglaublicher eine Geschichte war, desto eher glaubte man ihm.
Er hingegen erkannte, daß er kein Gott war, und schloß den Pakt mit dem Teufel. Drei, manchmal fünf Monate hielt er den Belagerungszustand durch, vertröstete, versprach, zog alle Register seiner Täuschungskünste. In dieser Zeit nahm er Kredite auf bei verschiedenen Banken, und dann trat Phase drei in Kraft: der Kniefall des betrogenen Betrügers.
Der Vermögensberater besuchte seine Kunden und sagte ihnen, was sie bereits ahnten oder wußten: daß sie einem Bankrotteur aufgesessen waren. Nicht er, seine ausländischen Partner seien die Schuldigen. Er, der in gutem Glauben gehandelt habe, versuche nun zu retten, was zu retten sei. Aus ethischen Gründen und um seinen Namen reinzuwaschen. Die Geschichten variierten, aber nicht im Kernpunkt: Er schlug einen Kompromiß vor, eine gütliche, ja beinahe gütige Einigung, indem er anbot, einen Teil des eingezahlten Geldes in bar zurückzuzahlen. Hier, bitte, der Einblick in seine Vermögenswerte. Wenn er, wie es die Gerechtigkeit gebot, alle Kunden befriedigen wollte, mußten sie von ihren Forderungen Abstriche machen. Zwischen dreißig und siebzig Prozent: Er feilschte, bettelte, drohte. Er schilderte die Folgen einer Anzeige, die seinen Kunden die Steuerfahndung ins Haus brächte. Er setzte sich eine Pistole an die Schläfe. Sie war nur ein Spielzeug, aber er spielte überzeugend den Ruinierten, Betrogenen, den potentiellen Selbstmörder. Und sie, die noch einmal betrogen wurden, spielten mit.
In der dritten Phase, in der es um seine Haut ging, wuchs er über sich selbst hinaus, mein Vater, der Betrüger. Sein System hatte nur einen Makel: Am Ende, wenn alles abgewickelt war, stand er mit leeren Händen, oft mit Schulden da. Das Personal, der geleaste Luxuswagen, die geborgte Büroeinrichtung, alles löste sich auf in nichts. Denn anders als die wirklich großen Anlagebetrüger hielt Wondraschek sein Spiel in Grenzen. Er hinterließ nicht verbrannte Erde, sondern begrenzte Schwelbrände. Die Anleger leckten ihre Wunden, doch sie schrien nicht nach der Feuerwehr. Vater war sehr stolz darauf, daß es nur ein einziges Mal in seiner Karriere zu einer Anzeige gekommen war, die sich mit einer hohen Geldbuße erledigt hatte.