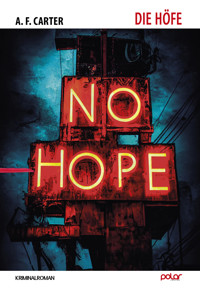
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Nacht, in der "Git" O'Rourke einen Mann in Randy's Tavern begegnet, um sich ein Vergnügen zu gönnen, endet damit, dass Bradley Grieg tot ist. All ihre Bemühungen, einen besser bezahlten Pflegejob außerhalb von Baxter zu bekommen, sind gescheitert. "Git" ist Krankenschwester, hat zwei Jobs und arbeitet 70 Stunden pro Woche, um sich und ihre 8-jährigen Tochter Charlie durchzubringen. Sie ahnt nicht, dass sie ihre Nacht mit einem Junkie verbracht hat, der einem Geldverleiher 18.000 Dollar übergeben soll und die nun fehlen. Als Grieg am Morgen erschossen in einem Motel aufgefunden wird, steht für Leutnant Delia Mariola fest, dass er die Nacht nicht alleine verbracht hat. "Git" gerät immer mehr in den Mittelpunkt der Ermittlungen. Carl Schmidt, Drogenhändler und Geldverleiher, macht sich ebenfalls auf die Suche nach ihr. Es ist nur eine Frage der Zeit, wer "Git" zuerst erwischt. Die Cops, die sie mit einem Haftbefehl suchen, oder der sadistische Vollstrecker Augie Barboza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 354
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
A. F. Carter
Die Höfe
Aus dem Amerikanischen von Karen WitthuhnHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Polar Verlag
Originaltitel: The Yards
Copyright: © 2021 by A. F. Carter
First published by Mysterious Press. An Imprint of Penzler Publishers, New York
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2023
Aus dem Amerikanischen von Karen Witthuhn
Mit einem Nachwort von Marcus Müntefering
© 2023 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Nadine Helms, Tobias Schumacher-Hernandez
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © Jason / Adobe Stock
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI Books GmbH, Ulm, Deutschland
ISBN: 978-3-948392-81-9
eISBN: 978-3-948392-82-6
Inhalt
1. GIT
2. GIT
3. GIT
4. DELIA
5. DELIA
6. CONNOR
7. DELIA
8. GIT
9. GIT
10. GIT
11. DELIA
12. CONNOR
13. DELIA
14. DELIA
15. GIT
16. CONNOR
17. DELIA
18. DELIA
19. CONNOR
20. GIT
21. CONNOR
22. DELIA
23. CONNOR
24. GIT
25. DELIA
26. DELIA
27. GIT
28. CONNOR
29. DELIA
30. CONNOR
31. DELIA
32. DELIA
33. GIT
34. DELIA
35. DELIA
36. CONNOR
37. CONNOR
38. DELIA
39. GIT
40. CONNOR
41. GIT
42. DELIA
43. CONNOR
44. CONNOR
45. GIT
46. EINE WOCHE SPÄTER: GIT
Ich bin (k)ein anderer: Ein Nachwort von Marcus Müntefering
1
GIT
Sogar ungeschminkt sehe ich ganz gut aus. Okay, mein Gesicht ist etwas zu schmal, die Nase zu kurz, das Kinn ein bisschen zu spitz. Aber die Männer stehen drauf, auch wenn man mich wohl nie auf dem Cover einer Modezeitschrift sehen wird. Nein, es ist mir immer leichtgefallen, mir einen Mann zu angeln. Nur mit der Auswahl tue ich mich schwer.
Im Rückblick denke ich, der erste Würfel war schon lange vor meiner Abschlepptour gefallen. Etwa zwei Jahre und drei Monate früher, plus minus ein paar Tage. Als ich darauf verzichtete, einen Mann im Leben zu haben. Fünfundzwanzig Jahre alt, und ich hatte die Nase gestrichen voll. Obwohl ich keine Männerhasserin bin. Ein paar Freundinnen von mir sind mit anständigen Typen verheiratet, nicht perfekt, aber anständig. Man kann sich vorstellen, sie auch noch in zwanzig Jahren umarmen zu wollen. Nur ich nicht. Mein erster Freund hat mir die Faust ins Gesicht gerammt, als ich ihm keinen blasen wollte – ich war zwölf –, und meine letzte Liebe, Franky Belleau, hat mein Konto leer geräumt und sich aufgemacht, Ruhm und Reichtum in Las Vegas zu suchen. Jetzt sitzt er im Gefängnis. Ein bisschen Ruhm hat er immerhin bekommen, einen Zehnzeiler auf Seite achtzehn der Las Vegas Review, nachdem er einen Gemüsehändler erschossen hatte.
Ein Mädchen, das auf der abgeranzten Seite der Gleise in einer heruntergewirtschafteten Stadt wie Baxter aufwächst, hat vielleicht gar keine andere Wahl als eine schlechte. Von A wie Alkoholikermutter, die jeden Monat den Liebhaber wechselte, bis Z wie Zaster, den mein Vater, der abgehauen war, gelegentlich von uns haben wollte, erfüllt mein Leben jedes Klischee. Manchmal denke ich, dass Frauen wie ich zu nichts anderem gut sind. Gott hat uns zu lebenden Beispielen dafür gemacht, wie man Kinder nicht großziehen soll.
Aber Jammern ist nicht mein Ding, und ich halte auch nicht die Hand auf. Nach meinem Schulabschluss an der Dunning High habe ich als Aushilfskellnerin gearbeitet und mir damit ein Jahr in der Krankenpflegeschule finanziert, was mich zu einer zugelassenen Hilfskrankenpflegerin macht.
Ursprünglich waren meine Ziele viel höhergesteckt. Ich wollte mindestens noch ein weiteres Jahr auf der Schule bleiben und mich zur staatlich geprüften Krankenpflegerin ausbilden lassen. Dann verdient man viel mehr. Aber dazu reichte es nicht. Das Land versank in der Rezession, mein Pell-Grant-Stipendium versank gleich mit, für andere Ausbildungsförderungen kam ich nicht infrage, und Franky machte sich mit meinen Ersparnissen aus dem Staub.
Wenn die Männer in meinem Leben sich als Trostspender geeignet hätten, hätte ich mich an irgendeiner Schulter ausgeweint.
Da mir keine Wahl blieb, nahm ich eine Stelle im Resurrection-Altenpflegeheim an und arbeite dort drei Zwölf-Stunden-Schichten die Woche. Das war zwei Jahre, bevor das Virus zuschlug. Die Sechsunddreißig-Stunden-Woche erlaubt es den Baptisten, die den Sauladen leiten, mich als Teilzeitkraft zu klassifizieren, ohne Anrecht auf Krankenversicherung oder bezahlten Urlaub. Was ich in den sechsunddreißig Stunden verdiene, reicht nicht mal für die Rechnungen, und um Charlotte muss ich mich ja auch noch kümmern. Deswegen habe ich mir noch einen zweiten Job gesucht.
Jetzt arbeite ich drei Nächte die Woche im Resurrection und drei weitere als Pflegerin bei einem alten Mann, der behauptet, früher Gangster gewesen zu sein. Zack verteilt lauter gute Ratschläge, ist aber zu alt, um mir an den Arsch zu fassen, auch wenn er mich jedes Mal, wenn ich das Zimmer durchquere, mit Blicken verfolgt. Ist auch gut so, denn ich bin nicht bereit, mir an den Arsch fassen zu lassen, egal wie sehr ich den Job brauche. Das Traurigste daran ist, dass ich ziemlich stolz auf das bin, was ich erreicht habe. Ich wohne zur Miete in einem kleinen Haus in Dunning, in einer Gegend, in der die Nachbarn um zehn Uhr abends die Musik runterdrehen. Respektabel, das trifft es wohl am besten – respektabel, aber immer noch arm. Vom Hügel hinter dem Haus aus kann ich die Bahngleise sehen. Nachts höre ich die Züge vorbeirumpeln. Sollte ich krank werden oder mich verletzen und vielleicht ein paar Monate lang kein Geld verdienen, überquere ich die Gleise wieder. Ich und Charlie, wir beide.
Hätte ich nicht geheiratet, wäre ich schon zwei Jahre eher auf die Krankenpflegeschule gegangen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Sean mich ausgesucht hat; in der Nachbarschaft hätten sich jede Menge Mädchen um seinen Ring gerissen. Aber er nahm mich, war immer charmant, immer rücksichtsvoll.
Meine Freundinnen warnten mich. Sean spielt mit dir, Git. Nennt dich hinter deinem Rücken sein Hillbilly-Mädchen. Das soll ein Witz sein, klingt aber nicht witzig. Wenn du ihn heiratest, hat er dich in der Hand.
Wie man sich denken kann, schlug ich alle Warnungen in den Wind. Ich heiratete Sean mit neunzehn, der Empfang fand im Hinterzimmer einer Kneipe statt.
Okay, ich war jung und weich. Ein kleines Mädchen, das seinen Daddy suchte, irgendeinen Daddy. Aber man muss mir zugestehen, dass ich in Windeseile hart wurde. Sean setzte sein Besitzrecht handfest durch, mit Fäusten und durch Drohungen. Bis zu dem Nachmittag, an dem ich mit der Glock, die er in seiner Nachttischschublade aufbewahrte, auf ihn schoss. Die Kugel streifte nur die Rippen, aber ich hatte auf seinen Kopf gezielt, und Sean wusste es. Er drehte sich um und floh, zur Tür hinaus, die Straße runter und raus aus meinem Leben. Die Glock und sein ungeborenes Kind ließ er zurück.
Meine Tochter – Charlotte auf der Geburtsurkunde, seitdem überall Charlie – kam acht Wochen später auf die Welt, wenige Tage nach meinem zwanzigsten Geburtstag. Und nicht im Gefängnis. Sean ging weder ins Krankenhaus noch zu den Cops. Leute wie wir tun so was nicht.
In dem Moment, in dem die Hebamme mir Charlie in die Arme legte und sagte »Begrüßen Sie Ihre Tochter«, wurde sie zum Mittelpunkt meines Lebens. Ich war besiegt. Ich hatte stundenlang in den Wehen gelegen, mein Kopf dröhnte, und der Gestank aus meinen Achseln war so rau, dass man ein Streichholz daran hätte anzünden können. Charlie setzte dem ganzen Mist ein Ende. Ich wusste genau, was ich zu tun hatte, wusste, wenn ich das hier versaue, war mein eigenes Leben im Arsch. Meine Aufgabe ist es, Charlie zu lieben, für sie zu sorgen, sie zu beschützen, sie großzuziehen. Meine Aufgabe ist es, meiner Tochter mehr zu geben, als ich gehabt habe, ihr eine Chance zu geben.
Ich will, dass Charlotte es besser hat. Ich will, dass sie in einer Gegend lebt, die so weit weg ist von den Bahngleisen, dass man die Züge nicht mehr hört. Aber dazu braucht man Geld.
Sean zahlt monatlich ein paar Dollar, genug, damit er nicht verhaftet wird, nicht genug, um Charlies Leben zu verändern. Also hängt das Schicksal meiner Tochter von mir ab, und ich behaupte mich so gut ich kann. Seit ich Männern abgeschworen habe, gebe ich mich meistens mit einem Vibrator und meiner Fantasie zufrieden, aber ich will nicht lügen, es gibt Momente, da brauche ich eine kleine Abschlepptour.
Bis ich zwanzig war, existierte das Wort Libido in meinem Wortschatz nicht. An meinem Ende der Nahrungskette wird dafür nur ein Wort verwendet: geil. Ehrlich gesagt bin ich meistens geil, und normalerweise besorge ich es mir selbst. Aber alle paar Monate komme ich an einen Punkt, an dem ich einen Mann brauche. Dort beginnt diese Geschichte, der letzte Schritt auf meinem Weg, seit ich mir geschworen habe, es allein zu schaffen.
2
GIT
Mom sitzt mit einer nicht angezündeten Zigarette zwischen den Fingern auf der Bettkante. Zum Rauchen muss sie rausgehen. Ich sitze auf einem Korbstuhl und starre in den Spiegel auf meiner Schminkkommode. Kein Grund zur Eile. Es ist noch nicht mal sieben, und die beste Abschleppzeit beginnt erst nach zehn. Ich habe den Samstag genommen, weil es mein einziger freier Abend ist.
»Ich bin für das grüne Kleid«, sagt Mom.
»Nicht das schwarze?«
»Darin hast du einen flachen Hintern.«
Mein Haus liegt an der Booth Lane, hat drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und ein zu kleines Badezimmer, das wir uns teilen müssen. Wir, das sind ich – Bridget O’Rourke – und Charlie, die acht ist, außerdem meine Mutter, Celia Graham. Charlie ist in ihrem Kinderzimmer und sieht fern, wie ich durch die Gipswand hören kann.
Meine Mutter ist die Krone des Weißen Abschaums, und das ist keine Übertreibung. Sie war nach allem süchtig, für das irgendwer anders bezahlte, und in meiner Kindheit öfter weg als da. Das war ein Segen, weil in den Gesprächen mit meiner Mutter, ob betrunken oder nüchtern, die ganze Wut mitschwingt, die sie im Laufe ihres harten und bitteren Lebens angesammelt hat. Als Kind habe ich sie geschluckt. Welche Wahl hatte ich? Wenn Mom wegblieb, war ich immer froh, auch wenn ich manchmal meine Oma Jo anbetteln musste, um etwas zu essen zu bekommen.
Als ich nach dem ersten Jahr in der Krankenpflegeschule von zu Hause auszog, war Mom genauso überrascht wie der Rest meiner Familie. Damals hoffte ich, sie zum letzten Mal im Rückspiegel zu sehen, und dann Lebwohl, sayonara und goodbye. Doch dann wurde ich alleinerziehende Mutter, und arbeiten zu gehen und Kinderbetreuung zu bezahlen, war unmöglich. Sogar im verarmten Baxter und Post-Covid muss man für professionelle Kinderbetreuung tausend im Monat hinlegen. Also schloss ich einen Deal mit meiner Mutter: Ich gab ihr ein Dach über dem Kopf und stellte Essen auf den Tisch, sie wurde … vielleicht keine richtige Großmutter, aber wenigstens ein Kindermädchen. Für Moms Leber hatte es damals kein Zurück mehr gegeben, sie war in schlechter Verfassung. Ihre Schulter- und Hüftknochen waren spitz genug, um unter das Waffengesetz zu fallen. Ihr Gesicht bestand aus tiefen Furchen. Ihr Mund war so tief eingefallen, dass es aussah, als würde sie ihre Lippen verschlucken.
Tut mir leid, wenn ich kein Blatt vor den Mund nehme. Meine Beziehung zu meiner Mutter ist rein praktischer Natur, und meine Verbitterung sitzt tief. Meiner Meinung nach bin ich ihr rein gar nichts schuldig, sondern habe Anrecht auf Wiedergutmachung. Wenigstens ist sie inzwischen nüchtern, aus gutem Grund. Sie weiß genau, dass ich sie in hohem Bogen rauswerfe, sollte sie wieder anfangen zu trinken. Und sie weiß auch, dass sie wahrscheinlich irgendwann ein Stück von meiner Leber brauchen wird.
»Okay, das grüne.« Ich stehe auf, hänge das schwarze Kleid in den Schrank und lege das grüne aufs Bett. Die kleinen Pailletten auf dem hellen Stoff wirken im grellen Licht der Schlafzimmerlampe billig und schrill, doch im Halbdunkel einer schummrigen Bar werden sie leuchten.
Ich weiß, wohin ich in ein paar Stunden fahren werde, wo ich sitzen werde, weiß, dass das blutrote Schild mit dem Namen der Bar – Randy’s – die linke Seite meines Kleids und die Silberreifen an meinem Handgelenk zum Glitzern bringen wird.
»Is echt Zeit, dass du ma rauskommst, Git.« Mom kniet auf dem Boden und durchsucht einen Haufen Schuhe nach Pumps zu dem Kleid. »Hab sie.« Mom hebt die Fünfzehn-Zentimeter-Stilettos hoch. Sie sind eher silbern als grün, aber das passt schon. Mir tun schon von dem Anblick die Füße weh, aber alle paar Monate genieße ich es, mich schick zu machen und als jemand zu verkleiden, der ich nie sein kann. Nicht solange ich ein Kind großziehen muss.
Mom legt die Zigarette weg und holt ihren kleinen Koffer mit Schminkutensilien, Bürsten und Schwämmen aus der mittleren Kommodenschublade. Früher hätte sie fast mal ihren Lebensunterhalt als Kosmetikerin verdient, war aber immer zu unzuverlässig, um wirklich Erfolg zu haben. Dabei hat sie Talent, und sogar ihr leichter, aber merklicher Tremor verschwindet, wenn sie beschäftigt ist.
»Kommst du heute nach Hause? Oder morgen?« Ohne aufzusehen, zieht sie einen Augenbrauenstift aus dem Koffer. »Was soll ich Charlie sagen, wenn sie aufwacht und du bist nicht da?«
Das von einer Frau, die immer wieder wochenlang verschollen war.
»Wenn ich bei Sonnenaufgang nicht zu Hause bin, ruf die Bullen.«
»Und was sag ich?«
Da ich nicht antworte, macht sich Mom an die Arbeit. Sie zieht meine Augenbrauen nach und verlängert sie um etwa acht Millimeter. Dann sind die Lider dran. Drei verschiedene Lidschatten, die immer dunkler werden, bis beide Augen von einem hellen Grün umgeben sind, das zum Kleid passt. Ein bisschen Silberglitzer dazu und eine geschwungene, etwa zwei Zentimeter lange schwarze Linie außen neben meinen blauen Augen, dann ist das Werk vollendet.
»Wie findste das?«, fragt Mom.
Sie tritt beiseite und überlässt mich dem Spiegelbild. Ich sehe das, was ich mir erhofft habe: Partygirl, nicht Bordsteinschwalbe. Der Hauptunterschied ist, dass man für eine Nutte zahlen muss, und ich mach’s umsonst. Das gibt mir das Recht, wählerisch zu sein, wenn auch nicht allzu sehr.
Der Spiegel hält meine Aufmerksamkeit noch einen Moment lang. An der zu hellen Haut ist noch was zu machen, ebenso an den linealglatten Haaren, die meine Hillbilly-Abstammung verraten. Meine Großeltern – die einzigen, die ich kenne, die Eltern meiner Mutter – sind auf der Suche nach einem besseren Leben aus West Virginia hier eingewandert. Und fanden es laut Oma Jo auch.
Kurz vor ihrem Tod verkündete Oma Jo, dass sie stolz auf mich sei. Ich würde es weit bringen, wie auch sie es weit gebracht hatten.
»Egal wie schwer das Leben in Baxter auch war, da in den Tälern war es noch viel härter. Wer nicht in den Minen geschuftet hat, dem blieb nichts anderes übrig als Gras zu fressen.«
»Hast du schon entschieden, wo du heute Abend hinfährst, Git?« Mom macht sich wieder an die Arbeit, überdeckt die kleine Narbe über meinem rechten Auge, legt Foundation auf mein Gesicht.
»Vermutlich ins Randy’s.«
Randy’s Tavern ist eine Bar, in der sich Männer und Frauen treffen, die auf Sex aus sind. Sonst würde man dort nicht hingehen. Das kann ein Paar auf der Suche nach einem anderen Paar sein, eine Ehefrau, deren Mann auf Dienstreise ist, oder ich, die heiß ist auf einen One-Night-Stand.
Die Bar liegt am Rand von Mount Jackson, der einzig wohlhabenden Wohngegend von Baxter. Das mit dem »Mount« ist für uns, die wir am südlichen Ende der Stadt aufgewachsen sind, ein Witz. Mount Jackson kann nur da als Mount irgendwas bezeichnet werden, wo im Umkreis von Hunderten von Meilen nichts als Flachland existiert. Das mit dem »wohlhabend« ist genauso irreführend. Zwar stimmt es, dass oben auf dem Hügel Baxter Mansion thront, eine Villa mit fünfundsechzig Zimmern. Aber die Familie ist seit Jahren nicht mehr dort gewesen, und es kursieren Gerüchte, sie würden die Fabrik bald dichtmachen. Es gibt noch kleinere Villen, die meisten verlassen, und Häuser, die von den Besserverdienenden bewohnt werden – Ärzten, Anwälten, Geschäftsleuten.
Früher einmal waren in der Stadt sechs große Fleischverarbeitungsanlangen in Betrieb, alle in Familienbesitz. Als Erste machte 1994 die Gauss-Fabrik dicht, die fünfte, Dunning Pork Products, schloss vor sechs Jahren ihre Tore. Jetzt ist nur noch die übrig, die Anfang des letzten Jahrhunderts von George Baxter gegründet wurde.
Und wenn die auch noch zumacht?
Im Mittleren Westen gibt es nichts als Mais, Rinder und Schweine. Tech-Firmen verschlägt es nicht hierher. Wenn kein Wunder geschieht und Baxter Packing auch noch schließt, heißt es »Renn um dein Leben«.
»Kannst du nicht lieber bei deinesgleichen bleiben?« Mom zerrt mich wie immer auf die Erde zurück.
»Und das wäre wo?«
Sie ist mit meinem Gesicht zufrieden, zieht einen Lockenstab aus ihrem Zauberkoffer und beginnt, mein dünner werdendes Haar zu bearbeiten, das ich noch mit einem Hut bedecken werde. Ich bin fast fertig und ganz heiß darauf, loszukommen. Mit ein bisschen Glück schwinge ich meinen mehr als befriedigten Arsch morgen früh bei Sonnenaufgang wieder zur Tür hinein. Je früher ich mich auf den Weg mache, desto besser.
»Lawton’s wäre gut.«
In gewisser Weise hat Mom wahrscheinlich recht. Im Lawton’s müsste ich kein Getränk bezahlen. Ich könnte mich an die Tür stellen, mit dem Finger schnippen, und schon würde sich ein Dutzend arbeitsloser Rednecks mit Namen wie Austin, Clint oder Boyd um meine Gunst prügeln. Vielleicht würden wir in einem Pick-up-Truck in ein Motel fahren. Und wenn der Typ pleite wäre, könnten wir es auf der Ladefläche treiben.
Eine Stunde später schaue ich in den Spiegel und bin fasziniert von meinem Aussehen. Ich bin fast schön, mein Aussehen ist so exotisch, dass ich nicht weiß, was ich mit meinem Gesicht machen soll. Mir ist klar, dass ich nach den Sternen greife, aber genau darum geht es. Mein Slip und der BH haben hundert Dollar gekostet. Sie sind hellblau, mit lavendelfarbener Spitze verziert und nahezu durchsichtig.
Charlie kommt ins Zimmer, als ich gerade acht silberne Armreifen über meine Hand streife. Auch die werden das rote Licht einfangen.
»Mommy«, Charlie legt den Kopf schief, »du siehst wunderschön aus.«
Ich umarme meine Tochter und gebe ihr einen leichten Kuss auf die Wange, der den Lippenstift nicht verschmiert. Dann ziehe ich eine Schublade der Schminkkommode auf, hole meinen Ehering hervor und schiebe ihn auf meinen Finger.
Auf geht’s.
3
GIT
In richtigen Städten wie New York oder Chicago würde man über das Randy’s nur lachen. Jedenfalls die bessere Gesellschaft. Aber ich muss zugeben, dass sich Mason Cheat, Besitzer des Randy’s, wirklich Mühe gegeben hat. Alles, vom Steinfußboden bis zur Metalldecke, ist edel. Die geschwungene Bar ist mit gestepptem Leder verkleidet, die purpurfarben lackierten Tische sind mit quadratischen Glasplatten bedeckt, und an der größten Wand hängt eine Skulptur aus Weißmetall, die mich vage an einen Vogel im Flug denken lässt.
Das ist alles ganz schön, das Bemühen, meine ich, aber für meine Begriffe erhebt die Bar Anspruch auf höhere Weihen vor allem durch das, was nicht da ist: ein Billardtisch nämlich.
Das Licht im Randy’s wird hauptsächlich durch Wandleuchten erzeugt und ist dementsprechend schummrig, was mir, als ich eintrete, entgegenkommt. Wir befinden uns in Baxter tief genug im Westen, um einen weitkrempigen Hut, handgefertigt von einer Hutmacherin aus der Gegend, tragen zu können, der mein Gesicht weitgehend verdeckt. Hüte sind eigentlich out, sogar in Baxter, aber inmitten von Weideland und Rinderherden sind Stetsons auf den Farmerfesten, die die alten Zeiten wiederaufleben lassen, als Rinderzüchter noch ihr Vieh durch die Stadt trieben, kein ungewöhnlicher Anblick. Und bei Wild-West-Partys in den Klubs, wo vor allem der Texas Two-Step getanzt wird, sind sie geradezu ein Muss.
Als ich sicher bin, dass mich niemand erkannt hat, durchquere ich den Raum. Ich spüre die Blicke, die mir folgen. Das dient der Erregung – sich begehrt zu fühlen ist der erste Schritt –, und ich lege etwas mehr Schwung in meinen Gang. Hoffentlich nicht zu viel. Einfach ein bisschen mehr Dynamik in dem Teil meines Körpers, der sich gegenwärtig größter Beliebtheit erfreut.
Der Barmann wendet sich mir zu. Ich kenne ihn, ein Mann mittleren Alters mit Bart und traurigem Blick, als würde er den Job hier schon viel zu lange machen. Sein Name ist Shiloh, sein Lächeln entspannt. Falls er mich erkennt, behält er es für sich.
»Was kann ich bringen?«
»Einen Martini.«
»Kommt.«
Die zweite Hälfte meiner Jugend habe ich damit verbracht, in irgendeiner der vielen Bars in den Yards Shots zu kippen. Die Yards sind die schäbige Wohngegend um Baxters letzte verbliebene Fleischfabrik herum. Ich habe meine Lektion gelernt und nicht vor, mich heute Abend abzuschießen. Ich habe andere Bedürfnisse, der Martini ist bloß Teil der Show.
Im Stehen endet mein Rock kurz unter dem Hintern, und der Kragen liegt am Hals an. Die Ärmellöcher sind weit ausgeschnitten, offen fast bis zur Hüfte, und nur der eingenähte BH verhindert, dass ich gegen Baxters Sittengesetze verstoße. Beim Saum bin ich mir da nicht so sicher; wenn ich einen Fuß auf die polierte Stange des Hockers stelle und die Beine übereinanderschlage, rutscht er weit nach oben.
Als ich meine Position eingenommen habe, nehme ich das Angebot in Augenschein und erblicke vor allem Bürohengste, dazwischen ein paar herausgeputzte Rednecks, das übliche Gemisch, mit einer Ausnahme. Ich mustere den Mann verstohlen. Er sitzt an einem Tisch etwa drei Meter vor der Bar, ist älter als ich, aber nicht viel, und trägt ein schwarzes Jackett über einem Seiden-T-Shirt, das seinen Oberkörper betont, ohne offensichtlich zu eng zu sein. Das T-Shirt ist indigofarben, ein Kontrast zu dem verwaschenen Blau seiner Jeans.
Böser Junge? Toyboy? Etwas an dem schmalen Lächeln, das erscheint, als sich unsere Blicke treffen, sagt mir, dass er kein Spielzeug ist.
Aber er rührt sich nicht. Hebt sein Glas, trinkt, stellt erneut kurzen Blickkontakt her und schaut weg. Ich bin nicht blöd. Ich weiß, dass er meinen Ehering gesehen hat. Ich trage ihn an der Hand, mit der ich meinen Drink halte. Eine verheiratete Frau kommt an einem Samstagabend nur aus einem einzigen Grund ins Randy’s und setzt sich allein an die Bar. Jeder andere Mann stünde bereits neben mir.
Mein erster Verehrer – ich liebe das Wort, auch wenn es nichts mit der Situation zu tun hat – nähert sich bereits nach wenigen Minuten. »Frisch geschieden« ist ihm schon von Weitem anzusehen, von dem verängstigten Lächeln bis zum sorgfältig geklebten Scheitel.
»Darf ich Sie zu einem Drink einladen?«
»Ich habe noch.«
Mit ein wenig mehr Erfahrung würde er den Hinweis verstehen und andere Weidegründe aufsuchen. Aber die hat er nicht, und schon sprudelt der Lebenslauf aus ihm heraus, den er sich auf dem Weg an die Bar zurechtgelegt hat. Frisch geschieden, wie ich vorhergesehen hatte, er heißt Owen und stammt aus Baxter. Er lehrt Amerikanische Geschichte an der University of Wisconsin in Madison und besucht hier gerade seine Familie.
Ermutigung kommt nicht infrage, aber ich bringe es nicht über mich, ihn abblitzen zu lassen. An Owens linkem Ohr vorbei beobachte ich den Mann im Seiden-T-Shirt. Er lächelt wieder schmal, guckt sich die Show an, hat es nicht eilig. Was würde er machen, wenn ich einfach mit dem College-Professor abziehen würde? Wenn ich längerfristige Absichten hätte, wäre das vielleicht sogar eine Option – Owen ist ein Typ fürs Leben –, aber ich bin nicht aus auf lebenslang und nutze eine Pause in seinem Monolog, um mich zur Bar umzudrehen.
»Noch einen, Shiloh. Auf meine Rechnung.«
Ich spüre, wie Owens Hahnenkamm welkt. Wieder abgeblitzt. Aber dafür kann ich nichts und lasse ihn von dannen ziehen. Sofort nimmt jemand Neues seinen Platz ein, ein dickbäuchiger Mann mittleren Alters mit einer Goldkette, mit der man ein Kreuzfahrtschiff vor Anker legen könnte.
»Was trinken?«
In dem Moment stellt Shiloh meinen Drink auf die Bar.
»Danke«, sage ich, »schlechtes Timing.«
»Franklyn Wallace mein Name.« Er hält mir die Hand hin, die ich kaum berühre. Macht nichts, Franklyn legt schnell seine Karten auf den Tisch, zeigt, was er zu bieten hat. Er besitzt Häuser in Prairie Meadows, einer Gated Community vor der Stadtgrenze, sowie in Boca Raton, Florida. Die kann er sich leisten, weil ihm auch das größte Autohaus im County gehört, Toyotas, Chevys, Hondas, Audis, Hunderte von Autos. Ich soll bei Interesse vorbeikommen und nach Franklyn fragen.
Franklyn trägt einen Ring, dessen Diamanten in Hufeisenform angeordnet sind, und ich erkenne in ihm sofort den Typ, der auf der Highschool nie ein Mädchen abgekriegt hat. Aber jetzt, wo er erfolgreich ist? Jetzt vielleicht?
Ich will ihm nicht wehtun, genauso wenig wie ich Owen wehtun wollte. Ich halte die linke Hand hoch. »Verheiratet.«
»Ich auch. Hab den Ring im Wagen gelassen.«
»Na und? Ist das die Antwort?«
»Ja, genau, na und? Wir wissen beide, warum wir hier sind.«
»Du hast recht. Ich weiß, warum ich hier bin, und das bist nicht du.« Ich schaue ihm einen Augenblick lang in die Augen. »Nimm’s nicht persönlich, aber mir steht heute Abend der Sinn nach was anderem.«
Das bringt mir ein Achselzucken und eine kleine Rede ein, die er wahrscheinlich schon öfter gehalten hat. »Alles klar, damit kann ich leben, und danke, dass du nicht meine Zeit vergeudet hast.« Er wirft eine Visitenkarte auf die Bar. »Ruf an, wenn du Interesse an einem Wagen hast, neu oder gebraucht. Meine Preise sind unschlagbar.«
Als Franklyn abzieht, überlege ich, ob ich einen Fehler gemacht habe. Franklyn ist keine Schönheit, aber ich weiß, dass er ein vorbildlicher Liebhaber wäre und sich alle Mühe geben würde. Dass wir uns nie wiedersehen würden, wäre egal. Er würde sich mir stur widmen, dieses und jenes ausprobieren, bis er endlich den richtigen Knopf gedrückt hätte.
Aber er ist schon weg, und ich wende meine Aufmerksamkeit wieder dem Toyboy zu. Er sieht mich einen Moment lang an und steht dann auf. In der linken Hand hält er eine Ledersporttasche, die ich bisher nicht bemerkt hatte. Wenn die Tasche aus Schlangenleder ist, wonach sie aussieht, dann muss sie einige hundert Dollar wert sein. Mindestens.
Macht er jetzt seinen Zug? Ich rechne damit, dass er zu mir kommt, aber er wendet sich in Richtung Tür und schaut mich dann mit dunklen Augen fragend an: Ja oder nein? Er ist größer, als er im Sitzen wirkte, die Schultern breiter, aber irgendetwas nagt an mir, irgendein kleiner Zweifel. Trotzdem erhebe ich mich und halte kurz inne, um einen Zwanziger auf die Bar zu legen. Shiloh nickt mir zu und sieht dann den Mann an, der jetzt auf halbem Weg zur Tür ist.
»Ist er okay?«, frage ich.
»Hab ihn schon häufiger gesehen. Heißt Bradley Grieg und kommt ziemlich regelmäßig.«
Jetzt fühle ich mich sicherer und folge Bradley nach draußen auf den Parkplatz. Ich glaube, er will, dass ich zwei Schritte hinter ihm bleibe, aber diese Sex-Sklavin-Nummer ist nicht mein Ding.
»Das ist weit genug, Bradley.«
Als er seinen Namen hört, dreht er sich um und lächelt. Ich stelle mich dicht vor ihn. »Spielen wir, Bradley? Falls die Antwort Ja lautet, dann sollst du wissen, dass ich nicht auf Handschellen oder Fesseln oder Sklavenspielchen stehe. Wenn du das willst, gehen wir besser getrennte Wege.«
Er schaut mir sekundenlang direkt in die Augen, als würde er mich prüfen wollen. Aber dann lächelt er und sagt: »Stets zu Diensten.«
Meine inneren Alarmglocken schrillen. Obwohl ich seinen Namen gesagt habe, hat er nicht nach meinem gefragt. Doch als er mich an sich zieht und mir einen sanften, langen Kuss gibt, der nur allmählich drängender wird, verfliegt die Angst, mir wird heiß. Wir drücken uns aneinander, und ich spüre, dass er hart wird.
»Alles klar?«, fragt er.
»Ja«, sage ich, »alles klar.«
Bradley hat bereits ein Zimmer im Skyview Motor Court am Baxter Boulevard. Das Skyview ist vielleicht nicht gerade das Hilton, aber immerhin auch kein Stundenhotel. Ich folge seinem Audi über den Baxter Boulevard, der einzigen Straße, die quer durch die gesamte Stadt führt. An jeder Kreuzung halten uns Ampeln auf und steigern die Erwartung, meine Ungeduld hat fast etwas Erotisches. Ich öffne ein Fenster und schließe es wieder, als ich in der Ferne Donnergrollen höre. Ich brenne darauf, in wenigen Minuten stundenlange, allumfassende Befriedigung zu erleben. Dies ist mein Trip, und ich werde alles aus ihm rausholen.
Bradley biegt auf den Parkplatz des Skyview ab, ich klebe fast an seiner Stoßstange. Es ist ruhig, vor den Mini-Hütten stehen nur wenige Wagen, alle ein Stück entfernt von uns. Bradley wartet vor seiner Hütte und hält mir die Tür auf, als ich aus meinem kleinen Ford steige. Als ich an ihm vorbeigehe, schlägt er mir auf den Hintern. Und dann …
Keine zehn Minuten später ist er auf dem Weg ins Badezimmer, nackt. Ich stehe immer noch über die kleine Kommode gebeugt und bin wie gelähmt. Bradley hat kein Wort gesagt, hat mich weder geküsst noch gestreichelt, und ich muss davon ausgehen, dass er sich nur deswegen mit mir abgegeben hat, weil das immer noch besser als eine Socke ist. Ich höre die Dusche rauschen, dann wird sie abgestellt, dann Stille.
Mein Hirn rast wie eine überdrehte Roulettekugel, immer im Kreis. Ich muss hier raus, solange noch ein Quäntchen meiner Würde intakt ist, schaffe es aber aus irgendeinem Grund nicht, mich zu rühren. Außerdem ist mein Slip verschwunden. Ich erinnere mich vage, ihn aufs Bett geworfen zu haben, sehe ihn aber nirgends und will ihn nicht dalassen. Dazu war er zu scheißteuer.
Anstatt in Tränen auszubrechen, wonach mir ist, gehe ich auf die Knie und suche nach der verdammten Unterhose. Sie liegt hinter dem Kopfteil des Betts, endlich habe ich sie und stehe gerade wieder auf beiden Beinen, als die Badezimmertür aufgeht. Bradley schwankt nackt herein, high bis unter die Hutkrempe, die Augenlider auf halbmast. Als er nach einer längeren Pause spricht, kommt nur Lallen heraus.
»Biste noch da?« Er plumpst aufs Bett, setzt sich wieder auf. »Wart ma.«
Seine Jeans liegt neben ihm auf dem Bett. Er greift in eine Tasche, zieht ein aufgerolltes Geldbündel hervor, zählt drei Zwanziger ab und wirft sie in meine Richtung.
»Verpiss dich.«
Ich sehe die Scheine einzeln auf den Teppich flattern. Bradley schnaubt einmal, fällt auf den Bauch und beginnt zu schnarchen.
Ich brauche ein paar Minuten, um mich zu erholen, und bin stinksauer. Ich sehe mich nach irgendetwas Schwerem um, mit dem ich ihm den Schädel einschlagen kann, vielleicht eine Lampe. Aber die sind alle an den Wänden oder der Decke angebracht. Bleibt nur der Stuhl, auf dem ich sitze.
Als ich ins Bad gehe, schwirren mir immer noch tausend Gedanken im Kopf herum. Ich denke gerade, dass ich mich waschen sollte, bevor ich nach Hause fahre, da lässt mich der Anblick der Zigarette, des geschwärzten Löffels und der Spritze auf dem Badewannenrand erstarren. Als ich mich umdrehe, fällt mein Blick auf die Ledersporttasche auf dem kleinen Tisch im Zimmer. Ich gehe schnell zu Bradley und sehe nach, wie es ihm geht. Er hat anscheinend eine halbe Überdosis intus und wird so schnell nicht wieder zu Bewusstsein kommen.
Wo ich aufgewachsen bin, gilt Ehrlichkeit oft nicht als ratsam. Meine Mutter hat so viele Lügen erzählt, dass ich sie nicht mehr zählen kann. Sie hat mich angelogen, die Sozialarbeiter, Oma Jo, meine Lehrer und die Liebhaber, die sie betrogen hat.
Als ich die Tasche öffne, sehe ich als Erstes eine große Pistole, eine Halbautomatik. Ich zucke nicht mal. Man nennt diesen Teil des Landes bible belt, Bibelgürtel, könnte ihn aber genauso gut gun belt, Waffengürtel, nennen. Pistolen machen mir keine Angst, Gewehre und Flinten auch nicht, fragt meinen Ex-Mann. Außerdem bin ich sehr viel mehr an den Bündeln aus Zwanzigern und Fünfzigern interessiert, die unter der Pistole liegen. Das würde reichen, um den Lauf meines Lebens nachhaltig zu ändern, und zwar zum Besseren.
Und Charlies.
Meine tägliche Routine würde ich erst mal mehr oder weniger beibehalten. Meinen Job zu kündigen wäre zu auffällig. Aber ich könnte wahrscheinlich einen Teilzeitkurs belegen und mich zur staatlich anerkannten Krankenpflegerin weiterbilden. Dann würde ich genug verdienen, um Baxter zu verlassen, bevor die Stadt völlig am Ende ist. Ich könnte mir anderswo ein neues Leben aufbauen, wo niemand weiß, woher ich komme und wie ich aufgewachsen bin. Ich könnte mich und Charlie von den Ketten befreien, die uns hier fesseln.
Früher wurden Viehherden durch die Straßen von Baxter getrieben. Heutzutage werden sie in Lkws und Viehwaggons gebracht. Und wenn es morgens ruhig ist, hört man die Tiere schreien, wenn sie zum Schlachten geführt werden, das Gebrüll der Mastochsen, das Quieken der Schweine.
Auch davon könnte ich mich befreien.
4
DELIA
Als Chief Black anruft, befinde ich mich zur Abwechslung mal nicht in der Einsatzzentrale, obwohl ich als Chefin der Detectives von Baxter natürlich immer im Dienst bin, wenn ein Notfall es erfordert. Nein, ich sitze gerade im Büro des Pastors der Trinity Lutheran Church und stehe für das inakzeptable Verhalten meines Sohns gerade. Die Trinity ist eine der florierenderen Kirchen in Baxter. Der Saal hat zwei Emporen, an der Kassettendecke hängen Kronleuchter. Der Altar ist umgeben von Buntglasfenstern, die Kirchenbänke sind aus Ahornholz und auf Hochglanz poliert. Die Gemeinde passt zu diesem behäbigen Wohlstand. Baxter ist eine Stadt der Armen und Ärmsten, und was an Mittelschicht existiert, besucht entweder die Trinity oder eine der katholischen Kirchen.
Ich habe für Religion wenig übrig, aber da viele der Freunde meines zwölfjährigen Sohns in die Trinity Lutheran gehen, fahre ich Danny jeden Sonntag pflichtbewusst zum Gottesdienst. Ich will nicht wissen, was sie ihm dort beibringen, bin aber ziemlich sicher, dass es sein Verhalten bisher nicht beeinflusst hat. Heute Morgen hat er einem anderen Jungen aus noch ungeklärten Gründen aufs Maul gehauen.
»Ihr Sohn ist recht intelligent, Lieutenant Mariola«, sagt Pastor Grange. »Aber sein Wesen ist … wie soll ich sagen? Nicht aggressiv, so weit würde ich nicht gehen, aber doch sehr gereizt.« Er lächelt und entblößt gelbe, schiefe Zähne. »Ja, genau. Daniel ist ein reizbares Kind mit wenig Respekt für Autorität.«
Granges säuselnder Ton reizt mich ebenfalls, und ich muss mich beherrschen, um nicht irgendetwas Obszönes zu sagen, das ich später bereuen werde. Schließlich bin ich eine anständige Staatsbeamtin, der erste weibliche Detective in Baxter. Und inzwischen sogar die Chefin. Gut, die Stadt hat gerade mal hunderttausend Einwohner. Und die Detective Division hat insgesamt bloß sechs Ermittler. Und die Polizeibehörde legt mehr Wert auf Einnahmequellen wie Verkehrsdelikte und Falschparken. Aber ich bin immerhin diejenige, die Chief Black zur Chefin ernannt hat, als Tommy Harrigan pensioniert wurde.
»Ein Itaker für einen Paddy«, war seine leutselige Erklärung. »Und noch dazu ein Itakermädel.«
Pastor Grange ist verstimmt, als mein Handy die ersten Noten von »Fast Car« herausplärrt, ein Lied von Tracy Chapman. Und noch verstimmter, als ich drangehe. Tja. Mein Boss ruft an, den kann ich schlecht ignorieren.
»Wo sind Sie, Delia?«
»In der Trinity Lutheran. Mein Sohn …«
»Vergessen Sie den Jungen. Wir haben eine Leiche im Skyview, ein Mord. Ich brauche Sie da. Und zwar gestern.«
Das klingt wie ein Witz, ist aber keiner. Im vergangenen Jahr hat es im kleinen Baxter zehn Todesfälle durch Überdosis und fünf Selbstmorde im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch gegeben. Keine große Sache. Keine Eile. Jetzt aber haben wir unseren zweiten Mord, und der Chief kommt ins Schwitzen. Dass heute Sonntag und laut Dienstplan mein freier Tag ist, zählt nicht.
»Ich muss los«, sage ich zu Pastor Grange. »Die Pflicht ruft.«
Auf dem Weg zum Auto knöpfe ich mir im Vorzimmer des Pastorenbüros noch meinen Sohn vor. Dan blickt ergeben drein. Er weiß, dass er mit einer Standpauke zu rechnen hat, und freut sich nicht darauf.
»Erzählst du mir vielleicht mal, was passiert ist?«
»Barry hat dich Kampflesbe genannt.«
»Hat er das? Na, ich hoffe, du hast ihm wenigstens beide Beine gebrochen.«
Da grinst Danny. »Nee, ich hab ihm bloß die Ohren abgerissen.«
Danny ist blond, groß für sein Alter und ein geborener Sportler. Er spielt Football und Baseball. Ein perfektes Leben … wäre da nicht die unglückselige sexuelle Neigung seiner Mutter. Nicht dass ich Frauen mit nach Hause bringen oder mich in Baxters einziger Lesben- und Schwulenbar rumtreiben würde. Nein, ich bin so diskret, wie es in einer Bible-Belt-Stadt absolut erforderlich ist. Dennoch ist meine Sexualität kein Geheimnis, und in Dannys Pubertätswelt wird Ehre großgeschrieben. Auch wenn Barrys Schmähung den Tatsachen entsprach, musste Danny darauf reagieren, denn sonst würde er als feige oder schwul beschimpft und gehänselt werden. Und weder ich noch er lassen sich zum Opfer machen. Wenn man einer Konfrontation einmal ausweicht, wird man immer wieder den Kürzeren ziehen, diese in Stein gemeißelte Wahrheit kennt jeder Polizist. Charakter zählt.
»Ich erzähl dir mal eine Geschichte«, sage ich, seine resignierte Miene ignorierend. Er kennt das schon. »Erinnerst du dich, dass ich in der Highschool Baseball gespielt habe?«
»Ja, Second Baseman.«
»Genau. Und es gab da diesen Jungen, der mich die ganze Zeit auf dem Kieker hatte.« Ich muss kurz nachdenken, bevor mir der Name einfällt. »Jimmy Leland. Er hat mich nie in Ruhe gelassen, hat mich Butch Mariola genannt, sobald die Trainer nicht in der Nähe waren. Eines Tages haben wir ein Teamspiel gespielt, und er war auf der First Base und keiner out. Ich decke gerade die Mitte ab, als der Batter – ich weiß nicht mehr, wie er hieß – einen Groundball am Pitcher vorbeischlägt. Der Ball hüpft hoch, direkt in meinen Handschuh, und ich trete auf die Second Base und drehe mich um, um das Double Play zu vollenden. Und Jimmy Leland sollte mir in dem Moment eigentlich aus dem Weg gehen. Er ist bereits out gecallt worden. Aber er versperrt mir den Wurf zur First Base, hat ein breites Grinsen im Gesicht und brüllt: ›Yah, yah, yah, yah‹. Tja, ich werfe den Ball trotzdem und treffe ihn mitten auf der Stirn. Glaub mir, der Idiot ist umgefallen wie ein Baum.«
»Und was ist dann passiert?«
»Dazu komme ich gerade. Jimmy ging es so weit gut, aber der Trainer hat ihn zur Sicherheit in die Notaufnahme geschickt. Und es war egal, dass er mir aus dem Weg hätte gehen sollen, damit ich werfen kann, dass er sich falsch verhalten hatte. Ich wurde aus dem Team geschmissen, und das war das Ende meiner Baseball-Karriere. Verstehst du, Danny? Es hat sich gut angefühlt, den Typen aus dem Weg zu räumen, aber was hat es mir gebracht?«
Das muss man Danny lassen. Er plappert nicht gleich raus, was ihm als Erstes in den Sinn kommt, sondern überlegt erst. »Mom, ich konnte das nicht durchgehen lassen.«
»Das stimmt, aber du hättest warten können, bis ihr allein gewesen wärt. Pastor Grange hat die Macht wie damals mein Trainer. Wenn er dich rausschmeißt, bist du draußen.« Ich lasse das sacken und wechsle dann das Thema. »Ich habe gerade einen Anruf vom Boss bekommen. Ein Mord, draußen im Skyview Motor Court. Wenn ich heute Abend nach Hause komme, erzähle ich dir alles.«
Bei dieser Aussicht hellt sich Dannys Miene auf. Jetzt hat er etwas, mit dem er bei seinen Freunden angeben kann. Ein echter Mord. Er gibt mir einen Kuss auf die Wange – für den Mund ist er anscheinend zu alt –, und ich spute mich.
Die traurige Wahrheit ist, dass Danny das Ergebnis einer Vergewaltigung im Bekanntenkreis ist. Zumindest glaube ich das. Ich habe damals von der Schwangerschaft erst erfahren, nachdem mich wochenlang morgendliche Übelkeit geplagt hatte. Als der Arzt mir die Nachricht verkündete, war ich mehr als nur geschockt. Ich war neunzehn und studierte im ersten Jahr Strafrecht am Southern Illinois Community College. Außerdem war ich überzeugte (auch wenn das nur meinen Eltern bekannt war) Lesbe. Meine Überzeugung entsprang meiner einzigen Erfahrung mit einem Mann, ein wahres Desaster, das zum Verlust meiner Jungfräulichkeit und dem Entschluss führte, dieses Erlebnis niemals zu wiederholen.
Und jetzt … schwanger?
Zwei Monate davor war ich auf einer Party gewesen. Damals trank ich ziemlich viel und zog mir ab und zu etwas Koks rein, wie die meisten Kids in meinem Alter. Als ich im Morgengrauen im Bett aufwachte, dachte ich bloß, ich wäre ohnmächtig geworden. Ich hatte am Abend davor Gin getrunken, gemixt von einem Mann, den ich seit Jahren kannte. Fast so was wie ein Mentor.
Ich würde gern sagen, dass ich Rache genommen hätte, aber in Wirklichkeit konnte ich rein gar nichts tun. Ich konnte nicht beweisen, dass ich betäubt worden war oder dass Kyle Spyros mich vergewaltigt hatte. Und ohne Beweis konnte ich ihn nicht anzeigen. Nein, für mich stellte sich nur eine Frage: abtreiben oder nicht?
Meine Eltern sind gläubige Katholiken, trotzdem akzeptieren sie meine sexuelle Orientierung. So groß ist ihre Liebe. Aber Abtreibung ging zu weit. Viel zu weit. Wir lebten damals in Centralia, einer Kleinstadt mit zwölftausend Einwohnern in der allerkonservativsten südlichen Ecke von Illinois. Unverheiratete Mütter gab es zu viele, um sie geradeheraus zu verdammen, aber Abtreibung war unverzeihlich. Wenn ich mich einem Kind nicht gewachsen gefühlt hätte, hätten meine Eltern die Verantwortung übernommen.
Vielleicht fürchteten sie, ich würde mit Hass auf die aufgezwungene Schwangerschaft reagieren und mein Baby ablehnen. Tatsächlich liebe ich Danny seit dem ersten Tag bedingungslos, auch wenn ich keine besonders gute Mutter wurde. Ich bin eigentlich zu egoistisch und engagiere mich zu sehr für meinen Job, der unregelmäßige Arbeitszeiten mit sich bringt. Im ersten Jahr überließ ich die Kinderbetreuung meinen Eltern, während ich mein Studium zu Ende brachte. Erst nachdem ich den einzigen Job angenommen hatte, der mir angeboten wurde, weit entfernt in Virginia, begriff ich, wie schwer es ist, alleinerziehende Mutter zu sein. Da ist das nie endende schlechte Gewissen darüber, das Kind bei anderen lassen zu müssen, und die große finanzielle Belastung. Man lernt, sich durchzuwursteln, jongliert am Monatsende die Rechnungen, hält ständig die Augen auf nach neuen Chancen. Mein Umzug nach Baxter war rein finanziell motiviert.
Baxter wurde stückweise gebaut, eine Wohngegend nach der anderen, während gleichzeitig immer mehr Fleischverarbeitungsbetriebe entstanden, und schließlich war Baxter Boulevard die einzige Durchfahrtsstraße. Er ist zehn Meilen lang und führt von der südöstlichen Ecke der Stadt in die nordwestliche. In der Mitte stehen ein paar Amtsgebäude, ansonsten wird er vor allem von Einkaufszentren, Gebrauchtwagenhändlern, Tankstellen und Fast-Food-Filialen gesäumt. Leer stehende Läden und verblichene »Zu vermieten«-Schilder sind Zeugen einer Wirtschaft im permanenten Niedergang. Das fing schon an, lange bevor Covid-19 Baxter einholte, aber das Virus war der letzte Sargnagel. Baxter Packing machte dicht und wieder auf, dicht und noch einmal auf. Und das bevor Tests nachwiesen, dass über eintausendachthundert der etwa dreitausend Angestellten infiziert waren. Sie trugen das Virus in jeden Winkel der Stadt, und ich hörte auf, Detective zu sein. Stattdessen verbrachte ich wie alle meine Kollegen die Tage damit, die Notrufe der schwer Erkrankten anzunehmen, die so zahlreich eingingen, dass unser freiwilliges Ambulanzteam heillos überfordert war und wir die Kranken oft auf dem Rücksitz unserer Polizeiwagen in unser kleines Krankenhaus, das Baxter Medical Center, bringen mussten. Jeder Transport fühlte sich ein bisschen wie eine Hinrichtung an. Der Parkplatz stand voller Krankentragen, und





























