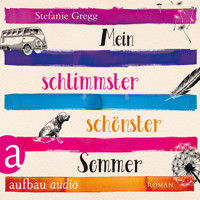9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Schatten des Krieges
- Sprache: Deutsch
Morgen sind wir uns wieder nah.
München, 1985: Als Lilith Robert kennenlernt, weiß sie: Er ist die Liebe ihres Lebens. Doch gezeichnet von den Traumata seiner Kindheit, entgleitet er Lilith immer mehr. Über Jahre verlieren sie sich aus den Augen, bis Robert plötzlich wieder vor ihrer Tür steht. Und mit ihm sein Sohn Aaron. Auch wenn Lilith nie Mutter werden wollte, sieht sie sich plötzlich mit Roberts Bitte konfrontiert, den 13-jährigen Jungen bei sich aufzunehmen. Doch kann sie überhaupt für ein Kind sorgen? Erst als Lilith gemeinsam mit Aaron und Robert eine Reise antritt, versteht sie ihre eigene Vergangenheit ...
Die berührende Geschichte einer Kriegsenkelin, die aus den Schatten der Vergangenheit heraustritt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Als ihr ehemaliger Geliebter Robert plötzlich wieder vor ihrer Tür steht, gerät Liliths Leben aus den gewohnten Bahnen. Denn nicht nur Robert, in den sie sich während ihres Architekturstudiums Hals über Kopf verliebte und den sie seitdem nie wirklich vergessen konnte, tritt zurück in ihr Leben, sondern mit ihm sein Sohn Aaron. Lilith, die selbst nie ein Kind gewollt hat, sieht sich auf einmal mit einem trauernden, 13-jährigen Jungen konfrontiert, den sie nach dem Tod seiner Mutter bei sich aufnehmen soll. Doch wie kann sie einem Kind je das geben, was es braucht, wenn sie selbst nie die Liebe von ihrer Mutter erfahren hat, die sie benötigte? Auf der Suche nach einer Antwort muss Lilith sich gemeinsam mit Robert und Aaron auf eine Reise begeben und sich mit der eigenen Vergangenheit versöhnen.
Über Stefanie Gregg
Stefanie Gregg, geboren 1970 in Erlangen, studierte Philosophie, Kunstgeschichte, Germanistik und Theaterwissenschaften, worin sie auch promovierte. Nach Stationen in Medienunternehmen und als Unternehmensberaterin widmet sich die Autorin dem Schreiben. Mit ihrer Familie wohnt sie in der Nähe von München.
Im Aufbau Taschenbuch sind ihre Romane »Mein schlimmster schöner Sommer«, »Der Sommer der blauen Nächte«, »Nebelkinder« und »Die Stunde der Nebelkinder« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Stefanie Gregg
Die Hoffnung der Nebelkinder
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog — Lilith, München 2017
Teil I
Kapitel 1 — Lilith und Robert, München 1985
Kapitel 2 — Lilith und Robert, München 2017
Kapitel 3 — Lilith und Robert, München 1986
Kapitel 4 — Lilith, München 1988
Kapitel 5 — Lilith, Tobias und Robert, München 1997
Kapitel 6 — Lilith, München 2009
Kapitel 7 — Lilith und Ana, München und Breslau 2017
Kapitel 8 — Lilith, München 2017
Kapitel 9 — Lilith, München 2017
Kapitel 10 — Ana, München 2017
Kapitel 11 — Lilith, Ana und Aaron, München 2017
Kapitel 12 — Lilith und Robert, München 2010
Kapitel 13 — Lilith und Aaron, München 2017
Kapitel 14 — Robert, Lilith und Aaron, München 2017
Teil II
Kapitel 15 — Robert, Lilith und Aaron, Phoenix, Arizona 2017
Teil III
Kapitel 16 — Lilith und Aaron, München 2017
Kapitel 17 — Lilith und Ana, München 2017
Epilog — München 2017
Danke
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine geliebte Tochter Lonny und meinen geliebten Sohn Timon, denen ich ein Leben ohne alte Lasten wünsche.
Prolog
Lilith, München 2017
Sie hatte den Schlüssel in die Wohnungstür gesteckt und zögerte plötzlich. Normalerweise war sie immer gern nach Hause gekommen. Doch was sie jetzt leise, aber klar in sich spürte, war Angst. Angst vor dem Fremden in ihrer Wohnung.
Natürlich nicht wirklich Angst vor dem dreizehnjährigen Jungen dort drinnen. Doch Angst davor, wieder nicht sie selbst sein zu können in ihrem Zuhause. Nicht zu wissen, ob das, was sie zum Abendessen zubereiten würde, richtig für diesen Jungen sei. Angst vor seinem scheuen Blick. Angst davor, mühsam ins Nichts zu sprechen, wo sie doch abends zu Hause so gern schwieg, und doch nichts oder kaum etwas von ihm zurückbekommen würde. Angst, nie mehr sein zu können wie früher, allein, gern mit sich allein, nicht bemüht, ganz gelassen allein, zwanglos. Nie mehr allein.
Das Zögern war deutlich länger, als es hätte sein dürfen. Am liebsten hätte Lilith den Schlüssel noch mal herausgezogen und unten in der Eckkneipe ein Glas Wein getrunken. Oder auch zwei, bevor sie dann in die Höhle des Löwen, der doch höchstens ein scheues Reh war, hineinmarschierte und munter tat.
Aber sie wusste es genau, Aaron hatte den Schlüssel bereits gehört. Er wusste immer, wann sie kam, war nie davon überrascht. Es wäre ihr lieber gewesen, er hätte markerschütternd laute Musik gehört, sie nicht erwartet, so dass sie in sein Zimmer gehen musste, ihn freundlich ermahnen, die Musik ein wenig leiser zu stellen, und er hätte dies mit pubertär-missmutigem Gesichtsausdruck quittiert. So war das doch bei Jugendlichen und ihren Eltern. So war es auf jeden Fall bei ihr und ihrer Mutter Anastasia gewesen. Es hatte ständig Ärger gegeben. Die Musik war zu laut und ihre Kleidung unmöglich – mit Batikbluse und Riesenschal lasse die Mutter sie nicht aus dem Haus. Außerdem solle sie sich lieber an den Schreibtisch setzen und lernen und danach den Müll hinaustragen und den Abendbrottisch decken. Das sei ja wohl das Mindeste, was man erwarten könne, wenn man noch nicht einmal in der Lage sei, seine eigene Wäsche zu waschen. Undsoweiterundsoweiter. Das hätte Lilith wenigstens verstanden. Sich dann durchaus überlegen können, ob man als Eltern ebenso hart durchgreifen müsse oder nicht einfach gemeinsam Musik hören könne. Sie war überzeugt, damit hätte sie irgendwie umgehen können.
Doch hinter der Tür war dieses scheue Reh, das sie erwartete. Lilith wusste nicht einmal, warum er sie erwartete. Weil er sich freute, dass sie kam? Oder weil er sich wappnete, um seine Angst zu besiegen? Oder weil er nichts fühlte? Nichts mehr fühlte, seit seine Mutter gestorben war.
Teil I
Kapitel 1
Lilith und Robert, München 1985
Er faszinierte sie. Seine runde Nickelbrille machte die braunen Augen noch markanter. Augen, die vor Begeisterung blitzten, wenn er von Derrida, Foucault oder Lyotard sprach. Lilith hatte dieses philosophische Seminar zur Postmoderne gewählt, um auch in der Architektur die neuen Baustile umfassend zu verstehen. In ihrem Studium wurden fünf fachfremde Seminare gefordert, um auch einen Überblick über philosophische, gesellschaftliche oder politische Aspekte zu erhalten, die in die Architektur einflossen.
»Die Dadaisten griffen Nietzsches Begriff des bejahenden Lachens auf. Sie begannen alles unter dem Zeichen des Lachens zu sehen, mit Ironie und Humor. Das Leben war nicht mehr ernst zu nehmen. Ebenso wenig die Kunst.«
Sie hörte seine Worte, doch irgendwann verschwommen sie immer so sehr, dass sie nachher noch einmal alles nachlesen musste, um es wirklich zu verstehen. Ob sie vielleicht zu sehr den jungen Dozenten beobachtete, der selbst noch Student war, als seine Inhalte verfolgte? Alle hingen an seinen Lippen. Sein Vortrag war brillant, gewagt, vielleicht manchmal etwas überspitzt. Ob die anderen Studentinnen auch den attraktiven Mann hinter den Worten sahen, wusste Lilith nicht, aber sie glaubte, es den Blicken entnehmen zu können.
»Doch die Entwicklung ging noch einen Schritt weiter. Gab es in der Moderne noch einen Funken Hoffnung – nämlich die Suche nach dem Neuen, nach Sinn, nach dem Einzigartigen und Modernen –, löst sich genau das in der Postmoderne auf. Nichts ist mehr ernst, nichts ist mehr neu. Man kann nur das Alte zitieren, es wiederholen, vielleicht neu zusammenstellen.«
Wenn sie gut genug waren, durften Studenten aus dem Hauptstudium auch Seminare für die Erstsemester geben. Er war gut. Er war überragend. Seine Arme fuhren durch die Luft, seine Worte waren schnell und treffend. Man musste sich anstrengen, ihm zu folgen. Einige der Seminarbesucher waren bereits abgesprungen, weil ihnen der Stoff zu schwer und Robert Balans Art, hauptsächlich zu dozieren und kaum mit den Studenten ins Gespräch zu gehen, zu anstrengend war.
»Wenn die Unterscheidung zwischen Realem und Irrealem, zwischen Erlebnis und Fiktion unmöglich wird, entsteht ein allumfassendes Lachen als Denkkultur der Postmoderne.«
»Ist die Neue Pinakothek dann aber wirklich ein postmodernes Gebäude?« Lilith sprach spontan das aus, was ihr durch den Kopf ging. »Man sagt doch, es sei das große postmoderne Werk in München. Aber sie greift doch die alten Formelemente auf: Rundbögen, Erker, Säulen, Freitreppen.« Sie hob herausfordernd die Augenbrauen. »Das ist doch sehr ernst. Und die Pinakothek ist auch eingepasst in die Umgebung, sie hat eine ähnliche Höhe wie die Bauten daneben. Wo ist denn da das Lachen, der Humor?«
Balan sah sie an. Er schätzte es nicht, unterbrochen zu werden. Wortmeldungen ignorierte er meist. Und Lilith war ihm auch noch einfach ins Wort gefallen.
»Ah.« Sein Ton war zynisch. »Eine aufsässige Kritikerin moderner Architektur. Sie werfen also der Neuen Pinakothek vor, pathetisch und monumental daherzukommen. Aber haben Sie sich mal die Details angesehen? Es gibt Wasserspeier, die kein Wasser speien. Es ist ein hochmoderner Stahlbau, der dann mit Naturstein verkleidet ist. Das ist Spiel, das ist Ironie, das ist Lachen. Man muss auf die Details achten. Dann erkennen Sie das postmoderne Werk.« Er machte eine kleine Pause und fügte dann mit einem belehrenden und zugleich spöttischen Tonfall hinzu: »Die Subversion liegt oft im Kleinen, nicht im Großen, Schreienden.«
Lilith fühlte sich gemaßregelt. Als ob sie nicht genau genug hingesehen hätte.
Balan blickte auf die Uhr. »Nun kann ich meinen Gedankengang nicht mehr fortführen. Lesen Sie nach. – Und …« Er blickte Lilith an und seine Mundwinkel zuckten nach oben. »Gehen Sie in die Neue Pinakothek. Sehen Sie sie sich von außen und von innen an. Nächste Stunde sprechen wir darüber.«
Oh, er ging auf sie ein. Das hatte er in dieser Form noch nie getan. War das ein zynisches oder ein positives Lächeln gewesen? Vermutlich Ersteres, nächste Stunde würde er sie gänzlich auseinandernehmen. Sie hob den Kopf. Sie würde morgen noch einmal zur Pinakothek gehen, sie würde nachlesen, sie würde gewappnet sein.
Kurz darauf saß sie in der Cafeteria und blätterte in ihren Unterlagen, als sie plötzlich einen Espresso sah, den ihr jemand hinschob. Robert Balan setzte sich ihr gegenüber auf einen Stuhl und stellte eine zweite Tasse vor sich. »Der Kaffee ist ungenießbar hier. Der Espresso ist nicht viel, aber ein wenig besser.«
Lilith nahm einen Schluck. »Wirklich nicht viel besser.«
Er kniff die Augen zusammen. Es schien ihn zu ärgern, dass sie nicht höflich abwehrte, er sei gut, und sich dafür bei ihm bedankte.
»Das ist richtig.« Er stand auf. »Dann werden wir beide diese Brühe hier nicht trinken, und ich zeige Ihnen, wo es den besten Espresso Münchens gibt.«
Er ging los. Sie folgte ihm.
»Robert«, sagte er, als sie an seiner Seite war.
»Lilith«, antwortete sie.
Bis sie in einem kleinen Café in der Ludwigstraße saßen, waren dies ihre einzigen Worte.
Hier standen dunkle Holzstühle und Tische auf dem alten Parkett mit seinen langen Dielen, die davon erzählten, dass bereits Generationen von Studenten an diesem Ort ihren Kaffee getrunken und philosophiert hatten. Alte Wandleuchten warfen ein warmes Licht auf die dunkelgelben Wände. Leise Gespräche ergaben ein Gesumm von Worten.
»Dieser ist gut.« Lilith lächelte nach ihrem ersten Schluck des Espresso, den er ihr bestellt hatte.
Er sah sie an. »Du gefällst mir.«
*
Ein Geräusch, das wie ein Fiepsen durch die Stuhlreihen ging. Oder wie ein Schreien und Quietschen. Undefinierbar. Nicht sehr laut. Aber doch deutlich hörbar.
Robert hielt in seinem Vortrag inne und lauschte kurz. »Wenn jemand das komisch findet, solche Laute zu machen, soll er bitte mein Seminar verlassen.« Er fuhr fort, als diesmal deutlich lauter ein fiepsender Schrei ertönte. »Wollen Sie mich provozieren?« Sein Blick schwankte zwischen Verwunderung und Empörung. »Keiner muss dieses Seminar belegen. Wer hier rumzischt, anstatt zu sprechen, soll gehen.«
Wieder ertönte das Geräusch und man sah, dass Robert wütend wurde.
»Entschuldigung«, sagte Lilith kleinlaut. »Ich bin es.«
Robert sah sie an, als ob sie die Allerletzte sei, von der er eine Störung seines Seminars erwartet hätte.
»Ich kann ihn keine zwei Stunden allein lassen.«
Nun wandten sich alle Blicke zu ihr und den unter dem Tisch versteckten Armen. Sie hob die Hände hoch und die anderen versuchten zu erkennen, was sie in den Armen trug. Robert ging ein paar Schritte vor und besah sich das zusammengerollte Fellbündel. Lilith wickelte das Tierchen auseinander und zeigte sein winziges Gesicht.
»Eine Katze«, stellte Robert fest.
Der Körper war schwarz, alle vier Pfoten weiß und ein heller Fleck auf der Brust. Schon jetzt ein wunderschönes Tier. Aber winzig, eher einem Hamster gleichend als einer Katze.
Robert schüttelte den Kopf. »Diese ist kaum eine Woche alt. Die gehört zu ihrer Mutter und nicht in einen Seminarraum.« Er schien empört, dass man solch ein Tier wie ein Spielzeug mitnahm.
»Die Mutter hat sie verstoßen. Vielleicht hatte sie zu viele Junge. Und der Bauer wollte sie ertränken. – Aber jetzt nimmt sie die Milch nicht.« Lilith hob eine kleine Flasche hoch.
Er nahm die Flasche und fühlte an ihr. »Die ist nicht warm genug. Sie nehmen die Flasche jetzt bitte irgendwo an Ihren Körper und wärmen sie.«
Im Seminarraum war er wieder zum offiziellen ›Sie‹ zurückgekehrt.
Dann nahm er Lilith den Winzling aus der Hand. »Und außerdem ist es hier zu kalt für dieses Kätzchen.«
Er barg das Tierchen unter seinem Sakko, um es warm zu halten, und begann, seinen Vortrag fortzuführen, wobei er sich nun leicht von einem Fuß auf den anderen wiegend durch den Raum bewegte, was alle mit Verwunderung quittierten. Es wurde still. Kein Maunzen mehr. Lilith schob sich die Flasche, die an der Morgenluft draußen erkaltet war, nachdem sie sie zu Hause gewärmt hatte, unter ihren Pulli.
Sie fühlte sich erleichtert. Die ganze Nacht bereits und spätestens die letzten zehn Minuten war sie sich verzweifelt bewusst geworden, dass die Spontanhandlung, dieses Neugeborene einfach von ihrem Wochenendausflug in den Bergen mitzunehmen, ein großer Unsinn gewesen war. Sie hatte sich zu viel zugemutet. Offenbar war der Kleine im warmen Dunkel von Roberts gemütlicher Jacke immerhin wieder eingeschlafen.
Als ob nichts gewesen wäre, beendete er seine Stunde wie immer. Als die anderen Lilith umringen wollten, scheuchte er sie mit einer Handbewegung fort und gab ihr das immer noch schlafende Kätzchen zurück. Sobald sie ihm nun das gewärmte Fläschchen an den Mund hielt, begann ein schmatzendes Saugen. Die Pfoten umfassten die kleine Flasche.
Robert und Lilith besahen sich das nun völlig zufriedene Wesen.
»Es braucht einen Korb oder eine Tasche zum Herumtragen. Damit es sich geborgen und wohl fühlt. Und nur warme Milch.«
»Oh, du weißt viel über Katzen.«
»Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Neben uns war ein Bauernhof. Ich bin fast täglich hinübergegangen.« Er sah sie ernst an. »Und ich habe mehrfach kleine Katzen gerettet, denn der Bauer wollte nicht zu viele haben und hat sie erschlagen. Ich habe sie aufgezogen, heimlich im Schuppen, denn zu Hause durfte ich kein Tier haben. Dann habe ich versucht, sie an meine Freunde und deren Familien zu verschenken.«
»Schön.« Sie wusste nichts anderes zu sagen, denn diese Tierliebe hätte sie ihm, dem Intellektuellen, nicht zugetraut.
Auch wenn sie sich nachher ärgerte, nicht mehr als dieses ›Schön‹ herausgebracht zu haben, nickte sie jetzt nur und blieb sitzen, bis der Kleine wieder in einen satten, ermatteten Schlaf fiel.
»Ich muss gehen.« Robert sah auf seine Uhr. »Aber morgen bin ich nachmittags in der Nähe des Westparks. Es ist schön dort. Wollen wir vielleicht einen Spaziergang machen, einen Espresso trinken, oder …« Er sah sie an, ernst, aber auch lächelnd. »… ein Bier trinken, damit wir keinen schlechten Espresso erwischen.«
»Das klingt gut«, antwortete Lilith. »Dort gibt es auch einen guten Steckerlfisch im Biergarten.« Sie versuchte, das Strahlen zu unterdrücken, das sich auf ihrem Gesicht ausbreiten wollte.
»Du kennst dich also nicht nur mit Espresso, sondern auch mit am Stock gebratenen Fischen aus. – Darin bin ich weniger Spezialist.«
»Aber ich. Ich liebe Steckerlfisch zum Bier.« Lilith lachte.
»So, wie du dich mit Philosophie und Architektur auskennst.«
»O danke, das aus deinem Mund zu hören, ist wirklich ein schönes Kompliment.«
»Ist so. Morgen um vier Uhr? Eingang Reulandstraße? Das ist bei der U-Bahn«, schlug er vor.
»Gern.«
Dann drehte er sich um und verließ den Raum. Lilith hatte sein Lächeln sehr wohl gesehen.
*
Sie war eine halbe Stunde zu früh da, drehte aber noch ein paar Runden, um nicht allzu zeitig am verabredeten Ort zu sein. Als sie, immer noch zehn Minuten vor der Zeit, ankam, war er bereits da. Wieder musste sie das Lächeln unterdrücken, das sich ihr unwiederbringlich aufdrängen wollte.
Und genau dies konnte sie auch auf seinem Gesicht erkennen, als sie näher kam. Er schien es jedoch kein bisschen unterdrücken zu wollen, umarmte sie und sagte: »Ich habe mich sehr auf dich gefreut.«
Dann sah er sie an: »Wo ist das Kätzchen?«
»Mein Mitbewohner hat versprochen, ein paar Stunden auf es aufzupassen.«
»Kann er das auch? Man muss ihm den Bauch streicheln nach dem Trinken, die Verdauung funktioniert noch nicht richtig.«
Lilith hatte das nachlesen müssen, aber er schien es zu wissen. »Ich habe es ihm gesagt. Ich denke, er schafft das.«
Nun ließ sie ihrem strahlenden Lächeln freien Lauf.
»Gut«, brummte Robert und fragte dann: »Kennst du den Westpark?«
Lilith fand ihn einfach wundervoll, er war vor wenigen Jahren für die Internationale Gartenbauausstellung angelegt worden. Auch wenn er nicht so groß wie der Englische Garten war, den Lilith so sehr liebte, war er ein wogendes Grün inmitten der Stadt, eine Oase der Ruhe. Anders als der wild wirkende Englische Garten gab es hier neben den Park- und den kleinen Waldflächen auch gestaltete Bereiche. Ob mit Pflanzen, wie den Rosengarten, oder mit kleinen architektonischen Ensembles, die Lilith natürlich sehr interessierten.
»Ja, ich kenne den Westpark. Und ich mag ihn sehr«, antwortete sie Robert.
»Wollen wir erst einen Spaziergang machen, bevor wir zu deinem Steckerlfisch mit Bier kommen?« Freundlich, aber doch auch ein wenig von oben herab blickte er zu ihr. Lilith konnte ihn nicht ganz einordnen. Er war intelligent, trug einen Hauch von Arroganz mit sich und zugleich empfand er eine zärtliche Liebe für Tiere. Er schien ihr ein wenig unergründlich. Aber genau dies gefiel ihr. Langweilige Menschen hatten sie nie interessiert.
»Gut. Wenn ich nachher beides bekomme, mache ich jetzt auch einen Spaziergang.« Sie lachte. »Ich mag den Asien-Teil des Parks. Wollen wir dorthin?«
»Ah. Schon wieder Begeisterung für Gebäude?«
»Ja, immer. Ich studiere Architektur«, erklärte Lilith.
»Ich dachte Philosophie. Was machst du dann in meinem Seminar?«
»Fachfremd.«
»Oh – und dann widersprichst du mir auch noch?«, spottete er.
»Na ja, es ging um Architektur. Und das ist mein Feld.«
Lilith versuchte, seinen Gesichtsausdruck zu deuten. Als ob er es nicht gewohnt war, dass ihm jemand widersprach und er dies eigentlich auch nicht mochte. Aber irgendwie bei ihr doch. Wertschätzung lag in seinem Blick.
»So, was sagt die Frau Architektin zu dieser Pagode?«, fragte Robert wenig später, als sie vor dem bunten Tempel standen, der sich malerisch im Teich spiegelte.
»Im Ostasien-Ensemble des Parks sind verschiedene Gebäude nachgebaut. Man kann hier quasi durch ganz Asien reisen. Es gibt die Nepalpagode, einen chinesischen und einen japanischen Garten. Wir stehen hier vor einem Thai-Heiligtum. Es gibt Thailänder, die die Buddhastatue darin anbeten, hat mir zumindest mal jemand erzählt.«
Wieder sah er sie mit diesem Blick an – aufmerksam, aber immer auch ein wenig spöttisch –, den sie später den »Robert-Blick« nannte.
»Auf jeden Fall ist das eine sehr schöne Geschichte«, stimmte er zu. »Obwohl es nicht allzu viele Thais in München gibt.«
Lilith zuckte mit den Schultern und ging weiter. »Also langsam bekomme ich einen riesigen Hunger. Und Durst!«
Robert blieb kurz stehen und rief ihr hinterher: »Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt: Du gefällst mir.«
Sie wartete, bis er sie eingeholt hatte. »Na, du missfällst mir nun auch nicht vollständig.«
Er lachte laut. »Für ein Erstsemester bist du nahezu unverschämt.«
Lilith nahm das achselzuckend als Kompliment hin.
Als sie am Steckerlfisch-Stand waren und Lilith ihren Geldbeutel hervorholen wollte, winkte Robert ab. »Ich zahle.«
Lilith glaubte gesehen zu haben, dass seine Augen kurz zuvor zum Preisschild gewandert waren. Sie hatte das unbestimmte Gefühl, dass er sich normalerweise hier keinen Fisch geleistet hätte.
Sie sah ihn an. »Ich zahle meine Sachen selbst.«
»Kommt nicht infrage. Ich zahle für uns beide.« Alles andere schien ihn in seiner Ehre zu kränken.
»Robert. Diesmal gern, aber ich sage dir, falls du jemals wieder mit mir ausgehen willst, zahle ich.«
Er sah sie eine Weile an. Dann sagte er: »Das passt mir nicht. Aber ich fürchte, ich möchte noch öfter mit dir ausgehen.«
Lilith wusste, dass es ihm wirklich nicht passte, dass er sie gern immer eingeladen hätte. Aber ihr Gefühl blieb, dass er um jede Mark bangte.
Auch nach Steckerlfisch und Bier blieben sie noch lange sitzen. Ihr Gespräch flog von soeben gelesenen Büchern und Anekdoten über andere Studenten, Freundinnen und Freunde bis zu Traumreisezielen. Es war, als wollten sie miteinander die ganze Welt ausdiskutieren.
»Magst du noch ein Bier?«
Lilith schüttelte den Kopf. »Mir wird auch langsam kühl.«
Er stand auf und legte ihr seine Jacke um die Schultern.
»Na, dann gehen wir.«
Es fühlte sich gut an, fest in seine Jacke gewickelt, von ihm bis zur U-Bahn begleitet zu werden.
Als sie sich verabschiedete, zog sie die Jacke aus und streckte sie ihm entgegen. Doch er schüttelte den Kopf. »Es ist kalt geworden. Behalte die Jacke an, und gib sie mir, wenn wir uns das nächste Mal sehen.«
»Gut«, sagte sie. Und beide wussten, dass dies eine weitere Verabredung war.
»Morgen?«, fragte er.
Lilith lachte. »Warum nicht.«
*
Lilith wachte durch das Klopfen an ihrer Zimmertür auf, das sie offenbar aus einem tiefen Schlaf gerissen hatte. »Ja?«
Die Tür ging auf, und Robert erschien. Jemand aus der WG musste ihm die Wohnungstür geöffnet und den Weg zu ihrem Zimmer gezeigt haben. Schnell versuchte sie sich aufzurappeln und mit einer Handbewegung ihre sicher wirr vom Kopf stehenden Haare zu glätten.
Er sah sie nur mit einem streifenden Blick an, bückte sich dann zu ihrer auf dem Boden liegenden Matratze und nahm das kleine Kätzchen in die Hand, das leise maunzte, wie Lilith erst jetzt bemerkte.
»Sie hat Hunger.« Ein kleiner Vorwurf lag in seinem Ton, dass sie sich nicht darum gekümmert hatte.
»Ich schlafe nun seit zwei Tagen nicht mehr«, erklärte Lilith müde. Sie fütterte die Katze und massierte das Bäuchlein. Das Kätzchen trank zu wenig, deswegen wollte es immer öfter trinken. Lilith war fix und fertig und hatte deswegen heute nicht einmal Roberts Seminar besucht. Er musste direkt nach dem Seminar, das um siebzehn Uhr endete, zu ihr gekommen sein. Woher wusste er überhaupt, wo sie wohnte? Ach ja, er hatte die Anmeldelisten.
»Es ist keine ›sie‹, es ist ein ›er‹«, sagte sie, als ob das gerade wichtig war. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht sortieren, sie fühlte sich wie gerädert, es konnten kaum zehn Minuten gewesen sein, die sie geschlafen hatte.
»Und er heißt Charleston«, fügte sie hinzu.
Sie hatte den Kater Charleston genannt wegen seiner weißen Pfoten und seines schwarzen Körpers. Nach dem Tanz der Zwanziger, der Golden Twenties, bei dem die Männer gerne weiße Handschuhe und weiße Schuhe trugen.
»Wo ist das Fläschchen und die Milch?«, fragte Robert.
»In der Küche«, antwortete sie.
»Schlaf ruhig«, sagte er, bevor er zur Küche ging.
Nein, das sollte sie auf keinen Fall, wenn der Mann zu ihr nach Hause kam, an den sie die ganze Zeit denken musste. Sie sah durch den halb heruntergelassenen Rollladen, dass es langsam Abend wurde. Ob er mit ihr heute noch weggehen würde? Sie wollte nur kurz die Augen schließen, solange er die Milchflasche wärmte, dann würde sie aufstehen und sich zurechtmachen. Robert war bei ihr, wie schön. Sie drehte sich auf die Seite und kuschelte sich unter die Decke.
*
Es war früher Morgen, als sie aufwachte, weil Robert ihr den kleinen Kater in den Arm drückte. Robert saß neben ihr und hatte sie wohl die ganze Zeit angesehen. Und sie hatte diese Zeit verschlafen wie ein Stein. Obwohl der Mann, der ihr so gut gefiel, die ganze Nacht bei ihr verbracht hatte. Sie versuchte, sich schnell den Schlaf aus den Augen zu reiben.
»Ich muss zur Uni«, sagte er leise. »Charleston ist satt, hat die ganze Nacht alle zwei Stunden und soeben ein ganzes Fläschchen getrunken. Er schläft mindestens noch zwei Stunden. Schlaf du auch weiter.« Mit einer sanften, liebevollen Geste strich er ihr über die Wange.
Lilith sah ihm kurz nach, als er die Tür schloss, und spürte ein Gefühl von Dankbarkeit. Sekunden danach schlief sie wieder ein und fühlte sich so ausgeschlafen wie seit ewigen Zeiten nicht mehr, als sie Stunden später wieder das Maunzen hörte. Sie spürte, wie der Kleine an ihrem Ohr knabberte und saugte. Sie streichelte ihn. »Jetzt habe ich wieder Kraft für dich. Wir kriegen das schon hin.«
*
Robert nahm ihre Hand, als ob er ihr den steinigen Abhang hinunterhelfen wollte. Dabei war Lilith, die oft genug in den Bergen gewesen war, mit ihren Wanderschuhen viel trittsicherer als er, der mit seinen Turnschuhen manchmal über das Geröll rutschte und dessen gewohnte Umgebung doch der Schreibtisch war. Er ließ ihre Hand nicht mehr los, obwohl der Weg danach so flach wurde, dass es dafür keinen Grund mehr gab.
Er schwieg, während er vorher gesprochen hatte wie ein Wasserfall. Unbedingt hatte er ihr diese Stelle zeigen wollen, eine Brücke über die Mangfall. »Einen magischen Ort« hatte er ihn genannt, grauenhaft und wundervoll. Mit ihrem grünen R4 waren sie an eine Stelle nahe der Mangfall gefahren, wo er sie hinlotste. Sie stiegen aus und folgten einem Weg in den Wald hinein, der zu einer kleinen Kapelle führte. »Sie ist im 17. Jahrhundert erbaut worden und heißt Sankt-Leonhard-Kapelle.« Lilith besah sich den Bau mit seinem hohen Spitzdach und dem kleinen Turm mit Zwiebelkuppel. Das schmale Bauwerk passte sich in die Landschaft ein, schmiegte sich zwischen Bäume und Wiese.
»Sankt Leonhard war ein fränkischer Adeliger, der später als Eremit lebte. Er predigte für Kranke und Hilfsbedürftige. Man erzählt, durch seine Gebete seien die Ketten der Gefangenen zersprungen.« Roberts Augen leuchteten. Er war in seinem Element. Historie, Legenden, Leben. »Ein Mensch, der sich allen Gütern versagte. Er hatte mehr als genug davon, um für andere zu leben.«
Lilith antwortete nicht. Sie genoss Roberts Begeisterung. Als sie weiterliefen, sah er plötzlich in den Himmel. »Ein Rotmilan.« Er zeigte hinauf. Lilith hatte keine Ahnung von Vögeln, mochte aber das majestätische Segeln dieses Exemplar.
»Man erkennt ihn am gegabelten, rotbraunen Schweif«, erklärte Robert.
Und tatsächlich sah Lilith ein wenig Rot am Himmel aufblitzen.
Sie liefen weiter in den Wald hinein und Lilith verspürte immer deutlicher ihre Aufregung. Roberts Worte rissen sie mit, sein Interesse an allem, ob Geschichte, Bauten oder die Natur mit ihren Tieren. Nicht nur seine Worte gefielen ihr, es war sein Enthusiasmus, seine Ausstrahlung, sein ganzes Wesen.
Ein schmaler Weg führte zu dem, was er ihr zeigen wollte. »Jetzt kommt das Schreckliche. Die Todesbrücke über die Mangfall. Die Selbstmörderbrücke nennen sie die Menschen, die hier leben«, sagte Robert nun leise. »Eine Brücke, von der jene springen, die keine Hoffnung mehr haben, die nur noch Sehnsucht spüren nach dem grünen Wasser, das tief, sehr tief unten fließt. Sie ist wirklich nichts Schönes, viel zu grausam, und doch großartig in ihrer brutalen Ästhetik. Kein Ziel für ein romantisches Date.« Sanft lächelte er sie an.
Und dennoch: Schönheit, Ästhetik, Schicksal, Abgrund. Es lag etwas Magisches in den Worten, etwas wie Bestimmung. Es war trotz allem der einzig richtige Ort für sie beide. Lilith fühlte es. Er wusste es, mochte er es sich eingestehen oder nicht. Vielleicht wollte er lieber an dem Glauben festhalten, ihr nur einen ›magischen Ort‹ zu zeigen.
Als sie die Betonplatten der Brücke betraten, zögerte Lilith einen Moment und erschauderte vor der gradlinigen grausamen Harmonie dieses Bauwerks, durch dessen massive Betonpfeiler in Schüben ein eiskalter Wind sich schob. Was für ein architektonisches Monster.
»Gebaut zum Machtbeweis eines grausamen, kranken Diktators, Beweis seiner Größe und Allmacht. Auf Hitlers Lieblingsstrecke von München nach Salzburg. Symbol der Unendlichkeit des Dritten Reiches«, erklärte Robert.
Lilith blickte hinauf. Beton. Hinunter. Beton. Eine eiskalte Umklammerung. Sie versuchte sich zu retten und ging zur Seite an das Geländer. Doch zwischen den Betonpfeilern und -kreuzen war hinter dem Geländer ein dicker Maschendrahtzaun aufgezogen, wohl um Selbstmörder vom Sprung abzuhalten.
Lilith lehnte sich an die Brüstung und sah hinunter. In schier unendlicher Tiefe unter ihnen floss die Mangfall. Wunderschön. Eigentlich war sie grün oder türkis und wild wie ein Fluss in Frankreich. Doch hier wirkte sie eher braun. Schäumend. Die Mangfall, die zum Schlund wurde. Das Monster stieß einen hinunter.
Robert drehte sich zu ihr um und unterbrach seine Erklärungen, als er ihr Zögern bemerkte. Er lief zurück, bis er nahe vor ihr stehen blieb. Sie war sich ungewiss, was jetzt geschehen würde. Schweigend bewegten sich seine Hände zu ihrem Gesicht, ergriffen die Kapuze ihrer Jacke und zogen sie ihr sanft und liebevoll über die Haare. Sie sah ihm in die Augen, während er die Knöpfe zum Verschließen der Kapuze suchte. Noch ein fürsorgliches Nachrücken der Kapuze, um den kalten Brückenwind von ihr abzuhalten, dann lächelte er sie an und trat einen prüfenden Schritt zurück.
Ihr würde das Monster nun nichts mehr antun können. Seine Geste fühlte sich an, als würde er ihr für immer Sicherheit geben.
Hinter der Brücke gingen sie weiter. Als ob sie nur einen Waldspaziergang unternähmen, erklärte er nichts, fragte sie nicht, ob sie umkehren wolle, und sie folgte ihm ohne ein Wort. Wozu auch? Der Abgrund lag hinter ihnen, vor ihnen der Wald.
Als er ihr die Hand gereicht und sie festgehalten hatte, wusste sie, dass sie diese Hand auch nicht mehr loslassen wollte.
Am Ende des Waldwegs standen sie vor einem Feld, das ein metallener Zaun begrenzte. Sein Arm stütze sich an das Gitter, an dem sie mit dem Rücken stand. Vorsichtig näherte sich ihr sein Gesicht. Sie schloss die Augen und spürte seine Lippen auf ihren, bis sie sich wieder lösten. Er wollte etwas sagen, doch sie legte ihm die Finger auf den Mund und schloss die Augen wieder.
»Du bist eine Sammlerin der Augenblicke«, hörte sie Roberts Stimme sagen und spürte, wie seine Finger sanft ihre Wange entlangstrichen. Und sie wusste, dass er, der ihr vom ersten Moment an in die Seele sehen konnte, damit ihren wahren Namen gefunden hatte.
»Küss mich noch mal«, sagte sie.
Er tat es.
Ein Augenblick zum Sammeln. Sie trank ihn, nahm ihn in sich auf wie nie zuvor. Das weite Feld, der Wald dahinter, Bäume, die sich wiegten, ihre jahrzehntealten Rinden zur Sicherheit anboten. Ein Himmel, glasblau. Seine Lippen, weich und wollend. Ziehend und gebend. Mehr Glück als Lust. Seine Hände, sicher, um sie, eine Haarsträhne über die Schulter streichend. Ein unendlicher Kuss.
Augenblick gesammelt. Es war vielleicht der schönste ihres Lebens.
Er drehte sich um, als ob er flüchten wolle, doch ihre Hand behielt er noch immer in seiner. Sie liefen an einem Baumstamm vorbei, zu dem sie beide nichts sagen mussten, aber lächelten. Der Stamm zeigte verschlungene Formen, Wölbungen, die so eindeutig ein Gesicht mit geöffnetem Mund und zwei großen Brüsten zeigten, dass man nichts anderes sehen konnte als die Wollust, die sich ihnen hier entgegenstreckte.
Dieser Augenblick, soviel war Lilith sich sicher, würde ihr immer bleiben. Und schlagartig wusste sie, dass sie Robert liebte.
Nur der metallene Draht in ihrem Rücken störte das Bild. Einer der Maschendrähte hatte ihr in den Rücken gestochen.
*
Er lag auf der Seite gestützt und zeichnete mit seinem Finger Ringe auf ihrem Bauch.
Sie spürten beide die Lust. Sie hatten immer aufeinander Lust. Doch hier im Englischen Garten waren zwar viele nackt, aber mehr geschah nicht. Wobei, bei Robert wäre alles möglich gewesen.
»Hör auf, oder wir müssen gleich wieder nach Hause gehen …« Sie lachte.
»Okay.« Er sah sie an. Mit diesem intensiven Robert-Blick, den sie so liebte. »Wäre schade um den Weißwein. Den trinken wir noch.« Er holte ihn aus dem Eisbach, wo er ihn zum Kühlen hingestellt hatte. »Bevor wir vielleicht doch zurück nach Hause gehen.« Er goss einen kleinen Schluck auf ihren Bauchnabel und küsste ihn dann fort.
Lilith kicherte. »Könntest du mir bitte noch mal die Sache mit der Neuen Pinakothek erklären?«
»Du willst nur, dass ich aufhöre, Wein aus deinem Bauchnabel zu trinken, damit du auch etwas abbekommst.«
Er küsste sie kurz, aber sanft. Als er sein Gesicht fortzog, hatte sie noch die Augen geschlossen und wollte eigentlich nichts anderes, als weitergeküsst werden. Doch Robert goss nun den Wein in die zwei mitgebrachten Gläser ein, sie ließen die Gläser wie Schampusflöten aneinanderklingen, obwohl es doch nur Senfgläser waren, und tranken einen Schluck.
»Das ist bestimmt wieder ein teurer Wein.« Liliths Stimme war ein wenig vorwurfsvoll. Sie wusste mittlerweile, dass Robert kaum Geld zur Verfügung hatte und er immer sehr sparsam war. Mit Nachhilfestunden für Schüler und Studenten besserte er seine Finanzen auf. Aber er erzählte Lilith oft, wie mühsam es für ihn war, schwachen Schülern das einfachste Basiswissen zu vermitteln. »Vergebene Liebesmüh« nannte er es. Wenn ein Abiturient nicht einmal in der Lage war, grammatikalisch korrekt zu schreiben, ärgerte er sich sehr. Für Robert war diese Arbeit verlorene Zeit, harte Stunden, von denen er wöchentlich einige gab. Offenbar schien er kein Geld oder nur wenig von seinen Eltern zu bekommen. Als Lilith einmal nachgefragt hatte, war ihm die Frage unangenehm und er lenkte ab. Danach fragte sie nicht mehr, sie wollte ihn nicht bloßstellen.
»Bei Wein darf man nicht sparen. Lieber verhungern«, sagte er.
Sie fuhr ihm mit der Hand über die Wange. Er war der verrückteste, der klügste, der wundervollste Mann, der ihr je begegnet war.
»Das ist Unsinn. Hier am Eisbach könntest du mir den billigsten Fusel geben und ich fände ihn dennoch göttlich, solange er nur gekühlt wäre.« Sie widersprach ihm gern. Weil ihm dies nicht gefiel, aber er sie doch gerade deswegen mochte.
»Irgendwann, Lilith, Göttin der Sumerer, werde ich dir die Welt zu Füßen legen und dir ausschließlich Champagner zum Trinken geben.«
»Göttin der Sumerer?«, fragte sie.
»Weißt du denn nicht, wer deinen Namen trug?«
Sie schüttelte den Kopf. »Erzähl es mir.«
Sie legte sich in seinen Schoß und schloss die Augen, damit die Sonne sie nicht blendete.
»Die Sumerer lebten im 3. Jahrtausend vor Christus. Ein stolzes, uraltes Volk, wohl das erste, das eine Hochkultur entwickelte. Sie erfanden die Keilschrift, aus der dann unsere europäischen Schriften hervorgingen. Kluge Menschen. Und Architekten wie du. Sie waren ebenso wohl die Ersten, die eine künstliche Bewässerung erbauten. Deswegen, Lilith, bist du ein Mensch des Wortes und der Architektur.« Seine Finger strichen ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie genoss seine Berührung, ohne dabei die Augen zu öffnen.
»Aber, Lilith, meine Göttin, es gibt immer auch eine Kehrseite der Weisheit. Lilith galt zugleich als Göttin und als ein Dämon. Sie lebte zuerst im Heiligen Weltenbaum. Doch als dieser gespalten wurde, musste sie fliehen. Seitdem ist sie nirgendwo zu Hause, immer auf der Flucht. Die Klügste, die Schönste, aber heimatlos.«
»Das ist aber traurig.« Lilith öffnete ihre Augen.
»Nun. Sie ist ein Luftwesen. Eine Muttergottheit. Eine Schöpfungsgottheit. Sie gibt Leben, sie ist kreativ, sie beschützt. Aber sie ist eben auch ein flüchtiger Windhauch.«
Lilith sah ihm in die Augen. War sie Leben gebend, kreativ, beschützend, ein flüchtiger Windhauch? Irgendwie traf diese Beschreibung auf sie zu, das spürte sie tief in sich. Passt du auf mich auf, Robert?, dachte sie.
»Deine Heimat ist Mesopotamien, das Zweistromland. Das heutige Syrien und der Irak.« Er sah sie ernst an: »Dorthin will ich unbedingt. Ich muss. Mit dir.«
Sie schloss ihre Augen wieder.
*
Durch die Tür und einen Vorhang, der die Geräusche der Außenwelt dämpfte, betraten sie das kleine italienische Restaurant, das Lilith ausgesucht hatte. Höflich hatte Robert ihr wie immer die Tür aufgehalten und den Vortritt gelassen. Auch wenn sie sich nun schon einige Wochen kannten, tat er dies immer. In dem Restaurant gab es kaum zehn Tische. Fast alle waren schon besetzt. Nicht nur sie liebte dieses kleine persönliche Lokal mit den rot karierten Tischdecken und den freundlichen Kellnern. Der Duft von Knoblauch und warmer Pizza stieg ihr in die Nase. Lilith sah einen kleinen Tisch in der Mitte des Restaurants und steuerte darauf zu. Als sie schon im Begriff war, sich zu setzen, hielt Robert sie am Arm auf. »Können wir nicht den Tisch dort hinten nehmen?«
»Der ist aber direkt neben der Toilette.«
»Bitte«, sagte Robert einfach nur.
Lilith zuckte mit den Schultern und setzte sich an den kleinen Tisch in der hintersten Ecke, direkt neben der Toilettentür. Als der Kellner für die Bestellung kam, wussten sie beide gleich, dass sie das Tagesgericht nehmen wollten, Spaghetti Calabrese, mit Tomatensauce und scharfer Salami.
Etwas genervt sah Lilith auf, als ein Mann die Toilettentür öffnete und damit fast an ihren Stuhl heranreichte. Robert tat, als ob er es nicht bemerkt hätte. Beim zweiten Toilettenbesucher musste Lilith dann einfach feststellen: »Der andere Tisch wäre doch besser gewesen.«
»Hm«, brummte Robert.
Es ärgerte Lilith ein klein wenig. Konnte er nicht zugeben, dass seine Wahl die falsche gewesen war?
»Oder etwa nicht?«, hakte sie nach.
»Lilith.« Nun sah er auf. »Ich hasse es, mitten im Raum zu sitzen. Ich kann dann nicht mehr ruhig sein. Ich brauche einfach eine Wand in meinem Rücken und den Blick in den Raum. Entschuldige bitte.«
Sie sah ihn an und schämte sich für ihren Ärger. »Natürlich. Ist kein Problem.«
Robert schenkte ihnen aus der Karaffe Wasser ein. Warum mochte er es nicht, in der Mitte eines Raums zu sitzen?, fragte Lilith sich kurz. Aber sie wollte nicht nachfragen. Es schien ihr, als könne dies die schöne Stimmung verderben. Sie spürte, wie Roberts Hand sich auf ihre legte. Ihre Finger verflochten sich auf der Tischdecke. Der Kellner kam und stellte zwei große Teller mit duftender Pasta vor sie, doch ihre Hände wollten einander nicht loslassen.
»Es wird kalt«, flüsterte Lilith Robert sanft zu.
Da beugte Robert sich über den Tisch und gab ihr einen Kuss. »Jetzt können wir essen.«
*
Liebevoll und sehnsüchtig hatten sie miteinander geschlafen. Doch dann, mitten im Sex, hatte er abgebrochen und sich zurückgezogen. Gerade noch hatte sie vor Lust ihre Hände auf das Bettoberteil gekrallt und gewartet, bis die Flut der Erleichterung und des Glücks sich in ihrem Körper ausbreiten würde. Jetzt tasteten ihre Finger ins Leere.
Sie sah ihn an. Er kniete vor ihr und starrte sie mit einem Blick an, der nicht ihr gelten konnte. Lilith erschrak. »Robert?«
Keine Reaktion, seine Augen starrten weit fort, durch sie hindurch, als ob er ins pure Entsetzen blicken würde.
»Robert!« Sie fasste ihn an den Schultern und er tauchte auf, wie aus einer anderen Welt. Dann drehte er sich um, setzte sich an die Bettkante, stützte das Gesicht in die Hände und begann zu weinen.
Lilith nahm ihn in den Arm, doch sein sich vor Schluchzen schüttelnder Körper schien dies kaum zu bemerken. Sie fühlte sich hilflos, als ob sie nicht an ihn heranreiche, ihn nicht herausholen könnte aus der Hölle, in der er brannte. Als ob er sie nie einlassen wollte in die tief versteckten Höhlen seiner unendlichen Traurigkeit.
Irgendwann hob er den Blick. »Entschuldige.«
Lilith sagte nichts und blickte ihm nur in die Augen, die nun wieder hier waren und sie sehen konnten.
Er legte sich auf das Bett, einen Arm unter dem Kopf. Sie setzte sich neben ihn und streichelte seine Brust.
»Deine Hände. Sie krallten sich um das Holz. Deine Knöchel wurden dabei ganz weiß. Es hat mich an etwas erinnert. Entschuldige.«
»An was denn?«, fragte Lilith verwundert.
»Ach egal.«
»An was?«
Es folgte eine lange Stille, in der sie ihn sanft weiterstreichelte. Beide nackt in diesem Bett, wo gerade noch Lust und Leidenschaft gewesen waren, und dann ein Grauen.
»Mein Vater kam erst 1949 von der Ostfront, aus Russland zurück«, begann er schließlich leise. »›Spätheimkehrer‹ nannte man sie. Voller Wut und Jähzorn war er. Er schrie in der Nacht, weil er wieder träumte.« Roberts Worte standen einzeln, unterbrochen von Stocken, als ob sie noch nie aus seinem Mund gekommen wären. Lilith streichelte ihn weiter, doch es war mehr ein Automatismus. Ihre Konzentration galt allein dem, was Robert ihr erzählte.
»Wenn sich seine Hände plötzlich im Sessel festkrallten, seine Knöchel weiß wurden, dann war dies der Versuch, diese Wut zu beherrschen, aber es gelang ihm nie. Dann brach es aus. Dann knallte eine Hand in mein Gesicht. Oder eine Faust. Einfach so.« Robert hielt inne, als müsse er sich seiner Erinnerung versichern. »Ich habe davor nie etwas gemacht, das ihn geärgert hat. Nichts. Nicht ich war es. Es kam aus seinem Inneren. Als ob er das, was er gesehen und erlebt hatte, auch in mich hineinprügeln müsste.«
Liliths Finger erstarrten auf seiner Brust.
Robert nahm ihre Hand, als müsste er Angst haben, sie zöge sie fort. »Einmal habe ich mich im Bad eingesperrt. Er trat die Tür ein. Und schlug mich dann mit einem Besenstock. Er hat mir das Schienbein gebrochen.«
Lilith legte sich sanft auf ihn, bedeckte ihn mit ihrem nackten Körper, als ob sie ihn in ihre Wärme einhüllen könnte.
»Bis heute ist der Krieg immer auch bei mir. Die Angst, die Gewalt, ich habe sie verinnerlicht, wie mein Vater sie in mich hineingeprügelt hat.«
Roberts Hände fassten ihren Rücken und pressten sie auf sich. Dann drang er ganz langsam in sie ein. Sanft. Liebend. Nicht nehmend, sondern gebend. Brennendes Leben, brennender Tod.
Danach trennten sie sich nicht. Ewig lagen sie so, umarmten sich weiter, mit Armen, die versprachen, sich nie wieder loszulassen.
Erst als es vor der Tür maunzte, stand Robert auf. »Komm rein, Charleston. Hattest du eine aufregende Nacht?«
Der Kater trat erhobenen Hauptes ein und legte sich neben Lilith nieder. Den Tag würde er, wie meist, im Zimmer verbringen, bis er sich in der Nacht wieder auf Abenteuer begeben würde.
»Irgendwelche Mäuse erlegt? Oder hübsche Katzendamen gefunden?«, fragte Robert.
Charleston hob kurz den Kopf, sah Robert an und schloss dann seine Augen.
*
Ihre Wangen glühten noch, als sie aus ihrer Zimmertür trat. Sie hätte auch noch ewig mit Robert auf ihrer Matratze liegen können, die auf dem Boden lag. Ein Studenten-WG-Zimmer eben. Er aber konnte nicht lange liegen. Sie wusste, dass es auch für ihn wundervoll war, mit ihr zu schlafen. Heiß, innig, aber auch magisch, besonders. Danach war er erschöpft, und doch konnte er nicht still bei ihr liegen bleiben. Er übernachtete auch nie bei ihr. Er hatte es ihr erklärt, obwohl es für sie schwer zu verstehen war.
»Wenn ich bei dir bleibe, kann ich die ganze Nacht nicht schlafen.«
»Warum nicht?«, hatte sie gefragt.
»Weil ich die ganze Zeit glaube, dich beschützen zu müssen. Weil ich Angst habe, jemand kommt herein und tut dir etwas an. Weil ich eigentlich nur mit dem Rücken zur Wand schlafen kann, dich dann aber ungeschützt zur Tür liegen lassen müsste.«
»Robert, die Tür ist verschlossen«, hatte sie ihm versichert.
»Eine Tür kann man eintreten.«
Bald danach musste er also immer aufstehen, und heute hatte sie sich ebenso aus dem warmen Bett gerollt. Es war ihr Geburtstag und er hatte ihr ein Geschenk mitgebracht. Bertolt Brecht: Liebesgedichte. Diese wunderschöne kleine Insel-Ausgabe mit dem fast haptischen Einband, der kahle Baumstämme zeigte. Das Büchlein war wundervoll. Der Inhalt war wundervoll. Wie auf einem Schulheft-Aufkleber prangten darauf Autorennamen und Titel. Fast hätte sie geweint, als er es ihr gegeben hatte. Ohne Geschenkpapier, einfach so. Dazu eine Flasche Champagner. Echter Champagner. Bei diesem Geschenk hatte sie sich weniger wohl gefühlt. Wie viele Stunden Nachhilfe hatte er dafür wohl geben müssen?
Das geschenkte Buch bedeutete ihr viel, der Champagner nichts.
In der Mitte der Wohnung gab es einen offenen Raum, den sich die WG als Wohn- und Esszimmer eingerichtet hatte. Ein Sofa, ein Couchtisch. Das Essen musste man also etwas gebückt einnehmen. Doch wen störte das schon? Wichtiger war das Trinken, die Gläser Wein, die man sehr gemütlich auf der Couch zu sich nehmen konnte. Wobei der Balkon langsam voll wurde. Es hatte sich nämlich eingebürgert, dass alle Mitbewohner ihre leeren Flaschen nicht zum Container brachten, sondern einfach auf den großen, an die vier Meter breiten Balkon stellten. Nun passte kaum noch eine Flasche darauf. Wer sich dem wohl annehmen würde?
Lilith ließ sich auf die Couch sinken. Robert war in die Küche gegangen, um Gläser für den Champagner zu holen. Dann hörte sie einen Schrei, beinahe ein Brüllen. Robert stürmte aus der Küche mit einer geöffneten, nur noch halb vollen Flasche Champagner in der Hand.
»Wer war das?«, schrie er wütend, wartete aber nicht auf eine Antwort. Er riss die Tür zu Silkes Zimmer auf. Doch offenbar war keiner darin. Dann Wolfgangs. Der saß, wie meist, am Schreibtisch und arbeitete.
Robert machte kehrt und schrie: »Niels!«
Dessen Tür öffnete sich und Liliths Mitbewohner erschien mit einem halb vollen Glas. »Wollt ihr jetzt auch endlich mal mit mir anstoßen?«