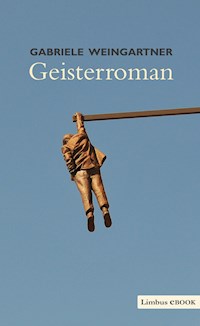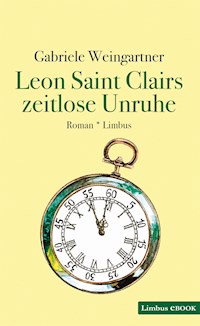Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Limbus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Felice und Ulrich sind ein Liebespaar - sie Studentin, er junger Professor der Freien Universität Berlin, intellektuell versiert, glücklich. Sie verbringen zwei Jahre an der amerikanischen Ostküste, wo der Politologe Ulrich mit einem Stipendium forscht und sie sich in hochkarätigen universitären Kreisen bewegen, wo man Weltpolitik buchstäblich als Konstruktion begreift. Dann jedoch geschieht etwas, was Ulrichs Leben für immer verändert. In einer unaufhaltsamen Abwärtsspirale trudelt er der Katastrophe entgegen und setzt seinem Leben schließlich ein Ende. Felice bleibt als vergeblich Fragende und dann radikal Vergessende zurück, bis Jahrzehnte später eine Kiste mit Schriftstücken sie zwingt, in die Vergangenheit, nach New York und Boston zurückzureisen, um herauszufinden, warum und wohin Ulrich damals verloren ging. Was hatte es mit den Hunden im Souterrain auf sich, die Ulrich so besessen in Schach halten wollte? Führte Ulrich ein Doppelleben? Wer wusste mehr als Felice, damals in jenen fernen, traumverlorenen Zeiten, als man sich in Ironie erging und sich das Leben mit literarischen Zitaten schöner färbte?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Weingartner
Die Hunde im Souterrain
Roman
Fiktion entsteht aus Realität, Literatur aus Leben, Romanfiguren aus realen Personen – aber nicht alles hat so stattgefunden wie hier geschildert; nicht jede Figur entspricht tatsächlich einer Person der Zeitgeschichte.
1
Ist Ironie männlich oder weiblich? Unsere Ironie war geschlechtsneutral, dachte Felice, die irgendwann am Ende ihrer Pubertät begonnen hatte, ihren wahren Vornamen zu verleugnen. Die Ironie war unser Heiratsversprechen. Wichtiger als Treue oder Loyalität. Und ohne dass wir dieses Wort zu häufig in den Mund genommen hätten. Klaus Manns Mephisto zum Beispiel verachteten wir. In der Präsenzbibliothek des Goethe-Instituts in Boston konnte man den Roman damals lesen, trotz des Verbots. Ulrich und ich aber vermissten die Ironie in diesem zerfledderten, offensichtlich durch viele Hände gegangenen Band eines Münchner Verlages. Wir merkten, dass Klaus Mann alles tat, um so etwas wie Ironie zu vermeiden. Wahrscheinlich hat er die distanzierte Attitüde seines Vaters gehasst, die uns so gefiel. Sie war eines der bevorzugten Gesprächsthemen unserer Frühzeit, als wir uns selbst noch einbeziehen konnten in diese kunstvoll gewahrte Entfernung von der übrigen Welt. Und nicht der Meinung waren, dass deren Unglück uns gleichzumachen begann.
Wir delektierten uns an den Schälmesserchen, mit denen sich die Freundinnen von Potiphars Frau in die Finger schnitten, als sie ihnen den jungen und schönen Joseph zum ersten Mal präsentierte. Wir liebten die Art, wie der durchtriebene Zweitjüngste mit seinen groben Brüdern in Sinnbildern sprach und seinen Vater mit Schmeicheleien bei Laune hielt. Wir lasen uns die Stellen vor, die wir besonders schätzten. Abends im Bett. Sonntagnachmittags auf dem Balkon. Manchmal sogar an Werktagen, im Botanischen Garten, auf irgendeiner Bank in der Nähe des Palmenhauses, während uns die Kohlweißlinge umflatterten. Settembrinis Streitgespräche mit Naphta, die wir auf ihren Sinn und ihren Unsinn abzuklopfen wagten. Imma Spoelmanns spitzzüngige Dialoge mit Klaus Heinrich, dem – zugegeben – allzu hölzernen Prinzen aus Königliche Hoheit. So wie Imma, die ja nur vermeintlich kaltschnäuzige Kapitalistentochter, wären wir gerne gewesen, so waren wir bisweilen. Ironie ließ sich nicht steigern, damals. Sie war unser Lebensgefühl, solange wir uns liebten. Unser Pfeifen im Wald, als wir uns verloren gaben.
Und nun hatte Felice es mit einer Spottdrossel zu tun. In der Kopie eines Mies-van-der-Rohe-Sessels sitzend, in Sues kleiner Wohnung in Brooklyn, vor knapp einer halben Stunde abgesetzt von einem Taxifahrer, der sie von Newark hergebracht hatte, mit ihrem Trinkgeld nicht zufrieden und wütend auf sie gewesen war, weil er im Stau auf der Verrazano-Bridge zu viel Zeit verloren hatte. Sue, wie sie schon seit Langem hieß, war so schlau gewesen, ihren Schlüssel bei Nachbarn abzugeben, die ihn erst herausrückten, als Felice das Codewort nannte: Library. Aber sie halfen ihr auch, ihren uralten Koffer, dessen Rollmechanismus klapperte, über die Straße und die Treppe hinaufzuschleppen, während sie ihr versicherten, wie liebenswürdig Sue doch sei. Wie selbstlos sie an Wochenenden die Kinder fremder Leute hüte und sie sogar in ihrem Pool planschen lasse.
Ja, Amerikaner waren freundlich und aufgeschlossen, das hatte Felice schon vor vierzig Jahren so empfunden. Vor dem Frauenmörder, der damals, zur Zeit ihrer Ankunft in Cambridge, die Gegend unsicher machte, wurde sie sofort und in den folgenden Wochen immer wieder von den unterschiedlichsten Leuten gewarnt, telefonisch oder auch einfach über den Gartenzaun hinweg beim unverbindlichen Gespräch, sodass sie sich eine Zeitlang gar nicht mehr aus dem Haus traute. Neighbourhood funktionierte in der Neuen Welt besser als im alten Europa – über Klassenschranken hinweg. Wahrscheinlich hatte Sue sich also gar nicht groß anpassen müssen. Schon früher war sie der Inbegriff von Zielstrebigkeit und Diskretion gewesen, die klassische Einser-Kandidatin, die in beängstigender Schnelligkeit ihr Studium absolvierte, während ihre Kommilitonen lieber demonstrieren gingen. Als Felice sie in einem der sterbenslangweiligen Bibliografierkurse kennenlernte, die sie während ihrer Ausbildung über sich ergehen lassen musste, hatte sich Sue dem Gleichmaß und den bürokratischen Abläufen ihres staatlich reglementierten Studiums bereits vollständig unterworfen, sie wehrte sich nie. Selbst ihr Hasch-Konsum fand nur am Wochenende statt. Vermutlich aber mussten Bibliothekarinnen so ticken: Sie gehen kein Risiko ein, sie wollen den Überblick behalten. Wobei Sue es immerhin bis nach New York geschafft hatte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!