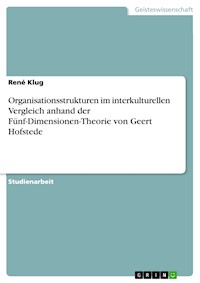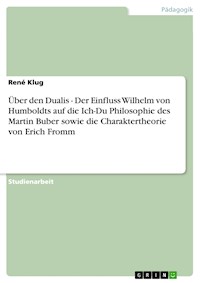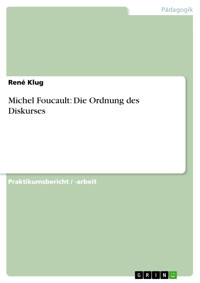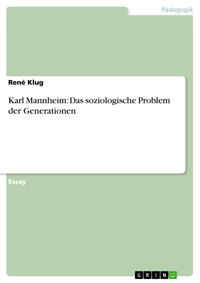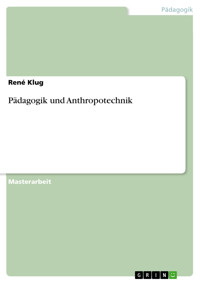Die Illusion der Chancengleichheit: Pierre Bourdieus These vom „Mythos der befreienden Schule“ im Spiegel von PISA 2000 E-Book
René Klug
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Pädagogik - Wissenschaftstheorie, Anthropologie, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum (Institut für Pädagogik), Veranstaltung: Bildungssystem und Soziale Ungleichheit, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich mit den Analysen des französischen Soziologen, Kulturphilosophen und Zeitkritikers Pierre Bourdieu. Ziel soll es dabei sein, seine hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren aufgestellten Thesen zum Thema soziale Ungleichheit im (französischen) Bildungswesen darzustellen, um diese in einem nächsten Schritt auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland zu beziehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht damit die Frage, ob – und falls ja, auf welche Art und Weise – sich die im eingangs erwähnten Zitat beschriebene soziale Selektivität des Bildungssystems mithilfe der Terminologie Bourdieus im Einzelnen beschreiben und belegen lässt. Ausgehend von einigen kurzen biographischen Notizen zum Werdegang und Schaffen Bourdieus gilt es demnach zunächst die zentralen Begrifflichkeiten zu nennen sowie im Detail zu erläutern, welche für die nachfolgenden Analysen von Bedeutung sein werden. Im Einzelnen sind dies die Begriffe des Habitus sowie des Kapitals (und seiner spezifischen Formen). Im Anschluss daran werden diese Begriffe in den Kontext von Bourdieus Untersuchungen zur Selektivität des französischen Bildungssystems der 60er Jahre zurückgebunden um somit die Mechanismen aufzeigen zu können, mittels derer nach Bourdieu die Schule eine herrschaftssichernde bzw. den gesellschaftlichen Status quo aufrechterhaltende Funktion ausübt. Im Folgenden richtet sich der Fokus dieser Arbeit dann auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland. Als Diagnoseinstrument dient hierbei die internationale Vergleichsstudie PISA 2000, deren zentrale Ergebnisse vorgestellt werden, um diese schließlich mit den Analysen Bourdieus in Verbindung zu bringen sowie einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Abschließen wird die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Pierre Bourdieus These vom
„Mythos der befreienden Schule“
im Spiegel von PISA 2000
Page 2
1. Einleitung
„Die soziale Selektivität des Bildungssystems ist vielfach beschrieben und belegt. Trotz aller Reformbemühungen der vergangenen Jahrzehnte ist die Chance, einen qualifizierten Bildungsabschluss zu erlangen, in nach wie vor hohem Maß abhängig von der sozialen Herkunft.”1
Diese Arbeit befasst sich mit den Analysen des französischen Soziologen, Kulturphilosophen und Zeitkritikers Pierre Bourdieu. Ziel soll es dabei sein, seine hauptsächlich in den 60er und 70er Jahren aufgestellten Thesen zum Thema soziale Ungleichheit im (französischen) Bildungswesen darzustellen, um diese in einem nächsten Schritt auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland zu beziehen. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht damit die Frage, ob - und falls ja, auf welche Art und Weise - sich die im eingangs erwähnten Zitat beschriebene soziale Selektivität des Bildungssystems mithilfe der Terminologie Bourdieus im Einzelnen beschreiben und belegen lässt.
Ausgehend von einigen kurzen biographischen Notizen zum Werdegang und Schaffen Bourdieus gilt es demnach zunächst die zentralen Begrifflichkeiten zu nennen sowie im Detail zu erläutern, welche für die nachfolgenden Analysen von Bedeutung sein werden. Im Einzelnen sind dies die Begriffe desHabitussowie desKapitals(und seiner spezifischen Formen). Im Anschluss daran werden diese Begriffe in den Kontext von Bourdieus Untersuchungen zur Selektivität des französischen Bildungssystems der 60er Jahre zurückgebunden um somit die Mechanismen aufzeigen zu können, mittels derer nach Bourdieu die Schule eine herrschaftssichernde bzw. den gesellschaftlichen Status quo aufrechterhaltende Funktion ausübt. Im Folgenden richtet sich der Fokus dieser Arbeit dann auf das gegenwärtige Bildungssystem in Deutschland. Als Diagnoseinstrument dient hierbei die internationale Vergleichsstudie PISA 2000, deren zentrale Ergebnisse vorgestellt werden, um diese schließlich mit den Analysen Bourdieus in Verbindung zu bringen sowie einer kritischen Überprüfung zu unterziehen. Abschließen wird die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse.
1Dravenau, Daniel/ Groh-Samberg, Olaf: Bildungsbenachteiligung als Institutioneneffekt. Zur Verschränkung kultureller und institutioneller Diskriminierung. In: Berger, Peter A./ Kahlert, Heike (Hrsg.): Institutionalisierte Ungleichheiten. Wie das Bildungswesen Chancen blockiert. Weinheim -München 2005. S. 103.
Page 3
2. Pierre Bourdieu - Eine kurze biographische Notiz
Pierre Bourdieu wird am 01.08.1930 in Denguin im Béarn (Pyrénées Atlantiques) geboren. Während seinem 1950 in Paris begonnenem Studium schreibt er sich an der Faculté des Lettres ein und bewirbt sich gleichzeitig an einer der renommiertesten französischen Bildungseinrichtungen, der Ecole Normale Supérieure, wo er 1954 die Agrégation in Philosophie erwirbt. Nach einer zweijährigen Tätigkeit als Gymnasiallehrer am Lycée de Moulins qualifiziert er sich als Assistent an der Faculté des Lettres von 1958 bis 1960 in Algier für die Forschung. 1964 wird Bourdieu zum Pro-fessor für Kultursoziologie an der Ecole Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales ernannt, 1968 zum Direktor des Centre de Sociologie Européenne in Paris. 1982 wird er schließlich an das Collège de France berufen, bevor er am 23.01.2002 im Alter von 71 Jahren in Paris stirbt.