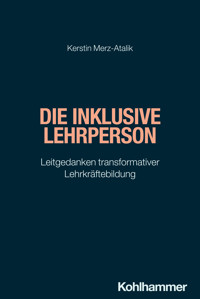
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Zwischen den internationalen Empfehlungen globaler Akteure zur inklusiven Lehrerbildung und der Wirklichkeit deutscher Lehramtsstudiengänge herrscht eine erhebliche Diskrepanz. Ein Blick über den nationalen Tellerrand auf ausgewählte inklusionsorientierte Lehrerbildungsmodelle und -konzepte im (inter)nationalen Raum macht deutlich, dass es in den meisten Bundesländern Deutschlands bislang an einer konsequenten Steuerung und Umsetzung einer Reform der segregationsorientierten Lehrerbildung mangelt. Auf Basis von aktuellen Forschungserkenntnissen zeigt das Buch den Professionalisierungsbedarf für eine inklusive Praxis auf und präsentiert ausgewählte Praktiken für die Initiierung und Vermittlung von inklusiven Werten, Haltungen und einer inklusiven Pädagogik und Didaktik. Damit gibt das Buch Impulse für eine zunehmende Professionalisierung von inklusiven Lehrpersonen, damit der Anspruch auf inklusive Bildung der Lernenden auch in Deutschland besser eingelöst wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titelei
Vorwort von Barbara Wenders und Reinhard Stähling
Lehrer*innenbildung an und für (inklusive) Reformschulen
1 Einleitung
2 Inklusive Bildung und Pädagogik der Vielfalt als Transformationsimpulse
2.1 Inklusionsverständnisse und die Verwendung des Inklusionsbegriffs
2.2 Was ist als ›inklusive Bildung‹ zu verstehen?
2.3 Inklusion als kulturpolitischer (Transformations-)Prozess
2.4 Wissenschaftliche Erkenntnisse zur inklusiven Bildung
3 Kontexte der Lehrer*innenbildung für Inklusion international
3.1 (Inter-)nationale Verpflichtungen und Erklärungen
3.1.1 Das Menschenrecht auf diskriminierungsfreie Bildung (CRC, UN, 1989)
3.1.2 Das Menschenrecht auf inklusive Bildung (UNCRPD: UN, 2006)
3.1.3 Inklusive Bildung als Ziel für nachhaltige Entwicklung bis 2030 (SDG: UN, 2015)
3.1.4 Transformationsimpulse zur inklusiven (Lehrer*innen-)Bildung (UNESCO)
3.1.5 Inklusive Lehrer*innenbildung in Programmen der OECD
3.1.6 Das Projekt TE4i (European Agency for Special Needs and Inclusive Education)
3.2 Die Entwicklung inklusiver Bildung in Deutschland im internationalen und nationalen Vergleich
4 Transformationsimpulse zur Lehrer*innenbildung für Inklusion (in Deutschland)
4.1 Pioniere und bundesweite Vorläufer (vor 2006)
4.2 Transformationsimpulse durch Akteure der Makroebene
4.2.1 Hoffnungen und Aktivitäten infolge der Ratifizierung der UNCRPD (2009)
4.2.2 Aktivitäten auf Ebene der Kultusministerkonferenz (KMK)
4.2.3 Gemeinsame Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) und der Kultusministerkonferenz (KMK) (2015)
4.2.4 Qualitätsoffensive Lehrerbildung (BMBF 2014 – 2024)
5 Bedingungen der Transformation zur Lehrer*innenbildung für Inklusion
5.1 Hierarchische Struktur der Steuerung im Mehrebenensystem
5.1.1 Handlungsoptionen im Akteursnetzwerk
5.1.2 Handlungsmodi von (Steuerungs-)Akteuren
5.1.3 Politische Kräfte in den Transformationsstrategien und -prozessen (Fallbeispiele)
5.2 Status quo der Lehrer*innenbildung für Inklusion
5.2.1 Strukturen und Konzepte der Lehrer*innenbildung für Inklusion im internationalen Raum
5.2.2 Organisationsformen von Inklusion in Lehramtsstudiengängen in Deutschland
6 Transformationsbarrieren zu einer Lehrer*innenbildung für Inklusion?!
6.1 Effekte der Beibehaltung schultypenspezifischer Lehramtsstudiengänge
6.1.1 Studien- und Berufswahlmotive von Lehramtsstudierenden
6.1.2 Studiengangsbezogene Informationen und Auswahlverfahren
6.1.3 Generalisten-Spezialisten-Verhältnis von Sonder- und Regelpädagogik
6.2 Reziprozität von Haltungen, inklusiver Praxis und Professionalität
6.3 Effekte der Beibehaltung (parallel existierender) Sonderschulen
6.4 Starke (unbewusste) Abwehrmechanismen der Akteure
6.5 Ableismus und defizit-/differenzorientierte Klassifikationen
6.6 Die Rolle der Disziplin der Sonderpädagogik in der inklusiven Bildungsreform
6.6.1 Die ›Legitimationskrise‹ der Sonderpädagogik?!
6.6.2 Fach- und berufspolitische Interessen in der Sonderpädagogik
6.6.3 Die Aneignung und »Sonderpädagogisierung« der Inklusion
6.7 Der Erhalt grundständiger Lehrämter für Sonderpädagogik
6.8 Fehlende Lobby für Inklusion in der Lehrer*innenbildung
7 Aspekte einer transformativen Professionalität in der inklusiven Bildung
7.1 Überzeugungen und Einstellungen von Lehrpersonen und anderen Akteuren
7.2 Selbstwirksamkeitserwartungen
7.3 Fähigkeit zum Forschungstransfer in die Praxis
7.4 Kompetenzen für kooperatives und vernetztes Denken und Handeln
8 Transformationsanregungen: Hochschulpolitik und Studiengangslogistik
8.1 Einrichtung von Akteursnetzwerken für (inklusive) Lehrer*innenbildung
8.2 Inklusive (Lehrer*innen-)Bildung im Whole-University-Approach
8.3 Kollaboration und Transformation disziplinärer Arbeitsbereiche
8.4 Professionalisierung von Hochschullehrenden für die inklusive Bildung
9 Transformationsanregungen: Curriculum und Hochschuldidaktik
9.1 Werteorientierung im transformativen Inklusionsverständnis
9.2 Anerkennung von Diversität durch Fairness in Leistungsrückmeldungen
9.3 Eine Identität als transformative und inklusive Lehrkraft
9.4 Inklusion: Querschnittsthema und Impuls für disziplinäre Relationierung
9.5 Professionelles Lernen in inklusiven Kontexten
9.5.1 Inklusive Schulpraxis
9.5.2 Inklusion in Hochschullehre und -forschung
9.5.3 Inklusive Hochschuldidaktik
9.5.4 Selbstvertreter*innen in der Lehre
9.6 Professionalisierung für Inklusion als berufsbiografische Aufgabe
10 Ein Strukturmodell für eine inklusive Lehrer*innenbildung (ILB)
Literatur
Seitenangaben der gedruckten Ausgabe
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Impressum
Inhaltsbeginn
Die Autorin
Dr. Kerstin Merz-Atalik ist Professorin für Pädagogik bei Behinderung und Benachteiligung/Inklusion an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und promovierte im Schnittfeldbereich von Migrations- und Integrationspädagogik. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Lehrer*innenbildung, international vergleichende Bildungsforschung, diversitätsorientierte Pädagogik/Didaktik und Governance in inklusiven Bildungssystemen.
Kerstin Merz-Atalik
Die inklusive Lehrperson
Leitgedanken transformativer Lehrerbildung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten© W. Kohlhammer GmbH, StuttgartGesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 [email protected]
Print:ISBN 978-3-17-028755-6
E-Book-Formate:pdf: ISBN 978-3-17-028756-3epub: ISBN 978-3-17-028757-0
Vorwort von Barbara Wenders und Reinhard Stähling1
Lehrer*innenbildung an und für (inklusive) Reformschulen
Jede Schule ist immer auch Ausbildungsschule für Studierende und Lehramtsanwärter*innen. Zugleich kann sie durch Hospitationen und Besuche auch als Fortbildungsstätte dienen. Die aktuelle Lehrer*innenbildung orientiert sich an bestehenden Schulen und deren Strukturen und begrenzten und tradierten Möglichkeiten und selbstverständlich erscheinenden Praktiken: vertikale Gliederungen in Primar- und Sekundarstufenschulen, horizontale Gliederungen in verschiedenen Schulformen ab dem Jahrgang 5, Sondersysteme für behinderte Schüler*innen, Aussonderungen von leistungsschwachen und verhaltensauffälligen Schüler*innen, begrenzte Umsetzungen von Lehrplänen, begrenzte Möglichkeiten wegen der Raum- und Klassengrößen und wegen des mangelnden Personals, wenig gebundene und verpflichtende Ganztagsschulen usw. Wiederholende PISA-Ergebnisse zeigen, dass die Schulleistungen der Schüler*innen in Deutschland stark von ihrer Herkunft bestimmt werden. In Deutschland gibt es – mehr als in vielen anderen Ländern – in diesem Feld seit langem Entwicklungsbedarf. Es werden Strukturänderungen in Richtung gebundener, verpflichtender Ganztagsschulen und längeren gemeinsamen Lernens bis zum zehnten Schuljahr unter einer Leitung diskutiert. Die Lehrer*innenbildung steht hier zumeist im Abseits und kann sich an solchen Reformvorhaben nicht beteiligen.
Bevor wir die Frage erörtern, welches konkrete Ziel die Lehrer*innenbildung verfolgen möge, haben wir zunächst Einigkeit darüber herzustellen, was Lehrer*innenbildung nicht tun soll: Sie sollte mit ihren Instrumentarien nicht bestehende Schulstrukturen bedienen und verfestigen. Im Gegenteil müsste sie dazu beitragen, die Reform des Schulwesens zu unterstützen. Konkret wäre anzustreben, was nach unserer Einschätzung bereits im Einvernehmen mit den gesicherten Forschungsergebnissen als Reformforderung vorliegt: eine inklusive Schule für alle Schüler*innen in einer Schulform, die von der Primarstufe bis zur Sekundarstufe unter einer verantwortlichen Leitung steht.
Alle Lehrer*innenbildungsvorhaben, die der Festschreibung des in Deutschland bestehenden, ab der Sekundarstufe gegliederten und selektierenden Schulsystems dienen könnten, sollten kritisch überprüft werden; auch und gerade die fachdidaktischen Aspekte, die viel zu sehr schulstufengebunden verengt werden (vgl. auch Stähling & Wenders, 2018, S. 91 ff.):
Wozu sollen Pädagog*innen ausgebildet werden, die nur in Sonderschulen arbeiten können und wollen?
Wieso sollen Lehrer*innen ihr ›Fach‹ verengt nur auf Schulstufen bezogen kennenlernen und in der Praxis erproben können?
Wer trägt die Verantwortung für den gesamten Lernprozess der Schüler*innen in den einzelnen Fachgebieten?
Gibt es überhaupt ›Grundschul-Englisch‹ oder ist die Fremdsprachendidaktik längst weiter?
Wieso kann die Wissenschaft der Mathematik überhaupt bei Lernanfänger*innen eine andere sein als bei Schulabgänger*innen?
Weshalb werden fachspezifische Qualifikationen erworben, die nur in bestimmten Schulformen gebraucht werden, die eine fächerübergreifende Vernetzung des Lernens nicht strukturell vorsehen?
Im real existierenden gegliederten Schulsystem werden Lehrer*innen ausgebildet, die für die zukünftigen Generationen Leitbilder darstellen sollen. Wie kann es uns gelingen, dass die Lehrer*innenbildung die längst überfällige Reform der Schulen voranbringt?
Man wird dem entgegenhalten, dass doch die zukünftigen Lehrer*innen klarkommen wollen im bestehenden Schulsystem und auch dort eine Anstellung anstreben und nicht den Auftrag verspüren, sich für die Reform des Bestehenden einzusetzen. Personalrät*innen werden hier sogar von Überforderung reden und die Mitarbeiter*innen vor solchen Vorhaben schützen wollen, die die bewährten Routinen des Schulgeschäftes ›auf Kosten‹ der Beschäftigten aushebeln könnten.
Hier verläuft auch die Frontlinie zwischen denjenigen, die auch die Schule nicht aus der Pflicht nehmen wollen, wenn es darum geht, die Zukunft der Kinder zu sichern (siehe z. B. Greta Thunberg und ihr weltweiter ›Fridays für Future‹-Schulstreik für das Klima), und denjenigen, die der Meinung sind, dass die Schule nur dazu diene, den jungen Menschen auf seine Rolle in der derzeitig real existierenden Gesellschaft bestmöglich vorzubereiten.
Wenn wir uns angesichts dieser Debatten auf das Grundgesetz besinnen und der Meinung sind, dass die Schule dazu beitragen soll, dass die jungen Menschen erzogen werden müssen, zum Beispiel zur Verantwortung »für die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen« (§ 2 SchulG NRW), so kann die Lehrer*innenbildung nicht abseitsstehen (vgl. Eichholz, 2013).
In seiner kritischen Analyse der Lehrer*innenbildung kommt Feuser (2013) zu dem Schluss, dass in den lehramtsbildenden Hochschulen die wesentlichen Grundlagenfelder derzeit zu wenig behandelt werden: Geschichte der Pädagogik, Bildungstheorie und Allgemeine Didaktik (vgl. auch Feyerer, 2013).
»Hätten wir eine subjektwissenschaftlich fundierte und bezogen auf die humanwissenschaftlichen Grundlagen qualitativ hochstehende Lehrer*innenbildung, bedürfte, was heute z. B. mit den Begriffen Diversität, Differenz, Vielfalt, Heterogenität verknüpft und diskutiert wird, überhaupt keiner besonderen Erwähnung und inklusiver Unterricht wäre selbstverständlich, sofern man Kinder und Schüler*innen in einem Kindergarten und einer Schule so zusammenkommen lässt, wie sie sind und weil sie da wohnen und leben« (Feuser, 2013, S. 27).
Für eine Lehrer*innenbildung, die zu einer Reform des Bildungswesens beitragen will, sind nach dieser Analyse zwei Aufgabenfelder zu fordern:
1.
Vermittlung von Kompetenzen zur Umsetzung von Reformen in Schulen: Die jungen Lehrer*innen müssen lernen, die vorhandenen Strukturen und Begrenztheiten der Schulen in Deutschland so zu reformieren und für sich zu nutzen, dass sie für die Entwicklung der nachkommenden Jugend nicht – wie bisher – eine Behinderung für das Lernen darstellen.
2.
Vermittlung von Kompetenzen für Lernprozesse: Die jungen Lehrer*innen müssen eigene Erfahrungen damit machen, wie Schüler*innen erfolgreich lernen, und diese unter Anleitung auswerten. Sie müssen die lern- und entwicklungslogischen Grundlagen im Zusammenhang mit didaktischen Fragen kennenlernen, in Verhaltenstrainings einüben und in Praktika anwenden.
Hier wird sichtbar, dass eine wirklich fundierte tatsächlich stattfindende Lehrer*innenbildung entscheidend dazu beitragen könnte, das deutsche Schulsystem zu reformieren. Dazu brauchte sie als feste Kooperationspartner*innen auch Schulen, in denen die Lehrer*innen sich ein Bild von humaner Pädagogik machen können. In diesen Schulen können sich die zukünftigen Lehrer*innen mit den alltäglichen Grenzerfahrungen auseinandersetzen und das didaktische Handeln üben.
Pädagog*innen brauchen positive Erfahrungen mit reformorientierten Schulmodellen, die Kinder und Jugendliche nicht einteilen und sortieren, sondern die sie als Lernende ernst nehmen und ihnen die Möglichkeit bieten, vertieft, nachhaltig und erfolgreich zu lernen.
Berufsanfänger*innen geraten nicht selten in eine Krise, weil sie sich als zukünftige Pädagog*innen immer fragen, ob sie den Aufgaben der reformorientierten Praxis gewachsen sind. Es muss vermieden werden, dass sie aus Verunsicherung heraus auf die ihnen aus der eigenen Schulzeit bekannten Verhaltens- und Denkmuster der traditionellen Schule zurückgreifen und sich aufgrund mangelnder Erfahrungen überlasten. Die intensiven Aufarbeitungen der eigenen Schulzeit und der dort eintrainierten Muster sind nötig (vgl. Kaiser, 2003). Dies kann verhindern, dass lernende Berufsanfänger*innen durch konservative Praxisbetreuer*innen dahin geführt werden, ihren ›Unterricht‹ im herkömmlichen Stil so zu gestalten, dass er nicht für alle Schüler*innen erfolgreich sein kann.
Alle Erfahrungen der Studierenden und Lehramtsanwärter*innen in der Schulpraxis sollten in den Seminaren der Lehrer*innenbildung aufgearbeitet werden. Auch Lehrkräfte mit Berufserfahrung sind auf Unterstützung angewiesen. Dazu benötigen wir in den Schulen und Seminaren sowohl Supervisionen und Lehrer*innenverhaltenstrainings als auch Reflexionen zur Schulpraxis. Ohne historische Rückblicke, zum Beispiel auf die reformpädagogischen Kämpfe der 1920er Jahre, sind die eigenen reformorientierten Praxiserfahrungen nicht einzuordnen und für zukünftige Reformen zu nutzen. Auch der Blick über die nationalen Grenzen hinweg ermöglicht die Einsicht darin, wie Strukturen entstehen und wie Reformen umgesetzt werden. Die Gesetzmäßigkeiten der Veränderungen zu ergründen kann dabei von großer Bedeutung für zukünftige Schulentwicklungen sein.
Besondere Universitäts- oder Übungsschulen wie die Laborschule Bielefeld muss es geben, die als zukunftsfähige Modelle dem pädagogischen Nachwuchs dienen können (vgl. Matthes, 2019; Reich Asselhoven & Kargl, 2015; Reich, 2017; Palowski Gold & Klewin, 2019). Nicht selten wird hier kritisch angemerkt, dass auch nach 40 Jahren Laborschule Bielefeld die notwendigen Strukturänderungen noch nicht ›in der Fläche angekommen‹ seien. Das liegt aber nicht daran, dass die Modellschule in Bielefeld fehlende Impulse aussendet an die vielen Lehrer*innen, die dort hospitiert haben, sondern möglicherweise daran, dass der Weg hin zu einer solchen reformorientierten Schule mehr bedarf als nur didaktischer Qualifikationen. Schulleitungen anderer Schulen, die eine Schulreform im eigenen Hause anstreben, brauchen neben dem guten Modell für das Lernen auch erfolgreiche Modelle für die Strategien der Veränderung einer Schule.
Am Beispiel der PRIMUS-Schule Berg Fidel/Geist (vgl. Stähling & Wenders, 2015; 2018) mit den Jahrgängen 1 bis 10 unter einer Leitung soll kurz aufgezeigt werden, inwiefern eine solche Langformschule für eine Lehrer*innenbildung, die auf die Zukunft vorbereiten soll, notwendig ist. Die Grundschule Berg Fidel wurde 1971 gegründet. Sie hat sich auf den Weg gemacht, innerhalb des bestehenden Systems in der Einzelschule genau die Strukturen zu schaffen, die für das gesamte Schulsystem zu fordern sind:
Ganztagsschule in gebundener Form wie in der Grundschule Berg Fidel seit 1992 – im Gegensatz zur Offenen Ganztagsschule gibt es gebundene Ganztagsgrundschulen nur in kleiner Zahl. Sie ist für alle Schüler*innen verpflichtend und daher wird von den Eltern hier auch kein Schulgeld verlangt. Das Konzept des offenen Ganztags enthält dagegen keine Schulzeit am Nachmittag, sondern freiwillige Angebote, die in der Regel von Eltern bezahlt werden. Die Einheit von Vormittags- und Nachmittagsschule ist nur in der gebundenen Schule möglich und daher auch pädagogisch gestaltbar.
Teams für jede Klasse mit sonderpädagogischem Personal – schulintern wird dies nur in wenigen Schulen durchgesetzt. Das abgestimmte, einheitliche Vorgehen der Pädagog*innen einer Klasse ist wichtig für den Erfolg. Dies ist nur in klasseneigenen Teams möglich. Studierende und Schulbegleiter*innen/Integrationshelfer*innen gehören genauso zum Team wie die hauptamtlichen Lehrer*innen und Sonderpädagog*innen. Sie koordinieren ihre Arbeit jede Woche in einer Teamsitzung.
In jedem klasseneigenen Team arbeiten Studierende aller Fachrichtungen, Schulformen und pädagogischen und psychologischen Richtungen mit. Etwa 70 % der Mitarbeiter*innen eines Teams befinden sich in Ausbildung.
Ausweitung der Grundschule Berg Fidel bis in die Sekundarstufe unter einer Leitung wie in der PRIMUS-Schule Berg Fidel/Geist – unter dem Begriff der Gemeinschaftsschule gibt es ähnliche Schulen zum Beispiel in Berlin. Sie sind aber noch überall im Bundesgebiet die Ausnahme.
Altersmischung in jeder Klasse und das schulformübergreifend (Jahrgang 4 – 6), wie in der PRIMUS-Schule Berg Fidel, Geist – das ist selten. Es bietet eine enorme Chance, die Verantwortlichkeiten für die Lernentwicklung aller Schüler*innen über lange Zeiträume unter gemeinsamer Leitung zu übernehmen. Die pädagogische und didaktische Arbeit kann nur so koordiniert werden.
Keine Ziffernnoten bis Jahrgang 8 einschließlich – ebenfalls sehr selten im öffentlichen Schulwesen. Die Pädagog*innen tragen gemeinsam über tradierte Schulstufen hinweg die Verantwortung für die entscheidenden Weichenstellungen und Beratungen in der Laufbahnberatung der Schüler*innen.
Diese für alle Schulen wünschenswerten Schulstrukturen sind in einer Schule durchgesetzt worden, die als einzige in ihrer Stadt diese Strukturen in der Einzelschule erkämpft hat. Es wurden also nicht die Strukturen im Schulsystem verändert – vielmehr blieben diese leider bestehen –, sondern nur diese einzelne Schule ging diesen Weg, die eigene Struktur neu zu gestalten. An allen diesen Schulentwicklungsprozessen haben immer auch Studierende und Besucher*innen teilhaben können. Jährlich hospitieren seit den 1980er Jahren in der Schule ca. 200 Pädagog*innen, Wissenschaftler*innen und Schulentwickler*innen aus dem In- und Ausland. Lehrer*innenbildung an erfolgreichen (inklusiven) Reformschulen ist notwendig und kann nicht ersetzt werden durch Literaturstudium allein. Sie ist ein Beitrag zur Reform des deutschen Bildungswesens.
Literatur
Eichholz, R. (2013). Streitsache Inklusion. Rechtliche Gesichtspunkte zur aktuellen Diskussion. In G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.), Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikationen braucht die inklusive Schule? (S. 67 – 115). Gießen: Psychosozial-Verlag.
Feuser, G. (2013). Grundlegende Dimensionen einer LehrerInnen-Bildung für die Realisierung einer inklusionskompetenten Allgemeinen Pädagogik. In G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.), Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikationen braucht die inklusive Schule? (S. 11 – 66). Gießen: Psychosozial-Verlag.
Feyerer, E. (2013). LehrerInnenbildung im Umbruch. In G. Feuser & T. Maschke (Hrsg.), Lehrerbildung auf dem Prüfstand. Welche Qualifikationen braucht die inklusive Schule? (S. 181 – 212). Gießen: Psychosozial-Verlag.
Kaiser, A. (2003). Anders lehren lernen. Ein Übungskurs für emotional fundierte Lehrkompetenz. Baltmannsweiler: Schneider.
Matthes, E. (2019). Universitätsschulen in deutschen Staaten – historische Fallbeispiele. Die Deutsche Schule,111(1), 8 – 21.
Palowski, M., Gold, J. & Klewin, G. (2019). Gemeinsame Praxisforschung statt Be-Forschung: Die Bielefelder Versuchsschulen und ihre Wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Deutsche Schule, 111(1), 56 – 65.
Reich, K. (2017). Inklusive Didaktik in der Praxis. Beispiele erfolgreicher Schulen. Weinheim: Beltz.
Reich, K., Asselhoven, D. & Kargl, S. (Hrsg.). (2015). Eine inklusive Schule für alle. Weinheim: Beltz.
Stähling, R. & Wenders, B. (2015). Teambuch Inklusion. Ein Praxisbuch für multiprofessionelle Teams. Baltmannsweiler: Schneider.
Stähling, R. & Wenders, B. (2018). Schule ohne Schulversagen. Praxisimpulse aus Grundschule und Sekundarstufe für eine gemeinsame Schule. Baltmannsweiler: Schneider.
Endnoten
1Barbara Wenders (ehemalige Lehrerin) und Reinhard Stähling (ehemaliger Schulleiter) der Grundschule Berg Fidel und der PRIMUS-Schule (Münster).
1 Einleitung
Welche Lehrer*innen werden in einer inklusiven Gesellschaft in einer Schule des 21. Jahrhunderts gebraucht? Die Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012) hat sich der Frage der Herausforderungen für die Lehrer*innenbildung2 wenige Jahre nach der ›UN Convention of the Rights of Persons with Disabilities – UNCRPD‹ (UN, 20063) gewidmet. An dem internationalen Projekt ›TE4i – Teacher Education for Inclusion‹ (2009 – 2012) waren Expert*innen aus Wissenschaft, Bildungspolitik und Praxis aus 28 europäischen Ländern beteiligt.4 Sowohl die Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung als auch die im Projekt eingebundenen Expert*innen gehen von einem direkten Zusammenhang zwischen der Gestaltung inklusiver Bildungssysteme, der Professionalisierung der Lehrpersonen und den Chancen der Entwicklung inklusiver Gesellschaften aus. Das internationale Konsortium befasste sich über zwei Jahre mit den Konsequenzen für die grundständige Lehramtsausbildung unter der Frage: »Wie werden alle Lehrkräfte in ihrer Erstausbildung darauf vorbereitet, inklusiv zu sein?« (European Agency for Development in Special Needs Education, 2012, S. 5; Übers. u. Hervorh. d. Verf.).
Die Zielsetzung des Projektes TE4i war durch die Projektleitung bewusst im Sinne einer »›becoming‹ dimension of (inclusive) educational practitioners« (Koenig, 2020b, S. 105) formuliert. Mit dem Titel dieses Buches ›Die inklusive Lehrperson‹ wird diese Auslegung aufgegriffen, da es in der Professionalisierung für Inklusion nicht ausschließlich um die Vermittlung additiver oder adaptierter, gegebenenfalls sogar alleinstehender inklusionsorientierter Handlungskompetenzen für die schulische Praxis gehen kann. Vielmehr bedarf es zur erfolgreichen Implementierung der inklusiven Bildung eines kulturpolitischen Transformationsprozesses im gesamten Bildungssystem und mithin im System der Lehrer*innenbildung. Der Untertitel des Buches verweist daher auf die damit im Zusammenhang stehenden komplexen Transformationserfordernisse und -prozesse in der gesamten Organisation der Lehrer*innenbildung, von allen Akteuren5, inklusive der (angehenden) Lehrpersonen. Unter transformativer Lehrer*innenbildung wäre ein Professionalisierungsprozess zu verstehen, der die Potenziale für eine Weiterentwicklung und für den erforderlichen Richtungswechsel im Bildungssystem zur Inklusion aufgreift und die angehenden Lehrpersonen auf eine intensive Auseinandersetzung mit den Prämissen inklusiver Bildung und die aktive Partizipation in den anstehenden Transformationsprozessen vorbereitet.
Adressat*innen dieses Buches sind zunächst die verschiedenen Organisationen und Institutionen in der Lehrer*innenbildung und die darin tätigen Akteur*innen oder Lehrenden. Dazu zählen die Akteure aus Bildungspolitik, Bildungs- und Wissenschaftsministerien, Hochschulen oder Studienseminaren und Fortbildungsinstitutionen. Das Buch soll Impulse geben für die Arbeit auf der Metaebene (z. B. Arbeitsgruppen in Organisationen), aber auch für die eigenaktive Professionalisierung von Hochschullehrenden, Lehrpersonen und Lehramtsstudierenden für ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems. Dazu werden zunächst die Professionalisierungsanforderungen systematisch herausgearbeitet unter der Frage: Was ist nötig dafür, eine inklusive Lehrperson zu werden bzw. solche zu fördern? So werden wesentliche Leitgedanken herausgearbeitet, in Anlehnung an die Empfehlungen und Dokumente globaler und nationaler Organisationen (z. B. UN, UNESCO, Hochschulrektorenkonferenz) sowie wissenschaftliche bzw. empirische Erkenntnisse. Die Leitgedanken werden im Text jeweils als Thesen (Thesen 1 bis 20) hervorgehoben; sie greifen die in den Kapiteln 2 bis 6 herausgearbeiteten Haltungen, Kompetenzen und Fähigkeiten von inklusiven Lehrpersonen auf. Keinesfalls sind sie jedoch im Sinne einer vollständigen Auflistung der Professionalisierungserfordernisse zu verstehen, vielmehr dienen sie den Leser*innen als Orientierung.
Das Ziel der vorliegenden Publikation ist es dabei, den vielfältigen Akteuren in der Lehrkräftebildung, wie zum Beispiel Lehrenden und Studierenden in den Lehrämtern und Bezugswissenschaften, den Verantwortlichen in Bildungspolitik, -verwaltung und Schulpraxis, einen umfassenden Einblick zu grundlegenden Prämissen der inklusiven (Lehrer*innen-)Bildung und den diesbezüglich anzustrebenden Transformations- und Steuerungsprozessen zu geben. Sie sollen durch die Lektüre dieses Bandes dazu angeregt werden, die bestehenden Kulturen, Strukturen und Handlungen in der Lehrer*innenbildung kritisch zu hinterfragen. Mit dem Buch wird zudem das Ziel verfolgt, die Akteure im (Lehrer*innen-)Bildungssystem auf der Basis von erweitertem Hintergrundwissen und Erfahrungsbeispielen zu motivieren, sich mit ihrer eigenen Rolle in der Transformation des Bildungssystems und der Lehrer*innenbildung zur inklusiven Bildung zu befassen und diese zu reflektieren.
Um eine inklusive Lehrperson ›zu werden‹ oder gar ›zu sein‹, bedarf es deutlich mehr als einzelner Module zur inklusiven Bildung im Studium oder des Besuchs von Lehrkräftefort- und weiterbildungen. Neben der Verankerung von fachlichen Inhalten zur Inklusion in den Studienordnungen sollten die Amivalenzen und Ambiguitäten des Lehrer*innenhandelns im Kontext der inklusiven Bildung im Bildungssystem erkannt und in der Professionalisierung für alle Lehrpersonen berücksichtigt werden. Zu diesen Ambivalenzen zählen zum Beispiel Spannungsverhältnisse (z. B. zwischen standardisierten Bildungsnormen und der Anerkennung der Vielfalt von Lernenden) oder das Handeln in den sich zur inklusiven Bildungsreform konträr verhaltenden, selektions- und segregationskonnotierten Organisationsformen und Praxiskontexten oder Konzepten.
Die Aufgabe der Lehrer*innenbildung für Inklusion wäre es die Lehrpersonen zu zu einem kontinuierlichen, möglichst eigenaktiven Aufbau von Reflexionswissen und Kompetenzen zur inklusiven Bildung zu befähigen, die es wahrscheinlicher machen, dass sie
sich in dem permanenten – weder absehbar noch linear verlaufenden – Transformationsprozess zu einem inklusiveren Bildungssystem im Sinne der Vision selbstreflexiv, vernetzt und zielgerichteter orientieren können,
den mit der Anerkennung von menschlicher Diversität und vielfältigen Bildungswegen zusammenhängenden Herausforderungen in den Organisationen und Institutionen mit diversitätssensiblen und inklusionsorientierten Haltungen und Praktiken begegnen können,
sich als gestaltende Akteur*innen in einem sich stetig verändernden Bildungssystem für ein Mehr an Gleichstellung und Bildungsgerechtigkeit und den gleichzeitigen Abbau von Barrieren für Teilhabe und Lernen (Booth & Ainscow, 2017) positionieren können, und
Bereitschaften entwickeln, sich gemäß den sich verändernden Herausforderungen durch die Diversität der Lernenden und der Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft im Rahmen der Berufsbiografie weiter zu professionalisieren.
Eine wesentliche Basis für die Professionalisierung für Inklusion sollte zunächst eine Klärung des Inklusionsbegriffs und -verständnisses sein, die einführend in Kapitel 2 unter Berücksichtigung der zahlreichen Dokumente und Publikationen globaler Akteure für die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems erfolgt (▸ Kap. 2). Globale, internationale Organisationen haben bereits umfassend Empfehlungen für eine Lehrer*innenbildung erarbeitet und veröffentlicht, die im Hinblick auf die erwartete Professionalität im inklusiven Bildungssystem als erforderlich erachtet werden. Die umfassenden Empfehlungen und völkerrechtlichen Vorgaben werden in Kapitel 3 vorgestellt (▸ Kap.3); ihnen sollte auch im deutschsprachigen Diskurs ein größerer Stellenwert eingeräumt werden. Auf nationaler Ebene wurden in den vergangenen Jahrzehnten ebenfalls vielfältige Transformationsimpulse gegeben. Diese werden in Kapitel 4 ausführlich thematisiert (▸ Kap. 4). Die bis zum aktuellen Zeitpunkt umfassend dokumentierten Transformationsimpulse für die Gestaltung inklusiver Bildungssysteme und mithin einer entsprechenden Lehrer*innenbildung lassen unschwer erkennen, dass in Deutschland auch nach mehreren Jahrzehnten noch deutliche Diskrepanzen zwischen Soll- und Ist-Zustand bestehen.
Dies macht es erforderlich, sich mit der Frage zu befassen, an wen sich die Transformationsimpulse richten und wer in die Transformationsprozesse eingebunden sein sollte: Wie wird die Lehrer*innenbildung in Deutschland gesteuert? Wer sind die in die Lehrer*innenbildung eingebundenen Organisationen und Institutionen (Akteursnetzwerke6)? Wer trägt die Verantwortung dafür, die Lehrer*innenbildung inklusiv zu gestalten? Wer trifft die relevanten Entscheidungen bezüglich Strukturen, Inhalten und Formaten? Kapitel 5 bietet daher einen Überblick über die Bedingungen für die Transformation, über die Steuerungsebenen und -aktivitäten sowie das Netzwerk an Akteuren, denen im Rahmen der Lehrer*innenbildung in Deutschland eine Verhandlungs- bzw. Entscheidungsmacht und Verfügungsrechte zukommen (▸ Kap. 5). Alle Akteure im Mehrebenensystem der Bildung bzw. der Lehrer*innenbildung, nicht nur die Lehrpersonen in der Praxis, »spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung wünschenswerter Transitionen und Transformationen durch transformatives Handeln und Governance« (Hölscher et al., 2018, S. 2). Zu diesen Akteuren zählen Individuen wie Lehrpersonen, Lehramtsstudierende, Bildungspolitiker*innen und Eltern, aber auch Organisationen wie Hochschulen, Studienseminare oder Gewerkschaften. Um sich als individueller Akteur oder kollektiv als Gruppe im Transformationsprozess von Lehramtsstudiengängen und Studienordnungen als gestaltender Change-Agent wahrzunehmen und einbringen zu können, ist es erforderlich, dass man die komplexen Steuerungsprozesse im System bzw. der Organisation der Lehrer*innenbildung erfasst und durchschaut. Dies gilt auch für Lehrende an Hochschulen (erste Phase der Lehrer*innenbildung), an Studienseminaren (zweite Phase) und in der Fort- und Weiterbildung (dritte Phase), für Lehramtsstudierende und Referendar*innen, aber auch für jene Lehrpersonen in der schulischen Praxis oder jene, die in die schulpraktischen Studien an Hochschulen eingebunden sind. Daher sollen in diesem Kapitel der Kontext, die gängigen Prozesse und Konditionen der Steuerung in der Lehrer*innenbildung behandelt werden.
In Kapitel 6 werden mannigfaltige Barrieren für die Transformation zu einer inklusiven Lehrer*innenbildung im Bildungssystem in Deutschland thematisiert (▸ Kap. 6). Da Steuerung und Implementation nicht immer rationalen Verfahrenswegen folgen, sollten die individuellen und institutionellen Akteure ebenso in der Lage sein die vielfältigen Herausforderungen, Widersprüche und Barrieren für Innovationen und Transformationen auf allen Ebenen des Bildungssystems zu erkennen und im Hinblick auf ihre Tätigkeiten bzw. Arbeitsumfelder zu reflektieren. Nur diese Weitsicht ermöglicht es ihnen, sich diesen Spannungsfeldern zu stellen und sie in ihrer Bedeutung für die Transformationsprozesse (und so auch für die nicht-rationale oder nicht-lineare Umsetzung von Reformen und Interventionen) in den Lehramtsreformen zu erkennen.
Kapitel 7 zu Aspekten einer transformativen Professionalität diskutiert die Bedeutung von Einstellungen und Haltungen zur Inklusion und weitere grundlegende Voraussetzungen seitens der angehenden Lehrpersonen, um die bereits ausführlich dargelegten Transformationsimpulse aufzugreifen und in die eigene Praxis zu transferieren (▸ Kap. 7). Einerseits geht es hierbei um allgemeine Ziele der Lehrer*innenbildung wie zum Beispiel die Förderung von Einstellungen und Selbstwirksamkeitserwartungen zur inklusiven Bildung durch die regulären Studienangebote. Andererseits sollte sich die Lehrer*innenbildung noch stärker der Frage widmen, wie man Lehrpersonen besser dafür professionalisiert, dass sie sich im Rahmen ihrer anstehenden Berufsbiografie eigenaktiv mit aktuellen Forschungserkenntnissen (z. B. zur inklusiven Bildung oder Digitalisierung) und kritisch-konstruktiv mit Reform- und Transformationsbestrebungen auseinandersetzen.
Die Kapitel 8 und 9 geben auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse Einblicke in inspirierende Praktiken der Lehrer*innenbildung für Inklusion, zunächst auf der Ebene der Hochschulpolitik und Studiengangslogistik, anschließend auf der Ebene der Curricula und Hochschuldidaktik (▸ Kap. 8; ▸ Kap. 9). In diesen Kapiteln können Modelle und Erfahrungen jeweils nur beispielhaft berücksichtigt werden, da die Vielfalt an Konzepten bundesweit mittlerweile beachtlich ist. Im Bewusstsein, dass man diese ausgewählten Konzepte nicht als Rezeptologien verstehen darf, können sie doch Anregungen dazu geben, über die eigenen Kulturen, Strukturen und Praktiken (Booth & Ainscow, 2017) im Zusammenhang mit der Inklusion kritisch nachzudenken und diese weiterzuentwickeln.
In Kapitel 10 wird abschließend ein Konzept der Neustrukturierung der Lehrer*innenbildung vorgestellt, mit dem es gelingen könnte, die Prämissen eines inklusiven Bildungssystems in der Lehrer*innenbildung angemessen grundzulegen und damit die inklusive Bildungsreform in der schulischen Praxis nachhaltig zu sichern (▸ Kap. 10).
Die Frage der Gestaltung einer Lehrer*innenbildung für Inklusion sollte – neben einer theoretischen, wissenschaftlichen und empirischen Fundierung – gleichzeitig grundlegend aus einer als erfolgreich und qualitativ hochwertig zu erachtenden inklusiven Schul- und Unterrichtspraxis heraus gedacht und entwickelt werden. Daher gilt auch eine Empfehlung in diesem Buch der Einbindung von Kolleg*innen aus dieser hochwertigen inklusiven Schul- und Unterrichtspraxis auf allen Ebenen der Steuerung, zum Beispiel auch bei Programmen der Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) oder in Lehrerbildungskommissionen in Bildungsministerien oder an Hochschulen, und in die Lehrer*innenbildung selbst. Den beiden Autor*innen des Vorwortes gilt daher ein Dank dafür, dass sie sich bereit erklärt haben, ein einleitendes Vorwort zu schreiben. Barbara Wenders und Reinhard Stähling (ehemalige Lehrerin und Schulleiter der inklusiven PRIMUS-Schule in Münster7) haben mit ihrem kontinuierlichen jahrzehntelangen Engagement für die inklusive Bildung, ihren Publikationen aus und für die inklusive Praxis sowie durch die in vielfältigen Formaten ermöglichten Praxiseinblicke in ihren inklusionsbewegten Schulalltag8 mittlerweile bundesweite Bekanntheit und Anerkennung erlangt. Auch sie sehen aus der Praxis heraus in der inklusiven Lehrer*innenbildung einen wesentlichen Baustein der inklusiven Bildungsreform.
Aufgrund der Tatsache, dass im deutschsprachigen Raum die Thematik der Inklusion in der Lehrer*innenbildung weitgehend erst nach der Ratifizierung des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD, UN, 2006) im Jahr 2009 angegangen wurde, werden für die Ausarbeitungen Publikationen und Studien aus dem angloamerikanischen Bereich verwendet. Zur besseren Lesbarkeit wurden die Textauszüge und Zitationen von der Verfasserin eigenständig ins Deutsche übersetzt.
Hiermit möchte ich meinen ausdrücklichen Dank aussprechen, allen Menschen die mich in den vergangenen Jahrzehnten auf meinem Weg der Auseinandersetzung mit Fragen der inklusiven (Lehrer*innen-)Bildung begleitet und angeregt haben, zum Beispiel den Kolleg*innen, Lehrer*innen, Studierenden und Eltern. Der Ausgangpunkt meines eigenen Entwicklungsprozesses im Zusammenhang mit der Professionalisierung für die inklusive Bildung fand sich darin, dass ich eher zufällig als frische Absolventin eines Studiums in Erziehungswissenschaften und Sonderpädagogik Ende der 1990er Jahre in Berlin als Integrationshelferin (im Rahmen der Eingliederungshilfe) zur Unterstützung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten in integrativ arbeitenden Grundschulen tätig war. Aufgrund der eigenen mangelhaften Qualifizierung und Vorbereitung für diese Tätigkeit (integrativer Unterricht war nicht Bestandteil meines damaligen Studiums der Heilpädagogik in Marburg) sowie eines ungenügend ausgewiesenen Verständnisses der mit Inklusion einhergehenden Prämissen habe ich mich autodidaktisch den Herausforderungen der schulischen Praxis und der Kooperation mit den Regelschullehrer*innen stellen müssen. Erst Jahre später habe ich verstanden, dass ich – aufgrund fehlender inklusionsbezogener Reflexions- und Handlungskompetenzen – meine Tätigkeit nur allzu häufig konträr zu den Rechten, Lernbedürfnissen und Interessen der Schüler*innen ausgeübt habe – beispielsweise wenn ich mit den Schüler*innen mit einem festgestellten Förderbedarf in Nebenräume gegangen bin, um sie dort individuell zu fördern oder ihnen allzu oft Auszeiten gewährt habe. Die Erfahrung der ungenügenden Professionalisierung für die Tätigkeit in den inklusiven Bildungssituationen durch das Hochschulstudium scheint mir nach wie vor eine meiner Hauptmotive zu sein, mich als Akteurin in der Lehrer*innenbildung für eine inklusionsorientierte Veränderung zu engagieren.
Zu den Menschen, die mich auf meinen Wegen begleitet und inspiriert haben, zählen viele Kolleg*innen und Inklusionsforscher*innen an nationalen und internationalen Hochschulen, Studierende der PH Ludwigsburg, Schulleiter*innen, Lehrpersonen und andere Akteure im Bildungssystem und nicht zuletzt die vielen Eltern, welche sich unermüdlich für eine inklusivere Bildungslandschaft für ihre eigenen Kinder engagieren. Zu den besonders relevanten Personen für meine Biografie als Wissenschaftlerin zählt Prof. Dr. Jutta Schöler (Emeritus; Technische Universität Berlin). Sie hat sich im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit als Forscherin viele Jahre mit der inklusiven Schulentwicklung in Südtirol und Italien befasst, Studierende im Rahmen von Exkursionen daran Anteil nehmen lassen und den Vorbildcharakter der Integration in Italien in zahlreichen Publikationen herausgearbeitet. Damit hat sie auch für mich – als ihre Promovendin – eine ›neue Welt‹ eröffnet. Daher möchte ich dieser Publikation ein Zitat von ihr vorwegstellen, in dem sie bereits im Jahr 2010 auf die Bedeutung der Professionalität von Lehrpersonen für die Umsetzung der inklusiven Bildung verweist:
»Lehrerinnen und Lehrer in italienischen Schulen stellen sich seit ca. dreißig Jahren darauf ein, die Kinder so zu akzeptieren, wie sie sind. Deshalb kann viel Zeit und Kraft direkt für die Förderung aller Kinder genutzt werden. Da es keine Selektionsverfahren auf der Basis defizit-orientierter, lernortzuweisender Diagnostik gibt, kann die Zeit für Förderdiagnostik und Individualisierung von Lernwegen und Unterricht genutzt werden. Sonderpädagogisch qualifiziertes Personal arbeitet in den Regelschulen gemeinsam mit allen Lehrerinnen und Lehrern im gemeinsamen Unterricht. Alle Lehrerinnen und Lehrer sind im Rahmen der Lehreraus- und Fortbildung auf die Tätigkeit in einer heterogenen Lerngruppe im Rahmen von inklusiven Konzepten vorbereitet. Die sonderpädagogischen Kompetenzen werden als eine wichtige Qualifikation für das Lernen aller Kinder gesehen« (Schöler et al., 2010, S. 16).
Mich haben internationale Erfahrungen in meiner Arbeit als Wissenschaftlerin sehr bereichert. Die PH Ludwigsburg hat eine ausgewiesene Internationalisierungsstrategie und ich erhielt vielfältige Unterstützung: für den Aufbau internationaler Forschungskooperationen (z. B. mit der UNC Charlotte/USA und Queens University Kingston/Kanada), für Erasmus-Teaching-Exchange-Aufenthalte an Partneruniversitäten (u. a. in Helsinki und Madrid) und zum Einwerben oder zur Mitarbeit in vielfältigen EU-Projekten (z. B. https://www.tdivers.eu; https://www.govined.eu). Die Auslandsaufenthalte ermöglichten mir wertvolle Einblicke in Konzepte der inklusiven (Lehrer*innen-)Bildung an internationalen Hochschulen.
Einen weiteren Dank möchte ich Miriam Wahl und Sarah Tenzer (Wissenschaftliche Hilfskräfte an der PH Ludwigsburg) sowie Prof. Dr. Oliver Koenig (Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten) aussprechen, die durch die redaktionelle Unterstützung bzw. ihr fachliches Feedback dafür gesorgt haben, dass dieses Werk endlich auch veröffentlicht werden kann.
Ein ganz besonderer Dank gilt meinem Ehemann, der mich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich in meinen Tätigkeiten als Wissenschaftlerin unterstützt und dadurch auch einen unermesslichen Beitrag zum Gelingen dieser Publikation geleistet hat.
Endnoten
2In der vorliegenden Publikation wird der Begriff ›Lehrer*innenbildung‹ in seiner Schreibweise bewusst verwendet, um zu verdeutlichen, dass es sich entgegen der dominierenden öffentlichen Wahrnehmung nicht um eine Berufsausbildung mit einem berufsqualifizierenden Abschluss im traditionellen Sinne handelt, sondern um einen lebenslangen vielschichtigen (Selbst-)Bildungs- und Professionalisierungsprozess (in Anlehnung an Feuser, 2013).
3Der englischsprachige Originaltitel der Konvention wird verwendet, da der deutschsprachige Titel ›Behindertenrechtskonvention‹ (UN-BRK) implizieren könnte, dass es sich um spezifische Behindertenrechte (eingeschränkt auf diese Gruppe) handle. Die UNCRPD (angenommen am 13. 12. 2006 in New York; ab dem 30. 3. 2007 zur Unterzeichnung aufgelegt; bis heute von nahezu 200 Staaten ratifiziert) repräsentiert jedoch explizit die allgemeinen Menschenrechte, die auch für jene Gültigkeit beanspruchen, die von Behinderung betroffen sind. Die Verwendung des englischsprachigen Originaltitels erscheint vor dem Hintergrund einer diskursanalytischen Perspektive wichtig – da wir das, worüber wir sprechen, dadurch hervorbringen, dass wir in bestimmter Weise darüber sprechen (in Anlehnung an Foucault; Weisser, 2015).
4Die Verfasserin dieses Buches war als Expertin an dem Projekt TE4i beteiligt.
5Da der Begriff ›Akteur‹ keine genderneutrale Version erlaubt, er sich auch auf Institutionen oder Organisationen bezieht, wird er jeweils in der maskulinen Form verwendet, soweit er nicht auf individuelle Personen(gruppen) rekurriert.
6Als Akteursnetzwerke wird das dynamische Beziehungsgeflecht zwischen unterschiedlichen Elementen bezeichnet, in welchem die Akteure immer in Abhängigkeit (Interdependenz) von den anderen Akteuren agieren.
7Die PRIMUS-Schule Münster – Berg Fidel/Geist – ist eine Modellschule des Landes Nordrhein-Westfalen mit gemeinsamem Lernen von Klasse 1 bis Klasse 10. Alle arbeiten in jahrgangsgemischten Klassen.
8Zum Beispiel durch Filme, Vorträge, Medienberichte oder Hospitationsangebote für Interessierte an der eigenen Schule (so auch für Lehramtsstudierende im Rahmen von Exkursionen).
2 Inklusive Bildung und Pädagogik der Vielfalt als Transformationsimpulse
»... welche Anforderungen ein inklusives Schulsystem an Lehrerinnen und Lehrer stellt und welche Kompetenzen (angehende) Lehrkräfte daher zukünftig benötigen, kann ohne präzise Definition des zugrunde gelegten Inklusionsverständnisses und der damit verbundenen Ziele nicht erfolgen« (CHE et al., 2015, S. 8).
»In welcher Welt wollen wir leben? Wie sieht Bildung in einer solchen Welt aus? (Slee, 2017, o. S.; Übers. d. Verf.).
»Was müssen wir wissen, um gut miteinander zu leben?« (Booth, 20219; Übers. d. Verf.)
Während das erste Zitat die grundlegende Frage des vorliegenden Buches aufgreift und als Ausgangspunkt eine präzise Definition des Inklusionsverständnisses für die Interventionen und Transformationsbemühungen in der Lehrer*innenbildung als erforderlich konstatiert, betonen die beiden anderen eher übergreifende Fragen nach dem Zusammenleben der Menschheit in der Welt der Zukunft. Die Frage nach der ›richtigen‹ Bildung sowie der Gestaltung von inklusiven Bildungsangeboten sollten immer auch in ihren Potenzialen für das Zusammenleben in der Welt reflektiert werden. Die Wahl dieser Zitate soll darauf verweisen, dass es sich bei der Thematik des Buches nicht um eine solitäre Randbewegung in ausgewählten Organisationen und Feldern – wie dem Bildungssystem – handelt, sondern dass die Frage der Professionalisierung von Lehrpersonen für inklusive Bildung in ein transformatives Zukunftsprojekt (Fraser, 2003, zit. n. Koenig, 2022) der Weltgemeinschaft eingebettet ist.
Wie sich zeigt (und in späteren Kapiteln näher ausgeführt wird), gibt es große Interdependenzen zwischen Inklusionsbegriffen oder -verständnissen, politischen Inklusionsansprüchen und inklusiven Praktiken in Organisationen oder von Akteuren. Deshalb muss auch der Frage nach den notwendigen Professionalisierungserfordernissen von Lehrpersonen für Inklusion jene nach dem Inklusionsverständnis vorangestellt werden (CHE et al., 2015). Langner et al. (2019) sind der Überzeugung, dass in der aktuellen Debatte zu selten diskutiert wird, was Inklusion ist und woran bestimmt werden könne, wann Lehrer*innen in Schule und Unterricht inklusiv agieren. Die Lehrer*innenbildung sollte sich zudem an der übergreifenden Vision eines gesellschaftlichen Zusammenlebens orientieren (z. B. Slee, 2017; Booth, 2021), das grundsätzlich alle in die Gegenwart und Zukunft der Menschheit einbindet. Trotz der bereits vor Jahrzehnten grundgelegten Bestimmungsmerkmale von Inklusion und inklusiver Bildung (z. B. durch die UN und ihrer Organe; ▸ Kap. 3) begegnen uns aktuell im öffentlichen wie auch im fachlichen Diskurs vielfältige und teilweise divergente Inklusionsverständnisse. Daher soll im Folgenden der Diskurs in wesentlichen Zügen nachgezeichnet und in das handlungsleitende Inklusionsverständnis für diese Publikation eingeführt werden.
2.1 Inklusionsverständnisse und die Verwendung des Inklusionsbegriffs
Nach wie vor begegnen uns in der Gesellschaft und in der Schulpraxis ausgesprochen divergente Vorstellungen von Inklusion. Grosche (2015) geht davon aus, dass es aktuell in Deutschland keine allgemein anerkannte Definition von Inklusion gibt, die trennscharf, logisch konsistent und widerspruchsfrei ist.
»Die Sprache der inklusiven Bildung wurde abgestumpft, sie wurde absichtlich durch eine populäre, zu weitgreifende Verwendung unscharf gemacht« (Slee, 2010, S. 14; Übers. d. Verf.).
Angelehnt an das Zitat von Slee (2010) ließen sich beispielweise die sprachlichen Fehlübersetzungen der offiziellen Dokumente in der deutschsprachigen Übersetzung der UNCRPD oder anderer UN-Dokumente diskutieren. So wurde zum Beispiel in der ersten amtlichen deutschsprachigen Fassung der UNCRPD (im Jahr 200910) der Begriff ›Inklusion‹ aus dem englischsprachigen Original in der durch die Bildungspolitik der deutschsprachigen Länder beauftragten Übersetzung mit ›Integration‹ fehlübersetzt11, ein Begriff der eine sehr viel weitreichendere Verwendung zulässt. Obwohl verschiedene Verbände, unter anderem auch im Bundestag in Berlin im Rahmen der Erstanhörungen, auf die Fehlübersetzung hingewiesen haben, wurde der Integrationsbegriff dennoch in der ersten offiziellen deutschen Übersetzung der UNCRPD verwendet.12 Damit handelt es sich nicht um das erste politische Dokument zur inklusiven Bildung, in dem – gegebenenfalls sogar durch ›absichtliche‹ Handlungen (im Sinne des Zitates von Slee, 2010) – unter dem Begriff der ›Integration‹ die Zielsetzungen konterkarierende Rekonstruktionen des Inklusionsbegriffs und -verständnisses durch bildungspolitische Akteure in den deutschsprachigen Ländern erfolgten. So wurde der Begriff Inklusion bereits in zahlreichen, vorausgegangenen globalen Erklärungen und Dokumenten (z. B. Salamanca-Erklärung, UNESCO 1994; Policy Guidelines zur Inklusion, UNESCO 2005) in den jeweiligen offiziellen deutschsprachigen Übersetzungen durchgängig mit dem Begriff der Integration gleichgesetzt (vgl. Lütje-Klose & Neumann, 2018). Der Begriff der Integration schien aus Sicht der politischen Akteure im Hinblick auf das selektive Bildungssystem vermutlich anschlussfähiger als jener der Inklusion.
Slee (2010) bezieht sich in dem Zitat andererseits auf verschiedene Formen der ›populären Verwendung des Begriffs‹, die weit über die ursprüngliche Bedeutung hinausgehen. Teilweise erfolgt dies auch im Rahmen eines absichtsvollen Handelns, zum Beispiel wenn durch die Verwendung des Begriffs Inklusion bei der Bezeichnung von Projekten oder Initiativen angezeigt werden soll, dass man bereits in den Transformationsprozess eingestiegen sei oder ihn gar abgeschlossen habe. So werden zunehmend Institutionen, Fächer und Positionen mit dem Prädikat ›inklusiv‹ betitelt. Jedoch beschreibt Cologon (2019) ein weithin mangelndes Verständnis der inklusiven Bildung, eine häufige Zweckentfremdung sowie eine Vereinnahmung des Begriffs und sieht darin erhebliche Barrieren für die Transformation des Bildungssystems. Die festgestellte Divergenz der Inklusionsbegriffe und -verständnisse ist dabei nicht auf den deutschsprachigen Raum eingeschränkt festzustellen, es handelt sich um ein international konstatiertes Phänomen (z. B. Loreman et al., 2014; diverse Beiträge in Schuelka et al., 2019; diverse Beiträge in Köpfer et al., 2021). Neben der Divergenz innerhalb der bildungspolitischen und bildungswissenschaftlichen Diskurse muss zudem berücksichtigt werden, dass der Inklusionsbegriff in verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen unterschiedlich verwendet wird, zum Beispiel in der Politikwissenschaft, der Erziehungswissenschaft oder der Soziologie (vgl. Feuser, 2010; Lütje-Klose & Neumann, 2018). Schuelka et al. (2019) kommen zu der Erkenntnis, dass Wissenschaftler*innen ebenso differierende Zugänge zur Inklusion aufweisen wie jene Akteure, die in der Praxis inklusiver Bildung tätig sind, und dass es ein Defizit an einem globalen, im Sinne eines international geteilten, Inklusionsverständnis gibt. Der Diskurs über sogenannte ›inklusive Entwicklungen‹ reiche von weitreichenden Umverteilungsreformen für alle in der Gesellschaft bis hin zu Angeboten für die größere Teilhabe von Bevölkerungsgruppen, die in der Regel marginalisiert oder ausgeschlossen waren (z. B. Frauen, Menschen mit Behinderungen, die Landbevölkerung usw.) (ebd.). Selbst im Hinblick auf die Frage, wie exklusive und inklusive Bildung sich voneinander abgrenzen, bestehe keine Übereinstimmung (ebd.).
Nach Hinz versteht sich Inklusion im Hinblick auf die Rechte von Schüler*innen im Bildungssystem als
»allgemeinpädagogischer Ansatz, der auf der Basis von Bürgerrechten argumentiert, sich gegen jede gesellschaftliche Marginalisierung wendet und somit allen Menschen das gleiche volle Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse zugesichert sehen will. Für den Bildungsbereich bedeutet dies einen uneingeschränkten Zugang und die unbedingte Zugehörigkeit zu allgemeinen Kindergärten und Schulen des sozialen Umfeldes, die vor der Aufgabe stehen, den individuellen Bedürfnissen aller zu entsprechen – damit wird, dem Verständnis der Inklusion entsprechend, jeder Mensch als selbstverständliches Mitglied der Gemeinschaft anerkannt« (Hinz, 2006, S. 98).
Dem entgegen wird in den deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Luxemburg, Österreich, Schweiz) der Begriff der Inklusion im Bildungssektor13 nach wie vor häufig stark eingeschränkt auf die Integration von Kindern mit einem Etikett ›sonderpädagogischer Förderbedarf‹14 verwendet (Merz-Atalik, 2017). Die Begrifflichkeiten zur Beschreibung der Tatsache, dass auch Lernende mit einem offiziellen Förderbedarf an dem Lern- und Schulangebot teilhaben, wie Inklusionskinder, Inklusionsklassen, Inklusionsschule, zeigen anschaulich, dass mit dem Begriff Inklusion das Zusammenkommen von Schüler*innen mit und ohne Behinderungen bzw. Beeinträchtigungen im schulischen Feld bezeichnet wird (ebd.). Der vielfach als Prädikat wahrgenommene Begriff der Inklusion suggeriert so gleichsam, der gemeinsame Unterricht sei per se ein inklusiver (Feuser, 2013) oder eine Schule bzw. Klasse sei inklusiv, sobald Kinder mit einer spezifischen Klassifikation anwesend sind.
Mit dem dritten von Slee (2010) in seinem Zitat aufgegriffenen Aspekt der Verwendung des Inklusionsbegriffs beschreibt der Autor eine zu weitreichende und unscharfe Verwendung. Dies gilt sowohl für den fachwissenschaftlichen Diskurs als auch für die Praxis der inklusiven Bildung in Deutschland. Nach Hinz ist der Begriff der Inklusion in Deutschland zu einem ›Modebegriff‹ geworden, indem »inzwischen nahezu alles als Inklusion deklariert wird, was sich positiv und fortschrittlich darstellen möchte« (Hinz, 2013, o. S.) bzw. was die totalen exkludierenden Strukturen auch nur minimal verschiebt.15 Dies wiederum führt dazu, dass nach Dannenbeck und Dorrance durch die inflationäre und wenig begriffsscharfe Verwendung des Inklusionsbegriffs eine Form von »Inklusionsrhetorik« (Dannenbeck & Dorrance, 2013, S. 9) festzustellen ist. Aufgrund der inflationären, unkonkreten und divergenten Verwendung des Begriffes besteht die Gefahr eines phrasenhaften Abgleitens der Debatte um Inklusion (Lanwer, 2017).
»Auf diese Art und Weise werden die sich hinter dem sozialen Phänomen Inklusion verbergenden und verursachenden Konflikte – das heißt Interessens- und Bedürfnisgegensätze zwischen gesellschaftlichen Akteuren und/oder Gruppen, die sich zu Widersprüchen verdichten und sich als gesellschaftliches Schlüsselproblem manifestieren – unsichtbar gemacht, mit der Konsequenz ihrer Bagatellisierung und Trivialisierung« (ebd., S. 14).
Die unscharfe Verwendung des Inklusionsbegriffs in Wissenschaft, Praxis und Bildungspolitik könnte auch eine Folge dessen sein, dass die durch die UNCRPD geforderte Transformation zu einem inklusiven Bildungssystem (Art. 24) von vielen Akteuren als eine ›Zumutung‹ wahrgenommen wird. Diese Haltungen und Einstellungen verwundern kaum, betrachtet man die historische Entwicklung insbesondere im deutschsprachigen Raum. Hier hat die Aussonderung und Selektion von Schüler*innen (mit von den gesetzten Schulbildungsnormen abweichenden Lernbedürfnissen und -entwicklungen) in Sonder- oder Hauptschulen eine besonders lange und tief verwurzelte Tradition. Dies führt unter Umständen zu Formen der interessengeleiteten Rekonstruktionen des Inklusionsbegriffs. Das vielfach festgestellte vermeintliche ›Definitionsdefizit‹ ist gegebenenfalls nicht nur einer mangelhaften wissenschaftlichen Reflexion geschuldet, sondern »resultiert aus ihrer fast unausweichlichen Einbindung in öffentlich-moralische Diskurse« (Wocken, 2019, S. 3) auf unterschiedlichen Ebenen und in unterschiedlichen Räumen.
Aus einer anderen Perspektive könnte man jedoch auch konstatieren, dass die oft geforderte ›Versachlichung der Inklusionsdebatte‹ eigentlich nicht möglich sei, da eine unauflösliche Verkettung pädagogischer Begriffe mit Werten, Normen und Interessen besteht (Wocken, 2019).
Hazibar und Mecheril sehen in dem Begriff der Inklusion mittlerweile einen leeren, multipel instrumentalisierbaren Signifikanten (Hazibar & Mecheril, 2013; zit. n. Langner et al., 2019) und Katzenbach warnt gar vor einer »regelrechten Verwahrlosung des Begriffs« (Katzenbach, 2015, S. 19).
Im Begriffsdiskurs werden aktuell zudem ein ›weiter‹ und ein ›enger‹ Inklusionsbegriff verhandelt. Im engeren Verständnis liegt der Fokus auf Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung bzw. einem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf (Baumgardt, 2018, S. 28). Eine Gefahr des engen Inklusionsverständnisses ist es, dass Differenzen zwischen den Schüler*innen im Sinne einer ›Zwei-Gruppen-Theorie‹ (vgl. Hinz, 1993; 2003; 2009; 2011) weiterhin zu stark betont werden bzw. sogar erst eine Differenzwahrnehmung seitens der Akteure aufgebaut wird statt sie abzubauen. Die Betonung von Differenzen und vermeintlichen Defiziten durch klassifikatorische Begriffe und Etikettierungen (wie sogenannter ›sonderpädagogischer Förderbedarf‹, aber auch sogenannte ›Inklusionskinder‹) birgt so die Gefahr durch eine zwar gut gemeinte inklusive Förderung die differenzbasierte Wahrnehmung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf noch zu verstärken (Baumgardt, 2018, S. 29). Baumgardt geht davon aus, dass in der deutschen Debatte eigentlich hinter dem Begriff der Inklusion jener der ›De-Segregation‹ verborgen scheint, da ausschließlich Kinder mit sogenanntem sonderpädagogischen Förderbedarf adressiert werden. Im Sinne des Inklusionsverständnisses der UN – mit Ausnahme der UNCRPD (UN, 2006) – werden jedoch alle Kinder mit ihrem je individuellen Lern- und Unterstützungsbedarf entlang unterschiedlichen Dimensionen in den Fokus gerückt (Baumgardt, 2018).
Von einem solchen weiten Inklusionsbegriff ausgehend wird die Differenzierung anhand der »ungleichheitsgenerierenden Kategorien wie Geschlecht, sozioökonomische Herkunft, Ethnie, (Dis)Ability, Religion usw.« gefasst (ebd., S. 29), die auch unter dem Begriff der Heterogenität verhandelt werden. Diese Kategorien beachten zu wenig intersektionale Effekte (zwischen den einzelnen Heterogenitätsdimensionen) und personalisierte, biografisch bedingte Differenzen innerhalb der Dimensionen. Daher sollte man zunehmend eher Phänomene in der Gesellschaft beschreiben, die für die einzelnen Mitglieder Auswirkungen auf die Bildungsverläufe haben können und zu einer Diversität der Schüler*innen beitragen (im Sinne von migrationsbedingter Vielfalt als Herausforderung für die Bildungseinrichtungen statt der gruppenbezogenen Klassifikationen von Schüler*innen mit und ohne Migrationshintergrund). Nach Florian und Camedda (2020) müssten in der Lehrer*innenbildung im Sinne eines weiten Inklusionsbegriffs und der intersektionalen sowie individuellen Differenzen dann breitere Herausforderungen im Zusammenhang mit Migration, Armut, Mobilität und Sprache integriert werden. Da das Bewusstsein für intersektionale Effekte in der Bildungsbenachteiligung mittlerweile gewachsen ist (z. B. Bešić, 2020), geht es in einem umfassenden Inklusionsverständnis generell um alle und um alle Formen von individueller (oder kollektiver) Vielfalt.
Ein solch umfassendes Inklusionsverständnis lässt sich zum Beispiel bei Trescher und Hauk erkennen. Bei Inklusion handle es sich um die relationale Dekonstruktion von Teilhabebarrieren, welche letztlich auch zu einer Re-Konstitution von Raum führe (Trescher & Hauk, 2020). Wenn also mehrsprachige Schüler*innen an Unterrichtssituationen nicht vollständig partizipieren können, da die Unterrichtssprache Deutsch ist, dann ist es nicht nur nötig, die Zweitsprache zu fördern, sondern auch Lernräume und -angebote muttersprachlich bzw. mehrsprachig zu gestalten, Übersetzungen und Sprachunterstützung zu leisten oder das Sprachniveau anzupassen. In Relation zu den Gegebenheiten des Raums werden die Teilhabebarrieren von allen Schüler*innen erfasst. Inklusion als Praxis bestehe dann folglich darin Möglichkeiten zur Teilhabe zu schaffen, damit Raumaneignung ermöglicht wird (ebd.). Räume würden diskursiv geordnet und ausgestaltet, durch Aushandlungsprozesse. Raum wird nach Auffassung der Autor*innen als soziale Praxis konstituiert, in der Form von Praxen der Aneignung. (ebd.). Damit konstituiert Aneignung den Raum, und so müssten raumbezogene Teilhabeprozesse initiiert und gelebt werden. Dies bedeutet, dass es für unterschiedliche Räume (Klassenzimmer, Schule, Hochschule, Pausenhof etc., aber auch virtuelle Räume) differente Teilhabekonzepte braucht.
In dem Diskurs um den Inklusionsbegriff erschweren zudem die nebeneinander existierenden und konkurrierenden deskriptiven, normativen und programmatischen Funktionen, in denen der Begriff Inklusion verwendet wird, ein einheitliches Verständnis (Weinbach, 2020). In einem deskriptiven Sinne werden zum Beispiel Verhältnisse oder Strukturen als inklusiv bezeichnet (wenn sich etwa sogenannte Regelschulen für Schüler*innen mit einem sogenannten sonderpädagogischen Förderbedarf öffnen), im normativen Sinne werden die menschenrechtlichen Implikationen verhandelt (z. B. weitestgehende Partizipation an allen gesellschaftlichen Lebensbereichen) und programmatisch wird der Begriff etwa im Sinne einer Zielsetzung für das Handeln eingesetzt (z. B. inklusive Fachdidaktik).
Ein Begriff mit einer so weiten Extension erscheint so unter Umständen ungeeignet dafür, als gemeinsam getragene Vision die Transformationsprozesse im Akteursnetzwerk der (Lehrer*innen-)Bildung für Inklusion anzustoßen bzw. deren Zielsetzungen und Konsequenzen zu reflektieren. Die so in Ansätzen aufgezeigte Problematik des uneinheitlichen Inklusionsverständnisses macht deutlich: Es ist unausweichlich, dass in Entwicklungs- oder Transformationsprozessen auf einer übergreifenden wie auch auf jeder einzelnen Akteursebene im Mehrebenensystem (auf Basis der einschlägigen Informationen und Dokumente16) Aushandlungs- und Annäherungsprozesse in Bezug auf das Inklusionsverständnis ermöglicht werden. Ohne diese mangelt es in den Akteursnetzwerken an einer gemeinsamen Vision für das Handeln. Daraus ergibt sich: Für die Lehramtsausbildung sollten komprimierte und leicht zugängliche Informationsmaterialien sowie Reflexionsinstrumente entwickelt werden. Diese sollen eine persönliche und kollektive Auseinandersetzung anregen und den Diskurs der Akteure in der Lehrer*innenbildung auf Basis der globalen menschenrechtlichen Dokumente (UN, UNESCO) ermöglichen.
These 117: Eine inklusive Lehrperson verfügt über einen umfassenden Überblick über die Menschenrechte und die völkerrechtlichen Vereinbarungen der UN sowie deren Bedeutung für die Bildung aller und die Gestaltung von Bildungsinstitutionen und -angeboten. Sie nutzt diese Informationen aktiv, um ihr Bildungs- und Inklusionsverständnis und das eigene professionelle Handeln zu reflektieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Für die Lehramtsausbildung sollten daher komprimierte und leicht zugängliche Informationsmaterialien und Reflexionsinstrumente entwickelt werden, die eine persönliche und kollektive Auseinandersetzung sowie und den Diskurs der Akteure in der Lehrer*innenbildung auf der Basis der globalen menschenrechtlichen Dokumente (UN, UNESCO) anregen und ermöglichen.
2.2 Was ist als ›inklusive Bildung‹ zu verstehen?
Im vorausgegangenen Kapitel wurde auf die inflationäre, unkonkrete und divergente Verwendung des Adjektivattributs ›inklusiv‹ in Bezug auf Organisations- und Handlungskonzepte (wie inklusive Bildung, inklusive Didaktik oder inklusive Schulen) hingewiesen. Diese Begriffsunschärfe und -divergenz in Bezug auf Inklusion und inklusive Bildung bestimmt weite Teile des öffentlichen und fachlichen Diskurses, auf der Ebene der Bildungspolitik, der Bildungsadministration, aber auch der schulischen Praxis. Das Desiderat einer Bestimmung des Inklusionsverständnisses (in Anlehnung an die menschenrechtlichen Implikationen) kann so unter anderem zu Missverständnissen, Fehldeutungen und nicht-inklusionskompatiblen Handlungen und Rekonstruktionen von Akteuren in der inklusiven Bildungsreform oder der Praxis führen bzw. diese verstärken.
Für die inflationäre Verwendung des Inklusionsbegriffs lassen sich viele Beispiele im System der Lehrer*innenbildung finden, zum Beispiel in der (un-)differenten Verwendung im Rahmen von Denominationen für Disziplinen, Fächer oder Professuren bzw. Stellen an Hochschulen und im Rahmen von Bezeichnungen von Studiengängen, Modultiteln in Studienangeboten oder -inhalten für Studienangebote. Soweit sich hinter den Denominationen weiterhin selektionsorientierte Konzepte verbergen, muss dies als reiner Etikettenschwindel betrachtet werden – wenn zum Beispiel eine Professur für ›Inklusive Pädagogik im Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung‹ lediglich Lehrangebote innerhalb des Studiengangs Lehramt Sonderpädagogik ausbringt, Diagnostik und Didaktik für die Förderschule vertritt und ein Kompetenzaufbau in den anderen Lehrämtern nicht vorgesehen wird. Die zunehmende Attribuierung zum Beispiel von Schulfächern18 mit dem Begriff der Inklusion sieht Feuser so beispielsweise als ein Paradoxon, das er als »Inklusionismus« (Feuser, 2017a, S. 11) bezeichnet. Ein mangelhaftes Verständnis der menschenrechtlich fundierten Vision und Bedeutung von Inklusion birgt die Gefahr, dass sich wenig oder gar nicht mit den menschenrechtlichen Implikationen kongruente Rekonstruktionen bilden (z. B. durch sogenannte Kooperationsklassen, in denen die Schüler*innen mit Behinderung partiell mit den sogenannten Regelschüler*innen gemeinsam unterrichtet werden). Diese nicht-inklusionskompatiblen Rekonstruktionen bilden sich dann im professionellen Fachwortschatz, im Wissen und in den Handlungskonzepten von Akteuren an Hochschulen ab, werden über die Organisation und das Studium an die nächste Generation der Lehrpersonen weitergegeben und nehmen so auch Einfluss auf die zukünftige Praxis. So werden effektive und nachhaltige Transformationsprozesse zur Inklusion negativ beeinflusst.
Bezugnehmend auf das Inklusionsverständnis der UNESCO beschreibt Ainscow (2020), dass trotz der 25-jährigen Debatte ein Konsens über das, was inklusive Bildung darstellt, schwer fassbar scheint. Es lassen sich jedoch drei wesentliche Bestimmungsmerkmale herausarbeiten (▸ Abb. 1). Im Rückblick auf frühe Dokumente der supranationalen Organisationen (wie UN, UNESCO) lässt sich ein klar konturiertes konzeptionelles Verständnis von inklusiven schulischen Bildungssystemen erkennen. Im Sinne der UN-Organisationen geht es dabei um ein generelles Konzept für Pädagogik und Bildung für alle Lernenden in der Gesellschaft. Dieses umfassende Inklusionsverständnis wurde bereits in der sogenannten ›Salamanca-Erklärung‹ (UNESCO, 1994) grundgelegt, die im Rahmen der ›Konferenz zu einer Pädagogik für besondere Bedürfnisse‹ durch Akteure aller Länder verabschiedet wurde.
»Wir glauben und erklären, [...]
dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat,
dass Schulsysteme gestaltet und Lernprogramme eingerichtet werden sollten, die dieser breiten Vielfalt an Eigenschaften und Bedürfnissen Rechnung tragen,
dass jene mit besonderen Bedürfnissen Zugang zu regulären Schulen haben müssen, die sie in einer kindzentrierten Pädagogik aufnehmen sollten, die ihren Bedürfnissen gerecht werden kann,
dass Regelschulen mit dieser inklusiven Orientierung das effektivste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, um Gemeinschaften zu schaffen, die alle willkommen heißen, um eine inklusive Gesellschaft aufzubauen und um Bildung für alle zu erreichen [...]« (ebd., o. S.; Übers. d. Verf.).
Diese Erklärung hat international eine bedeutend größere Resonanz in der Bildungspolitik und -wissenschaft erfahren als in Deutschland. Sie gilt als das erste offizielle supranationale Dokument, »in welchem der Begriff Inklusion mit einem programmatischen Charakter für die Entwicklung von Bildungssystemen verknüpft worden ist« (Merz-Atalik, 2017, S. 49). Die in diesem Dokument zum Ausdruck kommende Ausgangsannahme inklusiver Bildung ist, dass jede*r Schüler*in einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat, die durch Lernangebote aufgegriffen werden sollen, die auf einer kindzentrierten Pädagogik basieren. Damit heben die Verfasser*innen der Salamanca-Erklärung die Bedeutung der Individuum- und Subjektorientierung im Hinblick auf die Diversität der Bildungsprozesse hervor. Diese Positionen werden im internationalen Diskurs von Inklusionsforscher*innen ebenso als grundlegend für die inklusive Bildung betont. Kefallinou et al. (2020) kamen als Ergebnis eines internationalen Literatur-Reviews19 zum Verständnis von inklusiver Bildung zu dem Resümee:
»Inklusive Bildung ist ein lernerzentrierter Ansatz für das Lehren und Lernen, der darauf abzielt, die Unterschiede zwischen den Lernenden zu überwinden, indem die Optionen, die allen zur Verfügung stehen, erweitert werden, anstatt Aktivitäten nur für einige Lernende zu differenzieren (Florian und Black-Hawkins 2011). Inklusive Bildung vermeidet Praktiken, die Vergleiche, Einstufungen oder Etikettierungen und den Glauben an feste Fähigkeiten beinhalten (Swann, Peacock, Hart und Drummond 2012). Im Gegenteil, die inklusive Bildung verfolgt einen ›personalisierten‹ Ansatz für das Lehren und Lernen, bei dem die Lehrpersonen ihre Ansätze und Ressourcen an die Bedürfnisse jedes einzelnen Lernenden anpassen (Rowe, Wilkin und Wilson 2012)« (ebd., S. 9; Übers. d. Verf.).
Inklusive Bildung versteht sich nach Ainscow (2020) als ein Prinzip der Unterstützung und Wertschätzung von Vielfalt unter den Lernenden. Gleichzeitig verfolgt sie das Ziel, soziale Exklusion – welche aus diskriminierendem Verhalten aufgrund von Rasse, sozialer Klasse, Ethnizität, Religion, Gender und Fähigkeitserwartungen resultiert – zu eliminieren. Inklusive Bildung »geht von der Überzeugung aus, dass Bildung ein grundlegendes Menschenrecht und die Grundlage für eine gerechtere Gesellschaft darstellt« (Ainscow, 2020, S. 124; Übers. d. Verf.).
Abb. 1:Die drei wesentlichen Bestimmungsmerkmale des Inklusionsverständnisses der UN im Zusammenhang mit einem inklusiven Bildungssystem (nach Merz-Atalik, 2017, S. 51)
Bei inklusiver Bildung geht es somit nicht um ›gruppenspezifische‹ Konzepte20 im Sinne der Integration bzw. ›De-Segregation‹ (Baumgardt, 2018) von bislang marginalisierten oder diskriminierten Gruppen in das für eine Majorität konzipierte Bildungssystem. Nicht die Differenz im Hinblick auf sich bildungsbezogen auswirkende Heterogenitätsdimensionen, sondern die generelle Diversität und Vielfalt von Lernenden sollte handlungsleitend für die Gestaltung von Bildungs- und Lernangeboten sowie die Lehrer*innenbildung sein. Im Sinne eines weiten Inklusionsverständnisses stellt das Konzept der inklusiven Bildung im Idealfall also den selbstverständlichen Umgang mit der generellen Lernervielfalt in einem Universal Design für das Lernen21 mit dem Ziel der vollständigen Teilhabe dar (▸ Abb. 1). Inklusive Bildung basiert auf einer lernerbezogenen Subjektorientierung im Rahmen von diversitätsgerechten Strukturen, Curricula und Lehr-/Lernmethoden (ebd.). Da die inklusive Pädagogik das Ziel einer vollen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft für alle anstrebt, wird Inklusion als dauerhafter Prozess unter der Teilhabe der gesamten Gesellschaft verstanden. Im Sinne einer kulturellen Transformation erfordert dieser Prozess unbedingt die Partizipation der gesamten Gesellschaft und ihrer Organisationen. Er versteht sich explizit als eine Abkehr von den »Zwei-Gruppen-Theorien« (Hinz, 2002, S. 357).
These 2: Eine inklusive Lehrperson versteht sich grundsätzlich als Lehrer*in für alle Schüler*innen. Sie weiß um Formen und Ausmaße der Diskriminierung in Bildungs(-systemen), die negativen Effekte gruppenbezogener Klassifikationen und defizitorientierter Etikettierungen. Sie reflektiert ihr Denken und Handeln im Hinblick auf die Anerkennung der Diversität der Lernenden und setzt sich engagiert für die Berücksichtigung der generellen Diversität und Vielfalt der Schüler*innen in einem Universal Design ein.
Daraus ergibt sich: Schultypen- oder Schülertypen-bezogene Professionsbilder und -rollen im Lehramt und ebensolche Strukturen im System der Professionalisierung sollten von gruppenbezogenen Differenzparadigmen Abstand nehmen und im Sinne einer diversitäts- und subjektorientierten Professionalisierung aller Lehrpersonen weiterentwickelt werden. Ainscow (2020; in Anlehnung an Bešić, 2020) betont im Weiteren die intersektionale Perspektive der Inklusion auf verschiedene Diversitätsdimensionen und problematisiert, wie die wechselseitige Verflechtung sozialer Kategorisierungen wie Rasse, Klasse und Geschlecht zu diskriminierenden Prozessen führt.
Bereits in früheren Publikationen haben Ainscow et al. (2006) eine Definition von Inklusion für strategische Zwecke erarbeitet, die eine starke Orientierung für die Transformation des Bildungssystems aufweisen sollte. Inklusion im Bildungswesen sollte:
»... als Prozess betrachtet werden. Inklusion muss als eine nie endende Suche nach besseren Wegen gesehen werden, auf Diversität zu reagieren. Es geht darum zu lernen, wie man mit Unterschieden lebt und wie man aus ihnen lernt. Auf diese Weise werden Unterschiede positiver gesehen als Anregung für die Förderung des Lernens, zwischen beiden, Kindern wie auch Erwachsenen.
... sich mit der Identifizierung und Beseitigung von Barrieren befassen. Das beinhaltet die Sammlung, das Zusammenstellen und die Auswertung von Informationen aus einer Vielzahl von Quellen innerhalb bestimmter Kontexte, mit dem Ziel für Verbesserungen in Politik und Praxis zu planen. Es geht auch um die Nutzung von Evidenzen verschiedener Art, um Kreativität und Problemlösung anzuregen.
... die Verbesserung der Präsenz, der Partizipation und der Entwicklung aller Schüler*innen fokussieren. Bei Präsenz geht es hier darum, wo die Kinder unterrichtet werden, wie verlässlich und punktuell sie anwesend sind; Partizipation bezieht sich auf die Qualität ihrer Erfahrungen, während sie anwesend sind, und daher müssen die eigenen Sichtweisen der Lernenden einbezogen werden; bei Entwicklung geht es um die Ergebnisse des Lernens über das gesamte Curriculum, nicht nur um Test- oder Prüfungsergebnisse.
... ein besonderes Augenmerk auf jene Gruppen von Lernenden richten, die von Risiken der Marginalisierung, Ausgrenzung oder unzureichenden Entwicklungen betroffen sind. Dies verweist auf die moralische Verantwortlichkeit sicherzustellen, dass diejenigen Gruppen, die statistisch gesehen am meisten gefährdet sind, sorgfältig beobachtet werden; dass gegebenenfalls Schritte unternommen werden, um ihre Präsenz, ihre Partizipation und ihre Entwicklung innerhalb des Bildungssystem zu gewährleisten. Gleichzeitig ist es notwendig, Ausschau zu halten nach Lernenden, die möglicherweise übersehen werden« (Ainscow et al., 2006, zit. n. Ainscow, 2020, S. 127; Übers. u. Hervorh. d. Verf.).





























