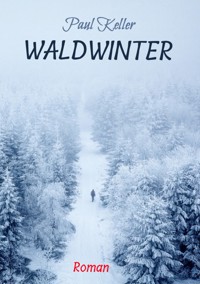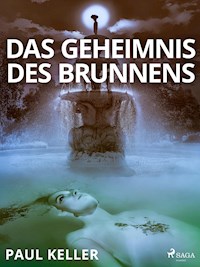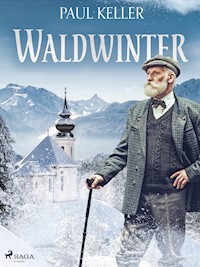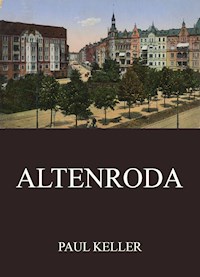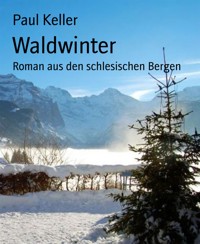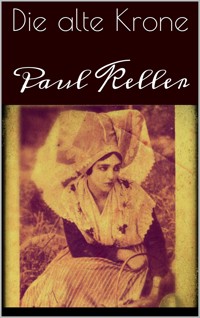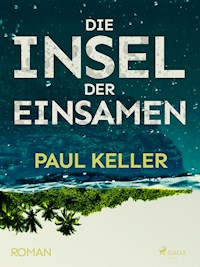
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Als Günther, Freier von Echtelfingen, dem faulen Fischer und Inselwärter Kajetan begegnet, entscheidet das nicht nur über Günthers weiteres Geschick. Denn er lässt sich von dem widerstrebenden Kajetan von der geheimnisvollen, wie verflucht wirkenden Insel der Einsamen erzählen, auf der nur "Pessimisten" leben, allen voran Graf Reinhold mit seiner Tochter Klotildis. Fremden ist das Betreten der Insel strengstens verboten. Doch als Günther durch sein Fernrohr einen Blick auf die schöne Klotildis, das "Dornröschen" der Insel, erhascht, ist es um ihn geschehen; er fesselt den Inselwächter und setzt selbst in dessen Boot über ... Mit Spannung verfolgt der Leser diese seltsame und tragische, zugleich traurige und doch sehr heitere Geschichte einsamer, gebrochener und verbitterter Menschen sowie ihren langen Weg bis zur Erlösung aus ihrem traurigen Los. Paul Kellers "Insel der Einsamen" ist eine köstliche, zugleich ergreifende wie erhebende dichterische Verklärung all des Jammers und Elends, wie es auch uns das banal-hastige Alltagsleben tagtäglich beschert. Seine idyllischen Schilderungen voll zarter Anmut und Schönheit sind genauso künstlerisch vollendet wie die dramatischen Szenen voll glühender Lebendigkeit und prächtiger Farbigkeit packend sind, und über allem liegt der zauberhafte Hauch eines modernen Märchens.Paul Keller (1873–1932) wurde als Sohn eines Maurers und Schnittwarenhändlers geboren. Zwischen 1887 und 1890 besuchte er die Präparandenanstalt in Bad Landeck und anschließend von 1890 bis 1893 das Lehrerseminar in Breslau. Nachdem er acht Monate als Lehrer im niederschlesischen Jauer tätig war, wechselte er 1894 als Hilfslehrer an die Präparandenanstalt in Schweidnitz. Zwischen 1896 und 1908 war er Volksschullehrer in Breslau. Keller gründete die Zeitschrift "Die Bergstadt" (1912–1931) und schrieb schlesische Heimatromane sowie "Das letzte Märchen", eine Geschichte, in der ein Journalist in ein unterirdisches Märchenreich eingeladen wird, um dort eine Zeitung aufzubauen, und dabei in Intrigen innerhalb des Königshauses hineingerät. Die Namen wie "König Heredidasufoturu LXXV.", "Stimpekrex", "Doktor Nein" (der Oppositionsführer) haben wahrscheinlich Michael Ende zu seinem Roman "Die unendliche Geschichte" angeregt. Zusammen mit dem schlesischen Lyriker und Erzähler Paul Barsch unternahm Keller zwischen 1903 und 1927 zahlreiche Reisen durch Europa und Nordafrika. Zudem führten ihn etliche Lese- und Vortragstourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei. Er war 1910 Mitglied der Jury eines Preisausschreibens des Kölner Schokoladeproduzenten Ludwig Stollwerck für Sammelbilder des Stollwerck-Sammelalbums Nr. 12 "Humor in Bild und Wort". Keller starb am 20. August 1932 in Breslau und wurde auf dem dortigen Laurentiusfriedhof bestattet. – Paul Keller gehörte zu den meistgelesenen Autoren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, was sich in einer 1931 bei fünf Millionen liegenden Gesamtauflage seiner Bücher widerspiegelt, und wurde in 17 Sprachen übersetzt. Schriftsteller wie der alte Wilhelm Raabe oder Peter Rosegger schätzten den Autor sehr. Gerade die früheren Werke wie "Waldwinter", "Ferien vom Ich" oder "Der Sohn der Hagar" zeichnen sich durch künstlerische Kraft und Meisterschaft aus. Seinen Roman "Die Heimat" (1903) nannte Felix Dahn "echte Heimatkunst". Seine bekanntesten Werke wurden zum Teil auch verfilmt.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paul Keller
Die Insel der Einsamen
Eine romantische Geschichte
Saga
Die Insel der Einsamen
© 1923 Paul Keller
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517376
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Das erste Kapitel.
Die Vorgeschichte der Insel.
Das, was ich hier erzähle, steht in Raum und Zeit; denn da es in meiner Seele ist, muss es auch noch sonstwo gewesen sein. Wenn Ihr mich aber befragt nach Jahr und Land, Orts- und Zeitgrenze, so muss ich Euch sagen, dass ich kein Geograph und Historiker, sondern ein Fabulant bin, der das schöne Recht hat, auf solche Fragen zu antworten: Ich lass mir meine Singvögel in keinen Stall sperren, und Ihr dürfet dreist einem Fabulanten mehr glauben als einem Geschichtsschreiber. Wen es jedoch gar zu sehr nach der Zeitfolie verlangt, dem will ich sagen, dass über die Jahre, da neben dem Herrgott nur der Kaiser Napoleon auf der Erde regierte, vielerlei Kriegs-, Hof- und andere Geschichten entstanden sind, mir aber abseits vom grossen Welttheater jener Zeit eine romantische Mär erwuchs, mit der ich nun beginne.
Irgendwo in deutschen Landen rann ein Fluss, der seltsame Manieren hatte. Es kam vor, dass die Wasser in seinem Lauf uneins untereinander wurden, wie es zuweilen bei den Völkern eines Bienenstockes geschieht, und dass dann die Hälfte des Gewässers ausschwärmte, zur Seite wich und einen eigenen Weg ging. Während aber die ausgewanderten Immen nicht wieder in den alten Stock zurückkehren, besannen sich die abtrünnigen Gewässer des Flusses immer recht schnell wieder auf die alte Heimat, schlichen in gedrückter Stimmung zurück und wurden vom alten Mutterstrom mit etwas Gebrumme zwar, aber doch herzlich gern wieder aufgenommen.
Wenn sich in einem Flusse solche Dinge ereignen, dann bilden sich Inseln, nicht so grosse, wie sie draussen im offenen Meere liegen, aber doch Inseln, kleine, rings von Wasser bespülte Eilande. Und alle Inseln haben ein Eigenleben, auch wenn sie vom „festen Lande“ nur einen Steinwurf weit entfernt liegen. Es ist, als ob das Wasser eine Isolierschicht um sie legte, so dass viele Ströme des gemeinen Lebens nicht zu ihnen gelangen können.
Die grösste Insel, die der Fluss bildete, hiess seit alter Zeit die „Fraueninsel“, wie es deren viele in der Welt gibt, überall da, wo frommer Sinn der Gottesmutter, „Unserer lieben Frau“, auf einem Eiland ein Kirchlein errichtete. Das Kirchlein unserer Insel lag auf einem Hügel und war von den Mönchen gegründet, die auf der Ostseite des Flusses ihr reiches Klostergut hatten und denen die Insel so lange gehörte, bis die Herren von Höffingen, die auf der Westseite des Flusses sassen, meinten, den Mönchen erginge es schon allzugut, und es sei empfehlenswert, dass sie ihnen die Insel, die gutes Acker- und Wiesenland sowie schönen Waldbestand aufwies, ohne Kaufbrief und andere Formalitäten auf gut Räuberrecht abnähmen. Der Bischof tat auf die Klage der Mönche hin die von Höffingen in den Bann, aber die Kerle machten sich nichts daraus, sondern behielten die Insel und bauten sich auf der zweiten Anhöhe des Eilands ein Lustschlösslein, allwo es oftmals sehr wild zugegangen sein soll. Zwei Jahrhunderte vergingen, der Bann war ins Vergessen geraten, die Höffingen waren immer noch die Herren der Insel.
Aus jener Zeit stammt die Sage vom Liebesbrunnen. Ein fahrender Spielmann, der sich Volker nannte wie sein grosser Vorfahr aus der Nibelungenzeit, kam auf die Insel und wurde im Lustschloss als gerngesehener Gast aufgenommen. Und da ereignete sich das, was so oft im Laufe der Zeiten geschah: ein Edelkind fiel in Liebe zu einem gemeinen Manne, des Grafen von Höffingen blondes Töchterlein Irmtraud entbrannte in heisser Glut zu dem jungen Spielmann und er zu ihr. Des Nachts, wenn alles schlief, lockte eine zarte Liebesweise das schöne blonde Kind nach dem Walde, wo der liederkundigste Mund sie küsste und von den Wonnen der Jugend sprach. Ach, der Graf entdeckte das zarte Geheimnis, und er war ein roher, jähzorniger Mann, wilder Phantasie voll, wenn es galt, jemanden zu strafen, der seinen Groll erregt hatte. Die Schlosswächter — drei an der Zahl — liess er henken, seinem Kinde und dem Spielmann ersann er eine besondere Strafe.
„Liebtest du meine Tochter?“ fragte er mit böser Arglist den Spielmann, der vor seinem Richterstuhle stand.
„Ich liebe sie tausendmal mehr als mein Leben,“ sagte Volker.
„Und glaubst du, was jener spricht?“ wandte sich der Graf an seine Tochter.
„Ich glaube es,“ sagte sie, und ihre trüben Augen wurden hell.
„Nun wohl,“ versetzte der Graf, „so wollen wir die Probe machen, ob er dich wirklich mehr liebt als sich selbst.“
Auf der Insel stand ein Ziehbrunnen. Er streckte einen hölzernen Arm empor, der sich niederneigte, wenn es galt, Wasser zu schöpfen. Dann stand der Brunnenschwengel auf einen Augenblick wie eine Wage. Darauf gründete der Graf seinen barbarischen Racheplan. Er liess sein Töchterlein in den Schöpfeimer hineinbinden, so dass sie über dem Brunnenschacht schwebte, und liess als Gegengewicht an den anderen Arm des Brunnenschwengels den jungen Spielmann an einem dünnen Faden aufhängen. Dann gab er ihm ein haarscharfes Messer in die Hand und sprach mit teuflischem Hohn:
„Wenn du sie nun mehr liebst als dein Leben, so bleib’ hängen, und sie ist gerettet; willst du aber nicht sterben, so schneide dich los, und sie fährt zur Tiefe!“
Nie stand eine schrecklichere Wage auf dem Erdenstern. Der Spielmann schleuderte das Messer weit von sich. Als aber die schaurige Not um Luft und Lebensatem eintrat, reichte ihm der Graf das Messer zum zweiten Male.
„Schneide dich los, und du bist frei!“
Der Spielmann liess das Messer fallen.
Die Todesangst kam, der Mund öffnete sich, die Zunge trat heraus, der Körper zuckte. Da gab der Graf dem Sterbenden zum drittenmal das Messer. Der hob mit der letzten Kraft der Verzweiflung die Klinge über sein Haupt — der Graf trat dicht vor ihn, sah ihm in das verzerrte Gesicht — und es senkte sich die Hand blitzschnell, und das Messer sass dem Grafen im Herzen. Er starb mit dem Spielmann zur selben Sekunde, und ihre grollenden Seelen traten zusammen vor Gott.
Die schöne Irmtraud wurde vom Volke befreit und als Gräfin und Herrin ausgerufen. Sie liess den Leichnam ihres Vaters in den Fluss werfen, den Krebsen und Fischen zum Frass, und errichtete dem Geliebten ein kostbares Denkmal von Marmor aus dem Lande Italia. An seinem Grabe sass sie oft mit geschlossenen Augen, und wenn ein Vogel ganz weich und zärtlich im Geäste sang, lächelte ihr bleicher Mund.
Der Ziehbrunnen aber wurde berühmt im ganzen Reiche. Sein Wasser war von wundertätiger Wirkung. Wer von ihm trank, war gefeit gegen alle Untreue, weshalb junge Mädchen mit diesem Wasser heimlich ihren Liebsten den Wein mischten; es galt aber auch als Schutzmittel gegen allerhand Roheiten, so dass geplagte Ehefrauen sich von ihm eine Flasche voll holten, die sie in ihr Waschwasser ausgossen, auf dass es nicht so schmerze, wenn sie geschlagen wurden. Es war eine herbe Zeit.
Die schöne Irmtraud blieb unvermählt und starb als die letzte ihres Stammes, worauf die Klosterbrüder die Insel wieder besetzten, die ihnen aber schon nach fünf Jahren von dem neuen Edelgeschlecht am Westufer des Flusses, denen von Heyburg, abgenommen wurde. Die Heyburger kamen in den Bann, machten sich nichts daraus ... es ging alles wie damals.
Und auch mit den Heyburgern nahm es ein böses Ende auf der Insel. Der letzte von ihnen war schon hoch in Jahren, als er ein junges Weib ehelichte und damit das tragische Schicksal von König Marke und Isolde auf sich herabbeschwor. Wenn Sommer und Winter in einen Bund treten wollen, liegt böser Herbststurm in der Mitte.
Ob wirklich ein Tristan durch Frau Sophiens Leben ging oder ob es nur niederträchtige Zungen waren, die den Alten an ihr irre werden liessen, weiss niemand genau. Die eine Kunde aber erfüllte mit Entsetzen das Land, dass ein furchtbarer Streit sich erhoben habe zwischen dem alten Herrn und seiner jungen Frau, dass er sie verfolgte, als sie vor dem Rasenden floh, dass sie durch den Fluss nach der Insel schwamm, dass er ihr auch dahin folgte und die Unglückliche, die sich in das Gnadenkirchlein geflüchtet hatte, vor dem Bilde Mariens, „der Zuflucht der Sünder“, erschlug.
Der alte Heyburg trank und lachte darauf drei Tage und drei Nächte lang und war voll wilder Freude; dann kamen die Diener des Gerichts und holten ihn ins Gefängnis. Er wurde aber bald freigelassen, ledig gesprochen aller Sühne. Aber er lachte, nicht, als er auf die sonnige Strasse trat. Er beichtete einem Mönch seine Sünden, doch sein Auge wurde nicht mehr froh. Durch die Welt irrte er und dort, wo sie am schönsten und friedlichsten war, weinte er oder träumte. Vor jedem Christusbild, das am Wege stand, erschrak er; jedes junge Weib, das er sah, war ihm ein qualvoller Anblick, und jedes Kinderlachen erweckte ein brennendes Heimweh in ihm.
Von allen diesen Gefühlen war das Heimweh nach dem Kinde das stärkste. Aller innere Kampf dagegen nutzte nichts; weit in der Ferne winkten zwei kleine, unschuldige Hände, winkten Tag und Nacht durch laute Lust und tiefe Einsamkeit, und eines Tages war der alte Heyburg daheim. Er rief den Knaben und sah ihm lange prüfend ins Gesicht; es war aber, als ob er ins Antlitz der Sphinx schaue: er sah nur die Züge seiner Frau. Ein paarmal war er kurz und barsch zu dem Kleinen, sonst war er gut zu ihm, und bei seinem Tode sagte er: „Mein Sohn, Gott segne dich!“
Nach dem Testament des alten Heyburg kam der Knabe zu den Mönchen auf dem Ostufer des Flusses zur Erziehung; das Gut, dessen Herrenschloss von marodierenden Kroaten niedergebrannt worden, war an profitlustige Händler verkauft worden, die es parzellierten.
Als das Kind zehn Jahre alt war, zog es mit den Klosterbrüdern in die Verbannung. Politische Machthaber hatten das Klostergut auf der Ostseite des Flusses „säkularisiert“, sich also noch sehr viel weniger um Kaufbriefe und derartige Formalitäten geschert wie ehedem die Höffingen und Heyburger.
Schöner und besser war es durch die neue Zeit am Flussufer nicht geworden: hüben kleine, kümmerliche Ackerbauern, die das erworbene Feld den Unternehmern viel zu teuer bezahlt hatten und nun ein jämmerliches Leben führten, um die Zinsen aufzubringen; drüben ein Reichsfürst, der das Klostergut um ein Lumpengeld „gekauft“ hatte und sich im übrigen das ganze Jahr in der „öden Gegend“ nicht sehen liess, so dass das zu einem Herrensitz gewandelte prachtvolle Kloster eigentlich nur noch von Lakaien bewohnt war. Vor dem alten Portal, vor dem ein Kunsthistoriker oder Architekt in Träume versinken konnte, pendelte nun zeitweilig ein Portier in einer hanswurstigen Livree einher; im alten Refektorium spielten alberne Bediente alberne Kartenspiele, und in einen Palma vecchio stiess ein Stubenmädel mit dem Kehrbesen ein Loch, worauf sämtliche „Schlossinsassen“ das beruhigende Urteil abgaben, um solch altes Gerümpel sei es nicht schade.
Ein heftiger Streit entspann sich um die Insel. Der durchlauchtigste Reichsfürst, der das Klostergut unter so günstigen Umständen gekauft hatte, besass einen pfiffigen Justitiarius, der nichts anderes zu tun hatte, als tagaus, tagein die „verbrieften Rechte seines hohen Herrn“ wahrzunehmen. Und als solches Recht erachtete dieser es auch, dass die „Insel“ nicht den Juden drüben gehöre, die — pfui Teufel! — „ein Gut schlachteten“, sondern dem allergnädigsten Herrn eigne, der das Klostergut gekauft hatte. Die Insel, meinte der Herr Doktor, sei ursprünglich und nachweislich Besitztum der Mönche gewesen, die ihr Besitzrecht formell niemals aufgegeben hätten, wie aus ihren Protesten, den verschiedenen Bannsprüchen usw. genugsam hervorgehe. „Res clamat ad dominum.“
Der Ausgang des Prozesses war der, dass der Reichsfürst mit seiner Klage abgewiesen, die Insel also den Händlern zugesprochen wurde.
Aber auch die Händler hatten mit der Insel, die ihnen nun gehörte, kein Glück. Das Eiland war verrufen. Entheiligt war die Kapelle, in der Blutschuld geschah, verloren war der Zauber des Liebesbrunnens, aus dem Graf Heyburg und seine Frau am Hochzeitstage Treue getrunken und der seine Kraft so schlecht bewährt hatte. Die Frauen mieden die Insel, die Hütejungen sträubten sich, ihre Herden hinüberzubringen, die Fischer hielten sich fern von ihrer Küste. Ach, das Volk war so furchtsam und so abergläubisch, dass nicht einmal die billigste Graspachtung sie verlocken konnte, auf verrufenem Gebiet ihr Leben zu riskieren. Die Händler zogen in die Ferne, anderen Grosstaten entgegen, und das Eiland lag verödet.
Nach einigen Jahren hiess es, allerhand lichtscheues Volk habe sich auf der Insel angesiedelt. Niemand kümmerte sich darum, nur wurde das Eiland von der Uferbevölkerung jetzt noch strenger gemieden, und die Bauern schraken zusammen, wenn ein Schuss oder ein Hammerschlag von dem bösen Grunde herüberschallte.
So blieb es, bis sich eines Tages die abgearbeiteten Bauersleute auf der Westseite wie die pokulierenden Lakaien auf der Ostseite gleichzeitig erzählten, etwas Grosses habe sich ereignet: ein fremder, finster aussehender Mann sei gekommen und habe von der Insel Besitz ergriffen. Er sei ein Graf und heisse Raimund. In seiner Gesellschaft sei ausser einiger Dienerschaft nur ein zehnjähriges Mädchen gewesen. Eine Reihe von Wagen mit allerhand Möbeln und Gerät war auf der Landstrasse erschienen. Fremdes Arbeitsvolk hatte alle diese Sachen nach der Insel gebracht, die einheimischen Bauern waren nicht eines Dienstes oder Wortes gewürdigt worden. Die fremden Arbeiter waren mit den Wagen wieder verschwunden; im alten, seit langer Zeit leeren Fischerhause am Strande aber war ein Fischer namens Kajetan mit seinem jungen Weibe angesiedelt worden, und der Graf hauste mit seinen Bedienten und dem Kinde auf der Insel.
Das war es, was die Bauern und was die Lakaien wussten. Mehr erfuhren sie nicht. Der neue Herr der Insel schickte keinerlei Botschaft nach dem alten Klosterhaus, und mit den Bauern am anderen Ufer gab sich auch niemand ab. Da übrigens das Kloster eine halbe Stunde stromaufwärts und die Bauernhäuser eine halbe Stunde stromabwärts lagen, alles verborgen hinter hügeligem Waldland, so war die Insel völlig vereinsamt, und es vergingen Tage, ja Wochen, ohne dass ein fremder Blick sie streifte.
Auf der Insel selbst aber mehrte sich dennoch die Bevölkerung. Finstere Gesellen zogen ein, die nie einen ihresgleichen am Uferland ansahen oder grüssten, Handwerker, Bauern und anderes Volk. Es wurde eine ganze Anzahl von Häusern und Gehöften auf der Insel errichtet, alles von fremden Zimmerleuten aus Holz aufgebaut. Die Zimmerleute kamen und verschwanden wieder, ohne dass sie mit der Uferbevölkerung in irgendeine Verbindung getreten wären. Ja, selbst ein Stücklein Vieh wurde bei keinem Bauern gekauft. Dagegen sahen die Stromansassen oft Lastkähne den Fluss herabkommen, Fahrzeuge, auf denen allerhand Haus- und Ackergeräte und auch Kühe, Pferde, Ziegen und Hühnervolk verladen waren. Die Schiffe kamen von weit her, landeten nur an der Insel und verschwanden wieder, wenn sie ihre Ladung abgesetzt hatten.
Dieses geheimnisvolle Treiben beschäftigte die Uferbevölkerung durch viele Jahre. Alte Märchen wachten wieder auf, neue Sagen entstanden, und alle Gerüchte, die um die Herdfeuer summten oder um die Schenktische der Wirtshäuser schwirrten, wurden geglaubt. Viele meinten, der Graf sei einer, der sich dem Teufel verschrieben habe und Spiessgesellen werbe, die in der Welt allerhand böse Gewerbe getrieben hätten und nun auf der Insel eine Zuflucht fänden. Ein Bauer, der nach der Insel zog und dort Aufnahme fand, war in der Stadt, die ein bis zwei Wegstunden unterhalb der Insel lag, von einem Herbergswirt als ein früherer Totschläger erkannt worden.
Christenmenschen konnten es nicht sein. Niemals wieder klang das Glöcklein von der Frauenkapelle herüber übers Wasser. Böse Geister trieben ihr Spiel auf der Insel, und der Rat jener Stadt, die stromabwärts der Insel lag, wurde von der Bevölkerung ermahnt, achtzugeben, dass sich nicht unweit der Stadtmauern ein gefährliches Räuber- und Diebsvolk einniste.
Die Insel blieb verfehmt. Nur der Fischer Kajetan, den der Graf als Fährmann ans Ufer gesetzt hatte, galt nicht als gefährlich. Die Leute sagten nur, dass er sehr hochmütig und sehr faul sei.
Das zweite Kapitel.
Der Fischer Kajetan feierte seinen Namenstag. Deshalb arbeitete er nicht. Wenn er nicht den Namenstag hatte, arbeitete er auch nicht. Es war eine schöne Gleichmässigkeit in seinem Leben.
Falls Kajetan überhaupt einmal etwas tat, tat er es nur zu seiner Unterhaltung. So, wenn er seinem Knecht Befehl gab, wie er die Fischreusen auslegen, oder wie er einen Pfahl oder eine Planke teeren, oder zu welchem Preise er die Barsche und zu welchem die Schleien verkaufen sollte. Der Knecht beachtete diese Befehle niemals, aber Kajetan hatte das Gefühl, er sei ein tüchtiger Mann seines Gewerbes, überall vonnöten und überall die wichtigste Person.
Am Morgen dieses schönen siebenten Augusttages nun lag Kajetan im Grase am Ufer des Flusses, ganz in der Nähe seiner Fischerhütte, blies den Rauch seiner Pfeife in die sonnenblaue Luft, blinzelte manchmal schläfrig über die Wasserfläche nach der Insel hinüber und gähnte oder betrieb einen lässigen Kampf mit einer Brummfliege, die seine grosse Spitzbubennase bedrohte. So befand er sich wohl und hatte nur den einen Wunsch, dass der Knecht nicht allzuspät aus der Stadt zurückkommen und ihm die bestellte Flasche Wacholderschnaps bringen möge.
Die Luft war still, die Sonne schien warm, das Wasser gluckste träumerisch am Ufer, und Kajetan schlief ein. Als er aber kaum zwei Stunden geschlafen hatte, rüttelte ihn eine kräftige Hand an der Schulter, und eine lachende Stimme sagte:
„Heda, Mann, tut Euch keinen Schaden; denn Eure Nase singt ein so lautes Lied, dass sie heiser werden wird, und es wäre schade um ihre schöne Stimme.“
„Meine Nase geht Euch nichts an,“ sagte Kajetan verschlafen und rieb sich die Augen. „Wer seid Ihr?“
„Dieser oder jener,“ erwiderte der Fremde leichthin, „ich möchte nur gern hinüber nach der anderen Seite — ins Klösterliche — und da ich vermute, dass Ihr der Fährmann seid, so muss ich Euch zu meiner Betrübnis aus dem wohlverdienten Schlummer wecken.“
„Hinüber ins Klösterliche?“ wiederholte Kajetan gähnend. „So wartet, bis mein Knecht aus der Stadt zurück ist, er kann nicht mehr lange sein.“
„Ja, könnt Ihr selbst mich denn nicht hinüberfahren?“ fragte der Fremdling. „Ich sehe doch, dass Euer Kahn leer steht und dass Ihr auch Zeit habt!“
„Zeit! — Zeit hat jeder! Aber seht, mein Knecht ist ein fauler Bursche. Er tut den langen lieben Tag nichts, und ich sehe nicht ein, warum ich eine Arbeit, wenn es wirklich einmal eine solche gibt, für ihn verrichten sollte.“
„Das ist richtig, edler Meister!“ erwiderte der Fremdling belustigt und setzte sich zu Kajetan ins Gras. „Man soll sich nie überstürzen. Wenn die Menschen alles doppelt so langsam täten, als sie es tun, gäbe es doppelt mehr glückliche Leute auf der Welt.“
Kajetan sah ihn beifällig an und dachte bei sich: dieser ist ein Mann von Bildung, den du über dies und das ausfragen kannst. So sagte er:
„Bleibt immer ein wenig bei mir. Es liegt sich gut hier. Und wenn Ihr mir einen Gefallen tun wollt, so erzählt mir was. Wir leben hier so einsam und verlassen, dass wir nicht das mindeste von dem wissen, was in der Welt vorgeht.“
„Kommt Ihr nicht manchmal nach der Stadt?“
„Nein, bis nach der Stadt sind es anderthalb Stunden Weg, und ich sehe nicht ein —“
„Ihr seht nicht ein,“ unterbrach ihn der andere, „warum Ihr dahin nicht lieber Euern Knecht gehen lassen sollt. Da habt Ihr ganz recht!“
„Ja,“ sagte Kajetan; „er ist sowieso ein fauler Bursche, er soll nach der Stadt gehen, nicht ich!“
„Erzählt er Euch denn nichts, wenn er zurückkommt?“
„Keine Spur! Er ist sehr dumm und heimtückisch. Ich sehne mich immer nach Neuigkeiten; aber es ist niemand da, der mir etwas erzählt. Wir sind ja hier wie verschollen. Alle Leute, die in den Dörfern hier herum und in der Stadt leben, sind sehr dumm und schlecht. Da freut man sich, wenn einmal einer kommt, der in der Welt herum ist. Das seid Ihr doch? Denn so seht Ihr aus! Ihr könnt nicht aus der Gegend sein!“
Der Fremde, ein starker schöner Jüngling in schmucker Wandertracht, nickte mit dem Kopf und sagte, ja, er sei weit her und es passiere schon so allerlei draussen in der Welt, und wenn es Herrn Kajetan recht sei, wolle er ihm gern einige pläsierliche Neuigkeiten zum besten geben.
Darauf erzählte der Fremde der Reihe nach, dass die Griechen mittels eines hölzernen Pferdes die Stadt Troja erobert hätten, dass eine andere Stadt, namens Pompeji, von einem feuerspeienden Berg zerstört worden sei, und dass ein Mönch, namens Berthold Schwarz, das Schiesspulver erfunden hätte.
Kajetan hatte gespannt zugehört und sagte zum Schluss: „Von all dem erzählt mir mein Knecht, der Halunke, kein Wort und hat es gewiss doch auch schon gehört.“
„Ein Mönch — soso, ein Mönch macht das Pulver?“ fuhr er fort. „Dann gehöre ich zu seiner Kundschaft; denn ich habe auch eine Flinte und schiesse auf tausend Schritt eine Möwe im Fluge. Ich sollte sogar drüben Jäger werden.“
Er wies mit seiner Tabakspfeife hinüber nach der Insel, die im blendenden Glast der höher steigenden Sonne lag. Der Fremdling lauschte auf.
„Da drüben auf der Insel solltet Ihr Jäger werden? Wolltet Ihr denn nicht?“
„Nein,“ sagte Kajetan, „es geht mir dort zu stupid zu.“
„Aber Ihr seid bekannt auf der Insel?“
Kajetan lächelte hochmütig.
„Ich heisse Kajetan und bin der Vertrauensmann des Grafen Raimund, und ohne mich gäbe es diese Insel gar nicht.“
„Wieso?“
Kajetan zuckte die Achseln.
„Ja, wieso! Eine Insel ist eigentlich keine Insel, müsst Ihr wissen. Und zwar warum? Weil Wasser darum herum ist und weil man auf dem Wasser fahren kann. Was nützt eine Insel, wenn jeder, dem es einfällt, auf seinem Kahne hinfahren kann oder wenn die Leute, die auf der Insel wohnen, von ihr herunterkönnen?“
Der Fremde sann diesen Worten nach, ohne ihren tieferen Sinn zu begreifen.
„Erklärt es mir näher,“ bat er.
„Das will ich tun,“ sagte Kajetan, „denn Ihr habt aus dem, was Ihr wisst, auch kein Geheimnis vor mir gemacht. Diese Insel ist die Insel der Einsamen, und die Leute, die darauf wohnen, heissen Pessimisten.“
Der junge Mann sah verdutzt auf den armseligen Fischer.
„Pessimisten? — Woher habt Ihr dieses Wort?“
Kajetan lächelte wieder.
„Ja, ich behalte mir viel in meinem Kopf, auch dieses schwere Wort! Und ich hab’s von einem, der drüben auf der Insel wohnt. Der war früher ein Dichter, und jetzt ist er mein Freund. Er war der grösste unter allen Dichtern; aber die Leute kauften immer die Bücher von anderen Dichtern, die nichts taugen, und seine Bücher kauften sie nicht. Da wurde er ein Pessimist.“
Kajetan machte eine kleine Pause; dann fuhr er fort:
„Allen Pessimisten ist es so ergangen. Sie waren gut und tüchtig; alle anderen Menschen waren schlecht und dumm; aber den Dummen ging’s gut und den Klugen ging es schlecht; und da wurden sie eben Pessimisten.“
„Seid Ihr auch einer?“ fragte der andere mit einem schiefen Seitenblick.
„Natürlich bin ich einer,“ rief Kajetan und räkelte sich wieder lang ins Gras. „Oder haltet Ihr mich etwa für einen Dummen? Wenn ich kein Pessimist wäre, hätte mich der Herr Graf nicht angestellt, dass ich seine Insel bewache.“
„Ah, Ihr seid der Inselwächter?“
„Was sonst? Eine Insel ist eigentlich keine Insel, müsst Ihr wissen. Denn warum?“
„Weil Wasser drum ist,“ fiel der andere ein.
„Ja, so, das sagte ich Euch schon. Nun, wer soll verhindern, dass Leute auf die Insel fahren, die dort nichts zu suchen haben? Ich verhindere es! Wer soll verhindern, dass die Leute, die auf der Insel sind, herunterkönnen? Ich verhindere es!“
„So ist die Insel ganz abgeschlossen von der Welt?“
„Vollständig! Und zwar nicht nur durch das Wasser, sondern durch mich!“
Der andere lachte.
„Diese Insel ist also ein Stück Land, das ringsum von Meister Kajetan umgeben ist?“
„Nein, nicht ringsum. Wie könnte ein einzelner Mann eine so grosse Insel bewachen, selbst wenn er einen Knecht hat? Es gibt nur eine Landungsstelle auf der Insel, alles andere ist flaches Sandufer.“
„Die Insel ist hübsch gross!“
„O, sie ist über viertausend Schritte lang und an den breitesten Stellen an die zweitausend Schritte breit. Sie hat viele Berge, Wälder, Felder, Gänse-, Kuh- und Schafherden, Ziegen, Hasen und Hühner.“
„Wieviel Menschen wohnen darauf?“
„Achtzehn — ohne die Weiber.“
„Wieso ohne die Weiber? Zählen die Weiber nicht mit?“
„Nein, denn alles Unheil kommt vom Weibe.“
„Das habt Ihr wohl auch wieder von dem Dichter?“
„Ich habe es von ihm; aber ich weiss es auch von selbst.“
„Habt Ihr eine Frau?“
Kajetan zog mit der Hand eine Linie durch die Luft.
„Gehabt! — Futsch!“
„Gestorben?“
„Nein, ausgerückt!“
Der Fremde sah Kajetan mitleidig an. Der hatte die Stirn in finstere Falten gelegt.
„Mit ihrem Vater ist sie ausgerückt,“ knirschte er. „Er hat sie wieder nach Hause geholt, als ich sie kaum zwei Jahre lang hatte. Er sagte, sie müsse bei mir zu viel arbeiten!“
Der andere lächelte abermals.
„Das ist Pech. Und so seid Ihr also ein Pessimist geworden?“
„Jawohl, da bin ich ein Pessimist geworden und habe mir einen Knecht halten müssen, den ich nicht nötig hatte, als die Frau noch da war.“
„Wie lange lebt denn der Graf schon auf der Insel?“
„An die acht Jahre. Seine Tochter ist jetzt achtzehn.“
„Eine Tochter hat er auch?“
„Sie heisst Klotildis.“
„Ist sie schön?“
„Nein, keine Frau ist schön. Der Dichter sagt, die Schönheit der Weiber ist Schwindel. Und Klotildis braucht auch nicht schön zu sein, denn es gibt niemand etwas darauf. Der Dichter sagt, sie ist ätherisch, das soll heissen, sie ist sehr mager.“
Kajetan schloss die Augen. Von dem vielen Reden schien er müde geworden zu sein, und namentlich das Thema über die Weiber hatte ihn sehr gelangweilt. Nach einer halben Minute schon begann seine Nase die Einleitungstakte zu einer grossen Symphonie. Darauf wollte sich nun der andere nicht einlassen; er rüttelte also Kajetan und sagte:
„Schlaft nicht, lieber Meister, sondern erzählt mir lieber noch ein wenig von der Insel.“
Kajetan gab verdrossen zur Antwort:
„Ich kann mich nicht zu Tode reden. Ihr habt mir das Neueste von der Welt erzählt, und ich habe Euch von der Insel erzählt, also sind wir quitt. Jetzt will ich schlafen; denn ich bin müde und habe ausserdem heute den Namenstag.“
„Der Tausend!“ rief der andere, „den Namenstag habt Ihr? Das trifft sich gut. Da sollten wir ein Fest feiern.“
Er bastelte an seinem Reisegepäck herum und reichte Kajetan eine kleine Flasche hin.
„Da, nehmt das zum Angebinde! Lasst es Euch gut bekommen: es ist edler Burgunder.“
Kajetan war mit einem Male wieder munter. Er bedankte sich und sagte dann:
„Ich habe es bald gemerkt, dass Ihr ein Mann von Bildung seid, hätte es aber gern, wenn Ihr mir Euren Stand und Namen nennen wolltet. Ihr wisst, wer ich bin, und ich weiss nicht, wer Ihr seid, und also steht die Wage schief.“
Der Fremdling erhob sich sogleich, machte eine zierliche Verneigung und hub an:
„Gestattet demnach, edler Meister Kajetan, grosser Admiral dieser Inselflotte, dass ich mich vorstelle: Ich heisse Günther, Freier von Echtelfingen, bin der vierte Sohn meines Herrn Papa und meiner Frau Mama, stamme aus der Gegend zwischen Köln, Rom, Konstantinopel und Danzig und habe mein Leben lang nichts getan als Allotria, indem ich nämlich Jurisprudentia studierte, mit welch lächerlichem Zeitvertreib ich eben fertig geworden bin. Darauf bin ich in die Welt gezogen, um nach Herzenslust zu wandern, und habe vorläufig keinen anderen Plan, als hinüber ins Klösterliche zu fahren, wenn sich dazu durch die Rückkehr Eures Knechtes eine Gelegenheit bieten wird.“
Kajetan hatte aus dem ganzen Wortschwall nur das eine behalten, dass sein Gast und Nachbar ein Edelmann sei; er sprang also mit einer für ihn ganz unpassenden Geschwindigkeit empor, zog seine Zipfelmütze ab, so dass sein dicker, struppiger, schon etwas angegrauter Schädel in Erscheinung trat, stammelte eine Entschuldigung und erbot sich, Herrn Günther augenblicklich selber hinüber ins Klösterliche zu rudern.
Doch Günther nahm ihm die Mütze, zog sie ihm eigenhändig wieder über die Ohren, gab ihm einen sanften Stoss, der Kajetan einlud, wieder im Grase Platz zu nehmen, und sagte:
„Machen wir nur keine Faxen, lieber Freund; ich bin froh, dass ich bei Euch bin, und habe es gar nicht so eilig, fortzukommen. Ruht Euch erst ein wenig aus, sammelt Euern Geist und erzählt mir dann noch etwas von dieser geheimnisvollen Insel, um derentwillen ich in diese sehr entfernte Gegend gekommen bin.“
„Wisst Ihr schon etwas von der Blutkapelle?“ fragte Kajetan leise.
„Ja, davon hörte ich in den Herbergen weiter den Strom hinauf. Und ich hörte auch, Graf Raimund, der nun diese Insel besitzt, sei der Sohn jenes Mannes, der seine Frau an der Schwelle des Heiligtums erschlug.“
Kajetan wälzte sich mit einem Ruck nahe an Günther heran und hielt ihm seine mächtige Pranke auf den Mund.
„Pst! Um Gottes Willen — das darf niemand sagen. Das ist bei schwerster Strafe verboten. Wenn Ihr darauf zu sprechen kommen wollt, so mache ich nicht mit.“
Der Fischer flüsterte es und machte ängstliche Augen.
„Vom Herrn Grafen soll niemand sprechen, auch nicht von dem, wie er lebt und was er tut.“
„Und was tut er?“ fragte der andere unbekümmert.
„Das sage ich nicht,“ erwiderte Kajetan. „Nehmt Euren Wein zurück und lasst mich in Ruh.“
„Oho, Meisterchen, jetzt werdet Ihr unfreundlich. Wenn Ihr mir also nichts vom Grafen erzählen wollt, so erzählt mir wenigstens von den anderen Leuten, die auf der Insel wohnen.“
Aber Kajetan war misstrauisch geworden. Er berief sich darauf, dass er der Vertrauensmann des Grafen sei und dafür zu sorgen habe, dass das Leben auf der Insel ein tiefes Geheimnis bleibe.
„So — so,“ sagte der andere und sonst kein Wort mehr. Nach einer Weile hörte Kajetan neben sich ein leises Klingen. Er wandte den Kopf und sah zu seinem gewaltigen Erstaunen, dass der andere eine ganze Anzahl goldener Dukaten auf das grüne Gras gezählt hatte.
„Was macht Ihr?“ fragte er beinahe atemlos.
„Ich zähle mein Geld,“ sagte der andere lässig; „es muss noch auf einen Monat ausreichen.“
„So reich seid Ihr?“
Günther antwortete nicht. Er raffte das Gold zusammen und füllte es in einen ledernen Beutel. Dann stand er auf.
„Lebt wohl,“ sagte er; „Euer Knecht ist mir zu lange; ich werde versuchen, weiter unterhalb über den Fluss zu kommen; wenn nicht eher, dann in der Stadt, wo ja eine Brücke ist.“
„Herr, ich will Euch ja doch hinüberrudern.“
„Das nehme ich nicht an,“ sagte Günther; „es liegt mir auch nichts daran. Etwas anderes wäre es, wenn Ihr mich zur Nachtzeit einmal nach der Insel rudern wolltet. Da solltet Ihr ein paar stattliche Goldfische von mir zu fangen bekommen.“
„Herr, das darf ich nicht. Ihr dürft die Insel nicht betreten.“
„So — aber der Dichter, Euer Freund, durfte es doch wohl. Oder ist er vom Himmel geschneit?“
„Ihr seid kein Pessimist.“
Herr Günther lachte fröhlich.
„Nun, ein so arger Pessimist wie Ihr seid, bin ich immerhin auch. Also könnt Ihr es schon wagen.“
„Ich darf es nicht, Herr. Die Insel nimmt keine neuen Bewohner mehr auf, und Besuche sind ganz und gar verboten.“
„So wird sie nach und nach aussterben?“
„Das soll sie! Es sind nur ältere Eheleute auf der Insel, die keine Kinder mehr bekommen, und das Heiraten ist verboten. Der frühere Jäger fing eine Liebschaft mit der Tochter des Wasserweibes an. Die Mutter zeigte sie selber beim Inselgericht an, und die beiden Sünder wurden verbannt.“
„Was ist aus ihnen geworden?“
„Zugrunde gegangen sind sie. In die grosse Stadt gezogen, geheiratet, drei Kinder gekriegt und Arbeit von früh bis spät.“
„Das ist ja eine scheussliche Geschichte!“ sagte Günther.
„Ja, und seit der Zeit ist die Insel ganz abgesperrt, kein Mensch darf mehr hinüber oder herüber, keine Zeitung, kein Brief kommt hin.“
„Brauchen sie nicht manchmal einen Arzt, gehen sie nicht zur Kirche?“
„Der Herr Graf kennt alle Wissenschaften und kuriert die kranken Leute selber. Zur Kirche gehen sie nicht, denn sie sind Pessimisten.“
„Aber sie haben doch Bedürfnisse; sie brauchen doch Geräte, Instrumente, Kleider, Nahrungsmittel.“
„Die Insel bringt alles in Hülle und Fülle, was der Mensch braucht: Getreide, viel Obst, Wild, allerhand Tiere; und auch für das andere ist gesorgt, denn sie haben drüben einen Schneider, einen Schmied, einen Schuster, einen Leinwandweber, einen Müller, fünf Bauern und zwei Polizisten.“
Günther wiederholte langsam die Aufzählung und sagte:
„Das sind mit dem Grafen zusammen dreizehn Männer. Ihr sprachet aber von achtzehn.“
„Ja, da ist noch der Dichter, der Oberst, der Gärtner, der Hühneraugenschneider und der Narr.“
„O,“ rief Günther, „das ist eine gediegene Kumpanei! Wozu brauchen sie so notwendig einen Hühneraugenschneider?“
„Alle Pessimisten haben Hühneraugen,“ sagte Kajetan tiefsinnig.
„Und wer macht die feineren Arbeiten, so zum Exempel, wenn eine Uhr entzwei gegangen ist?“
„Sie brauchen keine Uhr,“ erklärte Kajetan. „Kein Mensch braucht eine Uhr. Wenn die Sonne steigt, ist Vormittag, wenn sie fällt, ist Nachmittag, und wenn sie gar nicht da ist, ist Nacht.“
„Was seid Ihr für glückliche Leute,“ seufzte Günther. Er schwieg eine Weile; dann sagte er:
„Der Herr Graf hat gewiss viele Bücher. Gibt er davon auch den anderen zu lesen?“
Kajetan schüttelte energisch den Kopf.
„Auf der ganzen Insel gibt es nicht ein einziges Buch. Habt Ihr gesehen, was in den Büchern für schwarze Reihen sind? Die Menschen nennen das Buchstaben. Ich aber sage Euch: das sind Heerlinien von Gauklern und Verbrechern, die darauf losmarschieren, die Menschen zu belügen und zu betrügen, ihnen das, was sie selbst an Gold in sich haben, gegen Blech und Scherben einzutauschen. Die Leute, die nicht lesen können, sind gegen sie gefeit; die anderen aber kriegen sie alle unter, und diejenigen, die die Klügsten sein wollen, zu allererst.“
„Mann,“ rief Günther bewundernd, „was habt Ihr für ein Gedächtnis; denn das habt Ihr doch auch wieder von dem Dichter!“
„Nein, das habe ich vom Herrn Grafen, der manchmal eine Andacht hält, bei der ich dabei sein darf. Die meisten auf der Insel können gar nicht lesen.“
„Auch des Grafen Tochter nicht?“
„Klotildis? Nein, die kennt keinen Buchstaben.“
Günther schlug die Hände zusammen.
„Sagt einmal, Meister Kajetan, ganz im Vertrauen: ist der Graf ganz klar im Kopf?“
Wieder fuhr Kajetan mit seiner Hand erschrocken nach dem Mund des Sprechers, der längst wieder bei ihm im Grase lag.
„Pst! Um Gottes willen! Ihr seid ein gefährlicher Mensch. Euch erzähle ich auch nicht ein Wort!“
Er äugte furchtsam nach der Insel hinüber, als könne er von dort beobachtet werden.
Nach einer Weile fragte Günther:
„Wie haltet Ihr es eigentlich mit dem Gelde, Meister Kajetan?“
Kajetan seufzte.