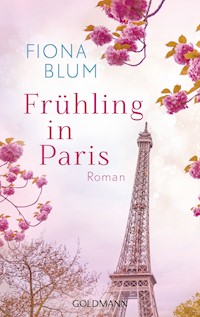8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sommer, Sonne, Italien! Die Trattoria Paradiso öffnet ihre Seeterrasse, und drei Schwestern finden das Glück.
Auf einer kleinen malerischen Insel im Trasimeno-See ist die Trattoria Paradiso von Ernesto Peluso das Herzstück der Einwohner. Als Ernesto plötzlich stirbt, muss seine jüngste Tochter Greta das Lokal allein weiterführen. Sie ist wie ihr Vater eine begnadete Köchin, und zur großen Erleichterung der eingeschworenen Inselgemeinschaft scheint in der Trattoria alles so zu bleiben, wie es war. Der überraschende Tod des Vaters bringt jedoch auch Greta und ihre beiden älteren Schwestern Lorena und Gina, von denen sie sich längst entfremdet hat, wieder zusammen und konfrontiert sie mit ihrer lange verdrängten Vergangenheit. Und so müssen die drei so verschiedenen Frauen endlich ihrem großen Familiengeheimnis auf den Grund gehen: was in jener Nacht vor vielen Jahren geschah, als ihre Mutter spurlos verschwand …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Auf einer kleinen malerischen Insel im Trasimeno-See ist die Trattoria Paradiso von Ernesto Peluso das Herzstück der Einwohner. Als Ernesto plötzlich stirbt, muss seine jüngste Tochter Greta das Lokal allein weiterführen. Sie kocht genauso begnadet wie ihr Vater, und zur großen Erleichterung der eingeschworenen Inselgemeinschaft scheint in der Trattoria alles so zu bleiben, wie es war. Der überraschende Tod des Vaters bringt jedoch auch Greta und ihre beiden älteren Schwestern Lorena und Gina, von denen sie sich längst entfremdet hat, wieder zusammen und konfrontiert sie mit ihrer lange verdrängten Vergangenheit. Und so müssen die drei so verschiedenen Frauen endlich ihrem großen Familiengeheimnis auf den Grund gehen: was in jener Nacht vor vielen Jahren geschah, als ihre Mutter spurlos verschwand …
Autorin
Fiona Blum ist das Pseudonym der Schriftstellerin und Juristin Veronika Rusch. Sie hat Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom studiert und mehrere Jahre als Anwältin gearbeitet. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrer Familie in einem alten Bauernhaus in Oberbayern. Für ihren Roman »Liebe auf drei Pfoten« erhielt sie den begehrten DELIA-Literaturpreis.
Fiona Blum
Die Insel der Orangenblüten
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe April 2023
Copyright © 2023 by Fiona Blum
Copyright der deutschsprachigen Erstausgabe © 2023 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Medienagentur, München.
Gestaltung des Umschlags und der Umschlaginnenseiten: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: © FinePic®, München; Alamy / Zoonar GmbH
Redaktion: Ilse Wagner
BH · Herstellung: ik
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24595-5V001
www.goldmann-verlag.de
Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte ein König, der keine Söhne hatte, aber drei schöne Töchter. Die drei zogen aus, das Königreich zu retten, jedoch nur Fantaghirò, der Schönsten und Klügsten von allen, sollte es gelingen …
Prinzessin Fantaghirò,frei nach: Italo Calvino, »Italienische Märchen«
TEIL EINS Schwestern
1
Es war die Zeit des Ginsters. Die Luft war erfüllt von seinem intensiven Duft, und Bienen und Falter umschwirrten die großen Büsche mit ihren satten goldgelben Blüten. Die Maisonne wärmte schon, und obwohl es noch früh am Morgen war, kam Don Pittigrillo in seiner schwarzen Soutane ins Schwitzen, als er die steinige Via Guglielmi hinaufstieg. Den ungepflasterten, gewundenen Ausläufer der einzigen Straße der Insel überhaupt noch »Straße« zu nennen war sehr euphemistisch, und er war froh über das trockene Wetter zu dieser Jahreszeit. Denn während der herbstlichen Stürme und im Winter verwandelte sich dieser Abschnitt der Straße regelmäßig in eine unpassierbare Schlammpiste, deren feiner rotbrauner Sand bis hinunter ins Dorf gespült wurde. Die Trockenheit war aber auch der einzige Vorteil, den der heutige Tag zu bieten hatte. Es sollte verboten sein, im Frühling zu sterben, dachte Don Pittigrillo erbost, während ihm der süße Ginsterduft, vermischt mit den Gerüchen von Rosmarin, wildem Thymian und Lorbeer, in die Nase stieg. Man sollte nicht sterben müssen, während um einen herum das Leben aus allen Nähten platzte. Doch da war nichts zu machen. Da ließ sein Chef nicht mit sich reden. Wie er überhaupt sehr eigenwillig war, wenn es um den Tod ging, das hatte er im Fall seines Freundes Ernesto wieder einmal eindrucksvoll bewiesen. Don Pittigrillos Miene verfinsterte sich. Bei allem Respekt, er war nicht einverstanden mit dieser Entscheidung seines obersten Dienstherrn. Ganz und gar nicht. Niemand hatte geahnt, dass ausgerechnet Ernesto Peluso, dieser Bär von einem Mann, dieser kraftstrotzende, temperamentvolle Kerl, dessen Lebensinhalt es gewesen war, andere Menschen mit seinen Kochkünsten glücklich zu machen, ein schwaches Herz hatte. Und doch war es so gewesen. Er war einfach umgekippt, in seiner Küche, bei der Zubereitung seines – Don Pittigrillo warf einen vorwurfsvollen Blick in Richtung Himmel – wahrhaft göttlichen Tegamaccios. Gott sei Dank hatte Greta, seine jüngste Tochter, sein Kochtalent geerbt, sonst wäre Ernesto Pelusos göttliches – wieder ein vorwurfsvoller Blick nach oben – Tegamaccio ebenso wie all die anderen wundervollen Kreationen seiner Küche mit seinem Tod wohl für immer in Vergessenheit geraten. Und das nur, weil der Allerhöchste mit seinem unergründlichen Willen beschlossen hatte, dass nun Schluss sei für den Mann.
Ein Fasan spazierte gemächlich eine Weile vor Don Pittigrillo her und flatterte dann auf die Kante der bröckelnden Trockensteinmauer, die den Weg zum Hügel hin begrenzte. Dort blieb er sitzen und betrachtete den vorbeihastenden Priester gelassen, ohne an Flucht zu denken. Die Fasane, die auf der Insel lebten, waren zahm und glückliche Nachfahren der Vögel, die der Marchese Giacinto Guglielmi seinerzeit zur Jagd ausgesetzt hatte. Die Guglielmis hatten um die letzte Jahrhundertwende das Castello der Insel bewohnt und die Villa Isabella, wie es genannt wurde, mit Glanz und Glamour erfüllt. Mit Beginn des zweiten Weltkriegs endete die Ära der Guglielmis, sie verließen die Insel, und die Villa Isabella verfiel, der Park verwilderte. Die Fasane der Guglielmis blieben nach deren Weggang auf der Insel und vermehrten sich im Laufe der Jahrzehnte prächtig. Da ein staatlicher Erlass die Jagd auf der Insel verbot und alles, was hier kreuchte und fleuchte, unter Naturschutz stand, waren sie mit der Zeit so zahm geworden wie Haushühner. Sie fraßen aus der Hand, hockten sich auf die Terrassen und vor die Hauseingänge, und sogar die Hunde und Katzen, die hier lebten, ließen sie weitgehend in Ruhe. Das Einzige, was ihrem geruhsamen Leben ein wenig Aufregung bescherte, waren die Tagestouristen, die im Hochsommer die Insel unsicher machten. Doch noch war es nicht so weit. Don Pittigrillo blieb einen Augenblick stehen, um zu verschnaufen, und ließ seinen Blick über das mit Winden und Brombeergestrüpp überwucherte Gitter der alten Villa wandern. Zwischen Zedern und Eichen war der zinnenbekrönte Turm zu sehen. Es herrschte vollkommene Stille. Nur die Vögel zwitscherten. Man erzählte sich, dass sich auch die prächtigen Pfauen der Guglielmis vermehrt hatten und noch immer in dem weitläufigen, verwilderten Park der Villa lebten. Doch im Gegensatz zu den Fasanen hielten sich diese geheimnisvollen Tiere versteckt, man bekam sie nur äußerst selten und angeblich nur unter ganz besonderen Umständen zu Gesicht. Don Pittigrillo hatte von den fünfundsechzig Jahren seines Lebens die meisten auf dieser Insel verbracht und noch nie einen Pfau gesehen, aber wenn man an so etwas wie einen allmächtigen Gott und das ewige Leben glauben konnte, war der Glaube an Pfauen, die sich in einem vergessenen Park verbargen, nun wirklich ein Kinderspiel. Er ging weiter. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr, bis die Trauergäste eintrafen, da konnte er nicht herumtrödeln und über Pfauen nachdenken, wenngleich ihn solche Dinge faszinierten und er gern seine Gedanken in rätselhafte Gefilde wandern ließ. Was die ungewöhnliche Entspanntheit der Tiere auf der Insel anbelangte, so hatte Don Pittigrillo eine ganz eigene, wundersame Theorie, ebenso zu der Frage, wann und vor allem wem sich die Pfauen zeigten. Er war der Überzeugung, dass dies alles dem heiligen Franz von Assisi zu verdanken war, der im dreizehnten Jahrhundert seine Fastenzeit auf der Insel verbracht hatte. War es nicht Franz von Assisi gewesen, der mit den Vögeln gesprochen hatte und dem alle Tiere Brüder und Schwestern gewesen waren? Don Pittigrillo war überzeugt davon, dass der friedliche Einfluss dieses heiligen Mannes auf der Insel bis heute fortdauerte und sich vor allem auf die Tiere auswirkte, die für derartige Schwingungen empfänglicher waren als die Menschen. Diese Ansicht behielt er jedoch lieber für sich. Es kursierten in dieser ach so aufgeklärten Welt schon genügend seltsame Geschichten, auch religiöse, viele von ihnen so absurd, dass sich das Nachdenken darüber kaum lohnte. Da musste Don Pittigrillo nicht noch eine weitere in die Welt setzen, selbst wenn er seine eigene Geschichte keineswegs für absurd hielt. Er glaubte daran. Aber schließlich war er Priester, und das Glauben war sein tägliches Brot.
Er hatte die Anhöhe erreicht, auf der die kleine romanische Kirche Michele Arcangelo stand. Von außen war sie unscheinbar, aus den groben ockerfarbenen Steinen der Insel erbaut und unverputzt. In ihrer schmucklosen Bauweise und mit dem offenen Glockenturm erinnerte sie eher an eines dieser gottvergessenen staubigen Kirchlein aus alten Western – Don Pittigrillo war ein großer Fan von Italowestern – als an eine ordentliche italienische Kirche. Die kunstvollen Wandmalereien des schlichten Innenraums jedoch waren von einer stillen, zarten Schönheit, die Don Pittigrillo immer wieder sprachlos machte. Er konnte verstehen, dass Paare hier oben in dieser Kirche heiraten wollten, auch wenn der Anstieg etwas beschwerlich war. Es war ein wunderschöner Ort, umgeben vom Blau des Trasimeno-Sees, romantisch und irgendwie verzaubert. Beerdigungen gab es hier jedoch nur noch äußerst selten. Das lag daran, dass nur die Menschen auf dem kleinen Friedhof zur letzten Ruhe gebettet werden durften, die bereits eine Grabnische hier besaßen und zum Zeitpunkt ihres Todes auch auf der Insel gelebt hatten. Die Pelusos lebten hier seit vielen Generationen, Ernestos Mutter hatte sogar noch den König von Italien gekannt. Als Greta mit der traurigen Nachricht zu ihm gekommen war, war es daher keine Frage gewesen, dass Ernesto hier seine Ruhestätte finden würde wie alle Pelusos vor ihm. Don Pittigrillo war sehr froh darüber.
Nachdem er sich in der kleinen Sakristei umgezogen hatte, ging Don Pittigrillo noch einmal in die Kirche, um zu prüfen, ob alles bereit war. Der Sarg war gestern Abend schon gebracht worden, man hatte in Anbetracht des unbefestigten, mitunter recht steilen Weges auf eine Prozession zur Kirche verzichtet. Jetzt stand er geöffnet vor dem Altar, Ernesto im guten Anzug, der breite, kräftige Mann mit einem so gelassenen und friedlichen Gesichtsausdruck, wie er ihn zu Lebzeiten nie gehabt hatte. Der Sarg war umgeben von weißen Lilien, die zusammen mit frischem Ginster einen wunderbaren Duft verströmten. Auch die Kerzen brannten bereits. Don Pittigrillo sah auf die Uhr und schnalzte unwillig mit der Zunge. Die Kapelle sollte längst da sein. Das war wieder einmal typisch. Orazio Mezzavalle, der Kapellmeister, war der unpünktlichste Mensch, den er kannte. Er würde vermutlich sogar zu seiner eigenen Beerdigung zu spät kommen. Der Priester ging nach draußen, nestelte die Packung Zigaretten aus den Tiefen seines Messgewandes und zündete sich eine an. Einen so guten Freund beerdigen zu müssen, das ließ auch ihn nicht unberührt. Beten allein half da nicht. Don Pittigrillo nahm einen tiefen Zug und bewunderte dabei die Aussicht auf den See, der still und friedlich vor ihm lag. Er bemühte sich, an das ewige Leben zu denken, das seinen alten Freund jetzt erwartete, und versuchte, sich für ihn zu freuen, doch es gelang ihm nicht. Die Aussicht auf die Ewigkeit erschien ihm wenig reizvoll, gemessen an einem erfüllten Leben, das noch viele Jahre hätte dauern können. Sein Blick wanderte den Weg hinunter, den er gerade gekommen war, und er sah, dass die Trauergemeinde bereits im Anmarsch war. Ein langer Zug schwarz gekleideter Menschen bewegte sich langsam zu ihm herauf. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Die Fähre aus Passignano hatte vor Kurzem angelegt, sicher waren damit auch viele Freunde und Bekannte Ernestos vom Festland angekommen. Die Bewohner der Insel würden ohnehin vollzählig erscheinen, daran gab es keinen Zweifel. Als der Zug sich allmählich näherte, erkannte Don Pittigrillo Ernestos Töchter, die vorausgingen. Er kannte sie, seit sie auf der Welt waren, hatte sie getauft, ihnen die heilige Kommunion erteilt, sie gefirmt, ihnen für einige Jahre ihre so rührend harmlosen, kindlichen Beichten abgenommen und versucht, ihnen beizustehen, als es nötig gewesen war. Und es war, weiß Gott, nötig gewesen.
Inzwischen hatte er nur noch Kontakt zu Greta, der Jüngsten, die als Einzige auf der Insel geblieben war. In der Kirche sah er sie nie, genauso wenig wie Ernesto, der ein ebenso leidenschaftlicher wie halbherziger Atheist und ein ebensolcher Kommunist gewesen war, was stets zu anregenden Diskussionen geführt hatte. Don Pittigrillo wusste nicht genau, wie Greta es mit dem Glauben hielt, sie sprach nie darüber, und er hatte sie noch nie danach gefragt. Wie Ernesto selbst, konnte seine jüngste Tochter recht abweisend und schroff sein, wenn es um Dinge ging, über die sie nicht sprechen wollte. Diese Frage war es ihm nicht wert, es sich mit ihr zu verscherzen, daher verzichtete er darauf, ihr gegenüber »den Pfaffen rauszukehren«, wie Ernesto es immer genannt hatte, wenn Don Pittigrillo seiner Meinung nach zu missionarisch daherkam. Ihr Fehlen in der Kirche war für ihn keine große Sache. Auch wenn er sich gefreut hätte, sie dort begrüßen zu dürfen, genügte es ihm doch zu wissen, dass Greta ein guter Mensch war. Und das konnte man beileibe nicht von allen Kirchgängern behaupten. Er traf Greta auch ohne Kirchenbesuch häufig, und zwar in ihrer Trattoria, wo er Stammgast war. Sie kochte mit dem gleichen Talent und derselben Begeisterung, wie ihr Vater es getan hatte. In der letzten Zeit hatte Ernesto ihr daher immer mehr die Küche überlassen. Er hatte begriffen, dass es nichts mehr gab, was er ihr noch beibringen konnte. Ohne Groll, vielmehr mit Stolz auf seine Tochter, hatte er begonnen, sich mehr um seine Gäste zu kümmern, mit ihnen ein Gläschen Wein zu trinken, zu plaudern und auf den See hinauszuschauen. Don Pittigrillo kannte Greta genau. Man musste nur einen Teller ihrer Tagliatelle al Tartufo kosten, ihren Sugo di Carne oder das Tegamaccio, jenen umbrischen Fischeintopf, für den die Trattoria Paradiso legendär war, dann wusste man alles über Greta Peluso, was es zu wissen gab.
Ihre Schwestern hingegen kannte er nicht mehr. Zu ihnen hatte er jeden Kontakt verloren. Sie ließen sich selten auf der Insel blicken. Lorena, die Älteste, die jetzt in einem offensichtlich maßgeschneiderten Kostüm und hohen Schuhen über den unebenen Weg gestöckelt kam wie eine Filmdiva, noch eher als Gina, die mittlere Schwester. Gina lebte seit Jahren im Ausland, zuletzt in Deutschland, wie er von Ernesto wusste, und kam, wenn überhaupt, nur zu Weihnachten nach Hause. Sie war immer schon am wenigsten greifbar gewesen, ein bisschen wie ein kleiner, seltsamer Vogel, den der Wind nur aus Versehen auf diese Insel geweht hatte. Die hübscheste der drei Peluso-Schwestern war als kleines Mädchen quirlig und fröhlich gewesen, mit einem herzförmigen Engelsgesicht und einem dichten seidenweichen Haarschopf. Als Teenager hatte sie sich dann jedoch alle erdenkliche Mühe gegeben, alles Engelsgleiche an sich so nachhaltig auszumerzen, dass man sich kaum noch an die frühere Gina erinnern konnte. Angefangen hatte es damit, dass sie sich mit dreizehn Jahren ihre Haare radikal abrasierte. Dieser Akt hatte nicht nur bei ihrer Tante Adelina für Entsetzen gesorgt, auch Don Pittigrillo war erschrocken darüber gewesen, wie aus dem kleinen, niedlichen Mädchen quasi über Nacht so ein struppiger, zorniger Teenager hatte werden können. Fortan trug Gina zerrissene Jeans, zerknitterte T-Shirts und karierte Hemden, und ihr Blick wurde kritisch, distanziert und finster. Sie fing mit dem Rauchen an und trieb sich mit den »bösen Buben« der Insel herum, allen voran dem heutigen Kapellmeister Orazio Mezzavalle und Enzo Fusetti, beide ein paar Jahre älter als sie. Sobald es in den folgenden Jahren irgendwo auf der Insel oder auf dem nahen Festland Ärger gab, konnte man sicher sein, dass Gina Peluso mit von der Partie war. Das hörte erst auf, als sie das Abitur in der Tasche hatte. Kurz darauf verschwand Gina und tauchte nur noch sporadisch auf. Don Pittigrillo war deshalb besonders neugierig auf diese mittlere Tochter. Als die drei Frauen näher kamen, konnte er sehen, dass Gina ihre Haare auch heute noch extrem kurz trug, was ihrem aparten Gesicht etwas Ruppiges und gleichzeitig Verletzliches gab. Zerrissene Jeans und Karohemden gehörten gottlob der Vergangenheit an. Sie trug stattdessen einen strengen schwarzen Hosenanzug, der die Wirkung ihrer kurzen Haare noch verstärkte. Aus der Ferne sah Gina wie ein junger Mann aus, der Ärger suchte.
Neben ihren beiden älteren Schwestern hatte Greta in ihrem schlichten Rock, der einfachen Bluse und den flachen Schuhen dagegen etwas von einem Aschenputtel. Allerdings nur auf den ersten Blick. Betrachtete man sie genauer, vergaß man, was sie trug, vergaß auch alles andere. Greta war nicht so hübsch wie Gina und nicht so eindrucksvoll wie Lorena, aber auf eine ungewöhnliche Art und Weise interessant. Mit ihrem dunklen Teint, den ungewöhnlich hellen Augen und einer Fülle von schwarzen Locken, die sie seit Kinderzeiten als eine Art Wuschelkopf trug – Don Pittigrillo kannte sich mit den korrekten Bezeichnungen von Frauenfrisuren nicht aus – und die ihr Gesicht wild und ungebändigt umrahmten, wirkte sie fast ein wenig koboldartig, wie der Priester mit seiner lebhaften Fantasie und seiner Vorliebe für Geheimnisvolles schon immer gedacht hatte. Sie ähnelte kaum ihren beiden Schwestern, die nach dem Vater geraten waren. Vor allem Lorena hatte die kühn geschwungene, immer etwas arrogant wirkende Adlernase der Pelusos geerbt. Greta dagegen war, mit Ausnahme der blauen Augen, die niemand sonst in der Familie hatte, ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Während die drei langsam näher kamen, fragte sich Don Pittigrillo, und das nicht zum ersten Mal, wie Ernesto es wohl ausgehalten haben mochte, beim Anblick seiner Tochter ständig an Tiziana erinnert zu werden. Er hatte nie gewagt, seinem Freund diese Frage zu stellen. Vermutlich hätte er ohnehin keine Antwort darauf bekommen. Jetzt hatten die drei Frauen die Kirche erreicht, gefolgt von Ernestos Schwester Adelina, Lorenas Mann und den Kindern sowie den übrigen Verwandten, Freunden und Bekannten. Je nach Kondition waren alle nach dem Aufstieg mehr oder weniger stark außer Atem. Adelina Peluso war hochrot im Gesicht, ihr schwarzer Beerdigungshut, den Don Pittigrillo schon von anderen Gelegenheiten her kannte, war verrutscht, und sie fächelte sich mit einem Taschentuch Luft zu. Ihrer leidenden Miene nach zu schließen sowie der Art, wie sie sich luftschnappend am Arm von Lorenas Ehemann Diego festklammerte, schien sie kurz davor, ihrem Bruder nachzufolgen. Doch Don Pittigrillo wusste es besser. Adelina hatte eine Rossnatur, sie war trotz ihrer erheblichen Leibesfülle zäh wie eine Kreuzotter, und es bedurfte mit Sicherheit mehr als ein paar Minuten Fußmarsch, um sie in die Knie zu zwingen. Zuletzt kamen die Mitglieder der Kapelle angehastet, die Instrumente geschultert. Don Pittigrillo warf demonstrativ einen Blick auf die Uhr, und Orazio, der schon lange kein böser Bube mehr war, sondern Klempner wie sein Vater, senkte schuldbewusst den Blick. Unter dem strengen Blick des Priesters ordneten sie ihre Kleidung. Die Männer banden sich die schwarzen Krawatten um, die Frauen strichen sich die Haare glatt, und dann packten alle ihre Instrumente aus und verschwanden in der Kirche. Don Pittigrillo richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf Ernestos Töchter. Greta wirkte ausgesprochen beherrscht, was Don Pittigrillo nicht verwunderte. Sie verfügte über eine innere Stärke, die fast unheimlich war, was vermutlich mit ihrer Geschichte zusammenhing. Obwohl sie mit Sicherheit am meisten litt, schien sie ruhig, fast ungerührt. Ihre ungewöhnlichen blauen Augen trafen die seinen, klar und offen wie immer, wenngleich ihr Blick tieftraurig war. Offenbar hatte sie nicht geweint. Lorena dagegen trug eine große Sonnenbrille und machte einen ziemlich mitgenommenen Eindruck. Sie war blass unter ihrem Make-up, und auf ihren Wangen zeigten sich Tränenspuren. Ginas Miene war verschlossen und distanziert, allerdings auf eine Art, die ihre Anstrengung verriet, nur ja nicht die Beherrschung zu verlieren. Als Don Pittigrillo ihr die Hand reichte und unbedachterweise »Guten Morgen, Ginetta« sagte, so wie alle sie genannt hatten, als sie noch klein und niedlich gewesen war, begann Ginas Kinn zu zittern. Mit einer hastigen Handbewegung entzog sie ihm ihre Hand und wandte den Blick ab, ohne zu antworten. Don Pittigrillo nahm ihr diese Reaktion nicht übel. Es war dumm von ihm gewesen, sie mit ihrem Kosenamen anzusprechen, der aus einer Zeit stammte, als alles noch gut und das Leben schön und sorglos gewesen war.
Der Priester hatte großes Mitleid mit den drei Frauen. Einen Elternteil zu verlieren war immer ein tiefer Einschnitt, gleichgültig, wie alt man war. Und in ihrem Fall war es schon das zweite Mal. Fast auf den Tag genau vor fünfundzwanzig Jahren hatten sie ihre Mutter verloren, und Don Pittigrillo hatte die Tragödie hautnah miterlebt, so wie alle anderen Inselbewohner auch. Tizianas rätselhaftes Verschwinden in jener verhängnisvollen Sturmnacht hatte niemanden unberührt gelassen, doch am schlimmsten hatte es natürlich die Töchter getroffen. Sie waren noch Kinder gewesen, die beiden älteren Mädchen Teenager und Greta erst acht Jahre alt. Don Pittigrillo fragte sich noch heute manchmal, wie es ihnen gelungen war, darüber hinwegzukommen. Aber vielleicht waren sie das auch gar nicht. Über den Verlust der Mutter steigt man nicht einfach hinweg wie über ein Hindernis auf seinem Lebensweg. Der Schmerz verkapselt sich mit der Zeit, zieht sich zurück, aber er verschwindet nicht, das wusste Don Pittigrillo, dessen Eltern beide früh verstorben waren, aus eigener Erfahrung. Und er hatte wenigstens um sie trauern können, was den Pelusos bis heute nicht vergönnt war. Don Pittigrillo warf erneut einen vorwurfsvollen Blick nach oben in Richtung des strahlend blauen Himmels. Noch so eine Sache, die er seinem Gott persönlich übelnahm. Solange Ernesto noch am Leben gewesen war, hatte niemand an der alten Wunde gerührt. Dafür hatte sein alter Freund gesorgt. Ernesto war so etwas wie das Pflaster gewesen, das alles verdeckte. Doch die Wunde darunter war nie verheilt, hatte nie verheilen können, und vermutlich würde sie jetzt, wo das Pflaster nicht mehr da war, wieder aufreißen. Don Pittigrillo blickte in die Gesichter der drei Peluso-Schwestern, und ihn beschlich ein ungutes Gefühl. Er fragte sich, was wohl ans Licht käme, wenn es so weit war. Was würde von der Wucht der Wahrheit mitgerissen, was zerstört werden, sofern es ihnen gelang, sie zu finden? Was würde am Ende übrig bleiben? Er blinzelte, um die beunruhigenden Gedanken zu vertreiben, nickte den dreien knapp zu und wandte sich dann rasch um. Nun galt es erst einmal, Ernesto unter die Erde zu bringen. Das war Last genug für heute. Alles andere zu seiner Zeit. Doch während er gemessenen Schrittes voraus in die kühle Kirche ging, schickte er ein ungestümes Stoßgebet in den Himmel und bat Gott, den Unerklärlichen und manchmal Unerträglichen, der ihm seinen besten Freund genommen hatte, inständig darum, dass alles gut werden würde.
2
Greta folgte Orazio Mezzavalle und seiner Musikkapelle, deren Trauermarsch voller falscher Töne ebenso holperte und stolperte wie die Trauergäste auf ihrem Weg den Hügel hinunter. Ihre Schwestern waren ein Stück zurückgeblieben. Die Illusion der Zusammengehörigkeit, die ihr gemeinsamer Gang zur Kirche zumindest nach außen hin vermittelt hatte, begann bereits wieder zu bröckeln. Doch Greta spürte kein Bedauern, sie war es gewohnt, ohne ihre Schwestern auszukommen. Sie fühlte sich unwirklich, ihre Füße schienen kaum den Boden zu berühren, und wäre nicht Tante Adelina gewesen, die sich bei ihr eingehakt hatte und mit leiser, nörgelnder Stimme ihre Kommentare zur Predigt, Musik und den Anwesenden abgab, wäre sie vermutlich davongeflogen. Greta hob das Gesicht in den zartblauen Frühlingshimmel und wünschte sich, ihre Tante würde sie nicht am Boden halten. Sie würde zu den Olivenbäumen hinaufschweben, schwerelos, sich in den dunklen Ästen der Zedern verstecken und die Trauergesellschaft von oben betrachten, wie sie sich den Weg wieder hinunterbewegte, langsam und doch zielstrebig auf die Trattoria zumarschierte wie eine Kompanie von schwarzen Waldameisen auf der Suche nach Futter. Greta wusste, sie würde erst begreifen, dass ihr Vater nicht mehr lebte, wenn sie allein war. Doch noch war es nicht so weit. Es galt, die Freunde und Verwandten zu bewirten, ihnen zu danken für das letzte Geleit, das sie ihrem Vater gegeben hatten. Babbo hätte es so gewollt. Er hätte sich gutes Essen und viel Wein zu seiner Trauerfeier gewünscht. Und Musik. Auch wenn sie so falsch klang wie die von Orazios Chaotentruppe. Oder aber gerade deshalb. Perfektion war nicht die Sache ihres Vaters gewesen. Und ihre auch nicht. Das überließ sie ihrer Schwester Lorena. Sie hatte die Perfektion gepachtet, da war für die beiden anderen Peluso-Schwestern nichts mehr übrig geblieben. Vermutlich war Lorena deshalb auch Anwältin geworden: Weil Gerechtigkeit auch eine Form von Perfektion war. Greta dachte lieber mit dem Bauch, auf ihn konnte sie sich meist verlassen. Und Gina? Die dachte immer erst dann, wenn es zu spät war. Als sie den Dorfeingang erreichten, schüttelte Greta Tante Adelinas Klammergriff ab und blieb stehen. Die Trattoria ihres Vaters war das erste Haus auf der Seeseite, ein schlichtes dreistöckiges Gebäude, behäbig, breit und unverputzt, aus den Steinen dieser Insel gemauert. Das Grundstück grenzte an den Park der Villa Isabella, der rückwärtige Garten führte an dessen verwitterter Mauer entlang hinunter bis zum See. Da die Trattoria mit ihren fünf Tischen drinnen und noch einmal fünf im Garten viel zu klein war, um alle Trauergäste zu beherbergen, hatten sie entlang der Parkmauer ein Büfett aufgebaut. Es war noch ein wenig zu früh zum Mittagessen, so gab es vor allem Kleinigkeiten, wie man sie zum Aperitif servierte. Sie hatte gestern zusammen mit Domenico, ihrem Pizzabäcker, und Adelina den ganzen Tag und die halbe Nacht gekocht und gebacken, und jetzt standen auf den weiß gedeckten Tischen große Steingutplatten, beladen mit goldgelb frittierten Olive Ascolane und Supplì di Riso, Schinken und klein geschnittenen Würsten aus Norcia, fetter, glänzender Porchetta, Crostini mit Trüffelpastete, Pecorino, Schüsseln mit gekühlter Panzanella, dem Brotsalat, den ihr Vater im Sommer so gern gemocht hatte, Krüge mit grünem Olivenöl, kleine Schälchen mit grobem Salz, Oliven und frische Torta al Testo, die umbrische Variante der Focaccia, selbst gebackenes Brot mit dunkler, harter Krume. Außerdem gab es noch Süßes wie Cantuccini, knuspriges Mandelgebäck, zum Vino Santo und Schalen mit weichen, fluffigen Ricciarelli und bunten Fave dei Morti, sogenannten Totenküchlein, die eigentlich zu Allerheiligen gebacken wurden. Da sie aber das Lieblingsgebäck ihres Vaters gewesen waren, hatte Greta sie für heute ebenfalls vorbereitet, gegen den erbitterten Widerstand von Adelina, die nichts davon hielt, gegen christliche Traditionen zu verstoßen. Selbst dann nicht, wenn es zu Ehren ihres toten Bruders geschah. Domenico war nach der Trauerfeier mit seinem Fahrrad schnell vorausgefahren und hatte alle Schüsseln, Schalen, Teller, Servietten und Gläser nach draußen getragen, den Weißwein in eisgefüllte Kühler gestellt und die Wasserflaschen gefüllt. Sie musste nicht nachsehen, ob alles bereit war, auf Domenico konnte sie sich verlassen. Dennoch zögerte sie hineinzugehen. Die Trauergäste scharten sich um sie, ihre Schwestern sahen sie fragend an, und sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach.
Adelina stieß sie an. »Du musst was sagen, Greta. Es hätte sich eigentlich schon oben, gleich nach der Beerdigung, gehört. Die Leute meinen sonst, wir wären zu geizig, sie einzuladen …« Greta hörte nicht mehr hin. In ihren Ohren rauschte es. Sie hasste es, vor vielen Leuten zu sprechen. Um ehrlich zu sein, sprach sie überhaupt nicht gern, seit sie als Kind mehrere Jahre vollkommen stumm gewesen war. Zwar hatte sie eines Tages wieder angefangen zu sprechen, dennoch hatte sie noch immer das Gefühl, es nicht richtig zu können. Die Worte kamen nicht so flüssig und mühelos aus ihrem Mund wie bei ihren Schwestern, bei ihrem Vater oder bei Tante Adelina, die ohne Punkt und Komma reden konnte. Und wenn ihr einmal nichts mehr einfiel, fügte sie einfach ein paarmal ein Madresanto oder ein Diomio hinzu und redete dann schnell weiter, so als hätte sie Angst davor, dass sich zwischen ihren Sätzen ein Abgrund auftun könnte. Adelina fürchtete sich vor den Pausen zwischen den Wörtern, als ob dort Dämonen lauerten. Deshalb bekreuzigte sie sich auch andauernd, vermutete Greta. Hinter Tante Adelinas breitem Rücken lauerte das Böse, stets bereit, beim geringsten Anzeichen von Unaufmerksamkeit zuzuschlagen. Bei Greta dagegen war es andersherum. Sie fürchtete sich vor den Wörtern zwischen dem Schweigen. Es war die Abwesenheit von Wörtern, die sie wie ein tröstlicher Kokon umhüllte und ihr ein Gefühl von Sicherheit vermittelte. Wenn es Dämonen gab, dann kamen sie wortreich daher, nicht schweigend, davon war Greta überzeugt.
Wieder knuffte Adelina sie in die Seite. »Jetzt reiß dich mal zusammen, Greta. Mach den Mund auf. Was sollen die Leute denken?«, zischte sie.
Greta schluckte, suchte in ihrem Kopf, ihrem Bauch, wo auch immer nach den richtigen Worten und fand nur Leere. Das Atmen fiel ihr plötzlich schwer. Da glitt ihr Blick zu Don Pittigrillo, der ihr zunickte und sie dabei mit seinen gütigen Augen so freundlich ansah, dass sie wieder atmen konnte. Sie straffte die Schultern und räusperte sich. Dann sagte sie, mit einem mühsamen Lächeln, an die Wartenden gerichtet: »Mein Vater heißt euch in der Trattoria Paradiso willkommen.«
Sie blieb zusammen mit Adelina neben der Tür zur Trattoria stehen, erleichtert, ihre Aufgabe gemeistert zu haben, und nickte jedem Einzelnen zu, der eintrat. Die Trattoria und der Garten füllten sich schnell mit Leuten, die beiden Aushilfen boten zusammen mit Domenico Wein an und geleiteten die Gäste ans Büfett. Nach und nach ließ die Anspannung unter den Trauernden ein wenig nach. Bald würde man beginnen, wieder unbefangen miteinander zu plaudern, Erinnerungen auszutauschen und – das vor allem – zu essen. Greta und ihr Vater hatten in der Trattoria schon öfter nach Beerdigungen die Feier ausgerichtet, und Greta war immer wieder über den großen Appetit von Trauergästen verblüfft gewesen.
»Trauer macht hungrig«, hatte ihr Vater dann gesagt. »Es ist anstrengend, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Mindestens so viel Arbeit, wie von der Insel ans Festland zu rudern.« Und dann hatte er gelacht und eine weitere Schüssel mit dampfenden Spaghetti nach draußen getragen. Greta musste schlucken, als sie daran dachte. Jeder Handgriff, jeder Teller, jeder Gedanke, der mit der Trattoria zusammenhing, würde sie in Zukunft an Babbo erinnern. Wie sollte sie das ertragen? Greta hatte keine Tränen, sie verspürte keinen Hunger, keinen Durst, sie fühlte überhaupt nichts, außer dem noch immer schier übermächtigen Wunsch, einfach davonzuschweben – wie ein Blütenblatt, eine Vogelfeder, ein Staubkorn – und alles hinter sich zu lassen.
»Den nicht!« Adelina packte Greta hart am Arm und schob sie in den Gastraum. Als sie die Tür zuschlug, klirrte die Glasscheibe.
Greta war erschrocken zusammengezuckt, als ihre Tante sie so unsanft aus ihren Gedanken gerissen hatte. »Was ist los?«, fragte sie.
»Der kommt hier nicht rein«, murrte Adelina und deutete durch die Glasscheibe auf den Mann, der in einigem Abstand auf der Straße stand.
Greta folgte ihrem Blick. Der Mann war allein, offenbar waren alle anderen schon in die Trattoria gekommen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Er trug einen schäbigen schwarzen Anzug und ein am Kragen ausgefranstes Hemd, das mehr gelb als weiß aussah. Seine Schuhe waren ausgetreten und staubig, und er hatte keine Socken an.
»Das ist Tano«, sagte Greta verwundert. »War er etwa auch auf Babbos Beerdigung? Ich habe ihn gar nicht gesehen.«
Tano war ebenfalls Insulaner, doch nicht wirklich Teil der kleinen, höchstens noch fünfzig Seelen zählenden Gemeinschaft derjenigen Menschen, die hier ständig wohnten und nicht nur wegen der Touristen im Sommer herkamen. Er hauste in einer winzigen, baufälligen Kate in der Nähe des alten Hafens, war Fischer, verbrachte aber den Großteil seiner Tage vor allem mit dem Trinken. Er mied die Gesellschaft von Menschen, und man sah ihn manchmal wochenlang nicht, bis er plötzlich auftauchte, meist in Begleitung eines seiner großen schwarzen Hunde. Dann kaufte er im winzigen Lebensmittelgeschäft von Cinzia Locatelli ein, Spaghetti, Reis, Brot, Hundefutter, Wein und Schnaps, trank manchmal einen Espresso in der Gelateria nebenan und verschwand wieder. Heute hatte er keinen Hund dabei, und ganz entgegen seinem sonst eher schroffen Auftreten wirkte er unsicher, kurz davor, die Flucht zu ergreifen.
»Keine Ahnung, wo er war und wo er hinwill.« Adelina schnaubte. »Hier rein kommt er jedenfalls nicht.«
»Aber wenn er auf der Beerdigung war, ist er ebenso willkommen wie alle anderen«, widersprach Greta und wollte die Tür öffnen.
Adelina legte ihre Hand auf Gretas Hand und hielt sie mit eisernem Griff fest. »Das wirst du schön bleiben lassen«, zischte sie. »Tano stinkt nach Schnaps und Scheiße. Ich glaube nicht, dass er sich jemals wäscht. Außerdem pöbelt er die Leute an. Willst du etwa alle unsere Gäste vergraulen?«
»Es ist eine Trauerfeier. Da wird er sich schon benehmen.« Greta riss sich los und öffnete die Tür. Doch es war zu spät. Tano war schon weg. Greta lief hinaus und sah ihn mit krummem Rücken in Richtung Hafen schlurfen. Sie wollte ihn rufen, doch Adelina, die ihr nachgelaufen war, zerrte sie zurück in die Trattoria. »Jetzt lass doch den alten Säufer. Du machst dich ja lächerlich. Wahrscheinlich wollte er ohnehin nur glotzen.«
Gina und Lorena erwarteten sie im Garten. »Wo wart ihr denn so lange?«, fragte Lorena.
»Gesindel vertreiben«, sagte Adelina unwirsch, und als Lorena fragend eine Augenbraue hob, winkte ihre Tante ab. Greta schwieg. Sie ärgerte sich, dass sie sich von Adelina hatte zurückhalten lassen. Babbo hätte Tano nicht abgewiesen. Ihm waren alle willkommen gewesen. Ob sie sauber waren oder nicht.
»Wein?« Lorena reichte Adelina ein Glas von dem Tablett, das hinter ihr auf dem Tisch stand, doch die Tante schüttelte fast entrüstet den Kopf. »Aber nein! Der ist nicht gut für meinen Blutdruck.«
Lorena stellte das Glas schulterzuckend zurück, ohne es Greta oder Gina anzubieten. Sie hatte sich frisch geschminkt, die Tränenspuren waren beseitigt, der Teint wieder makellos. Ihre Sonnenbrille hatte sie sich in die Haare gesteckt. Gina dagegen wirkte noch immer blass und angespannt. Sie hob mit fahrigen Bewegungen die Zigarette an den Mund, zog daran und hielt sich mit der anderen Hand an ihrem halb leer getrunkenen Glas fest. »Ich kenne keinen dieser Leute«, murmelte sie. »Alle sprechen mich mit Namen an, aber ich habe keinen Schimmer, wer sie sind.«
»Du warst zu lange weg, Liebes.« Adelinas Stimme bekam einen weicheren Klang. Gina war immer schon ihre Lieblingsnichte gewesen. Zumindest so lange, wie sie so funktioniert hatte, wie Adelina es von einem jungen Mädchen erwartete. Danach war ihre Zuneigung jedes Mal in Zorn umgeschlagen, sobald ihr Blick auf Ginas fast kahlen Kopf gefallen war. Die beiden hatten sich in der Zeit die heftigsten Gefechte von allen geliefert. Doch seit Gina weit weg wohnte und überdies eine erfolgreiche Geschäftsfrau geworden war, wie man hörte, war sie in der Achtung ihrer Tante wieder gestiegen. Adelina hakte sich bei ihr unter. »Komm mit, ich stelle dir alle vor.« Gina trank mit einem großen Schluck ihr Glas aus und ließ sich dann widerwillig von Adelina mitziehen.
»Erinnert ihr euch noch an unsere kleine Ginetta? Gina lebt jetzt in Deutschland«, hörte man Adelina zu Cinzia Locatelli vom Lebensmittelgeschäft und ihrem Mann sagen. »Stellt euch vor, sie hat eine eigene Firma …«
Zwischen Lorena und Greta breitete sich das unbehagliche Schweigen zweier Menschen aus, die sich irgendwann, vielleicht ohne es zu wollen, voneinander entfernt hatten und den Weg zurück nicht mehr fanden. Als sich jedoch ihre Blicke für einen Moment trafen, erkannte Greta in den Augen ihrer Schwester die gleiche Fassungslosigkeit, die gleiche Unfähigkeit zu akzeptieren, dass ihr Vater einfach nicht mehr da war, die sie selbst verspürte.
»Lorena …«, begann Greta zögernd, auf der Suche nach den richtigen Worten, um ihr zu signalisieren, dass sie beide das Gleiche fühlten, doch Lorena hatte sich bereits abgewandt, der Moment der Nähe war verflogen. Ihr Blick suchte Diego, ihren Mann, der mit den Kindern am Büfett stand und sich gerade ein frittiertes Reisbällchen in den Mund schob. Sie verständigten sich wortlos über irgendetwas, was Greta nicht zu deuten wusste, dann sah Lorena auf ihre Armbanduhr, die zusammen mit einem silbernen Armreif edel funkelnd an ihrem Handgelenk klimperte, und sagte: »Wie lange wird das hier noch dauern, Greta?«
Greta sah sie erstaunt an. »Es hat doch gerade erst angefangen …«
Lorena verdrehte die Augen. »Ja, schon. Aber ich finde es irgendwie pietätlos, diese Fresserei nach einer Beerdigung. Die sind alle nur hier, weil es etwas umsonst gibt.«
Greta schwieg. Wie sollte sie ihre Empörung über diesen Satz in Worte kleiden, wenn Lorena, die doch auch Ernestos Tochter war, es nicht von selbst verstand? Wie sollte sie ihr, die ebenso hier aufgewachsen war, in dieser kleinen verschworenen Gemeinschaft, erklären, dass all diese Nachbarn, Freunde und Bekannten das Bedürfnis hatten, noch eine Weile zusammen zu sein, miteinander zu essen und zu trinken und sich auf diese Weise von Ernesto zu verabschieden? Dass es gut und richtig so war, wie es war?
»Babbo hätte das nicht so gesehen«, sagte sie schließlich leise.
»Natürlich nicht.« Lorena seufzte. »Unserem Vater war es immer am wichtigsten, was die Leute denken. Hat immer am Althergebrachten festgehalten. Genau wie Adelina.« Sie sah sich um und musterte halb belustigt, halb verächtlich, wie die Tante Gina herumführte wie ein Zirkuspferd.
»Fehlt nur noch, dass Gina einen Knicks machen muss«, sagte sie, dann kniff sie die Augen zusammen, musterte die Schwester genauer und murmelte: »Trinkt Gina etwa schon das dritte Glas Wein? Du meine Güte. Es ist noch nicht mal Mittag. Am Ende tanzt sie womöglich auf dem Tisch …«
Greta zuckte mit den Schultern. »Und wenn schon? Wenn das ihre Art ist zu trauern …«
Lorena starrte sie empört an. »Das ist doch nicht dein Ernst!«
»Was stört dich daran? Etwa, was die Leute sagen …?«
Lorena öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, dann klappte sie ihn wieder zu und schüttelte den Kopf. »Wie dem auch sei, wir müssen bald los. Diego hat noch einen wichtigen Termin, den er nicht verschieben konnte, und für die Kinder ist das ja auch nichts …«
»Warum?«
»Was, warum?«
»Warum ist das nichts für sie, auf der Trauerfeier ihres Opas zu sein?«
»Weil … weil … ich sagte doch schon: Diese Fresserei ist einfach abstoßend. Wahrscheinlich endet das alles in einem Besäufnis. Das hat mit Trauer nichts zu tun.«
In dem Moment kam Gina zurück. Ihre Wangen waren leicht gerötet, und ihre Lippen hatten den verkrampften Zug verloren. »Jetzt bin ich wieder auf dem Laufenden, was die Bewohner der Isola Maggiore anbelangt.« Sie verzog das Gesicht zu einem kleinen Lächeln, dem ersten, seit Greta sie hier auf der Insel begrüßt hatte. »Alle Todesfälle, Geburten und Eheschließungen der letzten Jahre mit eingeschlossen …«
»Ob du das heute Nachmittag auch noch alles weißt?«, warf Lorena säuerlich ein.
»… stellt euch vor, Matteos Mutter ist auch hier. Sie habe ich doch tatsächlich gleich wiedererkannt …«, erzählte Gina weiter, und erst dann fiel ihr Lorenas Bemerkung auf. Sie unterbrach sich. »Was willst du damit sagen?«
»Alkohol ist nicht gerade förderlich fürs Gedächtnis, sagt man …« Lorena warf einen vielsagenden Blick auf das neue Glas Wein, das ihre Schwester von ihrer Vorstellungsrunde mitgebracht hatte. Ginas Miene verdüsterte sich. »Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Lorena«, fauchte sie und kippte den Wein in einem Zug hinunter.
»Natürlich. Deine Sache.« Lorena hob beide Hände in einer Unschuldsgeste. »Diego, ich und die Kinder nehmen übrigens das nächste Boot. Fährst du mit, oder willst du lieber weitertrinken?«
Als ihre Schwestern gegangen waren, sah sich Greta prüfend um. Die Sonne stand inzwischen hoch über dem Garten, und es war sehr warm geworden. Domenico hatte die beiden großen Schirme aufgespannt und das Eis in den Weinkühlern neu aufgefüllt. Das Büfett leerte sich langsam. Greta holte Nachschub, schnitt zusätzlich gekühlte Melonen und Orangen in Scheiben und schickte eine der beiden Aushilfen in die Gelateria, um eine große Schale Zitroneneis zu holen. Gegen vier Uhr waren die meisten Gäste gegangen. Auch Pina Ferraro, von der Gina gesprochen hatte, verabschiedete sich. Matteo Ferraro war mit Gina im Gymnasium in dieselbe Klasse gegangen. Sie waren eng befreundet gewesen.
»Wie schön, dass Gina wieder da ist«, sagte Pina Ferraro mit einem falschen Lächeln in ihrem früh verwelkten Gesicht. Greta hatte Matteos Mutter noch nie ausstehen können. Sie war ein boshaftes Klatschweib und eine Heuchlerin.
»Wird sie dieses Mal für länger bleiben?«
Greta zuckte mit den Schultern. Gina wohnte in Lorenas und Diegos Stadtwohnung in Perugia, wie immer, wenn sie nach Hause kam, was in den letzten Jahren höchst selten vorgekommen war. Greta hatte keine Ahnung, wie lange sie zu bleiben gedachte.
»Ist sie allein hier?«
»Ja«, gab Greta knapp zurück. Das jedenfalls wusste sie mit Sicherheit.
»Noch immer nicht in festen Händen?« Pina Ferraros Miene trübte sich, scheinbar besorgt. »Wie schade. Meine beiden Töchter haben ja schon sehr früh geheiratet …«
»Und wie steht’s mit Matteo?«, fragte Greta und traf damit den wunden Punkt von Pina Ferraro. Ihr Ältester dachte nämlich zu ihrem großen Kummer nicht daran, sein Junggesellenleben aufzugeben, schien es vielmehr in vollen Zügen zu genießen. Das hatte Greta von ihrer Nachbarin Nunzia erfahren, deren Tochter Franca auf dem Festland, in Passignano, wo auch Pina wohnte, einen Friseurladen hatte und daher über alles Bescheid wusste. Greta selbst hatte Matteo, der in Perugia lebte, schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Mit zwölf Jahren war sie eine Weile unsterblich in ihn verliebt gewesen, hatte den Schulfreund ihrer fünf Jahre älteren Schwester regelrecht angehimmelt. Er war immer nett zu ihr gewesen, hatte sie nie wie ein Baby behandelt oder aus dem Zimmer gescheucht wie Ginas andere Freunde, und sie hatte sich eingebildet, er würde sie auch ein bisschen mögen. Doch darin hatte sie sich bitter getäuscht.
Pina Ferraros Lippen wurden schmal. »Nun ja. Jeder, wie er möchte, nicht wahr? Ich werde Matteo jedenfalls erzählen, dass Gina wieder da ist.«
Greta nickte. »Tun Sie das, Signora Ferraro. Es wird aber nichts nützen.«
Pina sah sie empört an. Sie öffnete den Mund für eine scharfe Erwiderung, doch dann besann sie sich eines Besseren und wandte sich brüsk ab.
Adelina, die das Gespräch mitbekommen hatte, schüttelte den Kopf. »Manchmal weiß ich nicht, was schlimmer bei dir ist, Greta. Wenn du den Mund nicht aufkriegst oder aber wenn du ihn aufmachst.«
Dann waren nur noch die engsten Freunde ihres Vaters da. Greta kochte Espresso und stellte eine Flasche Grappa auf den Tisch. Als die Sonne langsam zu sinken begann, packte Orazios Kapelle auf Bitten der verbliebenen Gäste noch einmal die Instrumente aus und spielte zum Abschied für Ernesto, der ein großer Fellini-Fan gewesen war, La Passerella d’addio. Alle Anwesenden, mit Ausnahme von Greta, die noch immer keine Tränen in sich fand, weinten, als die fröhliche und doch so melancholische Zirkusmelodie erklang. Damit ging die Trauerfeier für Ernesto Peluso zu Ende, und alle waren sich darin einig, dass es ein würdiger Abschied gewesen war. Sie bedankten sich wortreich bei Greta und schlichen nach und nach davon, wohl wissend, dass die Trattoria Paradiso fortan nicht mehr dieselbe sein würde. Nunzia, ihre Nachbarin, fiel Greta schluchzend um den Hals, während ihr Mann Clemente leicht verlegen danebenstand und aufmerksam seine schwieligen Hände betrachtete. Greta tätschelte ihr die massige Schulter, roch Veilchenparfum, Haarspray, Schweiß und den etwas muffigen Lavendelduft, den ihr schwarzes Kleid verströmte. Vermutlich trug sie es nur zu Beerdigungen, und das übrige Jahr hing es ganz hinten im Schrank, mit einem Duftsäckchen am Kleiderbügel.
»Mein armes Mädchen!«, schniefte Nunzia, während sie sich widerstrebend von Greta löste. »Jetzt bist du ganz allein auf der Welt.«
»Sie hat doch noch ihre Schwestern«, wandte ihr Mann ein. Als Nunzia ungeachtet dieses Einwands wieder zu weinen begann, warf Clemente Greta einen verlegenen Blick zu und reichte seiner Frau ein Taschentuch.
»Ja, natürlich.« Nunzia beruhigte sich ein wenig und schnäuzte vernehmlich. »Ihr haltet zusammen, du, Lorena und Gina, nicht wahr?«
Greta nickte zögernd. »Sicher tun wir das.«
Nunzia sah sich um. »Wo sind die beiden eigentlich?«
»Sie mussten schon gehen«, sagte Greta.
Nunzia starrte sie aus vom Weinen geröteten Augen an. »Wie? Sie sind schon weg?«
Greta nickte etwas unbehaglich. »Diego, also Lorenas Mann, hatte wohl einen Termin …«
»Was hatte der?« Nunzias rundliches Gesicht färbte sich dunkelrot.
»Nunzia! Wir sollten jetzt auch gehen …« Clemente, der ahnte, was gleich kommen würde, versuchte, seine Frau zu bremsen. Doch Nunzia schüttelte seinen Arm ab wie eine lästige Fliege.
»So? Dieses solariumgebräunte Windei hatte also einen Termin? Am Tag des Begräbnisses seines Schwiegervaters?« Ihre schwarzen Augen verengten sich zu Schlitzen, die fast ganz hinter den dicken Wülsten ihrer Wangen verschwanden.
Greta winkte ab. »Das ist schon in Ordnung …«
»Und Lorena und Gina? Hatten die auch einen Termin?«
Clemente schob seine Frau jetzt energisch zur Tür. »Das ist doch wirklich nicht unsere Sache …« Er drehte sich entschuldigend zu Greta um: »Danke, Greta. Und wenn du was brauchst …«
Nunzia schimpfte weiter, während Clemente leise auf sie einredete, und ließ sich nur äußerst widerstrebend dazu bewegen, die Trattoria zu verlassen. Greta sah ihnen nach und musste ein wenig lächeln. Sie mochte die aufbrausende Nunzia und ihren ruhigen, bedächtigen Mann.
Nachdem aufgeräumt war, die Aushilfen und Domenico gegangen und Adelina sich auf Drängen von Greta ebenfalls zurückgezogen hatte, kehrte endlich Stille ein. Greta wischte die bereits blitzblanken Arbeitsflächen noch einmal ab, spülte die Kaffeemaschine, die Domenico bereits gereinigt hatte, rückte Tische und Stühle zurecht, zupfte Tischdecken gerade. Als sie beim besten Willen nichts mehr fand, was noch zu tun gewesen wäre, ging sie hinunter zum Steg, setzte sich auf die noch sonnenwarmen Planken und ließ die Füße ins Wasser baumeln. Unter ihren Zehen huschten kleine Fische zwischen den grünlichen Schlingpflanzen davon. Die Sonne stand inzwischen tief am Himmel und tauchte ihr kleines Boot, das dort angebunden vor sich hin dümpelte, in mildes Abendlicht. Ein Reiher flog vorbei, und im Schilf am Ufer raschelte die Nutriafamilie, die dort ihr Nest hatte. Greta sah zu, wie die Sonne langsam unterging, und spürte, wie die Luft kühler wurde. Im Abendrot leuchtete die Fassade des alten Hauses, in dem sie seit ihrer Geburt lebte, dramatisch rot auf, und was ihr bisher immer so schön, friedvoll und tröstlich vorgekommen war, erschien ihr heute unheilvoll, ja fast bedrohlich. Dann verschwand die Sonne hinter dem Horizont, und das Licht erlosch. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah nach oben in den Himmel, in den sie heute so gern entschwebt wäre. Die Schwalben kreisten über den Häusern, und die Luft war erfüllt von ihrem hohen, schrillen Pfeifen. Sie war unfähig, irgendwohin zu fliegen. Noch nicht einmal ihre Gedanken mochten sich erheben. Ihr Vater war tot. Es gab ihn nicht mehr. Nunzia hatte recht gehabt. Sie war allein. Eine ganze Weile blieb Greta noch sitzen, bemüht, diesen erschreckenden Gedanken zu erfassen, voll und ganz zu begreifen, ihn sich einzuverleiben, um ihn dann loslassen und weitermachen zu können, doch es gelang ihr nicht. Ihr Blick wanderte zu dem kleinen Fenster ganz oben im Giebel des Hauses.
»Was soll ich tun, Nonna?«, flüsterte sie. »Wie soll es weitergehen?«
3
Die beiden Räume unter dem Dach waren das Reich von Nonna Rosaria gewesen. Dort hatte sie ihr Schlafzimmer gehabt und das sogenannte Nähzimmer, das für Greta als Kind so etwas wie eine Schatzhöhle gewesen war. Obwohl ihre Großmutter nun schon seit sechsundzwanzig Jahren tot war, war dieses Zimmer nahezu unverändert geblieben. In jenem schrecklichen Sommer, in dem ihre Mutter verschwunden war und der damit ihr ganzes Leben in Vorher und Nachher geteilt hatte, hatte keiner aus der Familie Peluso die Kraft oder das Interesse aufgebracht, sich um die beiden Zimmer der Nonna zu kümmern, die wenige Monate zuvor gestorben war. Damals hatte Greta sie mit stummer Hartnäckigkeit in Besitz genommen und nicht mehr hergegeben. Noch heute schlief Greta neben dem Nähzimmer, im ehemaligen Schlafzimmer der Nonna, das sie sich neu und modern eingerichtet hatte. Im Nähzimmer dagegen stand noch immer alles an seinem angestammten Platz: die mechanische schwarze Singer-Nähmaschine mit dem kleinen Tisch unter dem Fenster und daneben der alte hölzerne Webstuhl, von dem niemand mehr wusste, wie man ihn bediente, die Aussteuertruhe aus dunklem Holz in einer Nische neben der Tür. Es gab noch immer die Kartons voller Stoffreste in den bis oben hin vollgestopften Regalen, Marmeladengläser, gefüllt mit bunten Knöpfen, kleinen Perlen, Schnallen, Troddeln, Bordüren, Spitzensäumen, Fadenspulen in allen Farben, Schneiderkreide, eine riesige Schere und sogar noch einige der Kleidungsstücke, die Nonna Rosaria bis kurz vor ihrem Tod regelmäßig für sich und die Enkelinnen genäht hatte: Kittelschürzen mit Blumenmuster und altmodisch geschnittene, knielange Röcke für sich selbst, bunte Hängerchen mit gesmokten Oberteilen und Perlenbordüren als leichte Sommerkleider für die kleinen Mädchen, die sie damals gewesen waren. Greta wischte dort regelmäßig Staub, putzte die Fenster und fegte den Boden. Hin und wieder öffnete sie die alte Aussteuertruhe und ließ ihre Hände über die vergilbten Stoffe gleiten, die dort lagerten, atmete den schwachen Duft der Lavendelsäckchen ein, die sie jedes Jahr neu gegen die Motten hineinlegte, oder saß einfach nur da, zwischen Nähmaschine und Webstuhl, und hing ihren Gedanken nach.
In jenem Sommer, in dem ihre Mutter verschwindet, denkt Greta nicht mehr an das Zimmer, für eine Weile vergisst sie sogar die Großmutter, ihren Tod und alles davor. Sie vergisst Nonnas fröhliches Lachen, das ihren rundlichen Körper erbeben ließ und ihr Lachtränen in die Augen trieb, vergisst das rhythmische Geräusch der Nähmaschine, wenn sie das Fußpedal zum Schwingen brachte, ihre Mandelkekse, die sie in einer bunten Blechdose immer für ihre drei Enkelinnen bereithielt, und die dünne schwarze Pfeife, die sie manchmal rauchte, an stillen Sommerabenden, wenn die Sonne glühend über dem See unterging. In jenem Sommer, der das Leben der Familie Peluso wie ein brennendes Schwert in Vorher und Nachher teilt, ist es nicht möglich, an etwas zu denken, was vorher war. Jede Erinnerung verstärkt den Schmerz, der so unbegreiflich ist, ins Unermessliche. In den Tagen, die folgen, in denen die Zeit stillsteht wie das viel zu warme Wasser des Sees und alle warten, ohne zu wissen, worauf, weint Greta kein einziges Mal, obwohl die Traurigkeit ihr manchmal das Herz so eng macht, dass sie glaubt, sterben zu müssen. Doch sie fürchtet sich davor, nie mehr mit dem Weinen aufhören zu können, wenn sie einmal damit anfängt, und deshalb versucht sie, die Tränen zurückzudrängen, sobald sie ihr in die Augen steigen. Und dafür reichen schon die kleinsten Dinge. Die Pasta al Sugo, die ihr die Tante hinstellt und die ganz anders schmeckt als die ihrer Mutter, der Anblick ihrer Haarbürste im Bad, ihre goldfarbenen Sandalen im Flur, mit den leicht schiefen Absätzen und den Glitzersteinen. Alles ist noch da, nur sie selbst nicht. Man könnte meinen, die Mutter sei nur einkaufen gegangen und habe sich verspätet, und manchmal versucht Greta, sich das einzureden. Es ist schließlich Tante Adelina, die, vier Monate danach, an einem regnerischen Tag im Oktober, alles, was einmal der Mutter gehört hat, in zwei große Kisten packt und wegräumt. Und Greta, die ihr dabei zusieht, hasst sie dafür mit einer stummen Inbrunst, die ihr selbst Angst macht. Danach kann sie nicht mehr anders, sie muss weinen, und sie weint, bis sie sich leer und ausgetrocknet anfühlt wie ein staubiger Fetzen Papier, der irgendwo am Randstein liegt und von der Sonne und der Hitze so ausgebleicht ist, dass man nicht mehr erkennen kann, wofür er einmal gut war. Sie würde sich gern von ihrem Vater trösten lassen. Sie wünscht sich, er würde ihr die Haare zerzausen, die fein wie dunkle, gekringelte Federn sind und in denen keine Spange und kein Gummi hält, und sie möchte ihn sagen hören: »Briciola, das ist doch nichts, was uns umhaut, oder?« Sie wünscht sich, dass er sie mit dem alten Spitznamen anspricht, den ihr Nonna Rosaria gegeben hat: Briciola, Krümelchen. Doch Babbo nennt sie nicht mehr so, und er ist nur noch unten in der Trattoria und kaum noch bei ihnen oben in der Wohnung. Und wenn doch, ist er gar nicht wirklich da, starrt abwesend in die Luft und gibt keine Antwort, wenn Lorena oder Gina ihn etwas fragen. Greta würde sich auch gern von ihren Schwestern trösten lassen, mit ihnen zusammen in Lorenas Bett liegen, so wie früher, und kichern, Zeichentrickfilme ansehen und Nonnas Mandelkekse essen. Doch die beiden haben keine Zeit für sie. Lorena lernt Tag und Nacht, ihre Augen hinter der Brille sind klein und gerötet vom vielen Lesen, ihre Stirn ist immer gerunzelt, und noch während des Essens liegt ein aufgeschlagenes Buch auf ihren Knien. Sie murmelt sogar lateinische Vokabeln vor sich hin, wenn sie auf dem Klo sitzt. Und Gina scheint ihre kleine Schwester gar nicht mehr zu sehen. Sie ist nach diesem Sommer eine andere geworden. Es hat damit begonnen, dass sie sich ihre Haare abgeschnitten hat, diese glänzende Wolke dunklen Haares, die Tante Adelina immer gekämmt und für die Schule in Zöpfe geflochten hat. Ginas Blick ist zornig geworden, sie kaut ununterbrochen Kaugummi, und ihre Lehrerin, Signora de Tetris, ruft ständig bei ihrem Vater an, um sich über sie zu beschweren. Ihr Vater sagt stets dasselbe: »Ich weiß, Signora, ich weiß. Haben Sie Geduld. Das wird sich geben.«
Doch Greta hat ihre Zweifel. Einmal bringt Signor Locatelli vom Supermarkt Gina höchstpersönlich nach Hause und erzählt der entsetzten Tante Adelina, dass er sie beim Klauen erwischt hat. »Eine Cola und eine Tüte Fonzis Käsewürmchen hat sie mitgehen lassen«, verkündet er in einem anklagenden Ton und legt beides mit einer vorwurfsvollen Geste auf den Tisch. Tante Adelina entschuldigt sich wortreich und bezahlt die Cola und die Fonzis. Als Signor Locatelli gegangen ist, verpasst sie Gina eine schallende Ohrfeige und vergisst dabei vor Zorn sogar, sich danach zu bekreuzigen wie sonst immer, wenn sie Klapse und Kopfnüsse an die Mädchen verteilt. Gina zuckt nicht einmal mit der Wimper. Sie bleibt einfach stehen, mit der glühend roten Wange, und mustert die Tante mit einem Blick, der Greta, die schweigend und unbemerkt auf der Treppe sitzt und zusieht, ein bisschen unheimlich ist.
Ein anderes Mal erzählt eine Nachbarin Tante Adelina, dass sie Gina nachts an der Hafenmole gesehen hat, zusammen mit Orazio Mezzavalle und Enzo Fusetti und ein paar ihrer nichtsnutzigen Freunde, die hin und wieder auf die Insel kommen, trinken, feiern und meist eine Menge Blödsinn machen. »Stell dir vor, Adelì, sie hat geraucht«, raunt die Nachbarin ihr zu, und Greta, die wiederum alles mit anhört, stellen sich vor schaurigem Entsetzen die Nackenhaare auf. Rauchen, das tun nur Erwachsene. Und Orazio und seine Freunde, die schon siebzehn Jahre alt sind, also fast erwachsen. Ihre Schwester Gina aber ist erst dreizehn, und Greta mit ihren acht Jahren versteht, dass es ungeheuerlich ist, wenn sie sich zur Schlafenszeit mit den großen Jungs herumtreibt und Zigaretten raucht. Es ist so ungeheuerlich und dabei aber zugleich so spannend, dass Greta eine widerwillige Bewunderung für ihre Schwester empfindet.
In jenem Herbst, in den ersten lichtlosen, gestaltlosen Wochen des Nachher, als die Schule wieder begann, Gina sich eine Ohrfeige einhandelte und beim Rauchen am Hafen erwischt wurde, Lorena den ersten Preis bei einem landesweiten Lateinwettbewerb gewann und Tante Adelina wortlos die goldenen Sandalen ihrer Mutter und alles andere in die Kiste packte und die geblümten Sommerkleider, die hellgraue Strickjacke, die Perlenkette, die Haarbürste, ihr Duft, ihre Stimme, ihre Berührungen aus dem Leben der Pelusos verschwanden, beschloss Greta auszuziehen. Sie teilte es ihrer Familie wortlos, nur durch Gesten mit, denn seit jener Nacht im Juni, als das Nachher begann, war ihre Stimme verschwunden. Manchmal dachte sie, ihre Mutter habe sie womöglich mitgenommen, habe sie ihr mit einer ihrer anmutigen Handbewegungen von den Lippen gezupft und eingepackt, um sie an jenem Ort, an den sie gegangen war, wieder freizulassen. Greta gefiel der Gedanke, dass ihre Mutter etwas von ihr mitgenommen hatte und ihre Stimme jetzt bei ihr war. Ihr selbst fehlte sie nämlich kein bisschen. Im Gegenteil. Ihre Stummheit führte dazu, dass man sie in Ruhe ließ. Man begann, sie zu übersehen. In der Schule und auch zu Hause vergaß man gelegentlich, dass sie da war. Man vergaß zu fragen, ob sie satt geworden war oder noch einen Nachschlag wollte, man vergaß, ihre Hausaufgaben zu kontrollieren, und kam nicht mehr auf die Idee, sich zu erkundigen, ob in der Schule alles in Ordnung war. Greta hörte daher nach und nach auf, Hausaufgaben zu machen, und begann, die Schule zu schwänzen. Nicht so häufig, dass es aufgefallen wäre, aber immer wieder, wenn sie fand, dass es genug war und sie eine Pause brauchte. Zwar fuhr sie mit ihren Schwestern mit dem Boot aufs Festland und begleitete sie zum Bus, der die beiden ins Liceo nach Perugia brachte. Doch dann, wenn der Schulbus weggefahren war, ging sie nicht weiter brav die Straße entlang zur Grundschule, sondern drehte auf dem Absatz um und lief zurück zum See. Dort, in einem Versteck im Schilf in der Nähe der Uferpromenade, saß sie oft stundenlang und starrte ins Wasser, sah den kleinen Fischen zu, die wie lebendig gewordene Sonnenstrahlen im grünlichen Wasser aufblitzten, beobachtete die schwarzen dünnen Wasserschlangen, die sich mit stolz erhobenen Köpfchen durch das Wasser schlängelten, und vergaß für kurze Zeit alles andere, das Nachher ebenso wie das Vorher, als ihr Leben noch sorglos und leicht gewesen war. Auf diese Weise hüllte sich Greta immer tiefer in den Kokon des Schweigens ein, wickelte ihre Sprachlosigkeit um sich wie einen Mantel aus spinnwebdünnem Stoff, der mit jeder Lage undurchdringlicher wurde. Und so gab es auch keine große Diskussion, als sie beschloss auszuziehen. Ihr Vater versuchte halbherzig, sie umzustimmen, Tante Adelina rang die Hände und schimpfte, Gina zuckte mit den Schultern und schob ihren Kaugummi von einer Backe in die andere, und Lorena sah nicht einmal von ihrem Schulbuch auf. Greta nahm ihr Bettzeug, ihre Bücher und ihre Kuscheltiere, packte zusammen mit der weiter nörgelnden Adelina ihre Kleider in einen Wäschekorb und zog eine Treppe höher in das Schlafzimmer von Nonna Rosaria. Sie fand, das sei der richtige Ort für sie, unter dem Dach, in Nonna Rosarias Bett, wo man aus dem Fenster über den ganzen See blicken und sich vorstellen konnte, eines Tages mit den Schwalben, die ihr Haus unermüdlich umkreisten, einfach davonzufliegen.
Wie richtig diese Entscheidung gewesen war, erfuhr Greta kurz darauf.
Es ist ein paar Tage nach Weihnachten, einem so traurigen, trostlosen Weihnachten, dass es vollkommen aus der kollektiven Erinnerung der Familie Peluso entfernt werden wird. Greta wird vom Geräusch einer ratternden Nähmaschine geweckt. Anfangs glaubt sie zu träumen, doch als sie sich aufsetzt, sich in den Arm zwickt und die Nähmaschine unverdrossen weiterrattert, obwohl Greta unzweifelhaft wach ist, schlüpft sie in ihre Hausschuhe und tapst im Dunkeln hinüber in das Nähzimmer, um nachzusehen, wer auf die Idee gekommen sein mochte, mitten in der Nacht zu nähen. Bereits als sie die Tür öffnet, fällt ihr das Licht der Stehlampe auf, die neben der Nähmaschine steht. Und vor der Nähmaschine, wie eh und je, sitzt Nonna Rosaria, klein und rundlich, und näht. Ihre Füße in den alten Pantoffeln bedienen emsig das Pedal, und die Nadel wieselt geschäftig über einen gelb und orange geblümten Stoff. Das Licht der Stehlampe beleuchtet ihren breiten Rücken und die kurzen grauen, gelockten Haare, die, wie Greta von alten Fotos weiß, früher, als junges Mädchen, tintenschwarz waren. Stumm vor Schreck starrt Greta die einst so vertraute Gestalt an, hört die gewohnten Geräusche, das Rattern der Nähmaschine, das leise Quietschen der Pedale, ja, sie meint sogar, ihre Großmutter zu riechen, eine Mischung aus Glyzerinseife, Zitronenöl und süßem Gebäck, die ihre Großmutter stets umgab und die Trost, Geborgenheit und Mandelkekse versprach. Greta wagt nicht, sich zu bewegen, aus Angst, ihre nach Keksen duftende, emsig nähende Großmutter würde sich womöglich in Luft auflösen, platzen wie eine Seifenblase. Eine Weile bleibt sie stehen und sieht Nonna Rosaria zu, dann schließt sie leise die Tür und geht zurück in ihr Zimmer. Wundersam getröstet schläft sie wieder ein, das Geräusch der alten Nähmaschine noch im Ohr. Als sie am nächsten Morgen erwacht, läuft sie sofort hinüber ins Nähzimmer, doch ihre Großmutter ist fort, und die schwarze Nähmaschine glänzt leer und unberührt in der Morgensonne.
Nur drei Tage später ist es erneut so weit. Greta erwacht vom Rattern der Nähmaschine, und wie beim letzten Mal sitzt Nonna Rosaria auf ihrem Platz am Fenster und näht. Dieses Mal traut sich Greta, näher heranzugehen und sie anzusehen. Ihre Großmutter trägt ihre Brille ganz vorn auf der Nasenspitze und hat den Kopf konzentriert über den Stoff gebeugt. Sie blickt nicht auf, als Greta langsam näher kommt, es gibt kein Anzeichen dafür, dass sie ihre Enkelin bemerkt. Greta starrt Nonna Rosaria mit einer Mischung aus Furcht und Sehnsucht an, und plötzlich wünscht sie sich nichts dringlicher, als mit ihr sprechen zu können.
»Guten Abend, Nonna.«
Die Worte kommen einfach so aus ihrem Mund geflossen, wie von selbst.
Der Fuß ihrer Großmutter bedient weiterhin das Pedal, die Nähmaschine rattert weiter, und Nonna Rosaria hält weiter ihren Blick auf ihre Näharbeit gesenkt. Doch Greta kann sehen, wie sich ihr altes, runzliges Gesicht zu einem breiten Lächeln verzieht, und sie hört, wie ihre Großmutter sagt: »Guten Abend, Briciola.«