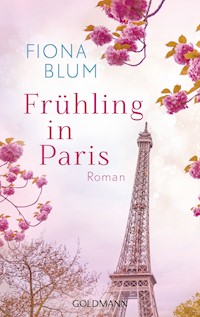7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Page & Turner
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ideale Geschenk für alle Büchernarren, Rom-Liebhaber und Katzenfreunde.
Eine schüchterne junge Frau, die versucht, sich hinter Büchern und Geschichten zu verstecken und dem Leben aus dem Weg zu gehen. Ein herrenloser Kater, der das letzte seiner sieben Leben schon aufgegeben hatte, als ihn ein Geruch unversehens in die Welt zurückholt. Zwei Kinder, deren Mutter ihre Tage unter einem Tisch zubringt, um der Angst zu entfliehen, und eine verrückte alte Frau, die ein großes Geheimnis hütet. Sie alle treffen während eines glühend heißen Sommers aufeinander, in Rom, dieser lauten, staubigen Stadt, deren unvergleichliche Schönheit sich nur demjenigen erschließt, der morgens um vier den Steinen zuhört und nicht an Zufälle glaubt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Buch
Eine schüchterne junge Frau, die versucht, sich hinter Büchern und Geschichten zu verstecken und dem Leben aus dem Weg zu gehen. Ein herrenloser Kater, der das letzte seiner sieben Leben schon aufgegeben hatte, als ihn ein Geruch unversehens in die Welt zurückholt. Zwei Kinder, deren Mutter ihre Tage unter einem Tisch zubringt, um der Angst zu entfliehen, und eine verrückte alte Frau, die ein großes Geheimnis hütet. Sie alle treffen während eines glühend heißen Sommers aufeinander, in Rom, dieser lauten, staubigen Stadt, deren unvergleichliche Schönheit sich nur demjenigen erschließt, der morgens um vier den Steinen zuhört und nicht an Zufälle glaubt.
Autorin
Fiona Blum ist Jahrgang 1968. Sie studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Anwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbstständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrem Mann, ihrer Tochter und einer Katze in einem alten Bauernhaus in Oberbayern. Unter ihrem richtigen Namen Veronika Rusch schreibt sie Kriminalromane, Theaterstücke und Dinnerkrimis.
Weitere Informationen unter www.fiona-blum.de und www.veronika-rusch.de.
FIONA BLUM
Liebe auf drei Pfoten
Roman
PAGE& TURNER
»Lachhaft zu sagen, jenseits des Himmels sei nichts …«
Giordano Bruno
EINS
Federica lag auf dem Balkon und wartete. Sie wartete, obwohl sie sehr gut wusste, dass es umsonst war: Es würde kein Luftzug wehen, nicht einmal der Hauch eines Luftzugs. Die drei staubigen Palmen in der Mitte des Hinterhofs standen matt und vollkommen reglos in der unbewegten Luft. Obwohl es schon halb eins war, zeigte das Thermometer noch immer unglaubliche 34 Grad Celsius. La grand’ afa, die von Marokko kommende, lähmende Schwüle dieses Sommers lag schon seit Tagen wie ein heißes Tuch auf der Stadt und nahm den Menschen die Luft zum Atmen. Und das war erst der Anfang. Die alljährliche Sommerhitze, in der der Herzschlag zum Stillstand kommt, sich das Gehirn anfühlt wie gekochte Calamari und die Glieder schwer wie Blei werden, dauerte immer ziemlich genau drei Monate: von Juni bis Ende August, wo dann meist La burrascadi fin’estate, ein großes Unwetter, offiziell den Sommer beendete.
Doch der Juni hatte gerade erst begonnen.
Unter ihr klapperte das Gebläse der altersschwachen Klimaanlage von Il Piccio, der Trattoria von Pasquale Balducci, der sich, ebenfalls wie jedes Jahr, störrisch und zornig, so als sei die Hitze eine an ihn persönlich gerichtete Beleidigung, geweigert hatte, seine Trattoria wenigstens für ein verlängertes Wochenende zu schließen und mit seiner schwitzenden Familie zu Verwandten in die Berge zu fahren.
Doch nicht nur die Balduccis, auch die meisten anderen Bewohner des Viertels blieben den Sommer über in der Stadt und würden wohl höchstens zu Ferragosto ein, zwei Tage nach Ostia fahren.
Hier im Testaccio, dem alten, vergessenen Viertel rund um den ehemaligen Schlachthof von Rom, war das Geld knapp, und kaum einer konnte es sich leisten zu verreisen. Das Testaccio rühmte sich damit, dasjenige historische Viertel zu sein, das in jeder Hinsicht am weitesten vom heiligen Zentrum der Stadt entfernt lag. Passenderweise verfügte es auch über einen Bastard in seiner Mitte, den illegitimen »achten« Hügel der Stadt, den Monte Testaccio, der nichts anderes als ein antiker Scherbenhaufen war, ein kahler Hügel, entstanden aus den Überresten zu Bruch gegangener Amphoren des alten Roms. Zur Besichtigung gab der Hügel nichts her, und malerische Gassen suchte man rund um den alten Schlachthof mit seinen rechtwinklig angelegten Straßen auch vergeblich, und so hatte das Viertel nie den Kultstatus seiner pittoresken Schwester Trastevere jenseits des Tibers erreicht. Es gab hier keine Sightseeing-Busse, keine Schneekugeln mit Petersdom und kein menu turistico. Stattdessen eine Pyramide voll streunender Katzen und viele Verrückte, Einsame und Gestrandete.
Und jene schmale Straße, die den hochtrabenden Namen Via del Arcangelo trug. Versteckt zwischen alten Häusern, von denen der Putz vergangener Jahrzehnte blätterte, folgte sie im Verborgenen der Biegung des Tibers von der Ponte Sublicio bis zur Ponte Testaccio. Dort, in einem ehemals terrakottarot gestrichenen Haus mit einem kiesbedeckten Innenhof, lag Federica Mazzanti in der schwülen Hitze der Juninacht auf dem Balkon ihrer Dachgeschosswohnung und wartete auf den Schlaf, der nicht kommen wollte.
Sie war keine Römerin von Geburt an, sondern stammte aus einem kleinen Dorf südöstlich der Stadt, wobei jeder, der sie zum ersten Mal sah, geneigt war zu glauben, dass das nur die halbe Wahrheit war. Eine so hellhäutige, zarte junge Frau konnte einfach nicht aus einem Bauerndorf in den Bergen des Latiums stammen. Sie musste angeflogen sein, vom Wind zufällig dorthin geweht wie die Schirmsamen des Löwenzahns, die kilometerweit getragen werden, bevor sie schließlich zu Boden sinken und Wurzeln schlagen. Und vielleicht war das auch so. Denn ihre ganze Familie, ihre Mutter Maria, eine kurzbeinige, energische Person, Salvatore, ihr Vater, überzeugter Kommunist und ehemaliger Postbeamter mit sardischen Vorfahren, und ihre drei Brüder waren allesamt schwarzhaarig und stämmig, mit Augen dunkel wie Olivenkerne. Federicas Augen dagegen hatten die Farbe des Tibers, manchmal waren sie schwermütig grau und abweisend, meist aber, vor allem im Licht der Sonne, schimmerten sie hellgrün, mit goldenen Sprenkeln. Solche Augen waren ein unerhörtes Ereignis in einem Dorf in den Bergen südlich von Rom. Niemand konnte sich erinnern, jemals jemanden mit solchen Augen gekannt zu haben. Außerdem hatte auch niemand Haare wie Federica, hellblond und lockig, federnd, dünn und leicht wie Spinnweben. So etwas kannte man in dem Dorf nicht, wo alle dichtes, kräftiges Haar hatten, das mit strassbesetzten Kämmen, bunten Klammern oder großzügigen Portionen Gel gebändigt werden musste.
Dieses ungewöhnliche Erscheinungsbild, das noch dazu mit einer alles übertreffenden Schüchternheit einherging, hatte ihr in ihrer Kindheit den Spitznamen La Diafana eingebracht, die Unsichtbare, so benannt nach einer ungeschickten Fee in einem Kinderbuch, die sich zu ihrem Leidwesen immer nur fast unsichtbar machen konnte. Und genau wie La Diafana hatte es auch Federica stets zutiefst bekümmert, dass es ihr nicht gelingen wollte, zwischen all den lauten, lebhaften, dunkelhaarigen Dorfkindern vollkommen unsichtbar zu werden. Auch als sie längst erwachsen war, wurde sie nicht müde, diese Kunst weiter zu perfektionieren. Die Tatsache jedoch, dass es ihr immer besser gelang, je älter sie wurde, war sehr bedauerlich, denn so entging den meisten, was ein aufmerksamer Beobachter durchaus hätte erkennen können: Hinter der verträumten, stillen Fassade verbarg sich nicht nur ein großes, mutiges Herz, sondern auch eine eigensinnige, unbeirrbare Persönlichkeit. Ihrer Familie entging zumindest letztere Eigenschaft jedoch nicht: Es wurde allgemein vermutet, dass der für ein so zartes Mädchen überraschende Starrsinn in irgendeiner Weise etwas mit den sardischen Vorfahren des Vaters zu tun haben musste, die allesamt als schlimme Sturköpfe galten, oder aber, noch wahrscheinlicher, mit den sardischen Eseln, deren Dickschädel sprichwörtlich war. Dies war die bevorzugte Meinung von Federicas Mutter, deren überschäumendes Temperament immer wieder am stummen Widerstand ihrer einzigen Tochter abprallte wie der Sturm an einem der stoisch ins Meer ragenden Wellenbrecher an der Küste von Ostia.
Im Gegensatz zu Pasquale Balducci, der sich jedes Jahr aufs Neue verbissen an die Hoffnung klammerte, dass die Touristen, die die glühende Stadt während der Sommermonate wie Termitenschwärme heimsuchten, doch endlich auch seine Trattoria entdecken mochten, waren Federica die Touristen egal. Zwar hing einer ihrer beiden Jobs in gewisser Weise davon ab, aber andererseits war das Albergo Il Nido, Das Nest, in dem sie als Frühstücksfräulein arbeitete, so verschlafen und fernab aller Massentourismusströme gelegen, dass sich nur sehr selten größere Reisegruppen hierher verirrten.
Trotz der Hitze überfiel Federica jetzt ein leichter Kälteschauer, als sie an ihre Arbeit im Albergo dachte. Obwohl sie nun schon einige Jahre dort arbeitete, bereiteten ihr die Gäste nach wie vor Unbehagen. Es lag immer etwas Forderndes in ihren Stimmen, eine Ungeduld, die sie nicht verstand, und Erwartungen, die sie nur enttäuschen konnte, weil sie keine Antworten auf ihre Fragen hatte oder aber weil es die falschen Antworten waren. Zum Beispiel, warum die Signora Zafferano darauf bestand, ausschließlich Frühstück all’italiano zu servieren, und zu keinerlei Zugeständnissen an den Geschmack der Gäste bereit war. Im Nido gab es Espresso, Cappuccino, Milchkaffee oder Malzkaffee, Zwieback mit Nutella, Obst, Kuchen und süßes Gebäck. Basta. Keine Wurst, niemals – Dio mio! – Käse und noch nicht einmal Eier. Einzig zu Tee hatte sich die Signora durchgerungen, jedoch nur, weil sie ihn selbst gerne trank und er nicht viel Arbeit machte. Dafür kamen die Cornetti und Brioches von einer ausgezeichneten Pasticceria, es gab blütenweiß gestärkte Tischdecken, bestickte Servietten und altes Silberbesteck, und die Gäste wurden allesamt persönlich bedient. Von Federica, dem Frühstücksfräulein.
Federica versuchte, die beunruhigenden Gedanken an die Gäste in der Pension zu verscheuchen. Wenn es so weiterging, würde sie nie einschlafen können, und dabei musste sie in dreieinhalb Stunden schon wieder aufstehen. Sie drehte sich um, was einen neuerlichen Schweißausbruch verursachte, und schloss die Augen. Pasquales Klimaanlage im Erdgeschoss schnaufte wie Signora Bevilacqua, die Vermieterin, wenn sie vom Einkaufen die Treppe heraufkam. Sie wohnte im zweiten Stock, direkt unter Federica. Im ersten Stock wohnte Pasquale Balducci mit seiner Familie, die allesamt in der Trattoria arbeiteten. Federicas kleines Apartment lag unter dem Dach, dort, wo es im Sommer am heißesten war. Vor allem im Schlafzimmer, in das fast den ganzen Tag die Sonne schien, war es dann kaum auszuhalten. Deshalb schlief sie im Sommer auf dem Balkon, der auf den etwas schattigeren Hinterhof hinausging. Ebenso wie ihr unmittelbarer Nachbar, Mimmo Batticinque, der Mieter der zweiten Dachwohnung. Auch er hatte, wie Federica, ein Klappbett auf den Balkon gestellt, zwischen allerlei Kräutern und Pflanzen und frisch gewaschenen Socken, die, von der Sonne ausgedörrt, an der Wäscheleine baumelten, welche ihre beiden Balkone miteinander verband. Mimmo arbeitete sechs Tage in der Woche als Kellner in einem Restaurant an der Piazza Navona. Sein richtiger Name war Mimmo Gallo, doch jeder nannte ihn Batticinque, Gib mir fünf, weil er die Angewohnheit hatte, alle, die er traf, abzuklatschen, als ob es ständig etwas zu feiern gäbe. Er sah aus wie Roberto Benigni in jungen Jahren, mit hoher Stirn, krausen Locken und ein wenig schiefen Zähnen, und war ein ebensolcher Spaßvogel. Federica war froh, dass Mimmo ihr Nachbar war. Mit ihm gab es immer etwas zu lachen. Er lachte sogar über Dinge, die eigentlich zum Heulen waren.
Ein Lichtschein an seinem Fenster sagte Federica, dass er soeben nach Hause gekommen war. Und richtig, nach wenigen Minuten, in denen das kümmerliche Plätschern der vorsintflutlichen Dusche zu hören war, kam Mimmo heraus. Er trug nur eine Unterhose, und seine Haare standen wie ein Wischmopp zu Berge. »Psst! Fé!«
Federica richtete sich auf. »Ja?«
»Ich kann dich nicht sehen. Bist du schon geschmolzen?«
Federica kicherte. »Fast.«
»Ich hab was für dich.«
Mimmo brachte ihr manchmal eine Kleinigkeit mit, von der er wusste, dass sie sich darüber freute: eine geklaute Blume aus der Tischdekoration des Restaurants, in dem er arbeitete, einen schönen Stein, von dem er ihr erzählte, er habe ihn so lange angebettelt, bis er ihn habe mitnehmen müssen, oder aber das ein oder andere Buch vom Flohmarkt in Porta Portese, wo er sich meist an seinen freien Sonntagen herumtrieb. Jetzt nestelte er an seinen Socken herum und zog an der Leine. Wie eine Gondel einer Seilbahn schwebte ein verschrumpelter Tennissocken zu Federica hinüber. Sie holte einen kleinen Gegenstand aus Plastik heraus und drehte ihn ratlos in den Händen.
»Was ist das?«
»Ein einzigartiges Wunderding!« Mimmo machte eine weit ausholende Geste wie einer der Gemüsehändler am Campo de’ Fiori, der seine Ware anpreist. »Ich hab auch schon eins. Von Jo.«
Jo, das war Joseph Kédougou. Er war Senegalese und ernährte seine drei Frauen und eine unübersichtliche Anzahl Kinder daheim im Senegal, indem er den Sommer über mit einem selbst gezimmerten Bauchladen in der Stadt umherzog und den Touristen Sonnenbrillen, billigen Modeschmuck und Gürtel aus Kamelleder verkaufte.
»Und was genau für Wunder bewirkt es?«
»Es macht glücklich.«
»Oh.«
Eine typische Mimmo-Antwort. Federica wartete. Sie spürte, wie sich der Schweiß in ihrem Nacken sammelte und zwischen den Schulterblättern hinunterrann.
»Da ist ein kleiner Schalter, den musst du drücken.«
Federica tastete mit den Fingern an dem kleinen, unförmigen Gegenstand herum, fand den Schalter und drückte ihn. Ein blaues, wirbelndes Licht flackerte auf, und ein kühler Lufthauch traf Federicas schweißnasses Gesicht. »Ein Ventilator!«, rief sie entzückt. »Ein leuchtender Miniventilator!« Sie sah zu Mimmos Balkon hinüber und sah auch dort ein blaues Licht in der Dunkelheit wirbeln.
Federica konnte Mimmos Gesicht im Schein seines Ventilators erkennen. Er grinste, und mit seinen schiefen Zähnen und wilden Haaren sah er wie ein vergnügter kleiner Kobold aus. »Hatte ich recht? Macht es glücklich?«
»Ja. Hattest du. Danke!«
Mimmo hob seine rechte Hand. »Batticinque.«
Sie hob ebenfalls ihre Hand, »Batticinque!«, und ließ sich dann müde lächelnd auf ihr Bett zurückfallen, den flimmernden Ventilator neben sich.
ZWEI
Um vier Uhr morgens mochte Federica die Stadt am liebsten. Es war so unwirklich ruhig, dass das Knattern ihres alten Mofas überdeutlich von den Häuserfronten zurückgeworfen wurde. Sie überquerte den Tiber und fuhr in die Viale Trastevere, wo das Postamt lag, in dem sie jeden Morgen, außer am Sonntag, die Post der Stadtviertel Trastevere, Testaccio und Aventin sortierte. Um diese Zeit konnte sie spüren, was Giordano Bruno – ihr anderer Freund neben Mimmo Batticinque – meinte, wenn er von der Unendlichkeit der Welten sprach. Sie brauchte nur den Kopf zu heben, dort, auf der Ponte Sublicio, wo unter ihr still der Tiber vorbei zum Meer floss, und sich den Himmel anzusehen. Jetzt, in den heißen, lichten Juninächten, war der Nachthimmel noch heller als sonst und schien so durchlässig, dass man glauben konnte, dahinter tatsächlich andere Welten leuchten zu sehen. Mitten in der Stadt war es allerdings auch zu anderen Jahreszeiten nie wirklich dunkel. Die unzähligen, orangefarbenen Straßenlampen verliehen der Nacht einen seltsam irrealen, fast grünlichen Schimmer, den es nur hier gab und der von den mehr als zweitausend Jahre alten Mauern herrührte, die nachts, beschienen vom orangefarbenen Licht, lebendig wurden und Struktur und Stimme bekamen. Etwas, was sie tagsüber, erstickt von Touristen, Staub und Abgasen, längst verloren hatten. Federica liebte deshalb die Nacht und den frühen Morgen. Nur in diesen Stunden konnte man durch die Straßen gehen, ohne einem Menschen zu begegnen. Dafür begegnete man anderen, geheimnisvolleren Dingen. Und man konnte stille Zwiesprache halten mit den Steinen, die, noch aufgeheizt vom Tag, erst jetzt langsam auszuatmen begannen. Federica mochte Steine lieber als Menschen. Deshalb war vielleicht auch Giordano Bruno ihr Freund. Natürlich war auch er einmal ein Mensch aus Fleisch und Blut gewesen, doch das war lange her. Er war seit vielen Hundert Jahren tot. Man hatte ihn wegen seiner Lehre von der Unendlichkeit der Welt als Ketzer auf dem Campo de’ Fiori verbrannt. Zweihundert Jahre später war ihm auf diesem Platz südlich der großen und ungleich prächtigeren Piazza Navona ein steinernes Denkmal errichtet worden. Dort stand er noch immer, ein steingewordener Philosoph und Volksheld, die Kapuze tief in die Stirn gezogen, den Blick auf ewig anklagend in Richtung des Vatikans gewandt. Federica besuchte ihn oft. Manchmal, wenn sie rechtzeitig aufgestanden war, noch vor der Arbeit im Postamt, meist aber, bevor sie ihre Arbeit als Frühstücksfräulein bei Signora Zafferano antrat. Dann war der Blumen- und Gemüsemarkt rund um das Denkmal bereits geöffnet, doch es waren noch kaum Kunden da. Man konnte ungehindert zwischen den Ständen umherschlendern und dem Ketzer einen Besuch abstatten. Auf dem Campo de’ Fiori kannte man die auffallend blonde, stille junge Frau schon, und manchmal bekam sie von den Händlern ein Cornetto oder ein Tramezzino geschenkt. Damit setzte sie sich ihrem Freund zu Füßen und stellte ihm die eine oder andere Frage. Es ging dabei meist um Dinge, die sie gelesen hatte und die sie nicht losließen. Noch mehr als den Steinen galt Federicas Liebe nämlich Büchern, und oft beschäftigten sie die Geschichten, die sie gelesen hatte, noch tagelang. Es gab darin Rätsel, die sie nicht entwirren konnte, geheimnisvolle Andeutungen, die nicht aufgelöst wurden, und Wendungen, die sie nicht verstand, so sehr sie sich auch den Kopf darüber zerbrach. Manchmal war sie auch mit dem Schluss eines Romans nicht einverstanden und versuchte, für die Probleme, mit denen die Helden alleingelassen worden waren, eine zufriedenstellende Lösung zu finden. Es ging doch nicht an, dass Frauen Selbstmord begehen mussten, weil sie sich in den falschen Mann verliebten, dass aufrechte Männer ins Elend gestürzt wurden, weil sie ihre Meinung äußerten, und Kinder verstoßen wurden und sich allein und bettelnd durchs Leben schlagen mussten. Für all das musste es eine Lösung geben. All diese Rätsel und Fragen aus den unzähligen Büchern, die sie las und – ein Mal gelesen – für alle Zeiten im Kopf behielt, besprach sie mit Giordano Bruno, der dazu in der Regel schwieg. Manchmal gab er ihr einen Hinweis in Form eines Satzes aus einer seiner Schriften, die sie in kleinen, abgegriffenen Heftchen bei sich trug, meist aber waren seine Gedanken wenig praktikabel für die Probleme, mit denen sich die Protagonisten aus Federicas Büchern herumschlagen mussten. Das sagte sie ihm dann mit aller Deutlichkeit, doch auch dazu schwieg der Denker auf seinem Sockel – steinern und ungerührt. Sie wies ihn darauf hin, dass es sich leicht über unendliche Welten nachdenken ließe wenn man, gemütlich und von Alltagssorgen unangefochten, in einer Studierstube saß, es im täglichen Leben jedoch darauf ankam, in der Welt zurechtzukommen, in der man sich gerade befand. Sie warf ihm vor, dass dazu seine Schriften jeglichen praktischen Rat schuldig blieben und er deshalb gut daran getan hätte, seine Positionen ein klein wenig dem Alltag normaler Menschen anzupassen, bevor er verbrannt wurde. Andererseits war sie gerade deshalb fasziniert von ihm. Er war für eine Idee gestorben. Eine Idee noch dazu, die sich im Nachhinein als vollkommen richtig erwiesen hatte. Nur war sie ihm zu früh gekommen. Zum falschen Zeitpunkt. Und am falschen Ort. Pech gehabt. Federica hatte keine solchen Ideen, und sie wusste nicht genau, ob das nun wiederum ein Glück war oder eher traurig. Zwar lief man heutzutage kaum mehr Gefahr, als Ketzer verbrannt zu werden, doch eine unbotmäßige Idee zur falschen Zeit konnte einem noch immer eine Menge Ärger einhandeln. Federica ging Ärger aus dem Weg, wenn sie konnte. Sie war nicht geschaffen für Schwierigkeiten. Und gerade deshalb übte der Gedanke, sich durch eine verrückte Idee solche einzuhandeln, einen großen Reiz auf sie aus. Schwierigkeiten zu haben, das klang nach Abenteuer, nach prallem Leben, schmeckte nach Hitze, Rauch und Feuer. An Schwierigkeiten konnte man sich leicht die Finger verbrennen, aber andererseits spürte man dabei das Leben unmittelbar, so wie wenn man einen Finger auf eine Schlagader legte und fühlen konnte, wie das Blut darunter pochte. Schwierigkeiten zu haben, das war wie der Finger an der Ader, ohne Haut dazwischen; zu fallen, ohne Netz und doppelten Boden; zu sagen, was man dachte, auch wenn es gefährlich war. Deshalb waren Schwierigkeiten nichts für sie. Sie errötete ja bereits, wenn jemand unerwartet ein Wort an sie richtete, und der Gedanke, jemandem einfach so die Meinung zu sagen, jagte ihr Angstschauer über den Rücken. Heute Morgen hätte sie ihrem steinernen Freund gerne noch einen kurzen Besuch abgestattet, doch die große Menge an Post, die zum Sortieren bereitlag, sagte ihr, dass es wohl zu knapp werden würde, um noch vor dem Frühstücksdienst am Campo de’ Fiori vorbeizufahren. In der großen Posthalle, in der sie jetzt mit anderen an langen, zerkratzten Tischen stand, hatte es über Nacht kaum abgekühlt, es war stickig und roch nach Pappe, Leim und altem Schweiß, zaghaft durchsetzt von dem angenehmeren Duft nach Espresso, der aus der kleinen Küche drang. Eros, der Leiter der Frühschicht, hatte wie jeden Morgen mit der alten, großen Moka Kaffee für alle gekocht, den er jetzt in winzigen Plastiktassen auszuteilen begann. Er hieß eigentlich Ermano Buzzetti, aber alle nannten ihn Eros, weil er ein großer Fan von Eros Ramazzotti war und ständig dessen Lieder vor sich hin summte.
»Una terra promessa …«, sang er leise, als er Federica ihre Tasse reichte. »Guten Morgen, Fé! Gut geschlafen?«
»Geht so.« Federica nahm dankend den Espresso entgegen. »Es ist zu heiß zum Schlafen.«
»Magari! Dio mio! Diese Hitze bringt uns noch alle um!«, stimmte Eros ihr zu, zwinkerte freundlich und ging mit seinem Plastiktablett weiter zu ihrem Nachbarn. Federica trank den Espresso mit einem schnellen Schluck und widmete sich dann wieder ihren Briefen. Eros war inzwischen zum nächsten Lied übergegangen: »E ci sei … adesso tu …« Sie brauchte nicht aufzusehen, um zu wissen, dass er jetzt bei Simonetta angelangt war. Dieses Lied schmachtete er immer bei Simonetta, und immer lachte sie dann und kniff ihm neckisch in die Wange. Simonetta hatte grellrot gefärbtes Haar und wog gute neunzig Kilo, doch Eros verehrte sie über alle Maßen. Seit Simonetta in der Poststelle arbeitete, versuchte Eros, sie zu erobern, doch was er auch unternahm, um sie zu beeindrucken, Simonetta lachte nur, kniff ihn in die Wange und widmete sich dann wieder ihrer Arbeit. Anfangs hatte es Wetten gegeben, ob es Eros irgendwann gelingen würde, das Herz der voluminösen Simonetta zu erweichen, mittlerweile aber hatten sich die anderen an die Vergeblichkeit seines Werbens gewöhnt und sahen kaum noch auf, wenn er zu singen begann. Er schien im Übrigen auch ganz zufrieden damit zu sein, für sie ein Lied zu singen, ab und zu eine Rose auf ihren Platz zu legen und sich dafür von ihr in die Wange kneifen zu lassen. Federica hatte niemanden, der ihr Rosen schenkte und Lieder für sie sang, doch das war kein Problem. Sie konnte sich ohnehin nicht vorstellen, jemanden als Dank in die Wange zu kneifen oder so zu lachen, wie Simonetta es tat – ein bisschen verheißungsvoll, ein bisschen spöttisch, ohne sich festzulegen. Federica hatte ihre Bücher, sie hatte Mimmo und Giordano Bruno und seine unendlichen Welten, und das reichte ihr. Es kam vor, dass sie tagelang mit niemandem sprach, ein »Guten Morgen« zu Eros, Signora Zafferano und den Gästen des Nido und ein »Gute Nacht« an Mimmo Batticinque einmal ausgenommen. Und lautes Lachen war auch nicht ihre Sache. Mechanisch sortierte sie weiter und hörte dabei mit halbem Ohr der Unterhaltung der anderen zu. Als die Uhr sechs zeigte, räumte sie ihren Platz und war so schnell und leise verschwunden wie eine Maus am Morgen.
DREI
Sie vergewisserte sich noch einmal, dass bei dem zuletzt eingetroffenen Gast alles in Ordnung war: ein Cornetto, Tee, Milch, brauner Zucker, dann zog sie sich unauffällig zurück. In der Küche atmete sie erst einmal tief durch und wischte sich ihre feuchten Hände an der Schürze ab, bevor sie wieder hinausging, um bei den Gästen, die bereits fertig waren, das Geschirr abzuräumen. Das war immer ein besonders heikler Moment, denn nach dem Frühstück waren die Gäste oft noch zu einem kleinen Plausch aufgelegt, stellten Fragen und wollten Tipps. Federica hatte die Öffnungszeiten der Museen, die Eintrittspreise und die wichtigsten Buslinien durch das Stadtzentrum längst auswendig gelernt, doch wenn sie tatsächlich danach gefragt wurde, brachte sie meistens etwas durcheinander, was sie dann stottern und schamrot verstummen ließ. Schlimm waren auch die Fragen nach »typischen« Restaurants. Federica wusste nie, was sie darauf antworten sollte. Was war typisch? Und noch wichtiger: Typisch wofür? Für das Testaccio? Für Rom? Für Italien? Eine solche Frage ließ sie jedes Mal in Schweiß ausbrechen, zumal sie herausgefunden hatte, dass für einen Engländer etwas ganz anderes typisch römisch zu sein schien als für einen Amerikaner und erst recht für einen Deutschen. Hinzu kam, dass jene Restaurants, die Federica noch am ehesten als typisch römisch ansehen würde, weil dort einfache, deftige Hausmannskost und Innereien wie beispielsweise trippa alla romana, Kutteln nach römischer Art, serviert wurden, in der Regel bei niemandem beliebt waren. Amerikaner, in dieser Hinsicht besonders zart besaitet, verzogen bereits das Gesicht, wenn Federica anfing zu erklären, dass echte Spaghetti Carbonara niemals mit Schinken, sondern mit Schweineschwarte gemacht wurden, und bei ihrem Versuch, das Wort »Kutteln« ins Englische zu übersetzen, wurden sie regelmäßig blass. Eine Weile hatte sie dennoch bei solchen Fragen herauszufinden versucht, was den Gästen tatsächlich vorschwebte, was für einen Geschmack sie hatten und welche »typischen« Bilder in ihrem Kopf waren, bis sie feststellen musste, dass eine allzu intensive Beschäftigung mit der Frage überhaupt nicht gewünscht war. Die Gäste reagierten irritiert bis ungeduldig auf ihre zögernden Fragen oder zuckten nur die Schultern, so als hätten sie keine Ahnung, was sie eigentlich wollten. Daher war sie mittlerweile dazu übergegangen, genauso wie Signora Zafferano, ausnahmslos allen das gleiche Touristenlokal im Trastevere zu empfehlen, in dem es Livemusik, Pizza, Spaghetti bolognese und etwas gab, was entfernt an Ossobuco erinnern sollte. Allerdings hatte sie dabei – ganz anders als Signora Zafferano – immer ein wenig ein schlechtes Gewissen, so als ob sie die Gäste betrügen würde. Das Problem war, dass Federica die Gäste nicht wirklich verstand. Nie konnte sie herausfinden, was sie von ihr erwarteten. Daher hielt sie es im Allgemeinen für klüger, zu lächeln und zu schweigen. Heute sah es so aus, als müsse sie auch nicht mehr tun, die Gäste schienen ungefährlich. Zunächst war da ein junges, offensichtlich frisch verheiratetes italienisches Paar, das sich ständig an den Händen hielt und verzückt anlächelte. Sie tranken beide Milchkaffee, aßen beide Biscotti mit Nutella und waren absolut problemlos. Sie hatten nur Augen füreinander, und wenn jemand sie nach dem Frühstücksfräulein gefragt hätte, hätten sie nicht einmal gewusst, wie sie aussah. Dann gab es noch Signore Zocco, einen älteren Kunsthändler aus Mailand, der jedes Jahr für mehrere Wochen nach Rom kam, immer am gleichen Platz saß und jeden Morgen ein Schokoladenbrioche aß und einen doppelten Espresso trank, und ein altes englisches Ehepaar, das so unauffällig war, dass es wie ein Teil der Einrichtung wirkte. Einzig die beiden deutschen Familien mit ihren hübschen blonden Kindern, die vorgestern angekommen waren und einen langen Tisch belegten, bargen ein gewisses Risiko. Gleich zu Anfang hatten sie sich über das karge Frühstück beschwert, nachdem Signora Zafferano ihnen jedoch einen längeren, nicht unfreundlichen, aber überaus bestimmten Vortrag über »authentische« italienische Frühstücksgewohnheiten gehalten hatte, zerpflückten sie nun gehorsam ihre Cornetti und Brioches auf dem Tisch und spülten sie mit reichlich Kaffee und heißer Milch hinunter. Vielleicht waren sie noch von Signora Zafferano eingeschüchtert, jedenfalls erwies sich Federicas Besorgnis, von ihnen etwas Schwieriges gefragt zu werden, als unbegründet. Als sie sich dem Tisch näherte, lächelten sie ihr nur freundlich zu und murmelten etwas, das wie Pnntschrrrno klang. »Buongiorno Signori!« Federica erwiderte ihr Lächeln erleichtert und hatte sogar den Mut, dem kleinsten der blonden Kinder, einem sommersprossigen Mädchen mit allerliebsten Zöpfchen, zuzuzwinkern, bevor sie die Teller abräumte. Alle Gäste saßen an den offenen, großen Fenstern, durch die die Morgensonne hereinschien und von denen aus man einen wunderbaren Blick über den Tiber und die Stadt hatte. Il Nido befand sich auf dem Aventin, dem eleganten südlichen Hügel der Stadt, der vom Schmuddelkind Testaccio nur durch eine Straße getrennt war. Federica benötigte genau fünf Minuten, um von ihrer Dachwohnung in der Via del Arcangelo zu ihrer zweiten Arbeit zu gelangen. Sie überquerte die Via Marmorata und knatterte dann mit ihrem Mofa die schmale, von Pinien gesäumte Straße hinauf zur Piazza Cavalieri di Malta. Von dort waren es nur noch wenige Meter zu der kleinen, versteckt liegenden Villa von Signora Zafferano, die diese nach dem Tod ihres Mannes zu einer Pension umgewandelt hatte.
Als sie gegen halb elf mit ihrer Arbeit fertig war und nach draußen trat, traf die Vormittagshitze sie wie eine Keule. Die Sonne hatte den Asphalt bereits so aufgeheizt, dass die Luft darüber flimmerte, und der intensive Duft der hohen Pinien, die das Haus der Signora Zafferano wie strenge Wächter umstanden, nahm ihr fast den Atem. Außer dem lauten Gesang der Zikaden in den Bäumen war nichts zu hören, er übertönte sogar das Rauschen des Verkehrs, der unterhalb des Hügels vorbeiströmte. Die drückend heiße, vom eintönigen Zirpen erfüllte Luft umhüllte Federica wie Sirup, und ihr rann der Schweiß den Nacken hinunter, noch bevor sie ihr Mofa aufgesperrt und die dicke Sicherheitskette in der Rückbank verstaut hatte. In der Pension war es vergleichsweise kühl gewesen. Signora Zafferano hatte im Frühstücksraum und in den Gästezimmern Klimaanlagen einbauen lassen, und der Schatten der Bäume tat ein Übriges, um die Temperatur im Haus einigermaßen erträglich zu halten. Dafür war es umso überwältigender, wenn man aus der schattigen Kühle nach draußen in die Sonne trat. Das Knattern ihres Mofas zerriss die flimmernde Stille, und die Zikaden verstummten für einen Moment. Die Hände nur leicht um die klebrig-heißen Griffe des Lenkers gelegt, fuhr sie los, ohne sich ihren Helm aufzusetzen, um sich auf dem kurzen Weg nach Hause wenigstens ein bisschen Kühlung zu verschaffen.
Die Via del Arcangelo lag still und staubig da, als sie ankam. Sie schob ihr Mofa in den Innenhof und kettete es an das Gitter eines Lüftungsschachtes. Aus dem Küchenfenster der Trattoria von Pasquale Balducci klang lautes Geschrei und Gezeter. Er stritt sich mit seiner Frau Rosanna. Das war nichts Neues. Sie stritten unentwegt, und Federica fragte sich, was die beiden überhaupt noch zusammenhielt. Doch im Grunde wusste sie die Antwort, wie jeder hier in der Straße: Es war die Trattoria. Sie konnten es sich finanziell nicht leisten, sich zu trennen. So blieben sie zusammen, aneinandergekettet durch ihren Familienbetrieb, der auch ihre beiden erwachsenen Söhne und die halbwüchsige Tochter ernährte, und stritten und jammerten und buken nebenbei knusprige, duftende Pizzaräder, so groß, dass sie über den Tellerrand hingen, bereiteten Spaghetti Carbonara mit geräucherter Schinkenschwarte und vielen gelbdottrigen Eiern zu und die besten trippa alla romana weit und breit. Wenn Federica Geld übrig hatte, was nicht so oft der Fall war, aus Gründen, die noch erklärt werden müssen, gönnte sie sich am Monatsende manchmal zusammen mit Mimmo Batticinque einen Abend im Il Piccio. Dann aßen sie supplì alla romana, mit Mozzarella, Provolone und Hackfleisch gefüllte, frittierte Reisbällchen, und carciofi alla giuda, Artischocken nach jüdischer Art, als Vorspeise, danach dicke, von Rosanna Balducci selbst gemachte bucatini all’amatriciana mit Speck und Tomatensoße und köstliches abbacchio, römisches Milchlamm mit Knoblauchsoße. Für das Dessert fuhren sie mit dem Mofa in die Innenstadt und teilten sich ein unverschämt teures, dickes Tartufo mit Sahne an der Piazza Navona. Dort saßen sie an einem der prächtigen Brunnen und aßen gemeinsam ihr Eis inmitten von Touristen und Nachtschwärmern. Wenn das Geld für solch lukullische Genüsse nicht reichte, tat es auch eine Pizza Margherita oder eine piadina an Raffis Bar in der Via Marmorata. Federica genoss diese gemeinsamen Abende mit Mimmo, die sie jedes Mal wie ein Fest feierten, obwohl sie, wenn es nach ihr gegangen wäre, nie auf den Gedanken gekommen wäre, mit ihrem Nachbarn essen zu gehen. Er hatte sie dazu überreden müssen. Eines Tages, Federica hatte etwa ein halbes Jahr in der Via del Arcangelo gewohnt, und sie hatten sich ein paar Mal im Treppenhaus gegrüßt, war Mimmo vor ihrer Tür gestanden und hatte ihr eine Hand entgegengestreckt. »Batticinque! Gratuliere!«
Sie hatte verdutzt eingeschlagen und war prompt errötet. »Warum?«, hatte sie gefragt, und Mimmo hatte die Augen aufgerissen und sie vorwurfsvoll angesehen. »Du weißt es nicht? Ich bitte dich!«
»Nein …« Sie hatte den Kopf geschüttelt und war sich dumm vorgekommen.
»Sechs Monate! Sechs Monate in diesem Haus, mit dieser Vermieterin und in dieser Straße, und du lebst noch! Viva! Viva Federica!«