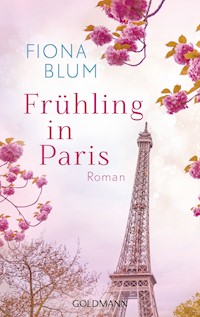
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Rue d'Estelle blühen die Platanen. Es ist Mai, und das Leben scheint heiter und unbeschwert. Doch den Bewohnern des Hauses Nr. 5 ist nicht nach Frühling zumute. Isaac, der alte russische Jude, verlässt kaum mehr seinen Tabakladen. Dem Studenten Nicolas, der als Straßenclown arbeitet, gelingt es nicht mehr, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und die ehrgeizige Tänzerin Camille hat alle Leichtigkeit verloren. Bis eines Tages die junge Louise auftaucht und ein kleines Café eröffnet. Mit ihrer Unbekümmertheit stellt sie alles auf den Kopf und sorgt für einen Zauber, den es in der Rue d'Estelle schon lange nicht mehr gegeben hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Buch
In der Rue d’Estelle blühen die Platanen. Es ist Mai, und das Leben scheint heiter und unbeschwert. Doch den Bewohnern des Hauses Nr. 5 ist nicht nach Frühling zumute. Isaac, der alte russische Jude, verlässt kaum mehr seinen Tabakladen. Dem Studenten Nicolas, der als Straßenclown arbeitet, gelingt es nicht mehr, die Menschen zum Lachen zu bringen. Und die ehrgeizige Tänzerin Camille hat alle Leichtigkeit verloren. Bis eines Tages die junge Louise auftaucht und ein kleines Café eröffnet. Mit ihrer Unbekümmertheit stellt sie alles auf den Kopf und sorgt für einen Zauber, den es in der Rue d’Estelle schon lange nicht mehr gegeben hat.
Autorin
Fiona Blum ist Jahrgang 1968. Sie studierte Rechtswissenschaften und Italienisch in Passau und Rom und arbeitete als Anwältin in Verona sowie in einer internationalen Anwaltskanzlei in München, bevor sie sich selbständig machte. Heute lebt sie als Schriftstellerin mit ihrem Mann, ihrer Tochter und einer Katze in einem alten Bauernhaus in Oberbayern. Unter ihrem richtigen Namen Veronika Rusch schreibt sie Kriminalromane, Theaterstücke und Dinnerkrimis. Für ihren Roman »Liebe auf drei Pfoten« erhielt sie den begehrten DeLia-Literaturpreis 2016.
Weitere Informationen unter www.veronika-rusch.de.
Fiona Blum
Frühling in Paris
Roman
Da stehe ich auf der Brücke und bin wieder mitten in Paris, in unserer aller Heimat.
Da fließt das Wasser, da liegst du, und ich werfe mein Herz in den Fluss und tauche in dich ein und liebe dich. Kurt Tucholsky
»Macarons zu backen ist eine Kunst. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Gramm Mandelmehl, wie viel Eiweiß und wie viel Zucker man verwendet. Man kann alles richtig machen, ja sogar perfekt, und doch werden die Macarons trocken werden, am Blech festkleben oder Risse bekommen. Die Leute werden höflich ein mäusekleines Stückchen davon abbeißen und freundlich nicken, doch am Ende wird der Rest noch auf dem Teller liegen. Die Süße des Zuckers wird sie erschlagen, die Creme wird ihnen wie ein Klumpen im Magen liegen, und das staubtrockene Gefühl im Mund wird sie traurig machen.
In die Macarons gehört eine gehörige Portion Freude, nicht zu genau abgewogen, eine Prise Schabernack für den feinen Glanz und beides gut vermengt mit Lachen und Leichtigkeit. Wenn man das beherzigt, werden die Macarons aussehen, als würden sie gleich davonfliegen, sobald man sie, vorsichtig, eines nach dem anderen, auf den Teller legt, und am Ende wird der Teller leer sein, und die Gäste werden mit einem Leuchten in den Augen wieder und wieder kommen.
Und merke dir eines: Du darfst sie nicht zu hart anfassen und sollst sie immer mit einem Lächeln genießen. Wie das Leben.
Retiré
»zurückgezogen«
Pose aus dem klassischen Ballett, bei dem das Spielbein ruhend am Standbein anliegt.
1
Wie soll man eine Geschichte beginnen, die sich in Paris ereignet, ohne über etwas zu schreiben, das ohnehin schon jeder zu kennen glaubt? Im Frühling noch dazu? Nun, man könnte versuchen, zunächst den Himmel über der Stadt zu beschreiben, jenes schimmernde, durchlässige Blau, das es nirgends sonst auf der Welt gibt und das eine Verheißung in sich birgt, die man nicht in Worte fassen kann. Das Morgenlicht über der Seine wäre einige Sätze wert, ebenso der Duft der blühenden Platanen im Jardin du Luxembourg, der Blick von der Spitze der Île de la Cité auf den Fluss, mit der Kathedrale von Notre-Dame im Rücken, und nicht zuletzt natürlich die Pariserinnen, die über die Place Vendôme schreiten wie Königinnen.
Doch diese Geschichte beginnt nicht dort, an der Seine, im 1. Arrondissement, im Herzen der Stadt, nein, sie beginnt vielmehr im Herzen einer jungen Frau, knapp fünfhundert Kilometer von Paris entfernt. Und davon soll zunächst die Rede sein. Mit Louise Barclays Herz hatte es nämlich etwas Besonderes auf sich. Es war von jeher ausgesprochen ruhelos. Zog hierhin und dorthin, drängte und schob, war immer auf der Suche, sehnte sich, sehnte sich so sehr … ja, wonach eigentlich? Das war die Frage. Louise hatte selbst keine Antwort darauf. Sie wusste nur, dass es keinen Sinn machte, sich zu wehren, wenn ihr Herz sie wieder einmal in irgendeine überraschende Richtung stolpern ließ, denn letztendlich gewann ein Herz doch immer. Und das war auch richtig so. Louise zog diese Vormachtstellung nicht in Zweifel, ebenso wenig, wie sie damit haderte, ungewöhnliche Haare zu haben, dicht, störrisch und von seltsamer Farbe, oder damit, ohne Brille kurzsichtig wie ein Maulwurf zu sein. Wohlwollende Menschen nannten ihre Haare üppig und bernsteinfarben, was sehr viel schöner klang, als die Realität aussah, wie Louise fand, andere hingegen verglichen sie mit der Mähne eines Islandponys oder dem wirbeligen Fell eines Rosettenmeerschweinchens, was das Ganze, ehrlich gesagt, besser traf. Sie fand, ihre Haare erinnerten von der Struktur her am ehesten an die Borsten eines Straßenkehrerbesens, waren sie doch ähnlich rötlich, ohne wirklich rot zu sein, oder aber rostfarben wie gefallenes Laub im Herbst, kurz bevor es zu modern begann. Und wenn Louise an diesen, ihren eigenen Vergleich dachte, waren ihr das Meerschweinchen und das Islandpony erheblich lieber.
Aber zurück zum Anfang unserer Geschichte. Der Umstand, dass Louise Barclay zu nachtschlafender Zeit in London aufgebrochen war, um jetzt, an diesem strahlend schönen Frühlingsmorgen, am Gare du Nord aus dem Zug zu steigen, hatte also etwas mit ihrem ruhelosen Herzen zu tun. Wobei, bei vordergründiger Betrachtungsweise müsste man dieses Urteil sofort revidieren. Schuld war eigentlich nicht ihr Herz, sondern ein Brief. Doch so genau kann man das nicht bestimmen. Herzenswege haben es ja an sich, recht verschlungen zu sein, ja, man könnte sogar sagen, das ist geradezu das Typische daran. Es gibt aber natürlich immer wieder Spielverderber, die das anders sehen wollen.
Jedenfalls stieg sie an diesem Morgen am Gare du Nord aus dem Zug – und stolperte als Erstes über ihren Koffer. Er sprang auf, und alle ihre Habseligkeiten verteilten sich über den Bahnsteig. Manch einer hätte dies als schlechtes Omen gedeutet, nicht jedoch Louise Barclay. Während sie fluchend in die Knie ging, Kosmetikbeutel, Schuhe, Bücher, Unterwäsche und Kleidungsstücke zusammenklaubte und alles zurück in den Koffer stopfte, dachte sie bei sich: »Da kann es ja nur noch besser werden«, ließ die Schlösser des Koffers zuschnappen und durchquerte raschen und sehr zuversichtlichen Schrittes die Bahnhofshalle. Auf dem Vorplatz hingen noch kühl die Schatten der Nacht, und die Pendler, die zusammen mit ihr ausgestiegen waren, hasteten mit verschlafenen Gesichtern und Kaffeebechern in der Hand an ihr vorbei in Richtung Metro. Sie sah ihnen einen Augenblick lang unschlüssig nach, überlegte, ob sie sich auch einen Kaffee aus dem nahen Coffeeshop holen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Gleichgültig, ob man sich nun auf die Seite der Realisten schlug und den Brief als Ursache ihrer Reise ansehen wollte oder aber mit den Romantikern verschlungenen Herzenspfaden den Vorzug gab, Louise jedenfalls war sich der Bedeutung dieses Moments voll bewusst: Sie war dabei, ein neues Leben zu beginnen. In Paris. So etwas musste man mit Bedacht angehen. Man musste das Richtige tun. Nun wusste sie zwar noch nicht genau, was »richtig« in ihrem Fall bedeutete, doch war sie sich sicher, dass es jedenfalls nicht hieß, mit einem Pappbecherkaffee aus einem Coffeeshop in der Hand den ersten Schritt zu machen. Mit solchen Feinheiten kannte sich Louise aus, denn es war nicht das erste Mal, dass sie ein neues Leben begann. Man konnte sogar sagen, sie war Profi darin, was wiederum mit ihrem ruhelosen Herzen zusammenhing. Umso bedauerlicher war es allerdings, dass sie trotz der vielen Leben, die sie bereits begonnen hatte, in den wirklich entscheidenden Dingen immer noch so vollkommen ahnungslos war. Jedes Mal war sie mit Mut und Optimismus ans Werk gegangen. Von beidem verfügte sie nämlich über ein gehöriges Maß, das, ähnlich wie die Ruhelosigkeit in ihrem Herzen, über das, was normal zu nennen wäre, weit hinausging. Dennoch hatte es nie gereicht. Immer hatte noch etwas gefehlt, und sie hatte bisher nicht herausfinden können, was es war.
Ein neues Leben zu beginnen ist nicht leicht, wie jeder bestätigen wird, der es schon einmal ernsthaft versucht hat. Es bedarf einer Menge entschlossener Schritte, deren Richtung ausschlaggebend für das Gelingen eines solchen Vorhabens ist. In Louises Fall erwies es sich daher, wie noch zu sehen sein wird, als problematisch, dass sie die Richtung gar nicht kannte. Vielleicht hatte sie sich über Richtungen bisher zu wenig Gedanken gemacht, hatte sich zu sehr darauf verlassen, blindlings zu folgen, wenn das Herz sie rief. Der Gedanke, dass ihr Herz auch einmal schweigen und ihrem Kopf die Führung überlassen könnte, war ihr noch nie gekommen. Noch war es jedoch nicht so weit. Fürs Erste tat sie das einzig Richtige. Sie entschied, zunächst einmal ordentlich zu frühstücken. Nach einem guten Frühstück in einem der vielen Pariser Cafés wäre es noch früh genug, sich zum eigentlichen Ziel ihrer Reise aufzumachen. Und dann würde man weitersehen.
Im Übrigen gab ja so vieles zu entdecken. Den Eiffelturm, Montmartre, Sacré-Cœur, oder, nein, zuerst Saint-Germain-des-Près, das Quartier Latin, die Tuilerien und ja, natürlich, Notre-Dame … die vielen Möglichkeiten nahmen ihr fast den Atem, und sie rief sich zur Räson. Das hatte Zeit. Sie würde ja hier bleiben. Sie würde hier leben. Sie konnte sich jeden Tag etwas Neues ansehen. Jeden einzelnen Tag …
Mit einer entschlossenen Geste packte sie den Rollkoffer und ging los. In ihr neues Leben.
2
Drehen wir die Zeit noch einmal eine Stunde und fünfundvierzig Minuten zurück.
6:29 Uhr.
Der TGV 7216, in dem Louise Barclay saß – an einem Fensterplatz in Fahrtrichtung, mit müden Augen und zugleich aufgeregt, und dabei zusah, wie vor dem Fenster die Stadt weniger und die Landschaft mehr wurde –, hatte gerade den Bahnhof in Calais Fréthun verlassen und würde bis Lille nicht mehr halten. Zur gleichen Zeit schwang sich in Paris ein junger Mann von einem Baugerüst, das er verbotenerweise erklommen hatte, auf die Balustrade der Galerie der Chimären, die sich in ungefähr fünfzig Metern Höhe um die Kathedrale von Notre-Dame zog. Er gesellte sich zu einem Fabelwesen mit Engelsflügeln und Hörnern, das – das Kinn auf die Hände gestützt – mit bereits rund zweihundert Jahre währender Nachdenklichkeit über die langsam erwachende Stadt blickte. Es herrschte vollkommene Stille. Paris war eine Stadt der Langschläfer. Bis in die späte Nacht hinein hatten die Restaurants und Bars geöffnet, waren die Straßen voller Leben. Doch jetzt, am frühen Morgen, schienen sie wie ausgestorben.
Der junge Mann, der aus luftiger Höhe, in Gesellschaft einer Kopie eines mittelalterlichen Wasserspeiers, über die Stadt blickte, hieß Nicolas Jaurès, und der Grund, warum er hier am Anfang der Geschichte zwingend erwähnt werden muss, liegt darin, dass er sich mit ruhelosem Herzen und dem Entschluss, alles Bekannte hinter sich zu lassen und ein neues Leben zu beginnen, bestens auskannte. Vielleicht sogar besser noch als Louise Barclay, die sich inzwischen der Stadt Lille näherte und dabei eingenickt war.
Dafür kannte Nicolas sich in anderen Belangen wiederum gar nicht aus. Oder besser gesagt, nicht mehr. Er hatte die Gebrauchsanweisung für gewisse Dinge des Lebens verloren. Doch das war eine andere Geschichte.
»Wir bewegen uns auf dünnem Eis«, sagte Nicolas zu dem Fabelwesen, dem die Pariser dem Namen Stygra gegeben hatten. Er erhielt keine Antwort und hatte auch keine erwartet.
»Auf dünnem Eis«, wiederholte er dennoch und machte einen Schritt auf die Kante der Balustrade zu. Es ging sechsundvierzig Meter in die Tiefe. Wie lange würde man fallen? Er breitete versuchsweise die Arme aus, bis die Spitzen seiner Finger die beiden Statuen zu seiner Rechten und Linken fast berührten. Endlos. In seiner Vorstellung gab es keinen Aufprall auf dem Asphalt, nur den Fall ins endlose Dunkel. Wenn man von Notre-Dame sprang, prallte man nirgends auf. Man fiel aus dieser Welt, fiel ewig, verschwand einfach. Das war das Geschenk, das diese Stadt jenen gewährte, die sie liebten.
Nicolas ließ die Arme sinken und setzte sich neben seinen steinernen Freund auf die Balustrade, sodass seine Beine über der Tiefe baumelten. Der Gedanke an den freien Fall schreckte ihn nicht. Ebenso wenig wie die Höhe selbst. Er war schwindelfrei, und seine Ausflüge am frühen Morgen hier herauf waren für ihn Training und Entspannung zugleich. Sie bedeuteten Freiheit. Er liebte die Höhe und genoss die Stille an diesem besonderen Ort, bevor die Touristen einer nach dem anderen die Wendeltreppe heraufgeächzt kamen. Doch das war noch nicht alles. Der eigentliche Grund, warum er regelmäßig den Gargoyle besuchte, war die Distanz zu der Welt da unten. Sie machte manche Entscheidung, die sich kompliziert anfühlte, einfacher, entwirrte hoffnungslos erscheinende Knoten, und sie gab – vor allem – den Blick frei auf die Dinge, die zählten.
Wie das Meer, dachte er flüchtig und verdrängte diesen Gedanken sofort aus seinem Kopf. Auch wenn es zutreffend war, dass das Meer auf ihn eine ähnliche Wirkung hatte, war es doch eine zu gefährliche Wendung, die seine Gedanken damit nahmen. Sie führten ihn zu nahe an Dinge heran, die sich nicht so leicht geraderücken ließen. Noch nicht einmal von sechsundvierzig Metern Höhe aus betrachtet.
Doch glücklicherweise war er nicht nur gut im verbotenen Herumklettern auf Baugerüsten, sondern auch darin, unliebsame Gedanken mit einem Lächeln zu verscheuchen. Das hatte er vor langer Zeit gelernt, und das tat er auch jetzt.
Vorsorglich.
Er lächelte der Stadt zu, die langsam in helles Morgenlicht getaucht wurde. Sein Blick wanderte vom Eiffelturm zu seiner Linken über den Louvre und die Tuilerien hinüber bis nach Montmartre, wo Sacré-Cœur weiß wie ein Schloss aus Zuckerguss auf ihrem Hügel in der Sonne erstrahlte. Sein Lächeln wurde breiter, als eine Taube angeflogen kam und sich nur eine halbe Armlänge von ihm entfernt niederließ. Sie nickte ein paar Mal nach Taubenart und musterte ihn skeptisch aus einem roten, runden Auge.
Nicolas lüpfte mit langsamen Bewegungen einen unsichtbaren Hut und neigte den Kopf. »Guten Morgen Madame.«
Derart angesprochen trippelte der Vogel ein paar Mal unsicher hin und her, plusterte sich ein wenig auf und flatterte schließlich auf den Kopf eines etwas entfernten Kobolds. Der Mann lachte leise und stand auf. Mit einer knappen Handbewegung verabschiedete er sich von seinem Freund, dem Wasserspeier, und kletterte lautlos über das Gerüst hinunter in die Welt, aus der er gekommen war.
Man könnte nun sagen, diese Ereignisse hätten nichts miteinander zu tun. Und wüssten die beiden, Louise und Nicolas, in diesem Moment voneinander, sähen einander – Louise im Zug, mit leicht geöffnetem Mund, schlafend, die Brille verrutscht, und Nicolas, von seinem Ausflug zurück, wieder am Boden angelangt, die geröteten kalten Hände in den Taschen seiner Jacke vergraben –, so würden sie beide aus vollem Herzen zustimmen. Sie kannten sich nicht. Ihre Wege hatten sich noch nie gekreuzt. Und doch. Es gab eine Verbindung. Sie hatten etwas gemeinsam. Und es würde nicht mehr lange dauern, und sie würden sich auch begegnen.
3
Doch zunächst gilt es noch, einen kurzen Blick in die Rue d’Estelle zu werfen. Nicht dass es sich um eine besonders spektakuläre Straße gehandelt hätte, im Gegenteil. Sie war weder prächtig noch elegant, nicht bunt oder quirlig, weder erhaben noch geschichtsträchtig. Mitten im lebhaften Viertel Marais, rechts der Seine gelegen, dem Fluss gleichermaßen nahe wie dem ehemaligen Hallenviertel, wo sich jetzt das Centre Pompidou befand und Röhren und Rolltreppen wie Gedärme, Adern, Knochen nach außen stülpte, war es nichts als eine kurze Sackgasse, die ihr abruptes Ende an einem stillen, von einem Eisenzaun begrenzten Park fand, in dem Tag um Tag die Tauben gurrten. Am ehesten könnte man diese Straße noch verträumt nennen. Sie hatte den Aufwärtstrend, den das Viertel seit geraumer Zeit schon durchmachte, verschlafen oder sich ihm verweigert, was auf das Gleiche hinauslief. In der Geschichte, die hier erzählt wird, spielt die Straße jedoch eine wichtige Rolle. Hier, im Haus Nr. 5, laufen die Fäden zusammen, die sich im Zug von Calais nach Paris und auf der Balustrade von Notre-Dame langsam auszurollen beginnen, und auch solche, deren Anfang bereits weiter zurückliegt. Ein zart schimmernder Faden, der vor vielen Jahren seinen Weg auf der Bühne der Opéra National begann und der jetzt Gefahr läuft, seinen Glanz einzubüßen. Und noch ein anderer Faden, ja eigentlich zwei Fäden, ineinander verwoben, die sich vor über zwanzig Jahren an einem trüben Wintermorgen von St. Petersburg aus auf den Weg nach Paris machten, über die Jahre langsam ausfransten, dünner und dünner wurden und einander schließlich verloren.
An diesem Morgen nun, als Nicolas von seinem Besuch bei Notre-Dame in die Rue d’Estelle zurückkam, pfeifend, die Hände noch immer in den Jackentaschen, stand im ersten Stock des Hauses Nr. 5 eine junge Frau am Fenster, goss eine weiße Orchidee und sah dabei gedankenverloren hinaus in den noch verhangenen dunstigen Morgen. Sie war dunkelhaarig, ihr glattes Haar war in der Mitte gescheitelt, und sie hatte eine kurze, gerade Nase, auf der ein paar wenige Sommersprossen saßen, die nicht so recht zu dem ansonsten so makellosen Gesicht passen wollten. Als sie ihren Nachbarn vom nahen Park heranschlendern sah, beugte sie sich vor und spähte durch den Spalt zwischen den dünnen weißen Vorhängen, um ihn genauer betrachten zu können. Wo mochte er wohl so früh schon gewesen sein? Oder war er etwa die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen? Möglicherweise hatte er eine Freundin. Sie stellte die zierliche Gießkanne ab und wischte einen Wassertropfen vom Fensterbrett. Zweimal die Woche ein Schnapsglas voll, hatte Madame Bonnet ihr kurz vor der Abreise mehrmals eingeschärft, nichts ahnend, dass es für sie selbst gar keine Rolle mehr spielen würde, ob die Orchidee in ihrer Wohnung verdurstete oder ertrank. Doch sie tat weder das eine noch das andere, denn Camille pflegte sie gewissenhaft, und solange sie das tat, würde die Orchidee hoffentlich weiterleben. Madame hatte Camille bei ihrer Abreise nicht nur die Pflanze, sondern gleich die ganze Wohnung anvertraut, in der Camille eigentlich nur eineinhalb Zimmer zur Untermiete bewohnte. Sie hatte sie gebeten, hin und wieder Staub zu wischen, zu lüften und sich im Übrigen »wie zu Hause« zu fühlen. Dann hatte sie Camille mit ihren kräftigen, kurzen Bäckerfingern wie so oft in beide Wangen gezwickt, da Camille ihrer Meinung nach viel zu blass war, und war winkend in das Taxi gestiegen, das sie zum Flughafen brachte.
Camille fuhr sich mit den Händen über ihr Gesicht. Zuerst zart, dann heftiger und heftiger, so lange, bis ihre Wangen brannten. Natürlich war sie zu blass. Scheiße noch mal. Sie ließ die Hände sinken und warf erneut einen Blick aus dem Fenster. Nicolas stand jetzt direkt vor dem Haus und sah nach oben. Camille zuckte zurück. Hoffentlich hatte er sie nicht gesehen, sonst würde er denken, sie spioniere. Ein seltsamer Kerl, dieser Nicolas Jaurès. Nicht eigentlich hässlich, genau genommen ganz gut aussehend. Auf eine etwas raue, kantige Art. Sie wusste jedoch nicht, ob er ihr besonders sympathisch war. Er hatte schöne Augen, das war ihr aufgefallen. Graublau, mit einem dunklen Rand. Sturmaugen, hatte ihre Großmutter solche Augen immer genannt und sie vor den entsprechend ausgestatteten Männern gewarnt. Unstet. Unberechenbar. Camille lächelte unwillkürlich in Gedanken an ihre abergläubische, von Geschichten und Anekdoten schier überquellende Großmutter, die sie im Grunde vor jedem Mann gewarnt hatte, egal, welche Augenfarbe oder Haarfarbe er hatte. Bei jedem gab es etwas zu beachten: Die Blonden waren leichtfertig, die Rothaarigen jähzornig, blaue Augen waren untreu, grüne Augen unehrlich. Wenn es nach ihrer Großmutter gegangen wäre, hätte sich Camille einen Blinden mit Glatze suchen müssen.
Als sie noch mal einen vorsichtigen Blick auf die Straße warf, war ihr Nachbar bereits im Haus verschwunden. Wenige Augenblicke später hörte sie seine Schritte auf der Treppe. Er hatte einen unverwechselbaren Gang, nahm immer zwei Stufen auf einmal, sprang die Treppe mehr hinauf, als dass er ging. Sie lauschte, bis er oben angekommen war. Die Tür fiel ins Schloss, dann war Stille. Sie kannte ihren Nachbarn eigentlich nicht. Nie hatten sie mehr als ein paar belanglose Worte gewechselt, und sie hatte keine Ahnung, was er eigentlich den ganzen Tag trieb. Sie meinte, sich zu erinnern, dass er einmal gesagt hatte, er sei Student? Doch sie bezweifelte das. Er war ständig unterwegs und schleppte dabei meist einen großen Rucksack mit sich herum. Das sah nicht nach Studium aus. Den Rucksack hatte er heute Morgen jedoch nicht dabeigehabt, fiel ihr auf, und sie verlor sich augenblicklich in Gedanken darüber, was das bedeuten mochte. Hatte er ihn irgendwo vergessen? Abgestellt? Oder gar nicht erst mitgenommen? Was wohl in diesem Rucksack war? Wozu brauchte er ihn? Ein leises Klingeln stoppte ihre Überlegungen. Es war der Wecker ihres Handys. Sie warf noch einen letzten Blick hinunter auf die Straße, zog die Vorhänge gerade und ging in die Küche. Zeit zu frühstücken.
Camille war nicht die Einzige, die an diesem Morgen aus dem Fenster sah. Im ersten Stock des gegenüberliegenden Hauses stand Madame Paulette Petit an ihrem Salonfenster und ließ ihren Blick ebenso schweifen wie Camille. Auch sie bemerkte Nicolas Jaurès, wie er vom Park kam, und auch sie wusste nicht, wo er gewesen war. Doch anders als Camille wusste Paulette alles andere, worüber die junge Frau nachgegrübelt hatte. Sie wusste, was Nicolas Jaurès den ganzen Tag trieb, was sich in seinem Rucksack befand und wozu er es brauchte. Und das war noch nicht alles. Sie wusste noch viel mehr. Sie war in dieser Straße geboren, und auch wenn sie nicht ihr ganzes Leben hier verbracht hatte – Gott bewahre –, war diese Wohnung doch ihr ganzes Leben lang ihr Hafen, ihr Rückzugsort und ihre Zuflucht gewesen. Nun war sie fast dreimal so alt wie die junge Frau am gegenüberliegenden Fenster, gut, nicht übertreiben, etwa zweieinhalbmal, und sie kannte die Rue d’Estelle und das Haus Nr. 5 besser als jeden anderen Ort in dieser Welt.
Paulette Petit war mit Isabelle Bonnet, deren Orchidee Camille gerade gegossen hatte, aufgewachsen. Isabelle war die Tochter des Bäckers in der Rue d’Estelle Nr. 5, Boulangerie Bonnet. Sie waren zusammen zur Schule gegangen und hatten auf der kleinen Bank vor der Bäckerei heiße Clafoutis mit braunem Zucker und Kirschen aus der Backstube gegessen und sich dabei die Zungen verbrannt. Zusammen mit Isabelles Geschwistern Claudine und George hatten sie auf der Straße Ball gespielt, Kästchenhüpfen und »Wer ist stärker«. Meist hatte Isabelle dabei gewonnen. Sie war immer schon kräftig und gut einen Kopf größer als Paulette gewesen, die ihrem Namen Petit alle Ehre erwies und auch heute noch nicht mehr als 1,54 Meter maß. Und jetzt war sie in einem Alter, in dem man ja schon wieder zu schrumpfen begann. Mon Dieu …
Sie zündete sich eine Zigarette an und blies den Rauch durch das einen Spaltbreit geöffnete Fenster. Camille St. Pierre saß jetzt gegenüber in Isabelles Küche und aß etwas. Wahrscheinlich Salat. Das arme Ding aß immer nur Salat, wahrscheinlich also auch zum Frühstück. Sie stellte sich sogar einen Wecker, um ihre Essenszeiten einzuhalten. Paulette schnalzte missbilligend mit der Zunge. Das war doch kein Spaß.
Sie wandte sich wieder der Straße zu, die leer und friedlich im frühen Sonnenlicht dalag. Die Tauben des nahen Parks gurrten, und der Himmel über den Dächern war von einem so lichten, luftigen Blau, wie er nur an einem Frühlingsmorgen in Paris sein konnte. Sie öffnete das Fenster weiter und zog die Gardinen zurück, um die frische Morgenluft hereinzulassen. Ein Spaziergang an der Seine wäre jetzt schön, überlegte sie. Nicht weit, nur bis Notre-Dame und wieder zurück. Es war noch mehr als genug Zeit, das Mädchen würde erst am Nachmittag kommen. Aber sie war zu unruhig, um das Haus zu verlassen. Vielleicht kam sie früher? Oder sie rief an, weil ihr etwas dazwischengekommen war? Das konnte sie nicht riskieren. Es war ihr schwer genug gefallen, sich überhaupt zu diesem Schritt durchzuringen, nicht auszudenken, wenn sie sich jetzt verpassten und alles umsonst gewesen war. Sie ging zum zweiten Fenster des Raumes und öffnete auch dieses weit.
Apropos umsonst. Es stellte sich ohnehin die Frage, ob es zu irgendetwas gut war, was sie hier veranstaltete, oder ob es nicht viel zu spät war. Ihr Blick flog vom Fenster unwillkürlich zu dem Foto, das über der Kommode hing und sie selbst, erheblich jünger, zusammen mit einer kräftigen, schwarzhaarigen jungen Frau zeigte. Isabelle und sie standen – beide in weißen gestärkten Schürzen – vor der Boulangerie Bonnet und lachten in die Kamera. Paulette erinnerte sich, dass Isabelles Vater das Foto damals auf ihre Bitte hin geschossen hatte. Es war etwa um die gleiche Jahreszeit wie heute gewesen, die Platanen hatten geblüht.
Und jetzt war ihre Freundin tot.
Damit stellte sich die Frage, ob ihr Plan zu irgendetwas gut war, im Grunde nicht mehr. Für Isabelle war es in jedem Fall zu spät. Doch darum ging es nicht. Paulettes Blick wanderte wieder zurück zum Fenster und hinunter zu dem leeren Ladenfenster der Boulangerie Bonnet. Seit fast vier Monaten war die Bäckerei nun geschlossen, und sie hatte noch immer nicht entschieden, was damit geschehen sollte.
Ihr ganzes Leben lang hatte es die Boulangerie Bonnet in der Rue d’Estelle gegeben. Bis zu jenem kalten, nebligen Januarmorgen dieses Jahres, an dem Isabelle verkündet hatte, dass sie in ihrem Leben genug gearbeitet habe und die Zeit, die ihr noch blieb, lieber in südlicher Sonne als in einer renovierungsbedürftigen Backstube verbringen wolle. Und weil Isabelle keine Frau war, die einmal beschlossene Dinge gern auf die lange Bank schob, sperrte sie schon eine Woche später die Boulangerie Bonnet zu, um auf Weltreise zu gehen. Paulette hatte die Entscheidung verstanden, ohne dass sie viele Worte darüber verloren hätte. Isabelle war in den Tagen zuvor beim Arzt gewesen. Dort hatte sie erfahren, dass ihr nicht mehr viel Zeit bleiben würde, um sich die große Sehnsucht ihres Lebens zu erfüllen.
Drei Monate lang hatte sie nichts von Isabelle gehört, außer den bunten Postkarten, die sie in unregelmäßigen Abständen schickte. Damit die Bewohner des Hauses sich ebenfalls über den Fortgang der Weltreise ihrer Patronne informieren konnten, klebte Paulette die Karten eine nach der anderen an das leere, langsam staubig werdende Ladenfenster. Was auf den Karten geschrieben stand, war dabei von geringerem Informationsgehalt als das Foto auf der Vorderseite, denn Isabelle war keine große Schreiberin, und so stand auf jeder Karte dasselbe: Grosses Bises, was so viel bedeutete wie Viele Grüße und Küsse. Und da keine Anrede dabeistand, konnte nicht nur Paulette, sondern auch jeder ihrer Mieter die Grüße und Küsse für sich in Anspruch nehmen. Von Januar bis Anfang April hatte es Grüße und Küsse aus Bali, Thailand, Indien und Australien gegeben.
Dann kam der Tag, an dem Paulette die letzte Nachricht über Isabelle erreichte. Das Schreiben war keine Postkarte, sondern eine offizielle Mitteilung der französischen Botschaft in Auckland, Neuseeland, dass eine gewisse Madame Isabelle Bonnet bei einem Absturz mit einer Propellermaschine auf dem Weg von Auckland nach Wellington ums Leben gekommen sei.
Drei Monate. Drei Monate waren Isabelle geblieben für einen Traum, den sie ihr ganzes Leben lang geträumt hatte. Schon als junges Mädchen hatte sie immer davon gesprochen, einmal weit weg zu gehen und fremde Länder zu bereisen. In ihrem von zahllosen Schülerhänden vollgekritzelten Schulatlas hatte sie Paulette die Namen der Orte, die sie alle sehen wollte, vorgelesen: Sansibar, Kapstadt, Samarkand, Bali …
»Klingen sie nicht wundervoll?«, hatte sie Paulette gefragt, und ihr Blick war dabei sehnsüchtig geworden. »Nach Geheimnis. Nach Abenteuer.«
Paulette hatte damals von den meisten dieser Orte noch nie etwas gehört und auch nicht den Wunsch gehegt, dorthin zu reisen. Geheimnisse und Abenteuer in fremden Ländern lockten sie schon damals nicht besonders, und so war es geblieben. Allerdings verstand sie durchaus etwas von Sehnsucht, und deshalb hatte sie zustimmend genickt. Bis vor vier Monaten war es jedoch bei Isabelles unerfüllter Sehnsucht geblieben. Die ganzen Jahre hatte sich Isabelle kein einziges Mal durchringen können, ihre Bäckerei für mehr als zwei Wochen zu schließen. Und in diesen zwei Wochen fuhr sie stets mit ihrem Mann Hugo in die Normandie. Nie weiter. Nie in ein anderes Land. Über dreißig Jahre lang. Nach Hugos Tod hörte sie auch damit auf und blieb das ganze Jahr über in Paris und in ihrer Bäckerei. Und schien auch ganz zufrieden zu sein. Isabelle war, wie man so schön sagte, die Seele der Rue d’Estelle Nr. 5 gewesen. Und nun hatte sich diese Seele einfach davongemacht. Sie hatte nicht abgewartet, bis die Krankheit sie zwingen würde, wieder nach Hause zu kommen, schwach und auf Hilfe angewiesen, nein, sie hatte entschieden, sich am anderen Ende der Welt buchstäblich in Luft aufzulösen. Es passte zu Isabelle, auf diese Art zu verschwinden, stur, laut und eigensinnig, wie sie gewesen war. Mit einem großen Knall.
So gesehen, fand Paulette, hatte Isabelle es gut getroffen, ausgerechnet in dieses Flugzeug zu steigen. Oder gut gemacht, irgendwie, wenn man an solche Dinge wie Vorahnungen glauben wollte. Paulette glaubte daran nicht, sie war eine sehr pragmatische Frau, doch sie kam nicht umhin, für Isabelles Abgang eine gewisse Bewunderung zu empfinden. Es war das richtige Timing gewesen, wenn man so wollte, und auch wenn Isabelle ihr schmerzlich fehlte, freute sie sich für ihre Freundin. Ihr war einiges erspart geblieben.
Das Haus indes schien wahrhaftig zu trauern. Es war, als hätte sich ein grauer Schleier darübergelegt, der jeden Tag etwas dichter wurde. Eingesponnen in einen Kokon aus Traurigkeit schien das Sonnenlicht nur noch gedämpft durch die Fenster zu dringen, und das Gurren der Tauben aus dem Park verblasste zu einem weit entfernten Echo von etwas, das irgendwann einmal gewesen war. Jedes Mal, wenn Paulette den Code an der Haustür eingab, um dort nach dem Rechten zu sehen, hatte sie das Gefühl, das Summen des Türöffners ertöne zögernder und leiser, so als wünschte sich das Haus nichts sehnlicher, als es Isabelle Bonnet nachzutun und endlich auch ganz verstummen zu dürfen. Nüchtern betrachtet war das natürlich albern, doch obwohl Paulette Petit für sich in Anspruch nahm, eine außerordentlich nüchterne Person zu sein, wurde sie dennoch jedes Mal von großer Erleichterung erfasst, wenn die Tür am Ende doch aufsprang und sie einließ.
Dass sie zu solch morbiden Gedanken überhaupt fähig war, sagte ihr schließlich, dass es so nicht weitergehen könne. Es musste sich etwas ändern.
Und da hatte sie diese Idee.
Paulette warf den kalten Zigarettenstummel aus dem Fenster und wandte sich wieder dem Foto an der Wand zu. »Vielleicht bin ich gerade dabei, einen großen Unsinn zu machen, Isabelle«, sagte sie und seufzte. »Aber nachdem du dich aus dem Staub gemacht hast, muss ich mich wohl oder übel darum kümmern.« Sie deutete anklagend mit dem Finger zum Fenster hinaus. »Schau dir das Haus an. Es ist ein trauriger Ort geworden. Ich bekomme Magenschmerzen, wenn ich nur einen Blick darauf werfe. Dieses magere junge Ding, das nur Salat isst, und Nicolas, der – darauf kannst du wetten – viel mehr mit sich herumschleppt als nur seinen großen Rucksack. Sie lassen sich gehen, seit du nicht mehr da bist. Und weißt du eigentlich, dass man Monsieur Isaac überhaupt nicht mehr sieht? Ich glaube, er hat sich in seinem Tabakladen eingegraben.«
Sie sah die lachende junge Frau auf dem Foto vorwurfsvoll an: »Du hast gut lachen. Du musst ja nicht zusehen. Du bist nicht mehr da …«
Sie stockte und wischte sich hastig eine Träne aus den Augenwinkeln. »Also kannst du auch nichts dagegen haben, wenn ich die Sache jetzt auf meine Weise anpacke. Irgendjemand muss es schließlich tun.«
4
Louise spazierte langsam und ziellos durch die noch ruhigen Straßen, und es erschien ihr alles wunderbar. Jedes noch so kleine Detail sog sie in sich auf, jeden Passanten, der ihr entgegenkam, lächelte sie an. Sofern es sich dabei um echte, eingeborene Pariser handelte, reagierten sie zunächst eher irritiert, waren sie doch grundlose Freundlichkeit mitten auf der Straße nicht gewohnt, meistens jedoch lächelten sie zurück. Am Centre Pompidou schließlich stand sie fast zehn Minuten vor drei direkt nebeneinanderliegenden Cafés, unschlüssig, welches sie wählen sollte, um das erste Frühstück ihres neuen Lebens zu sich zu nehmen. Sie entschied sich nach einigem Hin und Her für das mittlere, das die hübschesten Stühle und eine rote Markise hatte, bestellte Café au lait, Tarte au citron meringuée und dazu ein Omelett mit Käse. Mochte dem Kellner die Kombination etwas befremdlich vorkommen, so zeigte er es jedenfalls nicht. Während sie abwechselnd von ihrem Omelett aß, den Kaffee trank und vom süßen Kuchen naschte, beobachtete sie einen jungen Mann mit weiß geschminktem Gesicht und schwarz umrandeten Augen, der einen großen, alten Koffer heranschleppte und vor dem Café abstellte. Er trug ein weißes T-Shirt mit rundem Ausschnitt und eine Hose mit Hosenträgern. Ein Straßenkünstler.
Louise liebte diese Art von Vorstellungen, ließ sich gern von poetischen Geschichten verzaubern, tanzte mit Vorliebe zu exotischer Musik irgendwo an einer Straßenecke, auf einem Platz, und machte bereitwillig mit, wenn jemand eine Freiwillige brauchte, egal, was für Quatsch es auch sein mochte. Doch in Paris war Straßenkunst natürlich niemals Quatsch, dessen war sich Louise sicher. Sie nippte von ihrem Kaffee und ließ dabei den Mann nicht aus den Augen. Zu ihrer Enttäuschung tat er jedoch zunächst gar nichts, setzte sich nur auf den Koffer und drehte sich eine Zigarette. Louise sah sich um und verstand. Es waren noch zu wenige Leute da, als dass sich eine Darbietung gelohnt hätte.
Eine Kellnerin aus dem Café winkte ihm zu, und er erwiderte ihren Gruß mit einem breiten Lächeln. Louise musterte ihn genauer. Er war nicht besonders groß, drahtig, hatte dunkle, absichtlich wild zu Berge stehende Haare und – soweit man es unter der Schminke erahnen konnte – ein sympathisches Gesicht. Dazu ziemlich große Ohren, die er zudem noch mit roter Farbe betont hatte. Ein kleines Lächeln stahl sich auf Louises Gesicht. Eitel war er also schon einmal nicht. Die Kellnerin brachte ihm einen petit noir, sie redeten ein bisschen miteinander, während er rauchte und nebenbei in der kleinen Tasse rührte. Er schien einen Witz zu machen oder eine lustige Begebenheit zu erzählen, denn die junge Frau lachte auf. Noch immer belustigt den Kopf schüttelnd ging sie zurück in das Café. Louise wandte sich ihrem Kuchen zu. Sie wollte nicht den Anschein erwecken, ihn zu beobachten. Obwohl sie genau das natürlich tat. Weil es sie interessierte. Wie alles in dieser Stadt. Sie wollte alles sehen, alles erfahren, alles genießen. Das war ihr Plan.
Nach einer Weile hob sie wieder den Blick. Der Straßenclown hatte den Koffer geöffnet und holte einen Stoffbeutel heraus. Dann schloss er den Deckel wieder und setzte sich darauf, den Beutel zu seinen Füßen. Er entnahm ihm drei kleine rote Bälle und fing, die Zigarette noch immer im Mundwinkel, im Sitzen an, ein wenig zu jonglieren. Es wirkte mühelos, wie nebenbei, und sein Blick wanderte dabei fast gelangweilt über den Platz. Als er bei Louise anlangte, stockte er, und Louise lächelte ihm unwillkürlich zu. Er fing seine Bälle auf, warf die Zigarette weg und bedeutete ihr pantomimisch seine tiefe Zerknirschung darüber, dass er sie nicht sofort bemerkt hatte. Dann packte er die roten Bälle zurück in die Tasche und holte, behutsam wie einen wertvollen Schatz, eine Glaskugel heraus. Louise konnte aus der Entfernung nicht sehen, ob es sich um echtes Glas oder um Kunststoff handelte, doch der Clown tat jedenfalls so, als sei sie unglaublich zart und zerbrechlich. Er hob sie gegen die Sonne, sodass sich das Licht in ihr brach und leuchtende Punkte auf den Boden geworfen wurden. Dann versuchte er, die Punkte zu fangen, dabei gleichzeitig die Glaskugel nicht fallen zu lassen und nicht über den Koffer zu stolpern, was zu äußerst komischen, akrobatischen Verrenkungen führte. Louise musste laut auflachen.
Der junge Mann hielt inne. Er schien überrascht, so als habe er ganz vergessen, dass sie da war, und ließ die Hand mit der Glaskugel sinken. Louises Lächeln erstarb. Er sah mit einem Mal traurig aus, wie er mit hängenden Armen dastand und sie anschaute. Gehörte das zum Programm? Kam noch etwas? Unsicher begann sie zu klatschen und holte ihn damit aus seiner Erstarrung. Er gab sich einen Ruck und ließ die Kugel vorsichtig zurück in den Stoffbeutel gleiten. Dann öffnete er den Koffer und holte eine Blume heraus. Mit feierlicher Miene kam er direkt auf sie zu, verbeugte sich stumm und reichte sie ihr. Es war eine Rose aus Papier, rosa, zart und leicht wie ein Schmetterlingsflügel.
»Merci«, sagte Louise leise und hielt die Rose in der Hand wie einen kostbaren Schatz.
Ihre Blicke trafen sich für einen Moment, lange genug, um Louises Herz schneller schlagen zu lassen, dann wandte er sich ab und ging zurück. Er schnürte den Stoffbeutel zu, wickelte ihn zusammen und legte ihn zurück in den Koffer. Dann zurrte er den altmodischen Gurt um den Koffer wieder fest und verließ den Platz, ohne sich noch einmal nach ihr umzusehen. Louise kramte in ihrem Geldbeutel hastig nach Kleingeld, sie wollte ihm noch nachrufen, doch er war schon zu weit weg. Verwundert sah sie ihm nach. Hatte sie etwas falsch gemacht?
Sie winkte dem Kellner, um zu zahlen.
»Wissen Sie, wer das war?«, fragte sie ihn, als er ihr die Rechnung brachte.
»Wen meinen Sie, Mademoiselle?«
»Der Straßenclown gerade eben. Ihre Kollegin schien ihn zu kennen.«





























