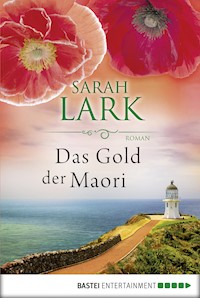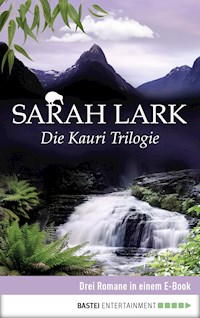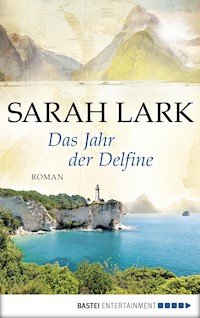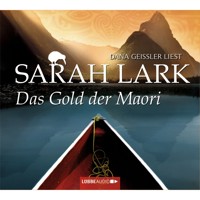Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Insel-Saga
- Sprache: Deutsch
London, 1732: Nach dem Tod ihrer ersten großen Liebe geht die Kaufmannstochter Nora eine Vernunftehe mit einem verwitweten Zuckerrohrpflanzer auf Jamaika ein.
Aber das Leben in der Karibik gestaltet sich nicht so, wie Nora es sich erträumt hat. Der Umgang der Plantagenbesitzer mit den Sklaven schockiert sie zutiefst, und sie entschließt sich, auf ihrer Zuckerrohrfarm manches zum Besseren zu wenden. Überraschend unterstützt sie dabei ihr erwachsener Stiefsohn Doug, als er aus Europa anreist. Allerdings versetzt seine Rückkehr manches in Aufruhr - vor allem Noras Gefühle. Doch dann verliert Nora durch ein tragisches Ereignis plötzlich alles, bis auf ihr Leben ...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:10 Std. 13 min
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Karte
Schwärmerei
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Die Insel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Zauber
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Verrat
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Liebe
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Rache
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Nachwort
SARAH LARK
DIE INSELDER TAUSENDQUELLEN
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Copyright © 2011 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Steven Wright / Shutterstock; Koshevnyk / Shutterstock; Bystrova M.B./ Shutterstock; Fleyeing / Shutterstock
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-8387-1026-6-
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
SCHWÄRMEREI
London
Spätsommer bis Herbst 1729
KAPITEL 1
Was für ein Wetter!«
Nora Reed schüttelte sich, bevor sie aus dem Haus ihres Vaters trat und auf die davor wartende Kutsche zueilte. Der alte Kutscher lächelte, als sie trotz hochhackiger Seidenschuhe behände über die Pfützen hüpfte, um ihr Kleid nicht zu beschmutzen. Der voluminöse Reifrock entblößte weit mehr von ihren Knöcheln und Waden, als schicklich war, aber Nora hatte vor Peppers keine Hemmungen. Er war seit Jahren im Dienst ihrer Familie und kannte sie, seit er sie weiland zur Taufe gefahren hatte.
»Wo soll’s denn hingehen?«
Lächelnd hielt der Kutscher Nora den Schlag des hohen, schwarz lackierten Gefährts auf. Die Türen waren mit einer Art Wappen verziert: kunstvoll ineinander verschlungene Initialen – T und R für Thomas Reed, Noras Vater.
Nora schlüpfte rasch ins Trockene und ließ sofort die Kapuze ihres weiten Mantels sinken. Ihre Zofe hatte an diesem Morgen dunkelgrüne Bänder in das goldbraune Haar geflochten, passend zu Noras vorn offenem sattgrünen Mantelkleid. Dem breiten Zopf, der ihr über den Rücken fiel, hätte der Regen jedoch auch ohne Schutz nichts anhaben können. Nora pflegte ihr Haar nicht weiß zu pudern, wie die Mode es vorschrieb. Sie bevorzugte es natürlich und freute sich, wenn Simon ihre Locken mit flüssigem Bernstein verglich. Die junge Frau lächelte versonnen beim Gedanken an ihren Liebsten. Vielleicht sollte sie doch im Kontor ihres Vaters vorbeischauen, bevor sie Lady Wentworth besuchte.
»Erst mal runter zur Themse, bitte«, gab sie dem Kutscher eher vage Anweisungen. »Ich will zu den Wentworths … Sie wissen schon, das große Haus im Geschäftsviertel.«
Lord Wentworth hatte sich gleich in der Gegend der Kontore und Handelshäuser an der Themse angesiedelt. Der Kontakt mit den Kaufleuten und Zuckerimporteuren war ihm offensichtlich wichtiger als eine Residenz in einem der vornehmeren Wohnviertel.
Peppers nickte. »Ihren Vater möchten Sie nicht besuchen?«, erkundigte er sich.
Der alte Diener kannte Nora gut genug, um in ihrem schmalen, ausdrucksstarken Gesicht zu lesen. In den letzten Wochen bat sie ihn auffallend oft, sie hinunter zum Reed’schen Kontor zu kutschieren – auch wenn es eigentlich ein Umweg war. Und natürlich drängte es sie dabei nicht so sehr, ihren Vater zu sehen, sondern eher Simon Greenborough, den jüngsten seiner Sekretäre. Peppers ahnte, dass die junge Frau sich auch mit dem jungen Mann traf, wenn sie spazieren ging oder ausritt, aber er gedachte nicht, sich einzumischen. Zweifellos wäre es seinem Herrn nicht recht, wenn Nora mit einem seiner Angestellten tändelte. Doch Peppers mochte seine junge Herrin – Nora verstand es seit jeher, das Personal ihres Vaters um den Finger zu wickeln –, und er gönnte ihr die Schwärmerei für den hübschen, dunkelhaarigen Schreiber. Bislang hatte Nora auch niemals ernsthafte Heimlichkeiten vor ihrem Vater gehabt. Thomas Reed hatte sie praktisch allein aufgezogen, nachdem ihre Mutter früh verstorben war, und die beiden hatten ein enges, herzliches Verhältnis. Peppers glaubte nicht, dass sie dies für eine Liebelei aufs Spiel setzen würde.
»Mal sehen«, meinte Nora jetzt, und ihr Gesicht nahm einen spitzbübischen Ausdruck an. »Kann jedenfalls nicht schaden, wenn wir vorbeifahren. Fahren wir einfach ein bisschen spazieren!«
Peppers nickte, schloss die Tür hinter ihr und stieg auf den Bock. Dabei schüttelte er unwillig den Kopf. Bei allem Verständnis für Noras junge Liebe – zum Spazierenfahren lud das Wetter nun wirklich nicht ein. Es regnete in Strömen, und das Wasser schoss sturzbachartig durch die Straßen der Stadt, Unrat und Müll mit sich reißend. Regen und Straßenschmutz verbanden sich zu einer übel riechenden Brühe, die unter den Rädern der Kutschen gurgelte, und nicht selten verfingen sich weggespülte Bretter, von den Ladenfronten gerissene Schilder oder gar Tierkadaver in den Speichen.
Peppers fuhr langsam, um keinen Unfall zu riskieren und die Laufburschen und Passanten zu schonen, die trotz des Wetters zu Fuß unterwegs waren. Sie ergriffen vor dem aufspritzenden Wasser die Flucht, wenn eine Kutsche vorbeikam, schafften es aber nicht immer, dem stinkenden unfreiwilligen Duschbad zu entkommen. Nun musste Peppers seine Pferde auch nicht zurückhalten. Die Tiere gingen nur unwillig vorwärts, sie schienen sich unter dem Regen ducken zu wollen – ebenso wie der schmale junge Mann, offensichtlich ein Botenjunge, der aus dem Kontor des Thomas Reed heraustrat, als Peppers seine Kutsche vorbeilenkte. Peppers empfand Mitgefühl für den Armen, aber er wurde nun von Nora abgelenkt, die heftig gegen das Fenster zwischen Kutsche und Bock klopfte.
»Peppers! So halten Sie doch an, Peppers! Das ist …«
Simon Greenborough hatte gehofft, dass sich das Wetter bessern würde. Aber als er aus dem Halbdunkel des Kontors auf die Straße trat, belehrte ihn der Anblick der triefenden Pferde vor den geschlossenen Droschken eines Besseren. Simon versuchte, den Kragen seines fadenscheinigen Mantels hochzuziehen, um den Spitzenbesatz seines letzten brauchbaren Hemdes zu schützen. Er pflegte ihn an jedem Abend selbst zu plätten, um ihn halbwegs in Form zu halten. Jetzt war er aber in kürzester Zeit durchnässt, ebenso wie Simons spärlich gepuderte Frisur. Das Wasser lief an dem kurzen Zopf herab, zu dem er sein dichtes dunkles Haar zusammengefasst hatte. Simon sehnte sich nach einer Kopfbedeckung, aber darauf pflegte er schon deshalb zu verzichten, weil er nicht genau wusste, was für seinen neuen Stand als Schreiber schicklich war. Ganz sicher nicht der Dreispitz des jungen Adligen, selbst wenn sein einziger Hut noch vorzeigbar gewesen wäre. Und auch nicht die aufwändige Perücke, die sein Vater getragen hatte und der Gerichtsvollzieher …
Simon versuchte, nicht weiter darüber nachzudenken. Er hustete, als ihm das Wasser den Rücken herunterrann. Wenn er nicht bald aus dem Platzregen herauskam, würden auch sein Mantel und seine Kniehosen völlig durchnässt sein. Seine alten Schnallenschuhe hielten der Nässe schon jetzt nicht stand, das Leder quietschte bei jedem Schritt. Simon versuchte, schneller zu gehen. Letztlich waren es ja nur ein paar Blocks bis in die Thames Street, und vielleicht konnte er gleich auf die Antwort auf den Brief warten, den er sich erboten hatte zu befördern. Bis dahin würde der Regen hoffentlich nachlassen …
Simon bemerkte die von hinten herannahende Kutsche erst, als er Noras helle Stimme hörte.
»Simon! Was um Himmels willen machst du hier? Du holst dir noch den Tod bei dem Wetter! Was fällt meinem Vater ein, dich den Laufburschen spielen zu lassen?«
Der Kutscher hatte sein nobles Gefährt neben Simon zum Stehen gebracht, zweifellos auf Noras Anweisung. Die junge Frau wartete allerdings nicht, bis er vom Bock gestiegen war, um ihr den Schlag aufzuhalten. Stattdessen stieß sie die Tür schwungvoll von innen auf und klopfte auffordernd auf den Sitz neben sich.
»Komm rein, Simon, rasch! Der Wind weht ja den ganzen Regen auf die Polster.«
Simon blickte unschlüssig ins Innere der Kutsche, und auch der Kutscher schaute etwas betreten auf den jungen Mann, der nass wie eine Katze am Bordstein stand. Schließlich ergriff er das Wort.
»Es wäre deinem Vater sicher nicht recht …«
»Es wäre Ihrem Vater sicher nicht recht, Miss Reed …«
Simon und der Kutscher sprachen die Worte fast zur gleichen Zeit aus und blickten auch gleichermaßen indigniert, als Nora sie mit einem hellen Lachen quittierte.
»Nun sei mal vernünftig, Simon! Egal, wo du hinwillst, es kann meinem Vater auch nicht recht sein, wenn sein Bote da ankommt, als habe er eben die Themse durchschwommen. Und Peppers wird nichts verraten, nicht, Peppers?«
Nora lächelte ihrem Kutscher verständnisheischend zu. Peppers seufzte und öffnete den Kutschenschlag weit für ihren Gast.
»Bitte, Mister … äh … Mylord …« Alles in Peppers sträubte sich, diese unglückliche Gestalt mit einem Adelstitel anzureden.
Simon of Greenborough zuckte denn auch die Schultern. »›Mister‹ ist in Ordnung. Der Sitz im House of Lords ist ohnehin verkauft, ob ich mich nun Lord oder Viscount nenne oder wie auch immer.«
Es klang bitter, und Simon schalt sich dafür, dem Diener Einblick in seine Familienverhältnisse gewährt zu haben. Aber womöglich wusste der ohnehin schon zu viel über ihn. Nora betrachtete das Personal in ihrem Haus in Mayfair als ihre erweiterte Familie. Wer wusste, was sie ihren Zofen oder Hausmädchen alles erzählt hatte?
Simon ließ sich aufatmend in die Polster neben sie gleiten. Er hustete wieder, dieses Wetter schlug ihm auf die Lunge. Nora schaute den jungen Mann halb strafend, halb bedauernd an. Dann griff sie kurz entschlossen nach ihrem Schal und rubbelte sein Haar trocken. Natürlich hinterließ das Puderspuren auf der Wolle. Nora betrachtete sie kopfschüttelnd.
»Dass du da aber auch immer dieses Zeug draufgibst!«, rügte sie. »Eine dümmliche Mode, du hast so schönes dunkles Haar, warum es weiß färben wie bei einem Greis? Gott sei Dank kommst du nicht auch noch auf die Idee, so eine Perücke aufzusetzen …«
Simon lächelte. Er hätte sich die Perücke gar nicht leisten können, aber Nora weigerte sich beharrlich, seine Armut auch nur zu bemerken. Wie sie alle anderen Unterschiede zwischen ihrer eigenen Stellung und der Simons ebenso konsequent leugnete. Ihr war es egal, ob er adlig war und sie bürgerlich, ob er völlig verarmt war, während ihr Vater zu den reichsten Kaufleuten des Empire zählte, und ob er in einem Schloss wohnte oder im Kontor ihres Vaters als schlecht bezahlter Schreiber diente. Nora Reed liebte Simon Greenborough, und sie ließ keinen Zweifel daran, dass diese Liebe irgendwann Erfüllung finden würde. Jetzt lehnte sie sich vertrauensselig an seine Schulter, während die Kutsche über Londons Kopfsteinpflaster rumpelte.
Simon warf dagegen einen nervösen Blick in Richtung Kutschbock, bevor er sie lächelnd in die Arme nahm und küsste. Nora hatte sich an diesem regnerischen Tag natürlich für eine geschlossene Kutsche entschieden. Das Fenster, das ihr ermöglichte, Peppers anzusprechen, war winzig und obendrein beschlagen. Der Kutscher würde nichts von dem mitbekommen, was sich drinnen tat. Nora erwiderte Simons Kuss denn auch ohne jede Hemmung. Sie strahlte, als sie sich von ihm löste.
»Ich hab dich so vermisst!«, flüsterte sie und schmiegte sich an ihn, ohne Rücksicht darauf, dass ihr Umhang dabei nass wurde und die Spitzen am Ausschnitt ihres Kleides zerknitterten. »Wie lange ist es her?«
»Zwei Tage«, antwortete Simon sofort und streichelte zärtlich über den Ansatz ihres Haars und ihre Schläfe. Er konnte sich an den feinen Zügen und dem Lächeln der zierlichen jungen Frau kaum sattsehen, und die Tage ohne sie waren ihm ebenso dunkel und trostlos erschienen wir ihr. Nora und ihr Vater hatten das Wochenende auf dem Landsitz von Freunden verbracht, aber es hatte auch da schon anhaltend geregnet. Die Liebenden hätten sich also sowieso nicht heimlich treffen können. Schließlich gab es keinen öffentlichen oder gar privaten Raum, in dem ein so unpassendes Paar unbemerkt miteinander hätte plaudern können – vom Austausch von Zärtlichkeiten gar nicht zu reden. Wenn das Wetter schön war, trafen sich die beiden im St. James’ Park, obwohl auch das nicht ungefährlich war. Auf den bevölkerten Wegen konnten sie von Noras Freunden und Bekannten gesehen werden, während in den verschwiegenen Nischen hinter dunklen Hecken oft auch dunkle Gestalten lauerten … Und nun wurde es obendrein Herbst.
»Wir müssen unbedingt mit Vater reden!«, erklärte Nora, der wohl ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen. »Das geht nicht mehr mit den Spaziergängen im Park, das Wetter wird doch immer schlechter. Vater muss gestatten, dass du mir in aller Offenheit den Hof machst! Schon, weil ich dich herumzeigen möchte. Meinen wunderschönen Lord …«
Sie lächelte Simon spitzbübisch an, und er verlor sich wie so oft im Anblick ihres schmalen, klugen Gesichts und ihrer grünen Augen, in denen ein Kaleidoskop von helleren und dunkleren Lichtern aufzublitzen schien, wenn Nora erregt war. Er liebte ihr goldbraunes Haar, vor allem, wenn sie es mit Blumen schmückte. Orangenblüten … Weder Simon noch Nora hatten je einen Orangenbaum gesehen, aber sie kannten die Blüten von Abbildungen, und sie träumten davon, sie eines Tages gemeinsam zu pflücken.
»Dein Vater wird das nie erlauben …«, erwiderte Simon pessimistisch und zog Nora näher an sich. Es war schön, sie zu spüren, sich vorzustellen, dies sei seine eigene Kutsche, in der er seine Liebste heimbrachte, auf einen Herrensitz in der Sonne …
»Wo wollen Sie überhaupt hin?«
Peppers knappe Frage ließ die Liebenden auseinanderstieben. Dabei war es unwahrscheinlich, dass er viel gesehen hatte. Er hatte sich nur halb zu seinen Passagieren umgewandt, und der Verkehr auf Londons Straßen, noch dazu bei diesem Wetter, erforderte seine ganze Aufmerksamkeit.
»In … in die Thames Street«, antwortete Simon. »Zum Kontor von Mr. Roundbottom!«
Nora lächelte dem Kutscher und Simon gleichermaßen vergnügt zu. »Ach, da kommen wir praktisch vorbei!«, freute sie sich. »Ich bin auf dem Weg zu Lady Wentworth, um das Buch zurückzugeben.«
Sie zog ein kleines, hübsch gebundenes Buch aus ihrem spitzenbesetzten Beutel und hielt es Simon hin.
»Barbados«, die Falte, die stets auf Simons Stirn erschien, wenn er sich sorgte, glättete sich, »ich hätte es auch gern gelesen.«
Nora nickte. »Weiß ich. Aber ich muss es zurückbringen, die Wentworths reisen morgen ab, auf die Jungferninseln. Sie haben da eine Plantage, weißt du. Sie waren nur hier, um …«
Simon hörte nicht mehr zu, er blätterte bereits in dem Büchlein. Warum die Wentworths in England gewesen waren, konnte er sich denken. Wahrscheinlich hatten sie ihre karibischen Besitztümer nur verlassen, um einen Parlamentssitz zu kaufen oder sich um einen zu kümmern, der ihrer Familie bereits gehörte. Die Zuckerrohrpflanzer aus Jamaika, Barbados und anderen Anbaugebieten in der Karibik wachten eifersüchtig über die Preisbindungen ihrer Produkte und die Einfuhrverbote aus anderen Ländern. Zu diesem Zweck festigten sie ihre Macht durch den Ankauf von Sitzen im House of Lords, angeboten von verarmten Adligen wie Simons eigener Familie. Soweit Simon wusste, hatte die Vertretung der Grafschaft Greenborough heute ein Mitglied der Familie Codrington inne, der ein großer Teil der kleinen Karibikinsel Barbuda gehörte.
Aber auch Nora hielt sich nicht lange mit Geschichten über die Familie Wentworth auf. Stattdessen schaute sie erneut in das Buch, das sie schon mehrmals gelesen hatte.
»Ist das nicht hübsch?«, kommentierte sie eine Zeichnung.
Simon hatte eben eine Seite aufgeschlagen, deren Text eine Radierung vom Strand von Barbados illustrierte. Palmen … Sandstrand, der dann unmittelbar in dichten Urwald überzugehen schien … Nora beugte sich eifrig darüber und kam Simon dabei so nahe, dass er den Duft ihres Haars aufnehmen konnte: kein Talkumpuder, Rosenwasser.
»Und da steht unsere Hütte!«, träumte sie und wies auf eine Art Lichtung. »Gedeckt mit Palmenzweigen …«
Simon lächelte. »Was das angeht, wirst du dich aber irgendwann entscheiden müssen«, neckte er sie. »Willst du jetzt mit den Eingeborenen in ihren Hütten leben oder eine Tabakplantage für deinen Vater führen?«
Nora und Simon waren sich einig darüber, dass England überhaupt und London im Besonderen nicht die Orte waren, an denen sie ihr Leben verbringen wollten. Nora verschlang alle Literatur über die Kolonien, derer sie habhaft werden konnte, und Simon träumte über den Briefen, die er für ihren Vater schrieb, von Jamaika, Barbados oder Cooper Island. Thomas Reed importierte Zuckerrohr, Tabak und Baumwolle aus allen Teilen der Erde, die sich das britische Empire im letzten Jahrhundert einverleibt hatte. Er stand in regem Kontakt mit den dortigen Pflanzern, und Nora hatte insofern auch schon einen Plan zur Verwirklichung ihrer Wünsche. Gut, in England gab es für sie und Simon vielleicht keine Zukunft. Aber wenn sie eine Zweigstelle des Reed’schen Geschäftes irgendwo in den Kolonien eröffneten … Aktuell war Barbados ihr Traumland. Aber sie hätte sich auch überall sonst angesiedelt, wo nur täglich die Sonne schien.
»Da wären wir … Miss Nora, Sir …« Peppers verhielt die Kutsche und machte Anstalten, die Türen für Simon zu öffnen. »48, Thames Street.«
Neben dem Eingang des Stadthauses prangte ein goldenes Schild, das auf Mr. Roundbottoms Kontor hinwies. Simon schlug das Buch bedauernd zu und schob sich hinaus in den Regen.
»Vielen Dank für die Mitfahrgelegenheit, Miss Reed«, verabschiedete er sich höflich von Nora. »Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen.«
»Die Freude war ganz auf meiner Seite, Viscount Greenborough«, erwiderte Nora ebenso artig. »Aber warten Sie im Kontor, bis es aufhört zu regnen. Ich möchte nicht, dass Sie sich auf dem Rückweg verkühlen.«
Peppers verdrehte vielsagend die Augen. Bisher fand er Noras Liebelei eher erheiternd als besorgniserregend, aber wenn das so weiterging, manövrierte sich seine kleine Herrin in eine Geschichte hinein, die nicht glücklich enden konnte. Thomas Reed würde seine Tochter auf keinen Fall mit seinem Schreiber vermählen, egal, ob der irgendwann mal einen Adelstitel getragen hatte oder ihn sogar noch trug.
Simon quälten ähnliche Gedanken, als er schließlich zurück an seinen Arbeitsplatz lief. Der Regen hatte nachgelassen, aber seine Kleider waren längst noch nicht getrocknet, und auf dem Korridor, auf dem Mr. Roundbottom ihn hatte warten lassen, war es obendrein zugig und kalt gewesen. Simon fror bis ins Mark – die hartnäckige Erkältung, die er sich schon im Frühjahr in dem winzigen, ungezieferverseuchten Zimmer geholt hatte, das er im Eastend von London gemietet hatte, würde ihn noch lange quälen. Was für ein Abstieg nach Greenborough Manor, und natürlich auch nicht angemessen für einen Angestellten in einem angesehenen Kontor.
Thomas Reed entlohnte seine Schreiber nicht üppig, aber er war auch kein Ausbeuter. Gewöhnlich hätte Simons Verdienst für eine saubere kleine Wohnung ausgereicht, die älteren Sekretäre ernährten davon sogar eine Familie – bescheiden, aber annehmbar. Simon konnte allerdings nicht hoffen, irgendwann auch einmal eine Familie gründen zu können. Wenn nicht ein Wunder geschah, würde er sein Leben lang für die Schulden schuften müssen, die sein Vater angehäuft hatte, und das, obwohl bereits alles verkauft war, was die Familie an Wertsachen besessen hatte.
Der Absturz war für Simons Mutter, seine Schwester und ihn völlig überraschend gekommen. Natürlich wusste die Familie, dass es mit den Finanzen von Lord Greenborough nicht allzu gut stand. Der Verkauf des Parlamentssitzes stand schon lange im Raum, wobei Simon im Stillen längst zu dem Ergebnis gekommen war, dass dies der Entscheidungsfähigkeit des House of Lords nur guttun konnte. Sein Vater hatte seinen Sitz nur selten eingenommen, und wenn, dann konnte er den Debatten, wie man sich erzählte, ebenso wenig folgen wie zu Hause den Tiraden seiner Frau, die nie müde wurde, ihm seine Trunk- und Verschwendungssucht vorzuwerfen. John Peter Greenborough war weit häufiger betrunken gewesen als nüchtern – aber seine Familie hatte keine Ahnung davon, dass er obendrein versucht hatte, seine angeschlagenen Finanzen am Spieltisch wieder in Ordnung zu bringen.
Als er schließlich starb – offiziell ein Sturz bei der Reitjagd, aber tatsächlich die Folge davon, dass er zu betrunken war, um sich auch nur im Schritt auf dem Pferd zu halten –, meldeten mannigfaltige Gläubiger ihre Ansprüche an. Lady Greenborough verkaufte den Parlamentssitz und damit im Prinzip auch ihr Land und den Titel ihres Sohnes. Sie trennte sich von ihrem Schmuck und ihrem Silber, verpfändete ihr Haus und musste es schließlich verkaufen. Die Familie Codrington überließ den Greenboroughs aus reiner Gnade ein Cottage am Rande des Dorfes, das immer noch ihren Namen trug. Aber Geld verdienen konnte Simon dort nicht. Inzwischen war zu den Schulden seines Vaters auch noch die Mitgift für seine Schwester gekommen, die man Gott sei Dank halbwegs standesgemäß hatte verheiraten können. Simons Zukunft dagegen war zerstört. In seinen dunkelsten Stunden fragte er sich, ob er die Liebe Noras, dieser ebenso schönen wie reichen jungen Frau, als ein Glück betrachten sollte oder ob sie nur eine weitere Prüfung darstellte.
Nora Reed war überzeugt, dass die Verwirklichung ihrer Träume nur eine Frage der Zeit war. Ihre Hoffnung, Thomas Reed würde Simon mit offenen Armen als Schwiegersohn aufnehmen, vermochte dieser allerdings nicht zu teilen. Im Gegenteil, eher würde der Geschäftsmann ihn als Mitgiftjäger aus dem Haus weisen. Dabei war Simon bereit, sehr hart für die Verwirklichung seiner Träume zu arbeiten. Er war ein ernsthafter junger Mann, hatte sich stets einen Posten in einer der Kolonien gewünscht und versucht, sich so gut wie möglich darauf vorzubereiten. Simon war kein großer Reiter, Jäger und Fechter – für die Zerstreuungen des Adelsstandes zeigte er weder besondere Neigungen noch Begabungen, ganz abgesehen von der finanziellen Situation seiner Familie. Aber er war klug und hochgebildet. Simon sprach mehrere Sprachen, war verbindlich und höflich und konnte im Gegensatz zu den meisten Peers auch gut mit Zahlen umgehen. Auf jeden Fall hätte er es sich durchaus zugetraut, ein Handelshaus wie das des Thomas Reed irgendwo in Übersee zu vertreten. Simon war bereit, sich hochzudienen, jeglicher Dünkel war ihm fremd. Man musste ihm nur eine Chance geben! Aber ob Thomas Reed seine Liebe zu Nora zum Anlass dazu nahm? Wahrscheinlich würde er Simon eher verdächtigen, seine Tochter als Sprungbrett für seine Karriere benutzen zu wollen.
Simon zweifelte jedenfalls daran, dass es richtig war, sich Thomas Reed so bald schon zu offenbaren. Es wäre auf jeden Fall besser zu warten, bis er sich selbst seine Achtung erworben und in eine höhere Position aufgestiegen war. Nora war erst siebzehn, und bisher machte ihr Vater keine Anstalten, sie zu vermählen. Simon hatte sicher noch ein paar Jahre Zeit, um sich so weit zu etablieren, dass er als Schwiegersohn des Kaufmanns in Frage kam.
Wenn er nur gewusst hätte, wie er das anstellen sollte!
KAPITEL 2
Was kann man denn sonst noch machen – also außer Zuckerrohr zu pflanzen oder Tabak?«, erkundigte sich Nora.
Sie saß auf der Chaiselongue der Lady Wentworth und balancierte geziert eine Teetasse zwischen Daumen und Zeigefinger. Seit Queen Anne das Heißgetränk einige Jahrzehnte zuvor bekannt gemacht hatte, wurde es in jedem besseren Salon in England serviert. Wie die meisten Damen hatte Nora reichlich Zucker hineingerührt – sehr zum Wohlgefallen ihrer Gastgeberin, die in jedem in England gesüßten Tee einen Beitrag zur Erhaltung ihres Wohlstandes sah.
»Also Tabak hat sich gar nicht besonders bewährt«, antwortete Lady Wentworth geduldig.
Die vielen Fragen der jungen Kaufmannstochter amüsierten sie. Nora Reed schien wild entschlossen, ihre Zukunft in den Kolonien zu sehen. Lady Wentworth bedauerte, dass ihre Söhne erst acht und zehn Jahre alt waren. Die kleine Reed wäre eine hervorragende Partie, und dass sie bürgerlich war, störte die Lady kaum. Schließlich hatte auch ihr eigener Mann den Titel käuflich erworben. Man musste längst nicht mehr heiraten oder sich aufwändig vom König zum Ritter schlagen lassen, um zu den Peers von England zu gehören. Wobei auch Letzteres für die Zuckerbarone machbar war. Gegen entsprechende Zuwendungen – Geschenke, Unterstützung der Flotte oder andere Wohltaten für die Krone – erkannte der König an, wie fleißig man dort am anderen Ende der Welt für das Gedeihen des Königreichs tätig war …
»In Sachen Tabak erzielen Virginia und andere Kolonien in der Neuen Welt bessere Qualitäten. Aber Zuckerrohr wächst nirgendwo so gut wie auf unseren Inseln. Wobei man natürlich auch Ausgaben hat …« Lady Wentworth erinnerte sich rechtzeitig, dass sie hier eine Kaufmannstochter vor sich hatte. Wenn sie zu sehr davon schwärmte, wie leicht sich der Zuckerrohranbau auf Jamaika, Barbados und den Jungferninseln gestaltete, mochte Noras Vater versuchen, die Preise zu drücken. »Allein die Sklaven!«
»Also, Sklaven halten wollten wir eigentlich nicht!«, bemerkte Nora leise, aber ehrlich. Auch darüber hatte sie sich mit Simon bereits ausgetauscht, und die beiden waren einer Meinung. »Das … das ist unchristlich.«
Lady Wentworth, eine resolute Frau in den Dreißigern, deren üppige Figur Korsett und Reifrock fast sprengte, lachte auf. »Ach, Kindchen«, wehrte sie ab, »Sie haben ja keine Ahnung. Aber die Kirche sieht das zum Glück ganz realistisch: Hätte Gott nicht gewollt, dass die Schwarzen für uns arbeiten, dann hätte er sie nicht geschaffen. Und wenn Sie erst mal in Übersee sind, Miss Reed, werden Sie das auch einsehen. Das Klima ist nichts für weiße Menschen. Zu heiß, zu feucht. Keiner kann lange da arbeiten. Die Neger dagegen, für die ist das ganz normal. Und wir behandeln sie ja gut – sie kriegen zu essen, wir stellen ihnen die Kleidung, sie …« Lady Wentworth brach ab. Viel mehr schien ihr zum Wohlbefinden ihrer Sklaven nicht einzufallen. »Der Reverend predigt ihnen sogar das Evangelium!«, erklärte sie schließlich triumphierend, als sei allein das schon die Arbeitskraft eines ganzen Lebens wert. »Wenngleich sie das nicht immer zu schätzen wissen. Da grassieren Rituale, Kindchen – furchtbar! Wenn die ihre alten Götzen beschwören … Es ist zweifellos gottgefällig, dass wir das einschränken. Aber lassen Sie uns von angenehmeren Dingen sprechen, Miss Reed.« Die Lady griff nach einem Teekuchen. »Gibt es vielleicht schon konkrete Pläne, Sie auf eine unserer schönen Inseln zu verheiraten? Was sagt denn überhaupt Ihr Vater zu Ihren Auswanderungsplänen?«
Über dieses Thema wollte Nora nun überhaupt nicht reden. Stattdessen versuchte sie es noch mal mit der Erkundung von Alternativen.
»Wie ist es denn mit Kaufleuten auf den Inseln?«, fragte sie. »Gibt es keine … hm … Zwischenhändler oder so was, die …«
Lady Wentworth winkte ab. »Nicht in nennenswerter Anzahl, Kind. Ein paar Kapitäne importieren wohl auf eigene Faust, aber sonst verhandeln wir stets direkt mit dem Mutterland.«
Was weiter keine Schwierigkeit darstellte, da die meisten Pflanzer ohnehin einen oder mehrere Wohnsitze in England unterhielten. Den Wentworths gehörte zum Beispiel nicht nur dieses noble Stadthaus, sondern auch noch ein Landhaus in Essex. Bei größeren Familien hielt sich praktisch immer ein männliches Mitglied im Mutterland auf und konnte die Verhandlungen mit den Händlern führen. Wenn das Kartell nicht gleich für alle verbindliche Preisabsprachen traf.
Nora biss sich auf die Lippen. Die Lady hatte Recht, im Zuckerrohrbereich wurde kein Handelshaus auf Jamaika oder Barbados gebraucht.
»Natürlich gibt es ein paar Kaufleute«, fügte Lady Wentworth schließlich hinzu. »Besonders auf den größeren Inseln, in den Städten. Unsereins deckt sich natürlich im Mutterland mit den wichtigsten Gütern ein …«, mit einer knappen Bewegung umriss sie das wertvolle Mobiliar ihres Hauses, dem die Einrichtung ihrer Plantage sicher in nichts nachstand, die Gemälde an den Wänden und nicht zuletzt ihr prächtiges Hauskleid, dessen voluminöse Rüschen sich über die Armlehnen ihres Sessels bauschten, »… aber es gibt natürlich auch auf den Inseln Schneider, Bäcker, Krämer …« Lady Wentworth’ Ausdruck verriet, was sie von dieser Bevölkerungsschicht hielt. »Natürlich nicht vergleichbar mit einem Handelshaus wie dem Ihres Herrn Vaters!«, beeilte sie sich rasch hinzuzufügen.
Nora unterdrückte ein Seufzen. Schlechte Aussichten für sie und Simon – zumal sich ihr Liebster auch sicher nicht zum Bäcker, Schneider oder umtriebigen Besitzer eines Kramladens eignete. Nora selbst hätte sich notfalls vorstellen können, hinter einer Theke zu stehen und mit den Frauen von Kingston oder Bridgetown zu plaudern, während sie ihre Waren präsentierte. Aber der scheue, überaus korrekte Simon? Schon bei der ersten wirklich saftigen Klatschgeschichte würde er sich indigniert zurückziehen.
Simon betrat aufatmend das altehrwürdige Kontor des Thomas Reed am Nordufer der Themse. Es war ziemlich düster, besonders die Räume der Schreiber und Sekretäre waren klein und die Schreibpulte kaum beleuchtet. Den älteren Angestellten fiel es oft schwer, die Zahlen in den Geschäftsbüchern zu entziffern. Lediglich in Thomas Reeds Privatkontor, das bequeme Sitzgelegenheiten für Besucher und Kunden bereithielt, gab es hohe Fenster, die den Blick über den Fluss freigaben. Auch an diesem Tag schien Reed jemanden zu empfangen. Simon vernahm die dröhnende Stimme des Kaufmanns und eine nicht minder laute mit schottischem Akzent, als er sich im Korridor vor dem Kontor aus seinem Mantel quälte.
»Gott, Reed, nun kommen Sie mir doch nicht mit moralischen Bedenken! Bei uns geht es moderat zu, auf anderen Inseln sind die Gesetze viel strenger. Die Dänen erlauben sogar, dass man widerspenstige Neger lebendig verbrennt! So was ist natürlich nicht die Art aufrechter Briten. Aber Disziplin muss sein. Dann lässt es sich auf Barbados auch als Sklave aushalten.« Der Sprecher lachte. »Ich muss es wissen, ich war schließlich selbst mal einer.«
Simon runzelte die Stirn. Das klang interessant. Von weißen Sklaven auf den Inseln hatte er nie gehört. Und den Besucher identifizierte er inzwischen auch mithilfe seines Wappens, das etwas aufdringlich eine im Korridor abgestellte Tasche zierte: Angus McArrow – seit Neuestem obendrein Lord of Fennyloch. Simon erinnerte sich, dass Thomas Reed beim Kauf seines Parlamentssitzes vermittelt hatte. Nun schien sich der Schotte, der eine Plantage auf Barbados sein Eigen nannte, zu revanchieren. Die Tasche enthielt ein paar Flaschen besten dunklen Rums, und die Stimmen der Männer hörten sich an, als hätten sie eine davon bereits geöffnet.
»Kann ich da jetzt wohl reingehen?«, fragte Simon nervös einen der älteren Bürodiener. Er musste schließlich seinen Brief abgeben.
Der Mann nickte ihm gelassen zu. »Hört sich nicht an, als tauschten sie Geheimnisse aus«, brummte er.
Simon klopfte vorsichtig, was sein Dienstherr und dessen Besucher vorerst überhörten, weil Reed gerade schallend lachte.
»Sie, McArrow? Sklave auf den Zuckerrohrfeldern? Unter lauter schwarzen Jungs?« Es klang ungläubig.
»Wenn ich’s Ihnen doch sage!«
Simon hörte Gläserklirren. Anscheinend hatten sie sich nochmals nachgeschenkt.
»Nannte man damals natürlich nicht so, da sprach man eher von Fronarbeitern. Und unter Negern war man auch nicht, die kamen erst später. Aber es lief aufs Gleiche hinaus: Ich schuftete mich fünf Jahre krumm für einen der ersten Pflanzer, und dafür erhielt ich am Ende ein Stück Land. Das haben damals viele so gemacht, bevor man in großem Stil Schwarze auf die Inseln holte. Glauben Sie mir, so mancher heutige Zuckerbaron begann als armer Schlucker. Die meisten geben es bloß nicht mehr zu, erst recht nicht ihre Nachkommen, die meisten Lohnsklaven wurden schließlich nicht alt. Die Zeit der Fron war hart, und auf den eigenen Feldern ging’s ja dann so weiter. Da haben’s viele nur gerade noch ein paar Jahre gemacht, bis das Zuckerrohr wuchs und die Kinder groß waren. Dann waren sie fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes totgeschuftet. Aber die Enkel gebärden sich jetzt wie die Könige!«
»Das ist interessant«, meinte Reed. »Wusste ich gar nicht … Einen Moment, bitte. Herein!«
Simons drittes Klopfen fand endlich Gehör. Der junge Mann schob sich schüchtern in den Raum und verbeugte sich vor Mr. Reed und Angus McArrow.
»Mylord …«, sagte er beflissen.
In McArrows breitem rotem Gesicht ging ein Strahlen auf.
»Tag, junger Mann! Simon … Greenirgendwas, oder? Sie haben meine Antrittsrede bei Hofe formuliert, richtig? Trefflich, trefflich, junger Mann! Kommen Sie, nehmen Sie sich auch einen Schluck! Sie sehen aus, als könnten Sie’s brauchen. Was haben Sie gemacht, waren Sie schwimmen?« Er lachte über seinen eigenen Scherz.
Simons Haar war immer noch nass, und die schlaff herabhängenden Rüschen seiner am Morgen so sorglich geplätteten Hemdbrust boten ein Bild des Jammers.
»Sie waren bei Roundbottom, Mr. Simon, nicht?«, erinnerte sich Thomas Reed an seinen Auftrag. »Aber Himmel, sind Sie denn gelaufen, bei dem Wetter? Junge, da konnten Sie doch eine Droschke nehmen!«
Thomas Reed, ein großer, schwerer Mann mit erstaunlich sensiblen Gesichtszügen, schenkte seinem jungen Sekretär einen gleichermaßen mitleidigen wie missbilligenden Blick. Simon erschien ihm manchmal etwas lebensuntüchtig – wohlerzogen, ja, und ein vorzüglicher Schreiber und Buchhalter. Aber sonst … Allein, wie er herumlief, er konnte sich wirklich einmal neue Kleidung leisten! Und bei Regen eine Droschke. Das sah ja aus, als würde Reed seine Leute nicht ordentlich bezahlen!
Simon senkte den Blick vor dem unwilligen Aufblitzen in Reeds grünen Augen. Sie wirkten so wach wie die seiner Tochter Nora, aber eher forschend als sanft, und Lachfältchen umgaben sie auch nicht. Nora würde später sicher Lachfalten entwickeln …
Simon lächelte verträumt, als er daran dachte, wie es sein würde, sie beim Älterwerden zu beobachten. Irgendwann würden sich auch in ihr bernsteingoldenes Haar weiße Fäden einschleichen, wie jetzt schon in den üppigen Schopf ihres Vaters. Simon würde sie necken, dass sie ihr Haar jetzt nicht mehr pudern müsste. Und er würde sie immer noch lieben …
»Was starren Sie denn so, Simon? Sie haben doch den Antwortbrief von Mr. Roundbottom, oder? Worauf warten Sie noch? Geben Sie her!« Thomas Reed hielt fordernd die Hand auf.
»Nehmen Sie erst mal einen Schluck!«, begütigte McArrow und reichte Simon zu dessen Schrecken wirklich ein Glas, gefüllt mit einer betörend duftenden bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Rum aus Barbados – zweifellos vorzüglich. Aber Simon konnte nicht wie ein Gleichgestellter mit Thomas Reed trinken! Noch dazu während der Arbeitszeit. Er zögerte und nestelte erst mal das Schreiben des Kaufmanns Roundbottom hervor. Er hatte es in der innersten Tasche seines Rocks aufbewahrt, um es nur ja vor dem Regen zu schützen.
»Nun tun Sie ihm schon den Gefallen!«
Thomas Reed nahm den Brief entgegen und löste Simons Dilemma mit einer leichten Kopfbewegung in Richtung McArrow und des Glases, das er Simon hinhielt. Natürlich gehörte es sich nicht, seinem Schreiber einen Drink anzubieten, aber er wollte den Schotten nicht verärgern. Simon nahm einen kleinen Schluck. Er fühlte wohlige Wärme seinen Körper durchdringen, als das starke, fast etwas süßlich schmeckende Getränk seine Kehle herunterrann. Sehr gehaltvoll, sehr gut und weicher im Geschmack, als Rum es gewöhnlich war.
»Ginge fast als Brandy durch, was?«, fragte McArrow Beifall heischend. »Von meiner Plantage. Ein spezielles Brennverfahren, wir …«
»Jetzt erzählen Sie aber erst mal weiter von Ihrer seltsamen Art des Landerwerbs, McArrow«, unterbrach Reed. Sehr zur Freude Simons, der die »Versklavung« des Schotten auch wesentlich interessanter fand als die Herstellung von Rum. »Wird das heute noch gemacht? Also das mit dieser …«
»Lohnknechtschaft?«, fragte McArrow und griff erneut nach seinem eigenen Glas. »Nun, da gibt’s nicht mehr viel zu erzählen. Es lief meist ganz ordentlich, die Pflanzer waren ja keine schlechten Kerle. Natürlich nahmen sie, was sie kriegen konnten. Ein Zuckerschlecken war das nicht, diese fünf Jahre auf der Plantage. Wobei ich Glück hatte. Nach drei Jahren kamen die ersten Neger, die durfte ich dann anlernen und beaufsichtigen. Keine gar so schwere Arbeit wie am Anfang also. Und mit meinem Herrn hatte ich auch Glück, der hat mir gutes Land abgetreten und noch zwei Sklaven, und meine Ernte konnte ich zusammen mit seiner vermarkten. Nur am Anfang natürlich, inzwischen hab ich mehr Land als er – oder eher seine Söhne. Die taugen leider nicht viel, deshalb musste ich jetzt auch einspringen mit dem Sitz im Parlament. Die jungen Drews führen das Lebenswerk des Vaters noch in den Bankrott …«
»Und gibt es das heute noch?«
Simon platzte mit der gleichen Frage heraus, die Reed eben schon gestellt hatte. Er biss sich gleich darauf auf die Lippen. An sich gehörte es sich nicht einmal für ihn, bei diesem vertrauten Gespräch der Geschäftspartner dabei zu sein, geschweige denn, sich daran zu beteiligen. Aber Reed lauschte genauso interessiert wie sein Schreiber, als McArrow jetzt antwortete.
»Das gibt’s heute kaum noch«, meinte er. »Schon weil keiner Interesse hat, dass noch mehr Plantagen entstehen. Wenn das Angebot zu groß wird, sinken die Preise – sorry, Mr. Reed, aber das wollen wir Pflanzer natürlich eher verhindern. Vereinzelt hört man noch von solchen Arrangements, aber dann erwarten die Herren mindestens sieben Jahre Verpflichtung – und ziehen die Leute oft noch am Ende über den Tisch. Nein, nein, das hat sich erledigt, als die Neger kamen. Wobei wir wieder beim Thema wären: Die haben’s gar nicht schlecht bei uns, die schuften nicht mehr als wir damals.«
Nur dass sie ihr ganzes Leben schuften und nichts haben, das ihnen nach fünf oder sieben Jahren gehört, dachte Simon und biss sich auf die Lippen. Er hätte noch eine dringende Frage gehabt, aber Reed hatte den Antwortbrief bereits kurz abgezeichnet und hielt ihn Simon nun hin. Eine klare Aufforderung zu gehen. Der Brief musste abgeheftet, der darin zugesagte Vertrag aufgesetzt werden.
Simon bedankte sich bei McArrow für den Rum und verließ den Raum, um seinen Platz am Schreibpult im Nachbarkontor wieder einzunehmen. Allerdings horchte er auf die Stimmen im Nebenzimmer und schlich sich auf den Korridor, als der Schotte sich schließlich verabschiedete.
»Mr. McArrow … äh … Mylord … Dürfte ich … Dürfte ich Ihnen noch eine Frage stellen?«
»Auch zehn, junger Mann!« McArrow lachte jovial. »Fragen Sie ruhig, ich hab Zeit. Vor morgen hab ich keine weiteren Besprechungen.«
Simon fasste Mut. »Wenn man es … Also, wenn ein junger Mann es auf den Inseln, irgendwo in Übersee … Jamaika, Barbados … Also, wenn man es da zu etwas bringen will … Gibt’s … gibt’s da gar keine Aussichten?«
McArrow musterte den jungen Mann forschend und verzog sein Gesicht dann erneut zu einem Grinsen. »Sie sind den Regen leid, ja?«, fragte er verständnisvoll. »Kann ich verstehen, mir reicht’s auch schon wieder. Aber die Inseln … Tja, natürlich können Sie sich auf einer der Plantagen verdingen. Inzwischen nehmen wir die Weißen nicht mehr als Feldarbeiter, allerdings brauchen wir Aufseher. Ob Sie da jedoch der Richtige wären? So ’n Bürschchen wie Sie … Sie seh’n ja aus, als ob Sie jeder kleine Windhauch schon umwerfen würde!«
Simon errötete. Er war nie ein sehr kräftiger Mann gewesen, aber die letzten Monate hatten ihn zusätzlich abmagern lassen. Er aß zu wenig, und der hartnäckige Husten zehrte ebenfalls an seinen Kräften. Aber wenn er erst mal im Warmen wäre … Und bestimmt stellten die Pflanzer ihren Aufsehern eine Unterkunft. Das Geld, das er jetzt für das verwanzte Zimmer im Eastend ausgab, konnte er in Lebensmittel investieren.
»Das … äh … täuscht, Mylord!«, erklärte er fest. »Ich kann arbeiten, ich …«
»Du siehst aber nicht aus, Junge, als könntest du die Peitsche schwingen!« Simon fuhr zusammen, nicht nur ob der Worte des anderen, sondern auch über das plötzliche Du. Aber er begriff, dass er als Arbeiter auf einer Plantage nicht darauf bestehen konnte, wie ein Gentleman behandelt zu werden. »Und das musst du bei den Negern«, sprach McArrow ungerührt weiter. »Wenn’s ganz hart kommt, musst du vielleicht sogar mal einen hängen. Und das schaffst du nicht, Kleiner!«
McArrow wollte seinen Worten wohl die Schärfe nehmen, indem er Simon jovial auf die Schulter klopfte, aber der junge Adlige sah ihn nur verwirrt an. Peitschen? Hängen? Das klang ja wie die Arbeit eines Scharfrichters!
»Nein, wenn überhaupt, dann wärst du höchstens was für die Verwaltung. Aber die Posten bei der Krone gibt’s nicht umsonst, da musst du dich einkaufen oder wenigstens jemanden kennen, der jemanden kennt …« McArrow schüttelte den Kopf, als er Simons enttäuschtes Gesicht sah. »Kannst es natürlich auch als Matrose versuchen«, meinte er schließlich. »Aber da seh ich genauso schwarz, die wollen starke, harte Kerle, kein Jüngelchen wie dich. Nee, bleib du schön hier, Kleiner, und schreib deine Rechnungen. Und vielleicht noch mal ’ne Rede für den alten McArrow! Die war trefflich, Junge … fast als wärst du selbst ’n Peer!«
Damit griff der Pflanzer nach seinem Dreispitz, dachte aber rechtzeitig daran, ihn nicht auf seine voluminöse Perücke zu setzen, sondern stilvoll unter den Arm zu klemmen, bevor er in den Regen hinaustrat. Die Kutsche mit seinem Wappen wartete schon. Der frischgebackene Lord würde nicht nass werden.
KAPITEL 3
Es hilft alles nichts, wir müssen es Vater erzählen!«, sagte Nora.
Es war endlich wieder ein schöner Tag, fast noch sommerlich, obwohl die Blätter im St. James’ Park sich schon herbstlich verfärbten. Allerdings wurde es jetzt gegen Abend, nachdem Simon das Kontor verlassen hatte, um sich erneut heimlich mit seiner Liebsten zu treffen, schon wieder kühl. Und dämmerig. Nora hätte die beiden Damen aus ihrer Bekanntschaft, die ihnen auf dem eher abgelegenen Weg eifrig plaudernd entgegenkamen, fast zu spät erkannt. Sie zerrte Simon gerade noch rechtzeitig hinter eine Hecke, bevor Lady Pentwood und ihre Freundin ihrer ansichtig wurden.
Nora kicherte, als sie vorbei waren, aber Simon machte sich Sorgen. Er sah kein Abenteuer in ihrer heimlichen Liebe, sondern bestenfalls eine Herausforderung. Unglücklich berichtete er Nora von seinem entmutigenden Gespräch mit McArrow. Die überraschte das nicht sonderlich. Sie fügte hinzu, was sie von Lady Wentworth erfahren hatte.
»Dieser McArrow hat Recht«, meinte sie dann fröstelnd. Ein guter Grund, sich enger an Simon zu schmiegen, der schützend den Arm um sie gelegt hatte und sich immer wieder zu ihr herabbeugte, um ihr Haar zu küssen. »Natürlich kannst du keine Neger schlagen! Wäre ja noch schöner, was sind das bloß alles für Leute, die sich da Lords und Ladys und Gentlemen nennen! Ich glaube nicht, dass Gott die Neger gemacht hat, damit sie für uns Zuckerrohr anbauen. Dann hätte er sie ja auch gleich auf die Inseln geschickt, und man müsste sie nicht aus Afrika holen! Auf den Schiffen soll es auch ganz schlimm sein, sagt mein Vater. Sie ketten sie an!«
Thomas Reed beteiligte sich nicht am Sklavenhandel – auch wenn er indirekt natürlich von der Arbeit der Schwarzen profitierte. Schließlich handelte er mit Zucker, Tabak und anderen Erzeugnissen aus den Kolonien, und ohne Sklaven wurde dort keine Plantage betrieben. Aber Menschen kaufen und verkaufen, sie einfangen, in Schiffsrümpfe zwingen, einkerkern und schlagen, obwohl sie nie ein Gericht verurteilt hatte – Thomas Reed hielt das nicht für vereinbar mit seinem christlichen Glauben. Egal, ob andere diese Meinung teilten oder nicht.
»Aber andere Arbeit gibt es nicht«, meinte Simon mutlos, woraufhin Nora die »Beichte« bei ihrem Vater wieder ins Gespräch brachte.
»Wir müssen Papa sagen, dass wir uns lieben. Du musst offen um mich werben, und dann finden wir schon eine Lösung. Ich bin überzeugt, dass Vater etwas einfällt. Wenn ich sage, ich will in die Kolonien, dann schafft er das auch!«
Nora hegte vollstes Vertrauen nicht nur zu den Möglichkeiten, sondern auch zur Bereitschaft ihres Vaters, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Sie war zweifellos ein verwöhntes Kind. Nach dem frühen Tod seiner Frau hatte Thomas Reed all seine Liebe auf sie konzentriert.
»Pass auf, wir machen es gleich morgen! Du kaufst ein paar Blumen … Die sind gar nicht so teuer an der Cheapside, und wenn du das Geld nicht hast …«
Simon lächelte zärtlich. Immerhin war Nora praktisch veranlagt. Wenn er sich Romantik nicht leisten konnte, so wusste sie klaglos darauf zu verzichten. Sie wäre glatt noch imstande gewesen, ihren Brautstrauß selbst zu pflücken. Er zog sie noch einmal näher an sich.
»Liebes, an ein paar Blumen soll es nicht scheitern. Aber lass mir noch ein paar Wochen, ja? Vielleicht findet sich doch noch eine Möglichkeit … Dieser McArrow zum Beispiel. Wenn der auf die Idee kommt, jetzt in London zu bleiben und im Parlament mitzureden, braucht er vielleicht einen Privatsekretär. Und als solchen nähme er mich mit nach Barbados … Außerdem ist in zwei Monaten wenigstens dieser leidige Kredit für Samanthas Hochzeit abgezahlt. Dann bleibt mir etwas mehr Geld jeden Monat. Himmel, Nora, ich kann nicht in diesem fadenscheinigen Anzug vor deinen Vater treten und um dich werben!«
Nora küsste ihn lachend. »Liebster, ich heirate doch nicht dein Jackett und deine Hose!«
Simon seufzte. Zu der Bemerkung würde Thomas Reed zweifellos einiges zu sagen haben. Aber immerhin war es ihm gelungen, Noras Ansinnen etwas aufzuschieben. Irgendwann musste einfach ein Wunder geschehen … Simon nahm Noras Hand und zog sie zu dem kleinen See inmitten des Parks, über dem schon Nebelschwaden waberten. Die Bäume warfen lange Schatten.
»Ich werde uns jetzt ein Boot mieten!«, beschloss er. »Dafür muss ein Penny da sein, und dann rudere ich dich über den See zu den Inseln. Wir können uns vorstellen, es wäre unsere Insel in der Südsee, die Wellen brechen sich am Strand …«
»Und wir können uns in aller Ruhe küssen!«, strahlte Nora. »Das ist eine wundervolle Idee, Liebster! Du kannst doch rudern, nicht? Alle Lords und Viscounts können rudern, oder?«
Wenn er ehrlich sein sollte, so beschränkten sich Simons Paddelkünste auf ein paar halbherzige Versuche, ein selbst gebautes Floß über den Dorfteich von Greenborough zu steuern. Korrekte Rudertechnik hatte er nie gelernt, aber er gab sich alle Mühe, seine Barke halbwegs geschickt über den See zu lavieren. So brachte Simon sie denn auch nicht zum Kentern, aber sein Husten, den er bei der Anstrengung kaum zu unterdrücken vermochte, beunruhigte Nora sehr.
In den nächsten Wochen wurde für die Liebenden natürlich nichts besser. Im Gegenteil, der Spätsommer wich einem ungemütlichen Herbst, und Simon fror in seinem feuchten, ungeheizten Zimmer bis ins Mark. Immerhin brannten stets großzügige Feuer in den Kaminen von Thomas Reeds Kontor, was nicht selbstverständlich war. So mancher Schreiber in den großen Handelshäusern führte die Feder mit klammen, behandschuhten Fingern und holte sich dabei die Gicht. Simon sandte aufatmend das letzte Geld für Samanthas Mitgift an seine Mutter, aber letztlich brachte ihm das keine Erleichterung. Fast zeitgleich erreichte ihn nämlich ein Brief aus Greenborough, in dem seine Mutter beglückt von Samanthas Schwangerschaft berichtete. Bis zur Geburt des Kindes, so hoffte sie, würde sie mit Simons weiteren großzügigen Zuwendungen den Silberleuchter auslösen können, der bislang die Taufkerze eines jeden Greenborough-Abkömmlings getragen habe.
Simon sandte also weiter Geld – obwohl Nora ihn streng dafür rügte.
»Aber sie haben das Recht darauf, es ist ein Familienerbstück«, verteidigte er seine Mutter und Schwester. »Und damit wird es doch auch uns zugute kommen. Wenn wir Kinder haben …«
Seine dunklen Augen, die bislang eher hoffnungslos in diesen grauen, windigen Novembertag geblickt hatten, leuchteten auf.
Nora seufzte und zog ihren Mantel enger um sich. Sie hatte ihren Liebsten trotz des unsicheren Wetters an die Docks von London begleitet. Thomas Reed hatte seinen jungen Schreiber mit der Kontrolle einer Ladung Tabak aus Virginia betraut. Der Kapitän des Schiffes galt als wenig zuverlässig, sodass der Pflanzer Reed ausdrücklich ans Herz gelegt hatte, die tatsächliche Lieferung sorglich mit den Frachtpapieren zu vergleichen. Simon hatte das eben gewissenhaft getan, auch wenn sein alter Mantel ihn dabei kaum vor Regen und Wind geschützt hatte. Nora in ihrem pelzgefütterten Cape ging es da besser, aber sie bemerkte natürlich, wie Simon fror, und erregte sich insofern noch heftiger über die Ansprüche seiner Mutter und Schwester.
»Wenn wir Kinder haben, dann kommen die wahrscheinlich auf den Jungferninseln zur Welt, oder auf Jamaika oder Barbados!«, gab sie zu bedenken. »Und da glaubst du doch nicht wirklich, deine Mutter würde rechtzeitig ihren Silberleuchter auf den Weg schicken, damit die Taufkerze standesgemäß präsentiert wird! O nein, Simon, das Ding geht in die Familie der wunderbaren Samantha über, damit die Carringtons auch ja nicht schlecht über Lady Greenborough denken. Und du lebst in einem Loch ohne Heizung und kannst dir nicht mal einen Mantel leisten, der nicht nach drei Minuten durchnässt ist! Schlimm genug, dass du für die Schulden deines Vaters geradestehst!«
Auch dafür brachte Nora wenig Verständnis auf, zumal Lord Greenboroughs Schuldner keineswegs Ehrenmänner waren, sondern ziemlich üble Buchmacher und Spieler. Nora riet ihrem Liebsten bedenkenlos, sie zwei Monate hinzuhalten und sich dann mit dem gesparten Geld in eine der Kolonien abzusetzen. Die Gauner mochten in England einen gewissen Einfluss haben – wobei Nora überzeugt war, dass auch der sich weitgehend auf London beschränkte –, aber bis nach Barbados oder Virginia reichte er sicher nicht. Simon betrachtete Spielschulden jedoch als Ehrenschulden – und überhaupt entzog sich ein Gentleman nicht seinen Pflichten gegenüber Stand und Familie. Noras sich häufig wiederholende Bemerkungen zu dieser Angelegenheit ließ er unkommentiert.
»Auf jeden Fall musst du jetzt mit Papa reden!«, entschied die junge Frau schließlich, während sie sich bei Simon unterhakte und ihn damit unauffällig zu ihrer Kutsche manövrierte. Auf dem Hinweg war er wieder gelaufen, um die Kosten für eine Droschke zu sparen.
Peppers, ihr geduldiger Kutscher, hielt den beiden wortlos den Schlag auf.
»Vielen Dank, Peppers!« Nora vergaß nie, dem Diener ein Lächeln zu schenken. Sicher auch dies ein Grund, dass ihr Hauspersonal die heimliche Liebe immer noch deckte. »Papa findet eine Lösung. Und er mag dich. Er vertraut dir. Das sieht man doch schon daran, dass er dich die Ladungen kontrollieren lässt und all diese Dinge. Wer weiß, vielleicht ahnt er auch schon was. Du musst jetzt nur unbedingt förmlich um meine Hand anhalten. Sonst können wir uns im Winter ja auch kaum noch sehen.«
Simon nickte ergeben. Mit Letzterem hatte sie Recht, aber dennoch fürchtete er sich bis ins Mark vor der Unterredung mit ihrem Vater. Wenn es nicht so gut ausging, wie Nora hoffte, verlor er damit schließlich nicht nur seine Liebste, sondern womöglich auch seine Anstellung und den warmen Platz im Kontor. Einen vergleichbar guten Arbeitgeber würde er kaum wieder finden – Thomas Reed hatte ihn nicht einmal gerügt, als er Anfang des Monats zwei Tage gefehlt hatte. Simon versuchte, seine hartnäckige Erkältung zu ignorieren, aber zu dieser Zeit war er so fiebrig gewesen, dass er kaum aus dem Bett kam. Natürlich schleppte er sich trotzdem ins Kontor, aber Reed schickte ihn umgehend wieder nach Hause.
»So sind Sie doch zu nichts nütze, Junge, Sie können ja kaum die Feder halten, und ich möchte nicht wissen, was für Zahlen Sie da eben addiert haben.«
Simon wusste diese ungeheure Großzügigkeit zu schätzen – Reed hätte ihn ebenso gut hinauswerfen und eventuelle Verluste durch seine Fehler vom Lohn abziehen können. So große Unterschiede bestanden nicht zwischen Lohnsklaverei auf den Inseln und einer ganz normalen Anstellung in London. Jetzt ahnte er jedoch, dass Nora sich nicht länger würde hinhalten lassen. Sie hielt die Zustimmung ihres Vaters zu ihrer Verlobung offensichtlich für eine beschlossene Sache.
»Nächste Woche, Simon! An diesem Samstag ist der große Ball der Kaufmannsvereinigung, da ist Papa abgelenkt – und ich muss auch noch das Kleid anprobieren und Frisuren besprechen … Und dann dieser Tanzunterricht, wer braucht schon die Bourgogne in den Kolonien?«
Nora tat stets so, als interessiere sie sich nicht für die Bälle und Empfänge, zu denen sie ihren Vater begleitete, weil Simon selbst natürlich nie geladen war. Aber im Grunde freute sie sich darauf. Sie liebte schöne Kleider und übte sich gern in den modischen Tänzen. Allerdings verzichtete sie auf jeden Flirt und jede Tändelei mit den jungen Männern, die ihre Tanzkarte füllten. Nora Reed hatte ihre Wahl getroffen – aber sie fieberte dem Tag entgegen, an dem Simon Greenborough sie zum ersten Mal durch ein Menuett führen würde. Und wer konnte es wissen, vielleicht tanzten sie ja übers Jahr schon unter Palmen! In London erzählte man sich von rauschenden Festen in den Residenzen der Zuckerrohrpflanzer auf den Inseln im Karibischen Meer.
»Aber in der nächsten Woche steht weiter nichts an, da haben wir dann auch Zeit, die Verlobung zu planen – mein Vater gibt bestimmt ein Fest! Und du musst über deinen Schatten springen und dir neue Sachen kaufen! Pass auf, wenn du erst mal den richtigen Leuten vorgestellt worden bist, findet sich auch ein Posten in den Kolonien! Oh, stell dir nur vor, Simon! Einmal aus dem Fenster sehen und nicht in strömenden Regen gucken, sondern in strahlenden Sonnenschein!«
Nora schmiegte sich an ihren Liebsten, sein wild pochendes Herz hielt sie für eine Freudenbekundung. Ein Scheitern seiner Werbung war unmöglich. Nora genoss den Ball der Kaufmannsvereinigung, während Simon versuchte, an seinem freien Sonntag seinen Husten auszukurieren. Er erstand Kamillenblüten und wenigstens so viel Brennholz, um Tee kochen und seinen zugigen Raum halbwegs beheizen zu können. Seine bärbeißige Vermieterin, Mrs. Paddington, kommentierte das mit boshaftem Spott.
»Na, ist der Wohlstand ausgebrochen bei Mylord? Muss ich Euch womöglich bald wieder mit Eurem Titel anreden?«
Simon sparte sich die Bemerkung, dass sich dies ohnehin gehört hätte, egal ob arm oder reich. Mal ganz abgesehen davon, dass Mrs. Paddington es eigentlich immer tat. Allerdings klang ihr Mylord oder Viscount Greenborough eher wie eine Beleidigung als wie ein Ehrentitel. Die Frau fand offensichtlich größte Genugtuung bei der Feststellung, dass ein Mitglied des Adels in die Niederungen ihres schmutzigen, nach dem großen Feuer von London nur billig und hässlich wieder aufgebauten Viertels absteigen konnte.
Simon zerrte seine Bettstatt schließlich so nah wie möglich an den Kamin und verbrachte den Sonntag unter seinen kratzigen, klammen Decken. Sehr viel Besserung brachte das nicht, der Kamin war lange nicht befeuert worden und noch länger nicht gekehrt. Er zog schlecht, und Simon hatte insofern die Wahl zwischen Kälte und Qualm. Letztlich entschloss er sich wieder für Erstere. Der Rauch verschlimmerte den Husten zudem, und die Kälte war wenigstens umsonst.
Nora entschloss sich schließlich für den Dienstag als Tag ihrer offiziellen Verlobung. Simon sollte ihrem Vater gleich nach der Arbeit im Kontor seine Aufwartung machen. Thomas Reed würde es sich dann schon zu Hause gemütlich gemacht haben, er ging meist vor seinen Schreibern, die oft noch bei Kerzenlicht die letzten Bücher in Ordnung brachten.
Simon zögerte den Aufbruch denn auch so lange hinaus wie eben möglich. Reed sollte auf keinen Fall denken, er zöge sich früh aus dem Kontor zurück oder drücke sich gerade an diesem Tag um die Arbeit. Aber schließlich ging auch der letzte Bürodiener, nachdem er das Kontor gefegt, die Federn angespitzt und die Tintenfässer für den nächsten Arbeitstag gefüllt hatte. Dem jungen Mann oblag es auch, die Feuer in den Kaminen und die Kerzen zu löschen, wenn der letzte Schreiber fertig war. Simon konnte ihn unmöglich noch länger warten lassen, indem er wichtige Arbeiten vortäuschte.
Zum Glück regnete es an diesem Tag nicht, sodass Simon den Weg nach Mayfair zu Fuß zurücklegen konnte. Er hätte sich sonst eine Droschke gegönnt – nicht auszudenken, dass er mit nassem, verknittertem Jabot vor seinen künftigen Schwiegervater trat. Das gesparte Geld hatte der junge Mann in einen Blumenstrauß für Nora investiert, der sich wirklich sehen lassen konnte – und dennoch verließ ihn fast der Mut, als er schließlich vor dem hochherrschaftlichen Haus in dem erst kurze Zeit zuvor erschlossenen Stadtteil Mayfair stand. Reed hatte das Herrenhaus vor wenigen Jahren bauen lassen. Seine Fassade war durch Pilaster in drei Teile gegliedert, der Dreiecksgiebel erinnerte an einen römischen Tempel, und dahinter erstreckte sich ein kleiner Park. All das war viel prächtiger, als Greenborough Manor je gewesen war.
Selbst in den besten Zeiten seiner Familie wäre Simon kein würdiger Bewerber um die Hand der Tochter dieses Hauses gewesen. Schließlich nahm er sich jedoch zusammen und betätigte den Türklopfer. Die Haustür wurde fast sofort geöffnet. Das zierliche junge Mädchen in der adretten Dienstbotenuniform schien nur auf ihn gewartet zu haben. Es blinzelte ihn verschwörerisch an, als er seinen Namen sagte und um eine Unterredung mit dem Hausherrn bat. Wahrscheinlich eine weitere »Vertraute« unter den Dienstboten, die Nora in ihre Liebesgeschichte eingeweiht hatte.
»Ich melde Sie dem Butler!«, erklärte die kleine Rothaarige freundlich. »Aber wenn ich Ihnen den Mantel schon mal abnehmen darf …«
Simon fand sich schließlich in einem kostbar möblierten Empfangsraum wieder und erwartete einen weiteren, diesmal höherrangigen Hausangestellten. Stattdessen erschien jedoch Nora.
»Simon!« Sie strahlte ihn an. »Du siehst gut aus! Wenn du bloß nicht so ängstlich gucken würdest!«
Simon versuchte, zurückzulächeln. Sie konnte das eigentlich nicht ernst meinen, er wusste nur zu genau, dass er blass war und in den letzten Wochen noch dünner geworden war. Aber seine Kleidung war immerhin untadelig. Er wurde immer besser in der Pflege der Spitze und Brustkrause an seinen letzten beiden Hemden, hatte selbst zu Nadel und Faden gegriffen, um Rock und Hose enger zu machen, und gestern einen Penny in Schmalz investiert, um seine abgetragenen Schnallenschuhe wieder auf Hochglanz zu polieren. Sein dunkles Haar hatte er wieder gepudert, aber diesmal nicht mit Talkum gespart. Mit ein bisschen gutem Willen konnte man die Pracht für eine der modischen Perücken halten.
»Und du siehst wunderschön aus«, gab er das Kompliment ehrlich an Nora zurück.
Sie lächelte geschmeichelt und strich den Stoff über ihrem Reifrock glatt. Zur Feier des Tages hatte sie sich für ein Kleid aus goldfarbenem Brokat entschieden, geschmückt mit unzähligen Schleifen und Bändern. Noras Haar war prachtvoll geflochten und wie immer nicht gepudert. Ihre Wangen waren vor Aufregung und freudiger Erwartung ganz rosig.
»Komm herein, Papa ist sehr gut gelaunt! Und was für schöne Blumen … Aber nein, das sage ich gleich erst! Vielleicht … vielleicht wartest du auch gerade, bis der Butler kommt …«
Im letzten Moment zeigte Nora denn doch etwas Angst vor der eigenen Courage. Sie ließ es sich allerdings nicht nehmen, Simon kurz aufmunternd auf die Wange zu küssen – und errötete ebenso wie er, als der Butler in der Tür erschien und durch ein Räuspern auf sich aufmerksam machte. Augenblicklich stob sie davon – Simon folgte ihr langsam, geführt von dem würdigen Majordomus, dessen Dienstkleidung erheblich kostbarer wirkte als Simons so mühsam gepflegter Staat als Brautwerber.
Thomas Reed hatte es sich in seinem Herrenzimmer gemütlich gemacht – etwas verwundert darüber, dass sich seine Tochter mit einer Stickerei zu ihm gesellte. Gewöhnlich mochte sie das Herrenzimmer nicht und zog stets ihr Näschen kraus, wenn sie des anheimelnden Geruchs nach Tabak, altem Leder und Rum gewahr wurde.
Nun aber saß Nora ihrem Vater gegenüber und versuchte, sich auf ein Gespräch zu konzentrieren. Zwischendurch sprang sie aber immer wieder auf, um irgendetwas zu holen oder nervös aus dem Fenster zu sehen. Jetzt, als der Butler den Besuch des Schreibers Simon Greenborough ankündigte, wirkte sie aufgeregt. Nora machte Anstalten aufzustehen, als ob sie annähme, Thomas Reed würde den Besuch in einem der förmlicheren Empfangsräume erwarten wollen. Dafür sah ihr Vater allerdings keinen Anlass, denn er erwartete offensichtlich keinen Höflichkeitsbesuch, sondern eine geschäftliche Angelegenheit. Auch wenn sich die Meldung des Butlers anders anhörte.
»Mr. Reed, Viscount Simon Greenborough wünscht, Ihnen seine Aufwartung zu machen.«
Thomas Reed lächelte. Das sah dem jungen Simon ähnlich: Immer korrekt bis zur Karikatur – wer sonst würde sich mit all seinen Titeln ankündigen lassen, um irgendeinen dringenden Brief oder eine Akte vorbeizubringen? Und dann hatte der Schreiber, der sich jetzt schüchtern, aber aufrecht hinter dem Butler ins Zimmer schob, sogar Blumen mitgebracht! Thomas fand das aufmerksam, aber übertrieben.
»Mr. Reed … Miss Nora …« Simon verbeugte sich förmlich.
»Kommen Sie rein, Simon!«, rief Thomas jovial. »Was liegt an um diese späte Stunde? Hat Morrisburg endlich geantwortet? Liefert er die Ware? Oder haben Sie was von diesem Schiff gehört, das angeblich verloren gegangen ist?«
Simon schüttelte den Kopf. Thomas Reeds Ansprache brachte ihn aus dem Konzept. Und was machte er jetzt überhaupt mit diesem Blumenstrauß?
»Was für schöne Blumen!«, brachte Nora ihren Satz an und lächelte ihm aufmunternd zu. »Für mich?«
Thomas Reed verdrehte die Augen. »Das nehme ich doch mal an, Kind, ich würde es jedenfalls befremdlich finden, wenn Mr. Greenborough mich mit floralen Zuwendungen bedenken würde. Wäre aber nicht nötig gewesen, Simon, dies ist schließlich kein Höflichkeitsbesuch, und so dicke haben Sie’s ja auch nicht …«
Simon errötete, als der Blick des Kaufmanns auf seinen abgenutzten Rock fiel.
»Doch«, brach es dann aus ihm heraus. »Also, es ist doch eher ein …«
»Nun geben Sie mir erst mal die Blumen«, lächelte Nora.
Simon brauchte Zeit, sich wieder zu fangen. Dies war natürlich sein erster Heiratsantrag, und mit dem Reden aus dem Stegreif hatte er es ohnehin nicht allzu sehr. Ihr Liebster schrieb wunderschöne Briefe, und wenn sie allein waren, sonnte Nora sich in seinen Komplimenten. Aber sonst fand sie Simon oft etwas schüchtern – vielleicht normal, wenn man so aus der Bahn geworfen worden war wie er. Sie streifte seine eiskalte Hand, während sie den Strauß entgegennahm.
Thomas Reed schaute etwas verwirrt, als er ihre Blicke bemerkte.
»Gut, Nora«, meinte er dann. »Vielleicht gehst du jetzt und lässt den Strauß in eine Vase stellen. Und wir besprechen die für dich zweifellos langweiligen Dinge, aufgrund derer Mr. Greenborough sich so spät noch auf den langen Weg gemacht hat.«
Nora errötete. »Nein, Papa«, erklärte sie dann. »Ich wollte sagen … äh … für mich ist das keineswegs langweilig, weil, es …«
»Weil ich …« Simon konnte auf keinen Fall zulassen, dass seine Liebste den Heiratsantrag einfach vorwegnahm.
Thomas Reed runzelte die Stirn. »Also, was nun, Simon? Lassen Sie mich wissen, was Sie herführt. Und was daran so erbaulich für junge Ladys sein soll. Seit wann interessierst du dich für verloren gegangene Schiffe aus Virginia?«
Noras Augen blitzten. »Schon immer! Du weißt doch, mich interessiert alles aus Übersee. Die Kolonien, die Schiffe … Simon und ich …«
»Simon und du?«, fragte Thomas Reed.