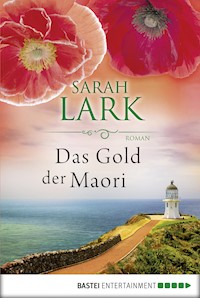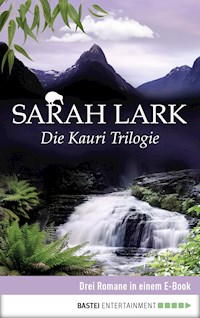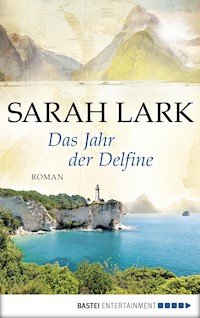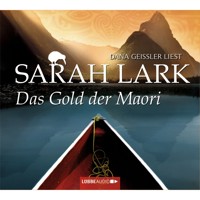9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Weiße-Wolke-Saga
- Sprache: Deutsch
London, 1852: Zwei junge Frauen treten die Reise nach Neuseeland an. Es ist der Aufbruch in ein neues Leben - als künftige Ehefrauen von Männern, die sie kaum kennen. Die adlige Gwyneira ist dem Sohn eines reichen "Schafbarons" versprochen, und die junge Gouvernante Helen wurde als Ehefrau für einen Farmer angeworben. Ihr Schicksal soll sich erfüllen in einem Land, das man ihnen als Paradies geschildert hat. Werden sie das Glück und die Liebe am anderen Ende der Welt finden? Ein fesselnder Schmöker über Liebe und Hass, Vertrauen und Feindschaft und zwei Familien, deren Schicksal untrennbar miteinander verknüpft ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1067
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Karten
AUFBRUCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SO ETWAS WIE LIEBE …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SO ETWAS WIE HASS …
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ANKUNFT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Danksagungen
Über die Autorin
Sarah Lark, geboren 1958, arbeitete lange Jahre als Reiseleiterin. Ihre Liebe für Neuseeland entdeckte sie schon früh. Seine atemberaubenden Landschaften haben sie seit jeher magisch angezogen.
Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin. Sie lebt in Spanien und arbeitet zurzeit an ihrem nächsten Roman. Unter dem Autorennamen Ricarda Jordan entführt sie ihre Leserinnen auch ins farbenprächtige Mittelalter (Die Pestärztin).
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
© 2007 by Bastei Lübbe AG, Köln
Dieses Werk wurde vermittelt durch
die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Lektorat: Wolfgang Neuhaus/Melanie Blank-Schröder
Titelgestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Shay Yacobinski/shutterstock | © Lee Avison/Trevillion Images | © Justin Foulkes/huber-images.de
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-0082-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
AUFBRUCH
London, Powys, Christchurch 1852
1
Die anglikanische Kirche in Christchurch, Neuseeland, sucht ehrbare, in Haushalt und Kindererziehung bewanderte junge Frauen, die interessiert sind, eine christliche Ehe mit wohl beleumundeten, gut situierten Mitgliedern unserer Gemeinde einzugehen.
Helens Blick blieb kurz an der unscheinbaren Anzeige auf der letzten Seite des Kirchenblättchens haften. Die Lehrerin hatte das Heftchen kurz überflogen, während ihre Schüler sich still mit einer Grammatikübung beschäftigten. Lieber hätte Helen ein Buch gelesen, doch Williams ständige Fragen rissen sie ständig aus der Konzentration. Auch jetzt wieder hob sich der braune Wuschelkopf des Elfjährigen von seiner Arbeit.
»Im dritten Absatz, Miss Davenport, heißt es da das oder dass?«
Helen schob ihre Lektüre seufzend beiseite und erklärte dem Jungen zum x-ten Mal in dieser Woche den Unterschied zwischen Relativ- und Konsekutivsatz. William, der jüngere Sohn ihres Arbeitgebers Robert Greenwood, war ein niedliches Kind, aber nicht gerade mit Geistesgaben gesegnet. Er brauchte bei jeder Aufgabe Hilfe, vergaß Helens Erklärungen schneller, als diese sie geben konnte, und verstand sich eigentlich nur darauf, rührend hilflos dreinzuschauen und Erwachsene mit süßer Knabensopranstimme zu umgarnen. Lucinda, Williams Mutter, fiel immer wieder darauf herein. Wenn der Junge sich an sie schmiegte und irgendeine kleine gemeinsame Unternehmung vorschlug, strich Lucinda regelmäßig alle Nachhilfestunden, die Helen ansetzte. Deshalb konnte William bis jetzt nicht flüssig lesen, und schon einfachste Rechtschreibübungen überforderten ihn hoffnungslos. Daran, dass der Junge ein College wie Eaton oder Oxford besuchte, wie sein Vater es sich erträumte, war nicht zu denken.
Der sechzehnjährige George, Williams älterer Bruder, machte sich gar nicht erst die Mühe, Verständnis zu heucheln. Er verdrehte vielsagend die Augen und wies auf eine Stelle im Lehrbuch, in der genau der Satz als Beispiel stand, an dem William jetzt schon seit einer halben Stunde herumtüftelte. George, ein schlaksiger, hoch aufgeschossener Junge, war mit seiner Übersetzungsaufgabe aus dem Lateinischen bereits fertig. Er arbeitete stets schnell, wenn auch nicht immer fehlerfrei; die klassischen Fächer langweilten ihn. George konnte es gar nicht erwarten, eines Tages in die Import-Export-Firma seines Vaters einzusteigen. Er träumte von Reisen in ferne Länder und Expeditionen zu den neuen Märkten in den Kolonien, die sich unter der Herrschaft der Königin Viktoria beinahe stündlich erschlossen. George war zweifellos zum Kaufmann geboren. Er bewies schon jetzt Verhandlungsgeschick und wusste seinen beträchtlichen Charme gezielt einzusetzen. Mitunter gelang es ihm, damit sogar Helen einzuwickeln und die Schulstunden zu verkürzen. Einen solchen Versuch machte er auch heute, nachdem William endlich verstanden hatte, worum es ging – oder wenigstens, wo er die Lösung abschreiben konnte. Helen griff daraufhin nach Georges Heft, um seine Arbeit zu kontrollieren, doch der Junge schob es provozierend beiseite.
»Oooch, Miss Davenport, wollen Sie das jetzt wirklich noch mal durchkauen? Der Tag ist doch viel zu schön zum Lernen! Spielen wir lieber eine Runde Krocket … Sie sollten an Ihrer Technik arbeiten. Sonst stehen Sie beim Gartenfest wieder nur herum, und keiner der jungen Herren bemerkt Sie. Dann machen Sie niemals Ihr Glück durch eine Heirat mit einem Grafen und müssen bis ans Ende Ihrer Tage hoffnungslose Fälle wie Willy unterrichten!«
Helen verdrehte die Augen, warf einen Blick aus dem Fenster und runzelte beim Anblick der dunklen Wolken die Stirn.
»Netter Einfall, George, aber es ziehen Regenwolken auf. Bis wir hier aufgeräumt haben und im Garten sind, werden sie sich genau über unseren Köpfen entleeren, und das dürfte mich kaum anziehender für adelige Herren machen. Wie kommst du eigentlich auf den Gedanken, ich hätte diesbezügliche Absichten?«
Helen versuchte, eine betont desinteressierte Miene aufzusetzen. Das konnte sie sehr gut: Wenn man als Gouvernante in Londoner Familien der Oberschicht arbeitete, lernte man als Erstes, das eigene Mienenspiel zu beherrschen. Helens Rolle bei den Greenwoods war weder die eines Familienmitglieds noch einer gewöhnlichen Angestellten. Sie nahm an den gemeinsamen Mahlzeiten und oft auch an der Freizeitgestaltung der Familie teil, hütete sich aber davor, ungefragt eigene Meinungen zu äußern oder sich anderweitig auffällig zu verhalten. Deshalb konnte auch keine Rede davon sein, dass Helen sich bei Gartenfesten unbeschwert unter die jüngeren Gäste mischte. Stattdessen hielt sie sich abseits, plauderte höflich mit den Damen und beaufsichtigte unauffällig ihre Zöglinge. Natürlich streiften ihre Blicke dabei gelegentlich die Gesichter der jüngeren männlichen Gäste, und manchmal gab sie sich einem kurzen, romantischen Tagtraum hin, in dem sie mit einem gut aussehenden Viscount oder Baronet durch den Park seines Herrenhauses spazierte. Aber das konnte George doch unmöglich bemerkt haben!
George zuckte die Schultern. »Na, immerhin lesen Sie Heiratsanzeigen!«, sagte er frech und wies mit versöhnlichem Grinsen auf das Kirchenblättchen. Helen schalt sich selbst, weil sie es offen neben ihrem Pult hatte liegen lassen. Natürlich hatte der gelangweilte George hineingesehen, während sie William auf die Sprünge geholfen hatte.
»Und Sie sind doch sehr hübsch«, schmeichelte George. »Warum sollten Sie keinen Baronet heiraten?«
Helen verdrehte die Augen. Sie wusste, dass sie George tadeln sollte, doch sie war eher belustigt. Wenn der Knabe so weitermachte, würde er es zumindest bei den Damen weit bringen, und auch in der Geschäftswelt würde man seine geschickten Schmeicheleien zu schätzen wissen. Doch ob es ihm in Eaton weiterhalf? Außerdem hielt Helen sich für immun gegen solch plumpe Komplimente. Sie wusste, dass sie nicht im klassischen Sinne schön war. Ihre Züge waren ebenmäßig, aber wenig auffällig; ihr Mund war ein bisschen zu schmal, ihre Nase zu spitz, und ihre ruhigen grauen Augen blickten ein wenig zu skeptisch und entschieden zu gelehrt in die Welt, um das Interesse eines reichen, jungen Lebemanns zu wecken. Helens schönstes Attribut war ihr hüftlanges, glattes und seidiges Haar, dessen sattes Braun leicht ins Rötliche spielte. Vielleicht hätte sie damit Aufsehen erregen können, hätte sie es offen im Wind wehen lassen, wie manche Mädchen es bei den Picknicks und Gartenfesten taten, die Helen im Gefolge der Greenwoods besuchte. Die mutigeren der jungen Ladys erklärten beim Spaziergang mit ihren Bewunderern schon mal, ihnen sei zu heiß, und nahmen den Hut ab, oder sie taten so, als wehte der Wind ihr Hütchen weg, wenn sie sich von einem jungen Mann über den See im Hydepark rudern ließen. Dann schüttelten sie ihr Haar, befreiten es wie zufällig von Bändern und Spangen und ließen die Männer die Pracht ihrer Locken bewundern.
Helen hätte sich nie dazu überwinden können. Als Tochter eines Pfarrers war sie streng erzogen und trug ihr Haar geflochten und aufgesteckt, seit sie ein kleines Mädchen war. Hinzu kam, dass sie früh hatte erwachsen werden müssen: Ihre Mutter war gestorben, als Helen zwölf war, worauf der Vater seine älteste Tochter kurzerhand mit der Führung des Haushalts und der Erziehung der drei jüngeren Geschwister beauftragt hatte. Reverend Davenport interessierte sich nicht für Probleme zwischen Küche und Kinderzimmer, ihm lagen allein die Arbeit für seine Gemeinde und die Übersetzung und Auslegung religiöser Schriften am Herzen. Helen hatte er immer nur dann mit seiner Aufmerksamkeit bedacht, wenn sie ihm dabei Gesellschaft leistete – und nur durch die Flucht in Vaters Studierzimmer unter dem Dach konnte sie dem lautstarken Treiben in der Wohnung der Familie entgehen. So hatte es sich fast von selbst ergeben, dass Helen die Bibel schon auf Griechisch las, als ihre Brüder gerade die erste Fibel durchackerten. In ihrer gestochen schönen Handschrift schrieb sie die Predigten ihres Vaters ab und kopierte seine Artikelentwürfe für das Mitteilungsblatt seiner großen Gemeinde in Liverpool. Viel Zeit für sonstige Zerstreuungen fand sich da nicht. Während Susan, Helens jüngere Schwester, Wohltätigkeitsbasare und Kirchenpicknicks hauptsächlich dazu nutzte, junge Honoratioren der Gemeinde kennen zu lernen, half Helen beim Verkauf der Waren, buk Torten und schenkte Tee aus. Das Ergebnis war vorauszusehen: Susan heiratete gleich mit siebzehn den Sohn eines bekannten Arztes, während Helen nach dem Tod ihres Vaters gezwungen war, eine Stelle als Hauslehrerin anzunehmen. Von ihrem Gehalt unterstützte sie zudem das Jura- und Medizinstudium ihrer zwei Brüder. Das Erbe ihres Vaters reichte nicht aus, den Jungen eine angemessene Ausbildung zu finanzieren, zumal beide sich keine allzu große Mühe gaben, das Studium zu einem raschen Abschluss zu bringen. Mit einem Anflug von Zorn dachte Helen daran, dass ihr Bruder Simon erst letzte Woche wieder durch eine Prüfung gerasselt war.
»Baronets heiraten normalerweise Baronessen«, antwortete sie jetzt ein wenig ungehalten auf Georges Frage. »Und was das hier angeht …«, sie wies auf das Kirchenblatt, »habe ich den Artikel gelesen, nicht die Anzeige.«
George enthielt sich einer Antwort, grinste aber vielsagend. Der Artikel handelte von Wärmeanwendung bei Arthritis. Sicher hochinteressant für die älteren Mitglieder der Gemeinde, aber Miss Davenport litt bestimmt noch nicht unter Gelenkschmerzen.
Immerhin schaute seine Lehrerin jetzt auf die Uhr und kam dabei zu dem Schluss, den Nachmittagsunterricht doch schon zu beenden. In einer knappen Stunde würde das Abendessen aufgetragen. Und wenn George auch höchstens fünf Minuten brauchte, sich fürs Essen zu kämmen und umzuziehen, und Helen kaum länger benötigte, war es bei William stets eine längere Prozedur, ihn aus dem tintenverschmierten Schulkittel in einen vorzeigbaren Anzug zu stecken. Helen dankte dem Himmel, dass sie wenigstens nicht damit gestraft war, sich um Williams Erscheinungsbild kümmern zu müssen. Das übernahm eine Kinderfrau.
Die junge Gouvernante schloss die Stunde mit allgemeinen Bemerkungen über die Wichtigkeit der Grammatik, denen beide Jungen nur mit halbem Ohr lauschten. Gleich darauf sprang William begeistert auf, ohne seine Hefte und Schulbücher eines weiteren Blickes zu würdigen.
»Ich muss schnell noch Mummy zeigen, was ich gemalt habe!«, verkündete er, womit die Arbeit des Aufräumens erfolgreich auf Helen abgewälzt war. Die konnte schließlich nicht riskieren, dass William in Tränen aufgelöst zu seiner Mutter floh und ihr von irgendwelchen himmelschreienden Ungerechtigkeiten der Lehrerin berichtete. George warf einen Blick auf Williams ungelenke Zeichnung, die seine Mutter gleich sicher mit Begeisterungsausbrüchen quittieren würde, und zuckte resigniert die Schultern. Dann packte er rasch seine Sachen zusammen, bevor auch er hinausging. Helen bemerkte, dass er ihr dabei einen fast mitleidigen Blick zuwarf. Sie ertappte sich dabei, an Georges Bemerkung von eben zu denken: »Wenn Sie keinen Mann finden, müssen Sie sich für den Rest Ihres Lebens mit hoffnungslosen Fällen wie Willy herumärgern.«
Helen griff nach dem Kirchenblättchen. Eigentlich wollte sie es wegwerfen, überlegte es sich dann aber anders. Beinahe verstohlen steckte sie es in die Tasche und nahm es mit auf ihr Zimmer.
Robert Greenwood hatte nicht viel Zeit für seine Familie, doch die gemeinsamen Abendessen mit Frau und Kindern waren ihm heilig. Die Anwesenheit der jungen Gouvernante störte ihn dabei nicht. Im Gegenteil, er fand es oft anregend, Miss Davenport ins Gespräch mit einzubeziehen und ihre Ansichten zu Fragen des Weltgeschehens, der Literatur und der Musik zu erfahren. Miss Davenport verstand deutlich mehr von diesen Dingen als seine Gattin, deren klassische Bildung zu wünschen übrig ließ. Lucindas Interessen beschränkten sich auf den Haushalt, die Vergötterung ihres jüngeren Sohnes und die Mitarbeit in den Damenkomitees diverser Wohltätigkeitsorganisationen.
Auch an diesem Abend lächelte Robert Greenwood freundlich, als Helen eintrat, und schob ihr den Stuhl zurecht, nachdem er die junge Lehrerin förmlich begrüßt hatte. Helen erwiderte das Lächeln, achtete aber darauf, Mrs. Greenwood dabei mit einzuschließen. Auf keinen Fall durfte sie den Verdacht erregen, mit ihrem Arbeitgeber zu flirten, auch wenn Robert Greenwood ein unzweifelhaft attraktiver Mann war. Er war groß und schlank, hatte ein schmales, intelligentes Gesicht und forschende braune Augen. Der braune Dreiteiler mit der goldenen Uhrkette kleidete ihn hervorragend, und seine Manieren standen denen der Gentlemen aus den Adelsfamilien, mit denen die Greenwoods gesellschaftlichen Umgang pflegten, in nichts nach. Ganz anerkannt waren sie in diesen Kreisen allerdings nicht; sie galten als Emporkömmlinge. Robert Greenwoods Vater hatte sein florierendes Unternehmen praktisch aus dem Nichts aufgebaut, und sein Sohn mehrte den Wohlstand und bemühte sich um gesellschaftliches Ansehen. Dazu hatte auch seine Heirat mit Lucinda Raiford beigetragen, die aus einer verarmten Adelsfamilie stammte – was vor allem auf die Vorliebe ihres Vaters für Glücksspiel und Pferderennen zurückzuführen war, wie man in der feinen Gesellschaft munkelte. Mit dem bürgerlichen Stand fand Lucinda sich nur widerwillig ab und neigte als Reaktion auf den gesellschaftlichen Abstieg ein wenig zum Protzen. So fielen die Empfänge und Gartenfeste der Greenwoods immer ein wenig üppiger aus als vergleichbare Ereignisse bei anderen Honoratioren der Londoner Gesellschaft. Die anderen Damen genossen das, zerrissen sich aber nichtsdestotrotz die Mäuler darüber.
Auch heute wieder, zu dem schlichten Abendessen mit der Familie, hatte Lucinda sich ein wenig zu festlich herausgeputzt. Sie trug ein elegantes Kleid aus fliederfarbener Seide, und mit ihrer Frisur musste ihre Zofe stundenlang beschäftigt gewesen sein. Lucinda plauderte über ein Treffen des Damenkomitees für das örtliche Waisenhaus, an dem sie an diesem Nachmittag teilgenommen hatte, doch viel Resonanz erhielt sie nicht; weder Helen noch Mr. Greenwood waren sonderlich interessiert.
»Und, was habt ihr mit diesem schönen Tag angefangen?«, wandte Mrs. Greenwood sich schließlich an ihre Familie. »Dich brauche ich wohl gar nicht erst zu fragen, Robert, vermutlich waren es wieder nur Geschäfte, Geschäfte, Geschäfte.« Sie bedachte ihren Mann mit einem Blick, der wohl liebevoll nachsichtig wirken sollte.
Mrs. Greenwood war der Meinung, dass ihr und ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen seitens ihres Gatten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Nun verzog er unwillig das Gesicht. Wahrscheinlich lag Robert eine unfreundliche Antwort auf der Zunge, denn seine Geschäfte ernährten nicht nur die Familie, sondern machten auch Lucindas Mitarbeit in den diversen Damenkomitees erst möglich. Helen bezweifelte jedenfalls, dass Mrs. Greenwoods überragende organisatorische Fähigkeiten für ihre Wahl gesorgt hatten – eher die Spendenfreudigkeit ihres Gatten.
»Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch mit einem Wollproduzenten aus Neuseeland, und …«, begann Robert mit Blick auf seinen ältesten Sohn, doch Lucinda sprach einfach weiter, wobei sie diesmal vor allem William mit ihrem nachsichtigen Lächeln bedachte.
»Und ihr, meine lieben Söhne? Sicher habt ihr im Garten gespielt, nicht wahr? Hast du George und Miss Davenport wieder beim Krocket geschlagen, William, mein Liebling?«
Helen starrte angestrengt auf ihren Teller, bemerkte aber aus dem Augenwinkel, wie George in seiner typischen Art gen Himmel zwinkerte, als riefe er einen verständnisvollen Engel um Beistand an. Tatsächlich war es William nur ein einziges Mal gelungen, mehr Punkte zu machen als sein älterer Bruder, und damals war George schwer erkältet gewesen. Gewöhnlich brachte sogar Helen den Ball geschickter durch die Tore als William, obwohl sie sich meist unbeholfener anstellte, als sie war, um den Kleinen gewinnen zu lassen. Mrs. Greenwood wusste das zu schätzen, während Mr. Greenwood sie tadelte, wenn er die Täuschung bemerkte.
»Der Junge muss sich daran gewöhnen, dass das Leben hart mit Versagern umspringt!«, sagte er streng. »Er muss verlieren lernen, nur dann wird er letztendlich siegen!«
Helen bezweifelte, dass William jemals siegen würde, auf welchem Gebiet auch immer, doch ihr flüchtiger Anflug von Mitleid mit dem unglücklichen Kind wurde gleich von dessen nächster Bemerkung zunichte gemacht.
»Ach, Mummy, Miss Davenport hat uns gar nicht spielen lassen!«, sagte William mit kummervoller Miene. »Wir haben den ganzen Tag im Haus gesessen und gelernt, gelernt, gelernt.«
Natürlich warf Mrs. Greenwood Helen sofort einen missbilligenden Blick zu. »Ist das wahr, Miss Davenport? Sie wissen doch, dass die Kinder frische Luft brauchen! In diesem Alter können sie noch nicht den ganzen Tag über den Büchern sitzen!«
In Helen kochte es, doch sie durfte William nicht der Lüge bezichtigen. Zu ihrer Erleichterung mischte George sich ein.
»Das stimmt doch gar nicht. William hatte wie jeden Tag seinen Spaziergang nach dem Mittagessen. Aber da hat es gerade ein bisschen geregnet, und er mochte nicht rausgehen. Die Nanny hat ihn zwar einmal um den Park gezerrt, aber zum Krocketspielen sind wir vor dem Unterricht nicht mehr gekommen.«
»Dafür hat William gemalt«, versuchte Helen abzulenken. Vielleicht kam Mrs. Greenwood ja auf seine museumsreife Zeichnung zu sprechen und vergaß den Ausgang. Doch die Rechnung ging leider nicht auf.
»Trotzdem, Miss Davenport: Wenn das Wetter mittags nicht mitspielt, müssen Sie eben nachmittags eine Pause einlegen. In den Kreisen, in denen William sich einmal bewegen wird, ist Körperertüchtigung fast ebenso wichtig wie geistige Förderung!«
William schien den Tadel für seine Lehrerin zu genießen, und Helen dachte wieder einmal an besagte Anzeige …
George schien Helens Gedanken zu lesen. Als hätte es das Gespräch mit William und seiner Mutter nicht gegeben, griff er die letzte Bemerkung seines Vaters wieder auf. Helen hatte diesen Kunstgriff schon mehrmals bei Vater und Sohn bemerkt und bewunderte zumeist die elegante Überleitung. Diesmal jedoch trieb ihr Georges Bemerkung die Röte ins Gesicht.
»Miss Davenport interessiert sich für Neuseeland, Vater.«
Helen schluckte krampfhaft, als sich alle Blicke auf sie richteten.
»Ach, wirklich?«, fragte Robert Greenwood gelassen. »Denken Sie an Auswanderung?« Er lächelte. »Dann ist Neuseeland eine gute Wahl. Keine übermäßige Hitze und keine malariaträchtigen Sümpfe wie in Indien. Keine blutrünstigen Eingeborenen wie in Amerika. Keine Sprösslinge krimineller Siedler wie in Australien …«
»Tatsächlich?«, fragte Helen und freute sich, das Gespräch wieder auf neutraleren Boden bringen zu können. »Wurde Neuseeland nicht auch durch Sträflinge besiedelt?«
Mr. Greenwood schüttelte den Kopf. »Aber nein. Die dortigen Gemeinden wurden fast durchweg von braven britischen Christenmenschen gegründet, und so ist es noch heute. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass es dort keine zweifelhaften Subjekte gibt. Vor allem in die Walfängerlager an der Westküste dürfte es so manchen Gauner verschlagen haben, und die Schafschererkolonnen werden auch nicht gerade aus lauter Ehrenmännern bestehen. Aber Neuseeland ist ganz gewiss kein Sammelbecken des gesellschaftlichen Abschaums. Die Kolonie ist auch noch jung. Sie wurde erst vor wenigen Jahren eigenständig …«
»Aber die Eingeborenen sind gefährlich!«, warf George ein. Offensichtlich wollte jetzt auch er mit seinem Wissen glänzen – und für kriegerische Auseinandersetzungen, das wusste Helen aus dem Unterricht, hatte er ein Faible und ein ausgezeichnetes Gedächtnis. »Es gab noch vor einiger Zeit Kämpfe, nicht wahr, Dad? Hast du nicht davon erzählt, dass einem deiner Handelspartner die gesamte Wolle abgebrannt wurde?«
Mr. Greenwood nickte seinem Sohn wohlgefällig zu. »Richtig, George. Aber das ist vorbei – im Grunde seit zehn Jahren, auch wenn gelegentlich noch Scharmützel aufflackern. Es ging auch nicht um die grundsätzliche Anwesenheit der Siedler. Was das angeht, waren die Eingeborenen immer fügsam. Eher wurden Landverkäufe angezweifelt – und wer will ausschließen, dass unsere Landnehmer da nicht tatsächlich den einen oder anderen Stammeshäuptling übervorteilt haben? Doch seit die Queen unseren guten Captain Hobson als Generalleutnant herübergeschickt hat, werden diese Streitigkeiten behoben. Der Mann ist ein genialer Stratege. 1840 hat er sechsundvierzig Häuptlinge einen Vertrag unterschreiben lassen, in dem sie sich zu Untertanen der Königin erklären. Die Krone hat seitdem bei sämtlichen Landverkäufen Vorkaufsrecht. Leider haben nicht alle mitgespielt, und es halten ja wohl auch nicht alle Siedler Frieden. Deshalb kommt es schon mal zu kleinen Unruhen. Aber im Grunde ist das Land sicher – also keine Angst, Miss Davenport!« Mr. Greenwood zwinkerte Helen zu.
Mrs. Greenwood runzelte die Stirn. »Sie erwägen doch nicht wirklich, England zu verlassen, Miss Davenport?«, fragte sie verdrießlich. »Sie denken wohl nicht ernstlich daran, diese unsägliche Anzeige zu beantworten, die der Pfarrer im Gemeindeblatt veröffentlicht hat? Gegen die ausdrückliche Empfehlung unseres Damenkomitees, wie ich betonen möchte!«
Helen kämpfte schon wieder mit dem Erröten.
»Was für eine Anzeige?«, erkundigte sich Robert und wandte sich dabei direkt an Helen. Die aber druckste nur herum.
»Ich … ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Da war nur eine Notiz …«
»Eine Gemeinde in Neuseeland sucht heiratswillige Mädchen«, klärte George seinen Vater auf. »Wie es aussieht, herrscht in diesem Südseeparadies Frauenmangel.«
»George!«, tadelte Mrs. Greenwood entsetzt.
Mr. Greenwood lachte. »Südseeparadies? Na, das Klima ist eher dem in England vergleichbar«, verbesserte er seinen Sohn. »Aber es ist doch kein Geheimnis, dass es in Übersee mehr Männer als Frauen gibt. Abgesehen vielleicht von Australien, wo der weibliche Abschaum der Gesellschaft gelandet ist: Betrügerinnen, Diebinnen, Hur … äh, leichte Mädchen. Aber wenn es um freiwillige Auswanderung geht, sind unsere Damen weniger abenteuerlustig als die Herren der Schöpfung. Entweder sie gehen mit ihren Ehemännern oder gar nicht. Ein typischer Charakterzug des schwachen Geschlechts.«
»Eben!«, stimmte Mrs. Greenwood ihrem Gatten zu, während Helen sich auf die Zunge biss. Sie war gar nicht so sehr von der männlichen Überlegenheit überzeugt. Da brauchte sie nur William anzuschauen oder an das sich endlos hinschleppende Studium ihrer Brüder zu denken. Gut versteckt in ihrem Zimmer verwahrte Helen sogar ein Buch der Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft, aber das musste sie unbedingt für sich behalten – Mrs. Greenwood hätte sie sofort entlassen. »Es ist wider die weibliche Natur, sich ohne männlichen Schutz auf schmutzige Auswandererschiffe zu begeben, in feindlichen Landen Quartier zu nehmen und womöglich noch Tätigkeiten auszuüben, die Gott den Männern vorbehalten hat. Und christliche Frauen nach Übersee zu schicken, um sie dort zu verheiraten, grenzt ja wohl an Mädchenhandel!«
»Nun, man schickt die Frauen ja nicht unvorbereitet«, warf Helen ein. »Die Anzeige sieht gewiss vorherige briefliche Kontakte vor. Und es war ausdrücklich von wohl beleumundeten, gut situierten Herren die Rede.«
»Ich dachte, Sie hätten die Anzeige gar nicht bemerkt«, spottete Mr. Greenwood, doch sein nachsichtiges Lächeln nahm den Worten die Schärfe.
Helen errötete erneut. »Ich … äh, könnte sein, dass ich sie kurz überflogen habe …«
George grinste.
Mrs. Greenwood schien den kurzen Wortwechsel gar nicht mitbekommen zu haben. Sie war längst bei einem anderen Aspekt der Neuseelandproblematik.
»Viel ärger als der so genannte Frauenmangel in den Kolonien erscheint mir das Dienstbotenproblem«, erklärte sie. »Wir haben heute im Waisenhauskomitee ausführlich darüber debattiert. Offensichtlich finden die besseren Familien in … wie heißt dieser Ort noch? Christchurch? Jedenfalls, sie finden dort kein ordentliches Personal. Vor allem Dienstmädchen sind rar.«
»Was durchaus als Begleiterscheinung des allgemeinen Frauenmangels zu deuten sein kann«, bemerkte Mr. Greenwood. Helen verkniff sich ein Lächeln.
»Auf jeden Fall wird unser Komitee ein paar unserer Waisenmädchen hinüberschicken«, fuhr Lucinda fort. »Wir haben vier oder fünf brave kleine Dinger um die zwölf Jahre, die alt genug sind, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Hierzulande finden wir kaum eine Anstellung für sie. Die Leute hier nehmen lieber etwas ältere Mädchen. Aber da drüben sollte man sich die Finger danach schlecken …«
»Das hat mir jetzt aber deutlich mehr den Anschein von Mädchenhandel als die Ehevermittlung«, wandte ihr Gatte ein.
Lucinda warf ihm einen giftigen Blick zu.
»Wir handeln nur im Interesse der Mädchen!«, behauptete sie und faltete geziert ihre Serviette zusammen.
Helen hatte da so ihre Zweifel. Wahrscheinlich hatte man sich kaum die Mühe gemacht, diesen Kindern auch nur ein Mindestmaß jener Fertigkeiten zu vermitteln, die man von Dienstmädchen in guten Häusern erwartete. Insofern konnte man die armen kleinen Dinger allenfalls als Küchenhilfen gebrauchen, und da bevorzugten die Köchinnen natürlich kräftige Bauernmädchen statt schlecht ernährte Zwölfjährige aus dem Armenhaus.
»In Christchurch haben die Mädchen Aussichten auf eine gute Anstellung. Und wir schicken sie natürlich nur in wohl beleumundete Familien …«
»Natürlich«, bemerkte Robert spöttisch. »Ich bin sicher, ihr werdet mit den künftigen Dienstherren der Mädchen eine mindestens ebenso umfangreiche Korrespondenz führen wie die heiratswilligen jungen Damen mit ihren künftigen Gatten.«
Mrs. Greenwood runzelte indigniert die Stirn. »Du nimmst mich nicht erst, Robert!«, tadelte sie ihren Mann.
»Selbstverständlich nehme ich dich ernst, meine Liebe.« Mr. Greenwood lächelte. »Wie könnte ich dem ehrenwerten Waisenhauskomitee etwas anderes unterstellen als die besten und lautersten Absichten. Außerdem werdet ihr eure kleinen Zöglinge ja wohl nicht ohne jede Aufsicht nach Übersee schicken. Vielleicht findet sich unter den heiratswilligen jungen Damen eine vertrauenswürdige Person, die sich für einen kleinen Zuschuss des Komitees an den Kosten für die Überfahrt um die Mädchen kümmert …«
Mrs. Greenwood äußerte sich nicht dazu, und Helen schaute wieder krampfhaft auf ihren Teller. Sie hatte den schmackhaften Braten kaum angerührt, mit dessen Zubereitung die Köchin vermutlich den halben Tag verbracht hatte. Doch den forschenden, amüsierten Seitenblick Mr. Greenwoods bei dessen letzter Bemerkung hatte Helen sehr wohl bemerkt. Das Ganze warf völlig neue Fragen auf. Beispielsweise hatte Helen sich bisher gar nicht vor Augen geführt, dass eine Überfahrt nach Neuseeland natürlich auch bezahlt werden wollte. Konnte man ohne schlechtes Gewissen seinen künftigen Gatten dafür aufkommen lassen? Oder erwarb er damit schon Rechte an einer Frau, die ihm eigentlich erst zustanden, wenn von Angesicht zu Angesicht das Jawort gesprochen war?
Nein, diese ganze Neuseeland-Geschichte war verrückt. Helen musste sie sich aus dem Kopf schlagen. Es war ihr nicht bestimmt, eine eigene Familie zu haben. Oder doch?
Nein, sie durfte nicht mehr daran denken!
Doch in Wahrheit dachte Helen Davenport in den nächsten Tagen an nichts anderes mehr …
2
»Wollen Sie die Herde gleich sehen, oder nehmen wir erst mal einen Drink?«
Lord Terence Silkham begrüßte seinen Besucher mit einem kräftigen Händedruck, den Gerald Warden nicht minder fest erwiderte. Lord Silkham hatte nicht so recht gewusst, wie er sich einen Mann vorstellen sollte, der ihm von der Züchtervereinigung in Cardiff als »Schaf-Baron« aus Übersee avisiert worden war. Doch was er nun sah, gefiel ihm nicht schlecht. Der Mann war für das Wetter in Wales zweckmäßig, aber durchaus modisch gekleidet. Seine Breeches waren von elegantem Schnitt und aus gutem Stoff, der Regenmantel aus englischer Produktion. Klare blaue Augen blickten aus einem großflächigen, ein wenig kantigen Gesicht, das zum Teil von einem breitkrempigen, für die Gegend typischen Hut verdeckt wurde. Darunter lugte volles braunes Haar hervor, nicht kürzer und nicht länger getragen, als es in England üblich war. Kurz und gut, nichts an der Erscheinung Gerald Wardens erinnerte auch nur im Entferntesten an die »Cowboys« aus den Groschenheftchen, in denen einige Dienstboten seiner Lordschaft – und zum Entsetzen seiner Gattin auch seine ungeratene Tochter Gwyneira! – gelegentlich schmökerten. Die Verfasser dieser Schundliteratur schilderten blutrünstige Kämpfe amerikanischer Siedler mit hasserfüllten Eingeborenen, und die ungelenken Zeichnungen zeigten verwegene Jünglinge mit langem, ungezähmtem Haarschopf, Stetson, Lederhosen und seltsam geformten Stiefeln, an denen angeberisch lange Sporen befestigt waren. Obendrein waren die Viehtreiber schnell mit ihrer Waffe bei der Hand, die man »Colt« nannte und die in Halftern an lockeren Gürteln getragen wurden.
Lord Silkhams heutiger Gast jedoch trug keine Waffe am Gürtel, sondern eine Taschenflasche Whiskey, die er jetzt aufschraubte und seinem Gastgeber anbot.
»Ich würde sagen, das hier reicht fürs Erste zur Stärkung«, sagte Gerald Warden mit tiefer, angenehmer, befehlsgewohnter Stimme. »Heben wir uns weitere Drinks für die Verhandlungen auf, wenn ich die Schafe gesehen habe. Und was das angeht, machen wir uns besser rasch auf den Weg, bevor es wieder regnet. Hier, bitte.«
Silkham nickte und nahm einen kräftigen Zug aus der Flasche. Erstklassiger Scotch! Kein billiger Fusel. Auch das nahm den hochgewachsenen, rothaarigen Lord für seinen Besucher ein. Er nickte Gerald zu, griff nach seinem Hut und seiner Reitpeitsche und stieß einen leisen Pfiff aus. Als hätten sie darauf gewartet, stoben drei lebhafte, schwarz- und braun-weiße Hütehunde aus den Ecken des Stalles, in denen sie Schutz vor dem unbeständigen Wetter gesucht hatten. Offensichtlich brannten sie darauf, sich den Reitern anzuschließen.
»Sind Sie den Regen nicht gewohnt?«, erkundigte sich Lord Terence, während er auf sein Pferd stieg. Ein Bediensteter hatte ihm seinen kräftigen Hunter vorgeführt, als er Gerald Warden begrüßt hatte. Geralds Pferd wirkte noch frisch, obwohl er an diesem Morgen bereits die weite Strecke von Cardiff nach Powys geritten war. Sicher ein Mietpferd, aber unzweifelhaft aus einem der besten Ställe der Stadt. Ein weiterer Hinweis darauf, wie der Ausdruck »Schaf-Baron« zustande kam. Warden war sicher nicht adelig, schien aber reich zu sein.
Jetzt lachte er und glitt ebenfalls in den Sattel seines eleganten Braunen. »Im Gegenteil, Silkham, im Gegenteil …«
Lord Terence schluckte, beschloss dann aber, dem anderen die respektlose Anrede nicht übel zu nehmen. Woher der Mann auch kommen mochte, waren »Mylords« und »Myladys« anscheinend eine unbekannte Gattung.
»Wir haben ungefähr dreihundert Regentage im Jahr. Genau genommen ist das Wetter in den Canterbury Plains ganz ähnlich wie hier, zumindest im Sommer. Die Winter sind milder, aber es reicht für erstklassige Wollqualität. Und das gute Gras macht die Schafe fett. Wir haben Gras im Überfluss, Silkham! Hektar um Hektar! Die Plains sind ein Paradies für Viehzüchter.«
Zu dieser Jahreszeit konnte man auch in Wales nicht über Mangel an Gras klagen. Wie ein Samtteppich bedeckte das üppige Grün die Hügel bis weit in die Berge hinein. Auch die wilden Ponys konnten sich jetzt daran erfreuen und brauchten nicht herunter in die Täler zu kommen, um auf Silkhams Grasland zu naschen. Seine Schafe, noch nicht geschoren, fraßen sich kugelrund. Wohlgefällig betrachteten die Männer eine Herde von Mutterschafen, die zum Ablammen in der Nähe des Herrenhauses untergebracht waren.
»Prächtige Tiere!«, lobte Gerald Warden. »Robuster als Romneys und Cheviots. Dabei sollen sie eine mindestens gleich gute Wollqualität liefern!«
Silkham nickte. »Welsh-Mountain-Schafe. Im Winter laufen sie zum Teil frei in den Bergen. Die bringt so leicht nichts um. Und wo liegt nun Ihr Wiederkäuer-Paradies? Sie müssen entschuldigen, aber Lord Bayliff sprach nur von ›Übersee‹.«
Lord Bayliff war Vorsitzender der Schafzüchtervereinigung und hatte Warden den Kontakt mit Silkham vermittelt. Der Schaf-Baron, so hatte in seinem Brief gestanden, gedenke ein paar Herdbuchschafe zu erwerben, um damit seine eigene Zucht in Übersee zu veredeln.
Warden lachte dröhnend. »Und das ist ein weiter Begriff! Lassen Sie mich raten … wahrscheinlich sahen Sie Ihre Schäfchen schon irgendwo im Wilden Westen von Indianerpfeilen durchbohrt! Aber da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Tiere bleiben sicher auf dem Boden des Britischen Empire. Mein Anwesen liegt in Neuseeland, in den Canterbury Plains auf der Südinsel. Grasland, wohin das Auge reicht! Sieht ganz ähnlich aus wie hier, nur größer, Silkham, ungleich größer!«
»Nun, dies hier ist auch nicht gerade ein Kleinbauernhof«, bemerkte Lord Terence indigniert. Was bildete dieser Kerl sich ein, Silkham Farms wie eine Klitsche darzustellen! »Ich habe um die dreißig Hektar Weideland.«
Gerald Warden grinste wieder. »Kiward Station hat um die vierhundert«, trumpfte er auf. »Allerdings ist noch nicht alles gerodet, da liegt noch einiges an Arbeit vor uns. Dennoch ist es ein prächtiges Anwesen. Und wenn dazu noch ein Zuchtstock der besten Schafe kommt, sollte es sich eines Tages als Goldgrube erweisen. Romney und Cheviot, gekreuzt mit Welsh Mountain – da liegt die Zukunft, glauben Sie mir!«
Silkham wollte ihm da nicht widersprechen. Er gehörte zu den besten Schafzüchtern von Wales, wenn nicht ganz Britanniens. Unzweifelhaft würden Tiere aus seiner Zucht jede Population verbessern. Inzwischen sah er auch die ersten Exemplare der Herde, die er Warden zugedacht hatte. Es waren alles junge Mutterschafe, die bislang noch nicht gelammt hatten. Dazu zwei junge Widder bester Abstammung.
Lord Terence pfiff den Hunden, die sofort darangingen, die verstreut auf einer riesigen Weide grasenden Schafe einzutreiben. Dazu umrundeten sie die Tiere in relativ großem Abstand und sorgten fast unmerklich dafür, dass die Schafe sich in direkter Linie auf die Männer zubewegten. Dabei ließen sie die Herde jedoch nie ins Rennen kommen – sobald sie sich in die gewünschte Richtung in Bewegung setzte, ließen die Hunde sich zu Boden fallen und warteten in einer Art Lauerstellung ab, ob ein Tier aus der Reihe tanzte. Geschah das, griff der zuständige Hütehund sofort ein.
Gerald Warden beobachtete fasziniert, wie selbstständig die Hunde vorgingen.
»Unglaublich. Was ist das für eine Rasse? ›Sheepdogs‹?«
Silkham nickte. »Border Collies. Sie haben das Treiben im Blut und brauchen kaum Ausbildung. Und die hier sind noch gar nichts. Da müssten Sie mal Cleo sehen – eine Spitzenhündin, die einen Trial nach dem anderen gewinnt!« Silkham sah sich suchend um. »Wo steckt sie überhaupt? Ich wollte sie eigentlich mitnehmen. Jedenfalls habe ich das meiner Lady versprochen. Damit Gwyneira nicht wieder … oh nein!« Der Lord hatte sich suchend nach der Hündin umgesehen, nun aber verweilte sein Blick auf einem Pferd und seinem Reiter, die aus Richtung des Wohnhauses rasch näher kamen. Dabei machten sie sich nicht die Mühe, die Wege zwischen den Schafkoppeln zu benutzen oder die Tore zu öffnen und hindurchzureiten. Stattdessen setzte das kräftige braune Pferd ohne zu zögern über alle Zäune und Mauern hinweg, die Silkhams Koppeln begrenzten. Als es näher kam, bemerkte Warden auch den kleinen schwarzen Schatten, der sich nach Kräften mühte, mit Pferd und Reiter Schritt zu halten. Teilweise sprang der Hund über die Hindernisse, teilweise hüpfte er die Mauern wie Treppen hinauf oder tauchte einfach unter der untersten Zaunlatte durch. Jedenfalls war das schwanzwedelnde, eifrige Etwas schließlich vor dem Reiter auf der Schafkoppel und übernahm gleich die Führung des Trios. Dabei schienen die Schafe fast Gedanken zu lesen. Wie auf ein einziges Kommando der Hündin formierten sie sich zu einer geschlossenen Gruppe und stoppten brav vor den Männern, ohne sich dabei auch nur eine Minute zu erregen. Unaufgeregt senkten die Schafe die Köpfe erneut ins Gras, bewacht von Silkhams drei Hütehunden. Der kleine Neuankömmling kam derweil Beifall heischend zu Silkham und schien über das ganze freundliche Colliegesicht zu strahlen. Allerdings sah die Hündin die Männer nicht direkt an. Ihr Blick richtete sich eher auf den Reiter des braunen Pferdes, der eben hinter den Männern zum Schritt durchparierte und anhielt.
»Guten Morgen, Vater!«, sagte eine helle Stimme. »Ich wollte dir Cleo bringen. Ich dachte, du brauchst sie.«
Gerald Warden blickte ebenfalls zu dem Jungen auf und wollte ihm gerade ein paar lobende Worte zu seinem eleganten Parforceritt sagen. Dann aber stockte er, als er den Damensattel bemerkte, dazu ein verschlissenes, dunkelgraues Reitkleid sowie die Fülle des nachlässig im Nacken zusammengebundenen, flammendroten Haares. Möglicherweise hatte das Mädchen die Locken vor dem Ritt züchtig aufgesteckt, wie es Brauch war, aber sehr viel Mühe konnte sie sich damit nicht gemacht haben. Andererseits hätte sich bei diesem wilden Ritt wohl fast jeder Knoten gelöst.
Lord Silkham blickte wenig begeistert. Immerhin erinnerte er sich jetzt daran, das Mädchen vorzustellen.
»Mr. Warden – meine Tochter Gwyneira. Und ihre Hündin Cleopatra, der vorgeschobene Grund ihres Kommens. Was machst du hier, Gwyneira? Wenn ich mich recht erinnere, sprach deine Mutter von einer Französisch-Lektion heute Nachmittag …«
Gewöhnlich hatte Lord Terence den Stundenplan seiner Tochter nicht im Kopf, doch Madame Fabian, Gwyneiras französische Hauslehrerin, litt an einer ausgeprägten Hundeallergie. Lady Silkham pflegte ihren Gatten deshalb stets zu erinnern, Cleo vor dem Unterricht aus dem Umkreis seiner Tochter zu entfernen, was nicht einfach war. Die Hündin klebte an ihrer Herrin wie Pech und Schwefel und war nur durch besonders interessante Hüte-Aufgaben von ihr wegzulocken.
Gwyneira zuckte anmutig die Schultern. Sie saß tadellos gerade, aber locker und völlig sicher zu Pferde und hielt ihre kleine, kräftige Stute gelassen am Zügel.
»Das war vorgesehen, ja. Aber die arme Madame hatte einen schlimmen Asthma-Anfall. Wir mussten sie zu Bett bringen, sie konnte kein Wort sprechen. Woher sie das nur immer hat! Mutter achtet doch so gewissenhaft darauf, dass kein Tier in ihre Nähe kommt …«
Gwyneira versuchte, gleichmütig dreinzublicken und Bedauern zu heucheln, doch ihr ausdrucksvolles Gesicht spiegelte eher einen gewissen Triumph. Warden hatte jetzt Zeit, sich das Mädchen näher anzusehen: Es hatte einen sehr hellen Teint mit leichter Neigung zu Sommersprossen, ein herzförmiges Gesicht, das unschuldig süß gewirkt hätte, wäre der ein wenig volle und breite Mund nicht gewesen, der Gwyneiras Zügen etwas Sinnliches verlieh. Vor allem wurde ihr Gesicht von großen, ungewöhnlich blauen Augen beherrscht. Indigoblau, erinnerte sich Gerald Warden. So hieß das in den Farbkästen, mit denen sein Sohn einen Großteil seiner Zeit vertrödelte.
»Und Cleo ist nicht zufällig noch mal durch den Salon gelaufen, nachdem die Hausmädchen dort jedes Hundehaar einzeln entfernt hatten, bevor Madame sich aus ihren Räumen traute?«, fragte Silkham streng.
»Ach, das glaube ich nicht«, meinte Gwyneira mit sanftem Lächeln, das ihrer Augenfarbe einen wärmeren Ton verlieh. »Ich habe sie vor der Stunde persönlich in den Stall gebracht und ihr eingeschärft, dass sie dort auf dich zu warten hat. Aber sie saß noch vor Igraines Box, als ich zurückkam. Ob sie wohl etwas geahnt hat? Hunde sind manchmal sehr einfühlsam …«
Lord Silkham erinnerte sich an das dunkelblaue Samtkleid, das Gwyneira beim Lunch getragen hatte. Wenn sie Cleo in diesem Aufzug in die Ställe gebracht und sich vor ihr niedergehockt hatte, um ihr Anweisungen zu geben, dürften ausreichend Hundehaare daran haften geblieben sein, um die arme Madame für drei Wochen außer Gefecht zu setzen.
»Wir reden später noch darüber«, bemerkte Silkham in der Hoffnung, dass seine Frau dann die Aufgabe des Anklägers und Richters übernehmen würde. Jetzt, vor seinem Besucher, wollte er Gwyneira nicht weiter zusammenstauchen. »Wie finden Sie die Schafe, Warden? Ist es das, was Sie sich vorgestellt haben?«
Gerald Warden wusste, dass er jetzt zumindest der Form halber von einem Tier zum anderen gehen und Wollqualität, Bau und Futterzustand begutachten sollte. Tatsächlich hegte er allerdings keinen Zweifel an der erstklassigen Qualität der Mutterschafe. Alle waren groß und wirkten gesund und wohlgenährt, und ihre Wolle wuchs gleich nach der Schur wieder nach. Vor allem würde es die Ehre eines Lord Silkham unter keinen Umständen zulassen, einen Käufer aus Übersee zu betrügen. Eher würde er ihm die besten Tiere überlassen, um seinen Ruf als Züchter auch in Neuseeland zu wahren. Insofern blieb Geralds Blick zunächst auf Silkhams außergewöhnlicher Tochter haften. Sie erschien ihm sehr viel interessanter als die Zuchttiere.
Gwyneira hatte sich jetzt ohne Hilfe aus dem Sattel gleiten lassen. Eine schneidige Reiterin wie sie konnte wahrscheinlich auch ohne Hilfestellung in den Sattel steigen. Im Grunde wunderte sich Gerald, dass sie überhaupt den Seitsattel gewählt hatte; wahrscheinlich bevorzugte sie das Reiten im Herrensitz. Aber vielleicht hätte dies ja das Fass zum Überlaufen gebracht. Lord Silkham schien ohnehin nicht begeistert, das Mädchen zu sehen, und auch ihr Verhalten gegenüber der französischen Gouvernante schien alles andere als ladylike.
Gerald dagegen gefiel das Mädchen. Wohlgefällig betrachtete er Gwyneiras zierliche, an den richtigen Stellen jedoch ausreichend gerundete Figur. Das Mädchen war zweifellos voll entwickelt, obwohl es sehr jung war, sicher kaum älter als siebzehn. Überhaupt schien Gwyn noch recht kindlich zu sein; erwachsene Ladys brachten meist nicht so viel Interesse für Pferde und Hunde auf. Allerdings war Gwyneiras Umgang mit den Tieren weit entfernt von weiblichem Herumtändeln. Jetzt wehrte sie lachend das Pferd ab, das eben versuchte, seinen ausdrucksvollen Kopf an ihrer Schulter zu scheuern. Die Stute war deutlich kleiner als Lord Silkhams Hunter, äußerst stämmig, aber doch elegant. Ihr geschwungener Hals und ihr kurzer Rücken erinnerten Gerald an die spanischen und neapolitanischen Pferde, die ihm auf seinen Reisen auf dem Kontinent mitunter angeboten wurden. Für Kiward Station jedoch befand er sie allesamt als zu groß und vielleicht auch zu sensibel. Schon den Bridle Path vom Schiffsanleger nach Christchurch hätte er ihnen nicht zumuten wollen. Dieses Pferd jedoch …
»Sie haben ein hübsches Pony, Mylady«, bemerkte Gerald Warden. »Ich habe eben seine Springmanier bewundert. Reiten Sie mit dem Pferd auch Jagden?«
Gwyneira nickte. Bei der Erwähnung ihrer Stute strahlten ihre Augen ähnlich auf wie eben, als es um die Hündin ging.
»Das ist Igraine«, sagte sie ungezwungen. »Sie ist ein Cob. Die typischen Pferde für diese Gegend, sehr trittsicher und ebenso gute Kutsch- wie Reitpferde. Sie wachsen frei im Bergland auf.« Gwyneira zeigte auf die zerklüfteten Berge, die im Hintergrund der Weiden aufragten – eine raue Umwelt, die zweifellos ein robustes Naturell verlangte.
»Aber nicht gerade das typische Damenpferd, oder?«, sagte Gerald lächelnd. Er hatte schon andere junge Ladys in England reiten sehen. Die meisten bevorzugten leichte Vollblutpferde.
»Kommt darauf an, ob die Dame reiten kann«, beschied ihn Gwyneira. »Ich kann nicht klagen … Cleo, nun bleib doch mal von meinen Füßen weg!«, rief sie der kleinen Hündin zu, nachdem sie fast über das Tier gestolpert wäre. »Du hast es ja gut gemacht, alle Schafe sind da! Aber das war nun wirklich keine schwierige Aufgabe.« Sie wandte sich Silkham zu. »Soll Cleo die Widder eintreiben, Vater? Sie langweilt sich.«
Doch Lord Silkham wollte zunächst seine Mutterschafe vorführen. Und auch Gerald zwang sich nun, die Tiere genauer in Augenschein zu nehmen. Gwyneira ließ ihr Pferd währenddessen grasen und kraulte die Hündin. Schließlich nickte ihr Vater ihr zu.
»Also gut, Gwyneira, dann zeig Mr. Warden den Hund. Du brennst doch nur darauf, ein bisschen anzugeben. Kommen Sie, Warden, wir müssen ein Stück reiten. Die jungen Widder sind in den Hügeln.«
Wie Gerald erwartet hatte, machte Silkham keine Anstalten, seiner Tochter in den Sattel zu helfen. Gwyneira bewältigte die schwierige Aufgabe, zunächst den linken Fuß in den Bügel zu stellen und dann das rechte Bein elegant übers Sattelhorn zu schwingen, voller Anmut und ganz selbstverständlich, wobei ihre Stute so regungslos stand wie eine Statue. Als sie dann antrat, fielen Gerald ihre hohen, eleganten Bewegungen auf. Das Mädchen und das Pferd gefielen ihm gleichermaßen, und auch die kleine, dreifarbige Hündin faszinierte ihn. Während des Rittes zu den Widdern erfuhr er, dass Gwyneira die Hündin selbst trainiert und schon diverse Hütewettbewerbe mit ihr gewonnen hatte.
»Die Schäfer können mich schon nicht mehr leiden«, erklärte Gwyneira mit unschuldigem Lächeln. »Und die Frauenvereinigung hat die Frage aufgeworfen, ob es überhaupt schicklich sei, dass ein Mädchen einen Hund vorführt. Aber was soll daran unschicklich sein? Ich stehe doch nur herum und mache vielleicht mal ein Tor auf und zu.«
Tatsächlich genügten ein paar Handbewegungen und ein geflüsterter Befehl, um die gut geschulten Hütehunde des Lords auszuschicken. Gerald Warden sah zunächst gar keine Schafe auf dem großen Areal, dessen Zauntor Gwyneira diesmal lässig vom Sattel aus geöffnet hatte, statt einfach darüberzuspringen. Auch dabei bewährte sich das kleinere Pferd; Silkham und Warden wäre es schwer gefallen, sich von ihren großen Tieren herunterzubeugen.
Cleo und die anderen Hunde brauchten nur wenige Minuten, um die Herde zu sammeln, obwohl die jungen Schafböcke sich viel aufmüpfiger gebärdeten als die ruhigen Mutterschafe. Einige brachen während des Treibens aus oder stellten sich den Hunden sogar kämpferisch entgegen, was die Sheepdogs aber nicht aus dem Konzept brachte. Cleo wedelte begeistert mit dem Schwanz, als sie sich auf einen knappen Ruf hin wieder zu ihrer Besitzerin gesellte. Die Schafböcke standen nun alle in relativ geringer Entfernung. Silkham wies Gwyneira zwei davon an, die Cleo sofort in atemberaubender Geschwindigkeit von den anderen trennte.
»Die hier habe ich für Sie vorgesehen«, erklärte Lord Silkham seinem Besucher. »Beste Herdbuchtiere, erstklassige Abstammung. Ich kann Ihnen nachher auch die Vatertiere zeigen. Sie wären sonst bei mir in die Zucht gegangen und hätten sicher eine Menge Preise geholt. Aber so … Ich denke, Sie werden meinen Namen als Züchter in den Kolonien erwähnen. Und das ist mir wichtiger als die nächste Auszeichnung in Cardiff.«
Gerald Warden nickte ernst. »Worauf Sie sich verlassen können. Prächtige Tiere! Ich kann die Nachzucht mit meinen Cheviots kaum erwarten! Aber wir sollten auch über die Hunde sprechen! Nicht, dass wir in Neuseeland keine Sheepdogs hätten. Aber ein Tier wie diese Hündin und dazu ein passender Rüde wären mir einiges Geld wert.«
Gwyneira, die ihre Hündin anerkennend gestreichelt hatte, hörte diese Bemerkung. Sogleich warf sie sich zornig herum und funkelte den Neuseeländer an. »Wenn Sie meinen Hund kaufen wollen, verhandeln Sie besser mit mir, Mr. Warden! Aber ich sag es Ihnen gleich: Nicht für all Ihr Geld können Sie Cleo bekommen. Die gehört zu mir! Ohne mich geht sie nirgendwohin. Sie könnten sie auch gar nicht führen, denn sie hört nicht auf jeden.«
Lord Silkham schüttelte missbilligend den Kopf. »Gwyneira, wie benimmst du dich?«, fragte er streng. »Selbstverständlich können wir Mr. Warden ein paar Hunde verkaufen. Es muss ja nicht dein Liebling sein.« Er blickte Warden an. »Ich würde Ihnen ohnehin zu ein paar Jungtieren aus dem letzten Wurf raten, Mr. Warden. Cleo ist nicht der einzige Hund, mit dem wir Trials gewinnen.«
Aber der beste, dachte Gerald. Und für Kiward Station war das Beste gerade gut genug. In den Ställen und im Haus. Wenn blaublütige Mädchen doch genauso einfach zu erwerben wären wie Herdbuchschafe! Als die drei zurück zum Haus ritten, schmiedete Warden bereits Pläne.
Gwyneira zog sich zum Abendessen sorgfältig um. Nach der Sache mit Madame wollte sie nicht noch einmal auffallen. Ihre Mutter hatte ihr eben schon die Hölle heiß gemacht. Dabei kannte sie die Vorträge der Lady längst auswendig: Wenn sie sich weiterhin so wild gebärdete und mehr Zeit in den Ställen und auf dem Pferderücken verbrachte als in den Schulstunden, fände sie nie einen Mann. Nun war es nicht zu leugnen, dass Gwyneiras Französischkenntnisse zu wünschen übrig ließen. Und das galt auch für ihre hausfraulichen Fähigkeiten. Gwyneiras Handarbeiten sahen nie so aus, als könnte man sein Heim damit schmücken – tatsächlich ließ der Pfarrer sie vor den Kirchenbasaren sogar unauffällig verschwinden, statt sie zum Verkauf anzubieten. Für die Planung großer Festessen und ausführliche Besprechungen mit der Köchin zu Fragen wie »Lachs oder Zander?« hatte das Mädchen ebenfalls wenig Sinn. Gwyneira aß, was auf den Tisch kam; welche Gabeln und Löffel sie zu welchem Gericht benutzen sollte, wusste sie zwar, hielt das Ganze aber im Grunde für Unsinn. Wozu die Tafel stundenlang schmücken, wenn dann in wenigen Minuten alles aufgegessen war? Und dann die Sache mit den Blumenarrangements! Seit einigen Monaten gehörte der Blumenschmuck im Salon und im Esszimmer zu Gwyneiras Obliegenheiten. Aber leider genügte ihr Geschmack meist nicht den Ansprüchen – etwa, wenn sie Feldblumen pflückte und auf die Vasen verteilte, wie es ihr gefiel. Sie fand das hübsch, doch ihre Mutter wäre bei dem Anblick fast in Ohnmacht gefallen. Erst recht, als sie auf den Gräsern auch noch eine versehentlich mit eingeschleppte Spinne entdeckte. Seitdem schnitt Gwyneira die Blumen unter Aufsicht des Gärtners im Rosengarten von Silkham Manor und arrangierte sie mit Hilfe von Madame. Um diese lästige Pflicht war das Mädchen heute allerdings herumgekommen. Die Silkhams hatten nicht nur Gerald Warden zu Gast, sondern auch Gwyneiras älteste Schwester Diana und deren Ehemann. Diana liebte Blumen und beschäftigte sich seit ihrer Heirat fast ausschließlich mit dem Anlegen des ausgefallensten und gepflegtesten Rosengartens in ganz England. Heute hatte sie eine Auswahl der schönsten Blüten für ihre Mutter mitgebracht und auch gleich geschickt in Vasen und auf Körbe verteilt. Gwyneira seufzte. So gut würde ihr das nie gelingen. Falls Männer sich bei der Auswahl ihrer Gattin wirklich davon leiten ließen, müsste sie wohl als alte Jungfer sterben. Gwyneira hatte allerdings das Gefühl, als wäre der Blumenschmuck sowohl ihrem Vater als auch Dianas Ehemann Jeffrey herzlich egal. Auch Gwyneiras Stickereien hatte bislang noch kein männliches Wesen – außer dem wenig begeisterten Pfarrer – einen Blick gegönnt. Warum also konnte sie die jungen Herren nicht lieber mit ihren wahren Begabungen beeindrucken? Auf der Jagd zum Beispiel würde sie Bewunderung erregen: Gwyneira verfolgte den Fuchs meist schneller und erfolgreicher als die restliche Jagdgesellschaft. Das aber schien die Männer ebenso wenig für sie einzunehmen wie ihr geschickter Umgang mit den Hütehunden. Zwar äußerten die Herren sich anerkennend, doch ihr Blick war oft ein wenig missbilligend, und beim abendlichen Ball tanzten sie mit anderen Mädchen. Aber das konnte ebenso gut mit Gwyneiras dürftiger Mitgift zusammenhängen. Das Mädchen machte sich da keine Illusionen – als letzte von drei Töchtern hatte sie nicht viel zu erwarten. Zumal auch ihr Bruder dem Vater auf der Tasche lag. John Henry »studierte« in London. Gwyneira fragte sich nur, welches Fach. Solange er noch auf Silkham Manor lebte, hatte er den Wissenschaften nicht mehr abgewinnen können als seine jüngere Schwester, und die Rechnungen, die er aus London schickte, waren viel zu hoch, als dass es sich allein um die Anschaffung von Büchern handeln konnte. Ihr Vater bezahlte stets widerspruchslos und murmelte höchstens etwas von »Hörner abstoßen«, doch Gwyneira war sich klar darüber, dass das viele Geld von ihrer Mitgift abging.
Trotz dieser Widrigkeiten machte sie sich keine allzu großen Sorgen um ihre Zukunft. Vorerst ging es ihr gut, und irgendwann würde ihre rührige Mutter auch einen Gatten für sie auftreiben. Schon jetzt beschränkten die Abendeinladungen ihrer Eltern sich fast ausschließlich auf befreundete Ehepaare, die rein zufällig Söhne im passenden Alter hatten. Manchmal brachten sie die jungen Männer gleich mit, häufiger erschienen allerdings die Eltern allein, und noch öfter kamen nur die Mütter zum Tee. Das hasste Gwyneira besonders, denn dabei wurden alle Fähigkeiten abgeprüft, die Mädchen angeblich dringend brauchten, um einem hochherrschaftlichen Haushalt vorzustehen. Man erwartete, dass Gwyneira kunstvoll den Tee servierte – wobei sie einmal leider Lady Bronsworth verbrüht hatte. Sie war erschrocken, als ihre Mutter ausgerechnet während dieser schwierigen Transaktion die faustdicke Lüge auftischte, Gwyneira hätte die Teekuchen selbst gebacken.
Nach dem Tee griff man zum Stickrahmen, wobei Lady Silkham Gwyneira sicherheitshalber ihren eigenen zusteckte, auf dem das Petit-Point-Kunstwerk fast vollendet war, und unterhielt sich dabei über das letzte Buch von Mr. Bulwer-Lytton. Für Gwyneira war diese Lektüre eher ein Schlafmittel; sie hatte es noch nie geschafft, auch nur einen dieser Schinken zu Ende zu lesen. Immerhin kannte sie ein paar Wörter wie »erbaulich« und »erhabene Ausdruckskraft«, die man in diesem Zusammenhang immer wieder anbringen konnte. Außerdem sprachen die Damen natürlich über Gwyneiras Schwestern und ihre wundervollen Ehemänner, wobei sie angelegentlich die Hoffnung äußerten, dass bald auch Gwyneira mit einer ähnlich guten Partie gesegnet würde. Gwyneira selbst wusste nicht, ob sie sich das wünschte. Sie fand ihre Schwäger langweilig, und Dianas Gatte war fast alt genug, um ihr Vater zu sein. Man munkelte, dass die Ehe vielleicht deshalb noch nicht mit Kindern gesegnet war, wobei Gwyneira die Zusammenhänge hier nicht ganz klar waren. Allerdings musterte man ja auch ältere Zuchtschafe aus … Sie kicherte, als sie Dianas gestrengen Gatten Jeffrey mit dem Widder Cesar verglich, den ihr Vater gerade widerwillig aus der Zucht genommen hatte.
Und dann Larissas Ehemann Julius! Der stammte zwar aus einer der besten Adelsfamilien, war aber schrecklich farblos und blutleer. Gwyneira erinnerte sich, dass ihr Vater nach dem ersten Kennenlernen verstohlen etwas von »Inzucht« gemurmelt hatte. Immerhin hatten Julius und Larissa bereits einen Sohn – der aber auch schon wie ein Gespenst aussah. Nein, das alles waren nicht die Männer, von denen Gwyneira träumte. Ob das Angebot in Übersee wohl besser war? Dieser Gerald Warden machte einen ganz lebhaften Eindruck, obwohl er natürlich zu alt für sie war. Aber er kannte sich immerhin mit Pferden aus, und er hatte ihr nicht das Angebot gemacht, ihr in den Sattel zu helfen. Ritten Frauen in Neuseeland vielleicht ungestraft im Herrensitz? Gwyneira ertappte sich manchmal beim Träumen über den Romanheftchen der Dienstboten. Wie es wohl sein mochte, mit einem der schneidigen amerikanischen Cowboys um die Wette zur reiten? Ihm herzklopfend bei einem Pistolenduell zuzusehen? Und die Pionierfrauen dort im Westen griffen auch durchaus selbst mal zur Waffe! Gwyneira hätte ein von Indianern umzingeltes Fort jederzeit Dianas Rosengarten vorgezogen.
Jetzt zwängte sie sich aber erst mal in ein Korsett, das sie noch enger einschnürte als das alte Ding, das sie beim Reiten trug. Sie hasste diese Quälerei, aber wenn sie in den Spiegel sah, gefiel ihr die extrem schlanke Taille. Keine ihrer Schwestern war so zierlich. Und das himmelblaue Seidenkleid stand ihr auch ganz hervorragend. Es ließ ihre Augen noch mehr strahlen und betonte das leuchtende Rot ihres Haars. Wie schade, dass sie es aufstecken musste. Und wie mühsam für die Zofe, die schon mit Kämmen und Haarspangen bereitstand! Gwyneiras Haar war von Natur aus lockig; wenn Feuchtigkeit in der Luft lag, wie fast immer in Wales, kräuselte es sich besonders und war schwer zu zähmen. Gwyneira musste oft stundenlang still sitzen, bis die Zofe es vollständig gebändigt hatte. Und dabei fiel ihr Stillsitzen schwerer als alles andere.
Seufzend ließ Gwyneira sich auf dem Frisierstuhl nieder und machte sich auf eine langweilige halbe Stunde gefasst. Doch dann fiel ihr Blick auf das unscheinbare Heftchen, das neben den Frisierutensilien auf dem Tisch lag. In den Händen der Rothaut lautete der reißerische Titel.
»Ich hab mir gedacht, Mylady wünscht ein wenig Kurzweil«, bemerkte die junge Zofe und lächelte Gwyneira im Spiegel an. »Aber es ist sehr gruselig! Sophie und ich konnten die ganze Nacht nicht schlafen, nachdem wir es einander vorgelesen hatten!«
Gwyneira hatte schon nach dem Heftchen gegriffen. Sie gruselte sich nicht so schnell.
Gerald Warden langweilte sich derweil im Salon. Die Herren nahmen einen Drink vor dem Essen. Eben hatte Lord Silkham ihm seinen Schwiegersohn Jeffrey Riddleworth vorgestellt. Lord Riddleworth, erklärte er Warden, habe in der Indischen Kronkolonie gedient und sei erst vor zwei Jahren hochdekoriert nach England heimgekehrt. Diana Silkham war seine zweite Frau, die erste war in Indien verstorben. Warden wagte nicht zu fragen, woran, aber mit ziemlicher Sicherheit war die Dame weder an Malaria noch an einem Schlangenbiss verschieden – es sei denn, sie hätte erheblich mehr Schneid und Bewegungsfreude besessen als ihr Gatte. Riddleworth jedenfalls schien die Regimentsunterkünfte während seiner ganzen Zeit in Indien nicht verlassen zu haben. Über das Land konnte er nicht mehr erzählen, als dass es außerhalb der englischen Refugien laut und schmutzig war. Die Einheimischen hielt er durchweg für Lumpenpack, allen voran die Maharadschas, und außerhalb der Städte war sowieso alles tiger- und schlangenverseucht.
»Einmal hatten wir so eine Natter sogar in unserer Unterkunft«, erklärte Riddleworth angewidert und zwirbelte seinen gepflegten Schnauzbart. »Ich habe das Biest natürlich sofort erschossen, obwohl der Kuli meinte, es sei nicht giftig. Aber kann man diesen Leuten trauen? Wie ist das bei Ihnen, Warden? Haben Ihre Dienstboten dieses widerliche Gezücht unter Kontrolle?«
Gerald dachte belustigt daran, dass Riddleworth’ Schüsse im Haus vermutlich mehr Schaden angerichtet hatten, als selbst ein Tiger jemals hätte zustande bringen können. Er traute dem kleinen, wohlgenährten Oberst kaum zu, einen Schlangenkopf mit einem Schuss zu treffen. Auf jeden Fall hatte der Mann sich eindeutig das falsche Land als Wirkungsbereich ausgesucht.
»Unsere Dienstboten sind mitunter ein wenig … äh, gewöhnungsbedürftig«, sagte Gerald. »Wir setzen meist Eingeborene ein, denen die englische Lebensart doch sehr fremd ist. Aber mit Schlangen und Tigern haben wir nichts zu tun. In ganz Neuseeland gibt es keine Schlangen. Und ursprünglich gab es auch kaum Säugetiere. Erst die Missionare und Siedler brachten Nutzvieh, Hunde und Pferde auf die Inseln.«
»Keine wilden Tiere?«, fragte Riddleworth stirnrunzelnd. »Kommen Sie, Warden, Sie wollen uns doch nicht weismachen, dass es dort vor der Besiedlung wie am vierten Tag der Schöpfung ausgesehen hat.«
»Es gibt Vögel«, berichtete Gerald Warden. »Große, kleine, dicke, dünne, fliegende, laufende … ach ja, und ein paar Fledermäuse. Ansonsten natürlich Insekten, aber die sind auch nicht sehr gefährlich. Sie müssen sich also anstrengen, wollen Sie auf Neuseeland umgebracht werden, Mylord. Es sei denn, Sie greifen auf zweibeinige Räuber mit Feuerwaffen zurück.«
»Vermutlich auch auf solche mit Macheten, Dolchen und Krummschwertern, was?«, fragte Riddleworth lachend. »Also, mir ist es ein Rätsel, wie jemand sich freiwillig in eine solche Wildnis begeben kann! Ich war froh, als ich die Kolonien verlassen konnte.«
»Unsere Maoris sind meist friedlich«, meinte Warden gelassen. »Ein seltsames Volk … fatalistisch und leicht zufrieden zu stellen. Sie singen, tanzen, schnitzen Holz und kennen kein nennenswertes Waffenhandwerk. Nein, Mylord, ich bin sicher, auf Neuseeland hätten Sie sich eher gelangweilt als gefürchtet …«
Riddleworth wollte eben aufbrausend erklären, dass er während seines Aufenthalts in Indien selbstverständlich keinen Tropfen Angstschweiß verloren hatte. Aber dann wurden die Herren durch Gwyneiras Eintreffen unterbrochen. Das Mädchen betrat den Salon – und schaute verwirrt, als es Mutter und Schwester nicht unter den Anwesenden entdeckte.
»Bin ich zu früh?«, fragte Gwyneira, statt ihren Schwager zunächst angemessen zu begrüßen.
Der guckte denn auch entsprechend beleidigt, während Gerald Warden kaum den Blick von Gwyneiras Erscheinung wenden konnte. Das Mädchen war ihm vorhin schon hübsch erschienen, aber jetzt, in dem festlichen Staat, erkannte er sie als wahre Schönheit. Die blaue Seide betonte ihren hellen Teint und ihr kräftiges rotes Haar. Die strengere Frisur betonte den edlen Schnitt ihres Gesichts. Und dazu diese verwegenen Lippen und die leuchtend blauen Augen mit ihrem wachen, fast herausfordernd wirkenden Ausdruck! Gerald war hingerissen.
Aber dieses Mädchen passte nicht hierher. Er konnte sie sich unmöglich an der Seite eines Mannes wie Jeffrey Riddleworth vorstellen. Gwyneira war eher der Typ, der sich Schlangen um den Hals legte und Tiger zähmte.
»Nein, nein, du bist pünktlich, Kind«, meinte Lord Terence mit einem Blick auf die Uhr. »Deine Mutter und deine Schwester verspäten sich. Wahrscheinlich waren sie wieder zu lange im Garten …«
»Waren Sie denn nicht im Garten?«, wandte Gerald Warden sich an Gwyneira. Eigentlich hätte er eher sie im Freien vermutet als ihre Mutter, die er vorhin als etwas steif und gelangweilt kennen gelernt hatte.
Gwyneira zuckte die Schultern. »Ich mache mir nicht viel aus Rosen«, bekannte sie, obwohl sie damit nochmals Jeffreys Unwillen und sicher auch den ihres Vaters erregte. »Wenn es Gemüse wäre, oder sonst etwas, das nicht sticht …«
Gerald Warden lachte, wobei er die säuerlichen Mienen Silkhams und Riddleworth’ ignorierte. Der Schaf-Baron fand das Mädchen entzückend. Sie war natürlich nicht die Erste, die er auf dieser Reise in die alte Heimat einer unauffälligen Musterung unterzog, aber bislang hatte sich keine der jungen englischen Ladys so natürlich und ungezwungen gegeben.
»Na, na, Mylady!«, neckte er sie. »Konfrontieren Sie mich da wirklich mit den Schattenseiten der Englischen Rosen? Sollte sich hinter milchweißer Haut und rotgoldenem Haar Stacheligkeit verbergen?«
Der Ausdruck »Englische Rose« für den auf den britischen Inseln verbreiteten, hellhäutigen und rothaarigen Mädchentyp war auch auf Neuseeland bekannt.
Gwyneira hätte eigentlich erröten müssen, lächelte aber nur. »Es ist auf jeden Fall sicherer, Handschuhe zu tragen«, bemerkte sie und sah aus dem Augenwinkel, wie ihre Mutter nach Luft schnappte.
Lady Silkham und ihre älteste Tochter, Lady Riddleworth, waren eben eingetreten und hatten Wardens und Gwyneiras kurzen Wortwechsel gehört. Beide wussten offensichtlich nicht, was sie mehr schockieren sollte: Wardens Unverschämtheit oder Gwyneiras schlagfertige Antwort.
»Mr. Warden, meine Tochter Diana, Lady Riddleworth.« Lady Silkham beschloss schließlich, die Angelegenheit einfach zu übergehen. Der Mann besaß zwar keinen gesellschaftlichen Schliff, doch er hatte ihrem Gatten eben die Zahlung eines kleinen Vermögens für eine Schafherde und einen Wurf junger Hunde zugesagt. Das würde Gwyneiras Mitgift sichern – und Lady Silkham freie Hand geben, das Mädchen schleunigst unter die Haube zu bringen, bevor die Kunde über ihr freches Mundwerk sich womöglich herumsprach.
Diana begrüßte den Besucher aus Übersee würdevoll. Sie war Gerald Warden als Tischdame zugewiesen, was dieser schnell bedauerte. Das Essen mit den Riddleworths verlief mehr als langweilig. Während Gerald kurze Stichworte gab und so tat, als lausche er Dianas Ausführungen über Rosenzucht und Gartenausstellungen, beobachtete er weiterhin Gwyneira. Abgesehen von ihrem losen Mundwerk war ihr Benehmen untadelig. Sie wusste, wie man sich in Gesellschaft verhielt und plauderte artig, wenn auch offensichtlich gelangweilt mit ihrem Tischherrn Jeffrey. Brav antwortete sie auf die Fragen ihrer Schwester, die ihre Fortschritte in französischer Konversation und das Befinden der werten Madame Fabian betrafen. Letztere bedauerte zutiefst, dem heutigen Abendessen aus Krankheitsgründen fernbleiben zu müssen. Sie hätte sonst zu gern mit ihrer früheren Lieblingsschülerin Diana geplaudert.
Erst als das Dessert serviert war, kam Lord Riddleworth auf seine Frage von vorhin zurück. Offensichtlich ging das Tischgespräch inzwischen selbst ihm auf die Nerven. Diana und ihre Mutter waren mittlerweile dazu übergegangen, sich über gemeinsame Bekannte auszutauschen, die sie durchweg »reizend« fanden und deren »wohlgeratene« Söhne sie offensichtlich für eine Verbindung mit Gwyneira in Betracht zogen.
»Sie haben immer noch nicht erzählt, wie es Sie einst nach Übersee verschlagen hat, Mr. Warden. Sind Sie im Auftrag der Krone gegangen? Womöglich im Gefolge des fabelhaften Captain Hobson?«
Gerald Warden schüttelte lächelnd den Kopf und ließ zu, dass der Diener sein Weinglas noch einmal füllte. Er hatte dem hervorragenden Tropfen bisher nur zurückhaltend zugesprochen. Später würde es noch ausreichend von Lord Silkhams hervorragendem Scotch geben, und wenn er auch nur den Schatten einer Chance haben wollte, seine Pläne zu verwirklichen, brauchte er einen klaren Kopf. Ein leeres Glas würde allerdings Aufmerksamkeit erregen. Also nickte er dem Diener zu, griff zunächst aber nach seinem Wasserglas.