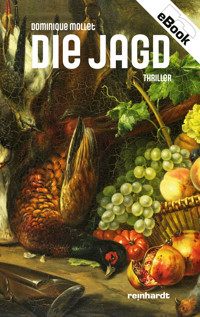
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Stargastronom Frank Frantzen entgeht knapp einem Attentat auf sein Flaggschiffrestaurant. An verschiedenen Orten auf der ganzen Welt ereignen sich weitere Unfälle und mysteriöse Todesfälle in Spitzenrestaurants. Ein Sektenführer, der den Weltruhm anstrebt, glaubt dies ausnutzen und seine Anhängerschaft auf eine bescheidenere Lebensführung einstimmen zu können. Militante Veganerinnen und Veganer sehen in den Anschlägen ein Zeichen, dass die Welt sich gegen den Fleischkonsum wehrt. Und eine grosse Versicherung will mittels KI die Attentäter finden, da sie von einer Serie ausgeht. Währenddessen versucht Frantzen, den Rest seines Restaurantimperiums und sein Leben zu retten. Im Verlauf des Thrillers kreuzen sich die einzelnen Schicksale und weisen mehr Gemeinsamkeiten auf, als den Beteiligten lieb ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DOMINIQUE MOLLET
DIE JAGD
THRILLER
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Manuela Seiler-Widmer
Korrektorat: Daniel Lüthi
Gestaltung: Célestine Schneider
Satz: Jaël Meier
Titelbild: Elisabeth Iosetta Hoopstad: Stillleben (1842).
Öl auf Leinwand, 74,1 x 92,8 cm, Rijksmuseum, Amsterdam
eISBN 978-3-7245-2828-9
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2758-9
Verlag: Friedrich Reinhardt AG, Rheinsprung 1, 4051 Basel, Schweiz, [email protected]
Produktverantwortliche: Friedrich Reinhardt GmbH, Wallbrunnstr. 24, 79539 Lörrach, Deutschland, [email protected]
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2025 unterstützt.
www.reinhardt.ch
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
DANK
AUTOR
«Erwartet euch nicht zu viel vom Weltuntergang»
Stanisław Jerzy Lec
1
Hoch über dem Mittelmeer sass Frank Frantzen in den Ruinen seines Imperiums, als der Raum um ihn herum plötzlich zu zittern begann.
Angefangen hatte alles mit Tofu, diesem gräulich-bräunlichen Block, den die Mütter in den 1970er-Jahren ihren Kindern liebevoll in der Bratpfanne zubereitet hatten und ihnen als Fleischersatz schmackhaft machen wollten. Auch Frank, seinen Brüdern Dirk und Thomas sowie seiner Schwester Daphne wurde dies zum Mittagessen vorgesetzt und sie fanden es scheusslich. Damals entschied er, dass ihm nie wieder so etwas passieren sollte und er beschloss, Starkoch zu werden. Zum grossen Erstaunen seines Umfelds gelang ihm dies schliesslich auch, obschon er weder in seinem Elternhaus noch bei seinen Freunden in einer kulinarisch interessierten Umgebung aufwuchs.
Er wurde zu einem der angesagtesten Köche weltweit und besass einige Sternerestaurants, in denen er abwechselnd selbst kochte oder angestellte Vertrauensköche seine Rezepte zubereiten liess. Flaggschiff war «Le Paradis», ein sündhaft teures Restaurant mit einem exklusiven kleinen Hotel in Èze, an der Grande Corniche, der kurvenreichen Strasse, die Nizza mit dem Fürstentum Monaco verbindet. Vor Jahren war dort die Fürstin Gracia Patricia, die ursprünglich als Grace Kelly Schauspielkarriere gemacht hatte, bei einem ungeklärten Autounfall ums Leben gekommen.
«Le Paradis» lockte zahlreiche Prominente an, auch wenn der Ort nur über diese Strasse und weder per Schiff noch per Helikopter erreichbar war. Frank hatte deshalb einen Shuttleservice eingerichtet oder besser gesagt einen Limousinendienst mit Oldtimern oder speziellen Autos, von denen nur eine limitierte Stückzahl existierte. Diese holten die Gäste in Nizza, Cannes oder Monte Carlo ab und brachten sie wieder zurück.
Nun sass er im ehemaligen Speisesaal seines Restaurants. Links und rechts von ihm türmten sich auf den Tischen Geschirr, Gläser, Schüsseln, Besteck, Tischtücher, Kerzenständer und das gesamte Inventar auf, das er besessen hatte. «Le Paradis» und all seine Restaurants waren Konkurs gegangen und er wartete auf den Liquidator. Zu Beginn konnte er es gar nicht glauben, hatte er doch stets seriös gewirtschaftet.
Der Zusammenbruch war wie aus dem Nichts gekommen und er hatte, obwohl er kein Anhänger von Verschwörungstheorien war, den Verdacht, dass möglicherweise jemand versucht hatte, ihn fertigzumachen. Auf jeden Fall zogen sich plötzlich Investoren zurück und Kunden, mit denen er seit Jahren befreundet war, mieden ihn. Im Moment konnte er sich damit aber nicht beschäftigen, sondern konzentrierte sich auf die Abwicklung des Konkurses, denn allein die Liegenschaft war sehr viel wert und er wollte noch etwas herausschlagen.
Gerade als Frank versuchte, die letzten Monate Revue passieren zu lassen, begann es. Gläser schlugen aneinander, Tellerstapel bewegten sich und rieben gegeneinander und einige Tassen fielen zu Boden. Begleitet wurde das Ganze von einem lauten Knall, den er nicht genau orten konnte.
Kurz darauf stand der hintere Teil des Restaurant- und Hotelkomplexes in Flammen und das Feuer breitete sich rasch aus. Frank konnte sich nicht vorstellen, was detoniert war und den Brand hätte auslösen können. Das Gas war längst abgestellt und es gab kaum explosives Material im Gebäude. Er geriet in Panik und wollte gleichzeitig löschen und sich in Sicherheit bringen. Die meisten Angestellten hatten das Haus schon vor einigen Tagen verlassen und somit war er allein mit dem immer bedrohlicher werdenden Brand. Wo sich sein letzter verbliebener Mitarbeiter Jérôme aufhielt, wusste er nicht.
Einer der Vorteile von Èze war die aussergewöhnliche und einsame Lage auf einem Felsvorsprung mit erschwerter Zugänglichkeit, womit das Heer der Touristinnen und Touristen ferngehalten wurde. Einer der Nachteile war, dass die Gemeinde nur eine kleine Feuerwehr hatte, die im Alarmfall zuerst zu den Einsatzfahrzeugen gelangen musste. Löschhelikopter standen nur bei Waldbränden zur Verfügung und das Meer war zu weit unterhalb der Gemeinde. Dies kam nun zuungunsten von «Le Paradis» zum Tragen.
Frank stürzte aus dem Haus zu seinem auf dem Vorplatz geparkten Mietwagen. Ob es Jérôme aus dem Haus geschafft hatte, wusste er damals nicht. Als er in Panik über die kurvenreiche Strasse Richtung Monaco raste, sah er im Rückspiegel seines Autos eine gewaltige zweite Explosion und eine riesige Rauchsäule aufsteigen.
2
Er sah umwerfend aus in seinem hellbraunen Massanzug, vom dem Er sich gleich ein Dutzend hatte anfertigen lassen, den handgemachten braunen Lederschuhen und mit seiner nach hinten gekämmten Frisur, bei der jedes Härchen zu sitzen schien. Seit Jahren hatte Er dieses Bild von sich aufgebaut und es gab kaum einen Menschen, der ihn anders gesehen hatte in dieser Zeit. Einen Namen brauchte Er nicht mehr und auch lästige Unannehmlichkeiten wie Passkontrolle, Schlangestehen oder das Erledigen etwelcher Formalitäten hatte Er längst an seinen treuen Sekretär delegiert, der dafür sorgte, dass Er sich um seine spirituelle Welt kümmern konnte.
Trotzdem wäre es falsch zu behaupten, dass Er nichts um sich herum mitbekam, weltfremd geworden wäre oder sich nicht mehr um die Geschehnisse gesorgt hätte. Nach wie vor interessierte Er sich für Nachrichten, politische und gesellschaftliche Entwicklungen und saugte alles auf, was es an nützlichen und nutzlosen Informationen gab. Den anderen immer einen Schritt voraus sein, war seine Devise, konnte Er doch nur auf diese Weise seine Anhängerinnen führen und sie von ihm abhängig machen.
Mit grosser Freude erfuhr Er von der Explosion eines Restaurants im französischen Èze. Seit jeher war Er ein Gegner dieser überteuerten und aus seiner Sicht degenerierten Küche. Er hatte bereits eine ganze Liste dieser Orte angefertigt, die es zu bekämpfen galt, und auch verschiedentlich seine Anhängerschaft zur Gewalt gegen «Oasen des Luxus», wie Er dies nannte, aufgestachelt. Eines seiner Zentren lag denn auch nicht weit entfernt im gebirgigen Hinterland Nizzas. Auf der anderen Seite hatten seine Anhänger bisher wenig zustande gebracht, was wohl auch am Umstand lag, dass Er sie möglichst wenig zu selbstständigem Denken geformt hatte und sie deswegen nur unzureichend planen konnten.
Als Vorsichtsmassnahme liess Er seine Jünger ihre bürgerlichen Namen ablegen, was eine allfällige polizeiliche Untersuchung enorm erschweren und vermutlich verunmöglichen würde. Wie stolz war Er auf seine Vorsehung. Wenn Er es nicht schon damals geahnt hätte, wäre ihm seine Genialität jetzt bewusst geworden.
Ebenso hatte Er auch angeordnet, den Fleischverzehr seiner Anhängerschaft zu drosseln oder vollkommen zu unterbinden, da das im Fleisch enthaltene Vitamin A aus seiner Sicht die Widerstandsfähigkeit der Menschen gegen ihre Vorgesetzen förderte. Zudem waren die Kosten für seine Leute auf diese Weise geringer. Dieser Verzicht betraf ihn selbstverständlich nicht, denn jemand musste schliesslich beurteilen können, ob es wirklich schädlich sei.
Er selbst hatte seine alte Identität schon lange aufgegeben und wohl niemand ahnte, dass Er ursprünglich ein Metzgersohn aus Lothringen war, der das elterliche Geschäft hätte übernehmen sollen, weswegen Er früh von zu Hause weggelaufen war. Nachdem Er sich eine Weile durchgeschlagen hatte, entdeckte Er unerwartet seine Muse, die ihn zu dem beflügelte, was Er nun war. Mit ein paar weiteren Menschen hatte er eine Gruppe gegründet, die bald wegen ihrer Radikalität gefürchtet war und dadurch von Vermietern oder Behörden beinahe alles bekam, was sie jeweils forderte. Die Gruppe wuchs und ordnete sich ihm unter. Nur die Muse wollte mehr als Muse sein und war eines Tages plötzlich verschwunden. Darüber zeigte Er sich gegen aussen sehr traurig, wusste aber, dass sie sicherlich nie wieder auftauchen würde. Irgendwie hatte ihm das elterliche Handwerk doch etwas genützt.
Er war in diese Gedanken versunken, als sein Sekretär eintrat und ihm den erwarteten Besuch ankündigte. Sie begrüssten sich höflich, allerdings ohne einander die Hand zu geben und Er bot seinem Gast einen Kaffee an, was dieser ablehnte. Er konnte ja nicht ahnen, dass dies eine Vorsichtsmassnahme war, da sein Gegenüber möglichst wenig Möglichkeiten bieten wollte, dass seine DNA gesammelt werden konnte.
Irgendwie hatte er sich seinen Gast anders vorgestellt, auch wenn ihm dies eigentlich egal war, schliesslich ging es nur ums Geschäft. Immerhin sah er etwas aus wie ein Verschnitt von Alain Delon und Buster Keaton, was wohl daher rührte, dass er eiskalt emotionslos sprach und nie auch nur im Geringsten lächelte oder seine Miene verzog.
Der Gast schien sich kaum für lange Ausführungen zu interessieren, sondern sprach nur über Ziele, Honorare und wie sie kommunizieren sollten, um zu vermeiden, dass ihre Zusammenarbeit von irgendjemandem entdeckt würde. Zum Glück verfügte Er in seiner Gemeinschaft über zahlreiche Zentren auf der ganzen Welt, womit Honorare nicht über Landesgrenzen überwiesen werden mussten und eine Art Kurierdienst bestand, auch wenn die Kuriere selbst keine Ahnung hatten, welche Informationen sie transportierten.
Referenzen brachte der Gast selbstredend keine mit, sondern meinte lakonisch, dass einige Unfälle und Verbrechen in der Berichterstattung grosser Medien auf seine Kappe gingen. Mehr sollte und brauchte niemand zu erfahren. Sie einigten sich im Grundsatz und legten die nächsten Ziele fest. Danach verabschiedete sich der Gast, ohne je seinen Namen genannt zu haben.
Er war sehr zufrieden mit sich selbst und dachte daran, dass Er damit seinem Ziel, einen Platz im Geschichtsbuch der Welt zu erhalten, näher kam, obwohl Er gleichzeitig wusste, dass die Bewertung seiner Leistung unterschiedlich gedeutet werden würde. Trotzdem beschlich ihn ein ungutes Gefühl. Was würde passieren, wenn sich sein Gast plötzlich gegen ihn wenden würde, schien dieser doch keine Skrupel zu kennen, wenn der Betrag stimmte? Er beschloss daher, seine eigenen Sicherheitsmassnahmen zu verstärken, vielleicht sogar mit einem Doppelgänger.
3
Daphne war Biobäuerin mit Leib und Seele und liebte ihren Beruf. Auch wenn ihre Arbeit zunehmend von Vorschriften und Reglementen geprägt war, empfand sie es als wichtig, naturnahe Landwirtschaft zu betreiben. Sie kannte natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die rationeller arbeiteten und wesentlich besser verdienten, doch war ihr Geld nicht wichtig. Zudem wurde ihre Situation durch grosszügige Zuwendungen der Europäischen Union gemildert und es gab zahllose Quellen, die sich für einen Subventionsbeitrag finden liessen.
Als Kind hatte sie eigentlich Tierärztin werden wollen.
Als sie jedoch in der Schule zum ersten Mal eine Ratte sezieren musste, verging ihr das Vorhaben – sie fand es grässlich, die Innereien eines toten Tiers zu präparieren und es wurde ihr damals übel. Erst viel später realisierte sie, dass sie auch als Bäuerin mit Tierzucht vor ähnlichen Problemen stand und kranke Tiere behandeln musste. Hinzu kam das Schlachten, das sie zwar nicht selbst vollzog, bei dem sie aber meist dabei war. Eine Ratte, die sie nicht namentlich gekannt hatte, wäre plötzlich willkommener gewesen als ein Tier, das sie aufgezogen hatte und dessen Leben in ihren Händen lag. Immerhin war sie Pragmatikerin genug, um zu wissen, dass jeder Beruf seine Nachteile hatte.
Mit ihren Geschwistern hatte sie seit der Jugendzeit kaum mehr Kontakt, da ihre Arbeit sie stark in Anspruch nahm. Freie Tage gab es selten und die Tiere konnten nicht allein gelassen werden. Zudem spielte sich ihr Leben auf ihrem Hof und im Kreis Gleichgesinnter ab und sie sah keine Notwendigkeit, sich auch noch um andere Probleme der Gesellschaft zu kümmern.
Trotzdem erschrak sie, als sie vom Anschlag auf das Restaurant ihres Bruders erfuhr. Eigentlich hätte sie dies gar nicht mitbekommen, wenn nicht eine Nachbarin zu ihr gekommen wäre und ihr davon berichtet hätte. Diese Nachbarin belieferte verschiedene Toprestaurants und hatte so davon erfahren. Und da sie wusste, dass Daphne einen Spitzengastronomen zum Bruder hatte, fragte sie, ob dies vielleicht ihr Bruder sein könnte.
Daphne dachte, dass ihr Bruder in ihren Tieren ohnehin nur das Entrecote sähe und der Rest ihn kaum interessierte, dies wollte sie nicht unterstützen. Das Brimborium, das gewisse Leute ums Essen machten, war ihr zutiefst zuwider. Sie hatte damals das Elternhaus früh verlassen und schlug sich durch. Sie träumte von Gesellschaftsutopien und wollte die Welt in vollkommen neue Bahnen lenken. Irgendwann realisierte sie, dass dies wohl kaum gelingen könne und sie fand, mit ihrer Berufung als Biobäuerin wenigstens einen Beitrag an eine bessere Welt leisten zu können.
Nun machte sich Daphne aber doch Sorgen um ihren Bruder, denn eine lebensbedrohliche Situation für ein Familienmitglied verändert viel, auch wenn das Verhältnis zuvor eher distanziert gewesen war. Allerdings war es gar nicht so einfach, an Informationen zu kommen. Es gab ein paar dürre Hinweise im Internet und ein paar Bilder eines ausgebrannten Restaurants in Südfrankreich, das wohl ihrem Bruder gehört hatte. Hinzu kam, dass ihr Französisch äusserst mangelhaft war und sie schon Mühe hatte, richtige Suchworte einzugeben. Mit der Zeit schaffte sie es doch noch, die Geschichte so weit zu rekonstruieren, dass sie sicher war, dass es sich um ihren Bruder handeln musste und es wohl keine Opfer beim Brandanschlag gegeben hatte.
Das nächste Problem bestand nun darin, Frank zu finden. Sie hatte keine Ahnung, mit wem er verkehrte und wo sie ihn suchen sollte. Auch hatte sie selbst kein grosses Bekanntennetzwerk mehr, seit sie als Biobäuerin von ihrer Arbeit absorbiert wurde. Immerhin kamen ihr ein paar alte Freundinnen und Freunde in den Sinn, die sie aus ihrer WG-Zeit kannte und mit denen sie vor Jahren auch demonstriert hatte. Sie erinnerte sich an die grossen Proteste der Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss, der besagte, dass die deutsche und die amerikanische Regierung Pershing-Atomraketen in Deutschland stationieren würden, falls die Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion nicht zum Ziel führten. Dies war ein Thema, das die frühen 1980er-Jahre geprägt hatte. Für Daphne war es eine herrliche Zeit, genoss sie doch die Demonstrationen, an denen sie gleichgesinnte Menschen kennenlernte, mit denen sie nächtelang die Welt verbessern konnte.
Damals spielte Oli eine grosse Rolle, sowohl politisch als auch privat. Er war zeitweise ihr Freund, auch wenn seine Treue nicht allzu stark ausgeprägt war. Dieser Mann hatte immer wieder gute Informationen und wusste oder recherchierte Dinge, die sie zum Staunen brachten. Später verlor sich der Kontakt, doch tauchte Oli immer wieder in Zeitungsartikeln auf und sie konnte seinen Weg in der alternativen Szene ab und zu verfolgen. In ihrer Umgebung gab es zahlreiche Bäuerinnen und Bauern, die bei Protesten mitwirkten oder politisch in verschiedenen Parteien oder Interessengruppen aktiv waren. Daphne beschloss, dort etwas herumzufragen, ob jemand irgendeinen Zugang zu Oli habe. Sie war überzeugt, dass er ihr helfen könnte und würde, war er doch nun in der Politik verankert und kannte vermutlich zahlreiche offizielle und inoffizielle Staatsstellen. Irgendjemand würde sicherlich wissen, wie sie ihren Bruder finden konnte.
Sie begann, in ihrem Umfeld, auf dem Markt oder bei Nachbarn und Produzenten herumzufragen und bald war bekannt, dass Daphne ihren Bruder suchte. Dass ihre Grundidee, die Suche mithilfe von Oli voranzutreiben, keine gute Idee war, konnte sie nicht ahnen.
4
Die Gruppe jubelte, als sie von der Explosion an der Côte d'Azur erfuhr. Sie hatte sich erst langsam zu einer radikalen Vereinigung entwickelt. Wie die Aktionisten gegen Tierversuche oder gegen das Pelztragen hatten sich Freunde zusammengefunden, denen es ums Tierwohl ging und die mit ihrer Lebensweise die Tiere vor der Züchtung oder vor der aus ihrer Sicht ungesunden Tierhaltung bewahren wollten. Ihr Fokus lag auf dem völligen Verzicht auf tierische Produkte sowie auch auf Nebenprodukte wie Eier, Fell oder Leder.
Es hatte harmlos begonnen, mit kleinen Standaktionen vor Supermärkten, Flyern in Briefkästen und dem Hinweis, wenn sie bei Freunden eingeladen waren, dass sie Veganer seien. Aber anstatt damit für ihre Anliegen zu werben und neue Anhängerinnen und Anhänger zu begeistern, wurden sie meist weniger oder überhaupt nicht mehr eingeladen. Auf diese Weise verkleinerte sich der bisherige Bekanntenkreis, während zunehmend Gleichgesinnte dazukamen.
Die persönliche politische Grundhaltung wurde zum privaten Hauptgesprächsthema und langsam bildete sich eine Interessengemeinschaft, die das eigene Handeln als gut und alles andere als schlecht betrachtete. Abweichende Meinungen wurden schnoddrig als «jemand sei leider noch nicht so weit» abgetan, was den Umgang mit Andersdenkenden nicht speziell erleichterte.
An Elternabenden wurde veganes Essen in der Schule eingefordert und Eltern, welche dies als unnötig empfanden, mit verächtlichen Blicken bestraft, was diese aber meist gar nicht erst wahrnahmen. Ebenso in Firmenkantinen, bei denen sie oft buchstäblich auf Granit bissen. Zwar gab es begrenzte vegane Angebote, doch blieben dies Nischen ohne grosse gesellschaftliche Wirkung. Dabei lehnten sie die Vegetarierinnen und Vegetarier ebenso ab wie Lebensmittelläden, die Fleischersatz anboten, damit wenigstens der Eindruck, man würde Fleisch essen, erhalten blieb.
Mit dieser ideologischen Einengung wandelte sich auch ihre Gruppe. Die Gemässigten zogen sich mehr und mehr zurück und übrig blieben diejenigen, die sich gegenseitig zu Ideen und Vorhaben aufstachelten. Dabei aber blieben sie auf der sicheren Seite, sie protestierten nur an Orten, an denen ihnen nichts geschehen und wo sie auch nicht belangt werden konnten.
Wann es genau gekippt war, wusste im Nachhinein niemand mehr. Sicherlich gab es andere wie die Pelzgegner, die begannen auf Leute loszugehen oder deren Pelzmäntel vollzusprayen, und auch die Aktionen der Tierversuchsgegner wurden militanter. Der Reiz, in diesem Wettbewerb mitzumachen, war gross und wuchs beinahe täglich.
So kam es, dass sie zu einer ersten Aktion schritten und eine Metzgerei besetzten respektive den Eingang verbarrikadierten. Der Erfolg war mässig. Ausser einem erzürnten Metzger, ein paar Kundinnen und Kunden sowie der eilig herbeigerufenen Polizei nahm niemand davon Kenntnis. Und wäre da nicht eine höhere Busse gewesen, hätten sie sich selbst kaum an diesen Tag erinnert.
Die Busse aber war für sie ein Mahnmal. Die repressive Gesellschaft hatte das, was zu ihrem Wohl geschehen sollte, ignoriert und sich autoritär gegen die Veganergruppe verhalten. Für eine Vereinigung, die sich hauptsächlich am Widerstand ihrer Gegenüber orientiert, war dies ein gefundenes Fressen.
Nun galt es, den vermeintlichen Schwung umzusetzen. Trotzdem wollten sie nicht in die Illegalität abrutschen, benötigten aber Anleitungen, wie sie sich verhalten sollten. Zum Glück gab es eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Kursen für gewaltlosen Widerstand gegen den Staat, zivilen Ungehorsam und Kampagnenseminare, wie politische Aktionen ausserhalb des Parteibetriebs organisiert werden können und ein paar von ihnen nahmen daran teil.
Rasch bemerkten sie, dass sie dort nicht sehr ernst genommen und belächelt wurden, wimmelte es an solchen Anlässen doch von professionellen Figuren, die Protestbewegungen von Streik über Strassenblockaden bis zur Störung von Atommülltransporten organisierten und anführten. Sie selbst sogen alles auf, was sie lernen konnten, waren aber nie ganz sicher, ob sie Tipps bekamen oder ob die anderen sie für ihre eigenen Zwecke instrumentalisieren wollten, etwa wenn diese vorschlugen, sie bei einer Aktion zu begleiten.
Je mehr sie an solchen Veranstaltungen lernten, desto grösser wurden die Spannungen in ihrer Gruppe, da die einen anwenden wollten, was sie nun gelernt hatten, während andere zur Zurückhaltung mahnten und befürchteten, dass sie sich zu stark gesellschaftlich exponieren würden, was wieder andere kritisierten. Die Gruppe stand erneut an einem Scheideweg und bemerkte, dass nicht alle mitziehen würden, falls sie dem Veganismus entscheidend helfen wollten.
Es kam, wie es kommen musste und endete mit einem Eklat, der sich an einem kleinen Detail entzündete, welches das Fass zum Überlaufen brachte. Die Tochter eines Gruppenmitglieds wollte einen fleischessenden Mann heiraten, was von einem Teil der Veganerinnen und Veganer als Verrat an der Sache betrachtet wurde. Die Mutter wurde aufs Übelste beschimpft und sollte dafür sorgen, dass diese Hochzeit nicht zustande käme. Diese aber verglich ein solches Vorgehen mit der Inquisition im Mittelalter und mit arrangierten Ehen, die nicht mehr zeitgemäss wären. Zudem verbat sie sich, dass die anderen sich in ihr Privatleben einmischten und das Glück ihrer Tochter zerstören wollten.
Zwei der drei Leitfiguren ihrer Gruppe, Frieder und Werner, traten deshalb sofort aus und wollten sich anderen, aktiveren Veganern anschliessen. Der Rest der Gruppe blieb beisammen und konzentrierte sich darauf, kleinere Aktionen zu planen oder vorzubereiten.
Als sie nun von der Sache in Èze erfuhren, waren sie nicht sicher, ob wohl die beiden darin involviert waren, denn diese hatten vor geraumer Zeit über ähnliche Vorhaben diskutiert.
5
Die Niagarafälle gehören zu den eindrücklichsten Naturattraktionen und ziehen jährlich Millionen von Touristen an. Gewisse Besucherinnen und Besucher waren zwar manchmal etwas enttäuscht, wenn sie erfuhren, dass der Wasserfall abgestellt oder stark reduziert werden könne und somit der Mensch über diese Urgewalt herrschte.
Doch kaum waren sie wieder in der Nähe der Fälle, wich diese Enttäuschung der Faszination über die tosenden Wassermassen.
Ein solcher Anziehungspunkt brachte es mit sich, dass auch eine Infrastruktur für die Touristenmassen bereitgestellt wurde und einige der Hotels auf der amerikanischen Seite waren beinahe bis ans Wasser gebaut worden. Die kanadische Seite war zurückhaltender, vor allem aber deswegen, da die Sicht auf die Fälle ohnehin viel schlechter war. Einer der besten Türme vor Ort befand sich trotzdem auf der kanadischen Seite. Auf seiner Spitze thronte ein Drehrestaurant, das von McMurphy schon in der dritten Generation geleitet wurde. Es galt als kulinarischer Höhepunkt der Region und die Plätze waren auf Monate ausgebucht, vor allem die Fensterplätze. Das Restaurant kragte aus dem Gebäude wie ein grosser Pilz. Die Aussicht auf die Fälle war atemberaubend, auch wenn der Rest der Aussicht in die anderen Himmelsrichtungen keinerlei spektakuläre Höhepunkte aufwies.
McMurphy galt unbestritten als einer der Chefköche Kanadas. Dies und die phänomenale Aussicht führten zu exorbitant hohen Preisen, welche die Gäste offenbar gern bereit waren zu bezahlen.
Über dem Restaurant befand sich eine Aussichtsterrasse, die ebenfalls sehr beliebt war. Wegen der grossen Besuchermenge war die Zugangskontrolle des Gebäudes schwierig und es war ein Leichtes, sich Einlass zu verschaffen.
Dies galt auch für jene drei Personen, deren Ziel nicht das Restaurant, sondern die Etage darunter war mit dem aufwendigen Antrieb, damit sich das ganze Restaurant drehen konnte. Licht, Heizung und Wasser mussten so angeordnet werden, dass sie sich im zentralen Teil des Gebäudes befanden oder über mitdrehende Elemente verbunden waren.
Natürlich konnte ein solches Restaurant vom Gewicht her nicht aus seiner Verankerung gehoben werden, aber eine massive Störung des Antriebs würde zu einer Überhitzung führen. Damit könnte leicht ein Brand ausgelöst werden.
Gesteuert wurde das Drehrestaurant von verschiedenen Elektromotoren, welche die drehende Grundplatte bewegten, auf der sich die Tische und Stühle befanden. Die schwere Mechanik brachte es mit sich, dass viel Schmiermittel und Öl verwendet wurden, damit die Bewegung reibungslos ablief. Trotz regelmässiger Revisionen waren Motoren und Antrieb nicht ganz dicht, was die drei Eindringlinge für ihre Zwecke nutzten. So konnten ein paar der Motoren blockiert werden, die dadurch heiss liefen und Schmiermittel und Öl entzündeten. Hinzugefügt wurde allerdings noch Brandbeschleuniger, da es für sie keine Rolle spielte, ob die Ursache später entdeckt werden würde.
Die Gäste und McMurphy ahnten nichts von solchen Plänen und Machenschaften in der Etage unter ihnen, bis das Feuer effektiv ausbrach. Es war eine Ironie des Schicksals, dass wohl an kaum einem Ort so viel Wasser vorhanden ist wie an den Niagarafällen, doch konnte dieses nicht einfach zum Löschen eines Hotelturms umgeleitet werden.
Das Hotel war etwas in die Jahre gekommen und zwar auf dem neuesten Sicherheitstand, umfasste aber ältere Materialien, die nicht alle gleich feuersicher oder teils spröde geworden waren. Zudem war der Nachteil der Pilzform, dass alle Gäste nicht dezentral fliehen konnten, sondern über den zentralen Teil des Gebäudes die Treppenhäuser benutzen mussten. Für Panik war deshalb gesorgt.
Die Feuerwehr verfügte nicht über solch hohe Leitern, um einen Wolkenkratzer zu löschen und konnte das Gebäude nur bis in eine gewisse Höhe kühlen. Oberhalb konnten nur Helikopter aktiv werden, wobei diese prioritär zur Rettung von Menschen eingesetzt wurden. Gleichzeitig verfügte das Restaurant wie alle Hochhäuser über eigene Wasser- und Sprinklersysteme, mit denen das Wasser in die höchsten Etagen gepumpt werden konnte.
Das Feuer, das an verschiedenen Orten gelegt worden war, verbreitete sich rasch. Dokumentiert wurde es von Tausenden von Mobiltelefonen von Touristen, die stets auf der Suche nach einen Bildmotiv oder einer Sensation waren, die sie mit dem Brand geliefert erhielten. Noch bevor die erste Fernsehstation über die Katastrophe berichtete, waren die Bilder bereits auf der ganzen Welt via Social-Media-Kanäle geteilt worden.
Im Inneren des Restaurants spielten sich chaotische Szenen ab. Alle Gäste, aber auch das Personal drängten zusammen in die Mitte, in der sich die Treppenhäuser und die nicht mehr funktionierenden Lifte befanden. Mehrere Personen wurden im Gedränge verletzt und zwei starben vor Ort. Ohnehin war das Restaurant nicht nur gut besetzt, sondern auch relativ eng bestuhlt, was die Schwierigkeiten vergrösserte.
Ganze Tische wurden umgeworfen und auf dem Boden mischte sich Geschirr mit Glasscherben, Esswaren, Getränken, Jacken und Handtaschen. Menschen schrien herum, suchten ihre Angehörigen und wollten sicher sein, dass ihre Familien beisammenblieben. Am Boden flackerten immer wieder Flammen durch den Teppich und entzündeten Tischtücher, Stuhllehnen und Dekormaterialien.
McMurphy war auch daran zu fliehen. Die Regel aus der Seefahrt, wonach der Kapitän als Letzter von Bord geht, gab es bei Restaurants nicht, weshalb er nicht abwarten wollte, bis alle Gäste in Sicherheit waren. Kurz vor dem Treppenhaus allerdings kippte eine Anrichte und erschlug ihn.
Die Medien berichteten in Sondersendungen vom Geschehen und den zahlreichen Opfern, gingen aber zuerst von einem Unglück aus und holten Fachleute ins Fernsehstudio, die von den Gefahren erzählten, die solche Antriebe bargen. Erst als die Brände nach einem Tag völlig gelöscht waren und die Polizei ihre Ermittlungen aufnehmen konnte, entdeckte diese, dass es sich um einen Anschlag gehandelt hatte. Zu diesem Zeitpunkt die Täter noch irgendwo auf der Flucht zu erwischen, erwies sich als unmöglich.
6
Als Frank endlich in der Nähe von Toulon ankam, hatte er sich von seiner Panik etwas erholt. Schon als er die erste kleinere Explosion in seinem Restaurant erlitten hatte, war er geschockt gewesen. Nachdem er aber nach seiner überstürzten Abfahrt im Rückspiegel eine weit grössere zweite Explosion gesehen hatte, konnte er sich zuerst kaum beruhigen.
Sein erster Gedanke war, möglichst weit weg vom Geschehen zu gelangen, als könnte auf dem Weg noch eine Gefahr lauern. Glücklicherweise kannte er die Strasse nach Nizza praktisch im Schlaf, sonst wäre er womöglich in einer der engen Kurven über die Strasse hinaus in den Abgrund gestürzt.
Irgendwo unterwegs hielt er auf einem Autoabstellplatz und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Er konnte sich allerdings nicht vorstellen, wer ihm nach dem Leben trachtete und Gastronom war grundsätzlich kein lebensgefährlicher Beruf.
Sein nächster Gedanke war, dass er irgendwo Unterschlupf finden und sich verstecken müsste, falls ihn irgendjemand verfolgte. Er traute sich nicht mehr, sein Mobiltelefon zu benutzen und schaltete es aus. Dann kam ihm in den Sinn, dass sich auch ausgeschaltete Telefone orten liessen, doch wollte er nicht auf seine Kontakte verzichten. Deshalb behielt er es bei sich.
Dann ging er im Kopf die Liste durch, wen er in Südfrankreich kannte und wer ihn wohl für ein paar Tage aufnehmen könnte. Ein Hotel oder eine Wohnung kamen nicht infrage, da er dort aufgespürt werden könnte. Die meisten Kontakte waren Kunden, Geschäftspartner und Bekannte, wobei ihm auffiel, dass er eigentlich gar keinen richtigen Freundeskreis besass, der ihm helfen könnte, wenn er in Schwierigkeiten war.
Schliesslich kam ihm eine Uraltfreundin in den Sinn, die er schon lange nicht mehr gesehen hatte, zu der er aber einen guten Draht hatte und die er sehr mochte. Sie war Schriftstellerin und lebte zurückgezogen irgendwo an der Côte d'Azur. Und er hatte eine Telefonnummer von ihr, von der er hoffte, dass sie noch funktionierte.
Rasch startete er sein Telefon wieder und suchte in seinem Adressverzeichnis wild durcheinander verschiedene Nummern. Er hoffte, dass auf diese Weise ein potenzieller Überwacher wenigstens nicht gleich wusste, wen er wirklich kontaktieren wollte. Frank notierte anschliessend die entsprechende Telefonnummer.
Ebenfalls musste er sein Auto für den Moment loswerden, damit ihn niemand entdecken konnte. Allerdings wollte er zuerst seine Unterkunft für die nächsten Tage sichern.
Telefonkabinen wie früher gab es kaum mehr und das eigene Telefon war keine Option. Er fuhr deshalb nach Nizza in eines der Grandhotels, das er normalerweise nicht frequentierte, und wurde dort fündig. In der Lobby befanden sich noch ein paar dieser alten Kabinen, in denen man Gespräche führen konnte.
Nach mehrmaligem Klingeln hob am anderen Ende jemand mit «Allo?» ab und Frank fragte, ob Marilena am Telefon sei. Er war überglücklich, ihre Stimme zu hören und schilderte, dass er ein paar Tage Auszeit benötige, ohne Details zu nennen. Marilena war pragmatisch und stellte zum Glück keine Fragen, sondern begnügte sich damit, dass er versprach, ihr alles zu erzählen. Sie freute sich, dass Frank sie besuchte. Sie wohnte allein und hatte selten Gäste, was ihr im Grunde genommen recht war. Gleichzeitig hoffte er, dass sie eine gute Kaffeemaschine hatte, denn er trank zu jeder Tageszeit Unmengen Espressi.
Früher war sie als Schriftstellerin sehr viel unterwegs und ein beliebter Gast an Partys gewesen, doch nun mochte sie das alte Leben nicht mehr. Trotzdem war es schön, wieder einmal einen Menschen zu treffen, den sie einst geliebt hatte, und zu erfahren, was seither mit ihm passiert war.
Glücklicherweise wohnte Marilena in der Nähe von Toulon. Frank erklärte ihr, dass er ohne Auto unterwegs sei und bat sie, ihn am Bahnhof Toulon abzuholen. Sie willigte ein.
Nach dem Telefonat begab sich Frank zum Flughafen von Nizza. Immer wieder schaute er in den Rückspiegel, konnte aber letztlich kein verdächtiges Fahrzeug erkennen, auch wenn er gleich wieder panisch wurde, wenn dasselbe Auto nach drei Rotlichtern immer noch hinter ihm fuhr. Aus diesem Grund machte er verschiedene Umwege, bis er schliesslich am Flughafen eintraf. Dort stellte er seinen Wagen ins Langzeitparking, aber nicht in die VIP-Sektion, in der er abonniert war.
An mehreren Geldautomaten hob er mit verschiedenen Kreditkarten Geld ab, das ihm für die nächste Zeit reichen sollte. Dann nahm er einen Bus zum Bahnhof Nizza und kaufte dort ein Bahnticket zweiter Klasse nach Marseille, das er in bar bezahlte. Im Zug wunderte er sich über die Enge, er war seit Jahren nicht mehr Eisenbahn und vor allem nicht in der zweiten Klasse gefahren.
Die Reise nach Marseille erschien ihm endlos, aber er wollte diesen Umweg fahren, um sicher zu sein, dass ihm auch hier niemand folgen würde. In Marseille angekommen stieg er in einen weiteren Bus, der ihn zum Bahnhof von Toulon brachte. Er ging auf einen Bahnsteig, um von dort wieder in die Ankunftshalle zurückzukehren, sodass Marilena denken würde, er sei mit dem Zug gereist.
Ihr wäre dies wohl weder aufgefallen noch interessierte es sie, konnte sie vom Geschehen doch nichts ahnen. Nach einer heftigen Begrüssung gingen sie zu ihrem Auto und fuhren aus Toulon hinaus in die liebliche, ländliche und ruhige Gegend im Hinterland.
Dies war das erste Mal seit der Explosion, dass sich Frank einigermassen entspannen konnte. Marilena hatte zu seiner Begrüssung rasch ein paar Dinge eingekauft und sie genossen Oliven, Käse, etwas Pâté und einen köstlichen Weisswein aus der Region. Und dann erzählte er seine Geschichte.
7
Nachdem Jérôme endlich zu Hause angekommen war, erwartete ihn eine unangenehme Überraschung.
Er stammte ursprünglich aus der Karibik und seine Familie lebte in Haiti. Der Kontakt zu seinen Verwandten war allerdings seit Jahren eingeschlafen und er konnte ohnehin nicht nach Hause zurückkehren, da die politische Lage zu unsicher war.
Sein ganzes Leben lang hatte er sich allein durchgeschlagen und war für sich selbst verantwortlich. Auch war er stolz darauf, was er trotz schlechter Ausgangslage alles erreicht hatte. Seine Karriere glich buchstäblich der eines Tellerwäschers, auch wenn ihm der zweite Teil, derjenige zum Millionär, fehlte. Er hatte hingegen mehrfach Glück gehabt – neben der Tatsache, dass er sehr fleissig und strebsam war und über eine rasche Auffassungsgabe verfügte.
Bereits als Jugendlicher arbeitete er in der Küche eines Hotels, das zu einer weltweiten Kette gehörte. Bei einem der zahlreichen Putschversuche und anderen Unruhen unter der Herrscherfamilie Duvalier rettete er dem stellvertretenden Hotelchef das Leben, indem er ihn bei einer Schiesserei zurückhielt, sodass dieser nicht zwischen die Fronten geriet. Kurz darauf nahm ihn der Hotelchef mit, als er nach Brasilien versetzt wurde.
Jérôme diente sich in der Hotelhierarchie hoch und machte durch seine zuverlässige Arbeit auf sich aufmerksam. Er konnte auch mit schwierigen Gästen umgehen, was ihn zum unverzichtbaren «Inventar» eines Hotels werden liess. Immer stärker rückte er in das Luxussegment der Hotellerie und Gastronomie. Nachdem er auf fast allen Kontinenten gearbeitet hatte, wollte er sich am liebsten in Europa niederlassen.
Die Gelegenheit bot sich mit dem Imperium von Frank Frantzen, den er in einem Hotel in Singapur kennengelernt hatte, in dem er gearbeitet hatte. Die beiden fanden einander sympathisch und Frank war stets auf der Suche nach hervorragenden Mitarbeitern, auf die er sich verlassen konnte. Eines Abends bot ihm der Gastronom einen Job an und Jérôme sagte begeistert zu. Zuerst war er in New York angestellt. Später wurde er nach Südfrankreich mitgenommen und konnte endlich in Europa leben.
Nach der Explosion in Èze verliess er den Ort fluchtartig. Da er sein Auto ohnehin ausserhalb des Hotelgeländes abgestellt hatte, konnte er es für seine Fahrt nutzen. Auf dem Weg kamen ihm mehrere Feuerwehrautos, Ambulanzen und die Polizei entgegen.
Er fuhr nicht gleich in seine kleine Wohnung ausserhalb Nizzas, die er gemietet hatte, da er sich das Wohnen am Meer nicht leisten konnte. Frank hatte ihm zwar eine Wohnung in Èze angeboten, was er jedoch nicht annehmen konnte. Immerhin hatte er ein Zimmer dort, das er nutzen konnte, wenn er nicht mehr nach Hause fahren wollte oder das Verkehrschaos an der Côte d'Azur noch etwas grösser war als ohnehin schon.
Jérôme hielt mehrfach an und kaufte an verschiedenen Orten Lebensmittel und sonstige Alltagsgegenstände, die er gerade brauchte. Irgendwann bemerkte er, dass es war, als wäre in Èze nichts geschehen, und er führte das darauf zurück, dass er ziemlich krisenerprobt war. Die Erschöpfung und das Verarbeiten des Geschehens würden wohl erst am Abend oder am nächsten Tag kommen.
Als er das Haus mit seiner Wohnung erreichte, kam ihm ein Mann entgegen, der in einem Auto auf ihn gewartet hatte. Er stellte sich als ein entfernter Cousin aus Haiti vor und wollte mit Jérôme sprechen, am liebsten in dessen Wohnung. Dies war ihm aber nicht geheuer, weshalb sie vor dem Haus stehen blieben, doch war in der Umgebung ohnehin nicht viel los, womit sie auch dort ungestört reden konnten.
Der andere begann, ein paar Details von Jérômes Familie zu erzählen, wobei dieser nicht sicher war, ob er wirklich dazugehörte oder nur gut recherchiert hatte. Er sprach von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Haiti und der Notwendigkeit, die Familien dort zu unterstützen. Da Jérôme nun gut verdiente, wäre es an der Zeit, sich endlich erkenntlich zu zeigen.
Darauf war er nicht erpicht, hatte er mit seiner Familie doch schon vor Jahren gebrochen und keinen Kontakt mehr. Es musste ein dummer Zufall sein, dass ihn dieser Mann überhaupt gefunden hatte. Als Jérôme nicht darauf einstieg, dass er nun die Menschen in Haiti unterstützen sollte, wurde sein Gegenüber deutlicher. Sie hätten ihn schon mehrfach gewarnt und er habe nie auf ihre Forderungen reagiert, liess er ihn wissen, weshalb er nun selbst vorbeigekommen sei.
Plötzlich wechselte der Mann das Thema und fragte Jérôme nach dem Brand im «Le Paradis». Jérôme wurde bleich, denn er ging davon aus, dass das Geschehnis in Èze sich noch nicht herumgesprochen hatte. Als der andere dann davon sprach, dass die nächste Warnung nicht mehr so harmlos werden würde, verlor er beinahe die Fassung und sagte zu, dass er schauen würde, was sich machen liesse.
Der Mann nannte darauf eine grosse Summe, die er von Jérôme erwarten würde, wohl wissend, dass dieser kaum in der Lage sein dürfte, diesen Betrag aufzubringen. Dann machte er rechtsumkehrt, ging zu seinem Wagen und fuhr davon. Zurück blieb ein zutiefst verängstigter Jérôme. Er ging in seine Wohnung, legte sich aufs Sofa und schlief beinahe sofort vor Erschöpfung ein.
8
Er genoss vor allem die längeren Reisen in seinem Learjet jedes Mal wieder, boten sie doch Bequemlichkeit und Er konnte sich entspannen, ohne immer als Vorbild seiner Anhänger dastehen zu müssen. Natürlich hatte Er sich seine Gemeinschaft nach seinem Gutdünken aufgebaut und die Mitglieder gehorchten ihm aufs Wort. Zudem hatte Er zahlreiche Kontrollmechanismen aufgebaut wie etwa, dass Er die traditionellen Familienstrukturen abgebaut und so die Rückzugsmöglichkeiten beschränkt hatte. Falls jemand seine Gemeinschaft verlassen wollte, konnte diese Person nicht alle ihre Angehörigen kontaktieren, da sie nicht an denselben Standorten wohnten. Und schliesslich hatte die Überwachung dafür gesorgt, dass die Mitglieder einander nicht mehr vertrauten und somit kaum gemeinsam gegen ihn agieren konnten.
Wichtige Funktionen hatte Er seit jeher nicht seiner Gemeinschaft anvertraut und sowohl die Finanzverwaltung, die rechtliche Beratung, die Sicherheit als auch das Management seiner «Villages», wie Er sie nannte, wurden nicht von Mitgliedern geführt.
Seine Gemeinschaften und die entsprechenden Villages waren zwar grosszügig konzipiert, doch von der Umgebung vollkommen abgeschottet. Manchmal verglich er sie mit Einrichtungen des Club Méditerranée, nur ohne Spassfaktor. Der Tagesablauf war strikt geregelt, Ausnahmen gab es keine.
Nun war Er auf dem Rückweg von seiner Kolonie in Kanada, ein Besuch, der äusserst erfolgreich gewesen war. Seit einigen Jahren hatte Er drei Standorte in Kanada. Die Vereinigten Staaten schienen ihm schwierig, einerseits wegen der immensen Konkurrenz grosser religiöser Gemeinschaften, andererseits wusste Er, dass seine Aktivitäten wohl genauer beobachtet würden und Er nicht so leicht tun und lassen konnte, was Er wollte. Immerhin hatte Er eine Art Staat im Staat aufgebaut, der von den Behörden entweder geduldet oder nicht entdeckt wurde.
In Kanada war alles viel lockerer und die grösseren Distanzen sowie die Zweisprachigkeit des Lands bewirkten, dass die Kommunikation weitaus langsamer lief. Er hatte sich denn auch sein Hauptvillage im französischen Teil eingerichtet und deshalb kaum je Kontakt zu Behörden.
Erfolgreich war sein Besuch in Kanada, da Er zwei neue grosse Gönner getroffen hatte, die ihn unterstützen und in seiner Gemeinschaft leben wollten. Er hatte seine Villages von der besten Seite präsentiert, die Nähe zur Natur und zu bescheidener Lebensführung betont und ihnen die hübschen Gästehäuser gezeigt, in denen sie wohnen könnten.
Neuen Interessentinnen und Interessenten bot Er seine Gemeinschaft wie ein Ferienhaussystem an mit der Möglichkeit, dass man verschiedene seiner Destinationen auswählen und dort abwechslungsweise leben könnte. Erst mit der Zeit wurde dies eingeschränkt – etwa mit dem Hinweis, dass man Reisen gar nicht mehr brauchte und auch im Village lieber mit den anderen zusammenlebte als allein und isoliert vom Geschehen. So erzog Er seine Anhänger und führte sie immer stärker in seine Abhängigkeit.
Dass seine beiden neuen Getreuen gut betucht waren, machte ihn besonders glücklich. Neben den verschiedenen Standorten musste ja auch sein aufwendiger Lebensstil wie der Learjet, in dem er zurzeit sass, finanziert werden. Davon hatten allerdings weder seine Anhängerschaft noch die beiden Neuen eine Ahnung und sie überlegten sich nicht einmal, wie Er von einem zum anderen Ort reiste. Vielleicht denken sie, ich könne fliegen, dachte Er sich belustigt, um darauf gleich wieder ernst zu werden.
Kanada war für ihn aber auch ein Rückzugsort. Seit längerer Zeit schon langweilte ihn sein Leben als Führer einer Gemeinschaft und Er hatte sich eine zweite Identität aufgebaut. Immer Vorbild zu sein war anstrengend und zudem hätten seine Anhänger kaum goutiert, wenn sie gewusst hätten, was Er alles von dem tat, was Er ihnen verboten hatte.
Diese Diskrepanz beschäftigte ihn und Er suchte nach einer Lösung. Dabei musste einerseits gewährleistet sein, dass Er sein Vermögen schützen und erhalten und Er andererseits von keinem Mitglied seiner Gemeinschaft erkannt oder aufgespürt werden konnte. Verschiedene Szenarien hatte Er sich bereits zurechtgelegt und in Gedanken durchgespielt, doch langsam schien es ihm, dass Er an die konkrete Umsetzung gehen musste.
Natürlich müsste Er in Zukunft auf gewisse Annehmlichkeiten wie sein Flugzeug verzichten, aber den Sekretär würde Er womöglich in sein neues Leben mitnehmen, zumindest zu Beginn, auch wenn ein Schlussstrich wohl besser wäre. Von seinem Umfeld beinahe unbemerkt hatte Er begonnen, gewisse eigene Merkmale zu akzentuieren, indem Er die Augen schloss, um komplizierte Fremdwörter zu sagen oder beim Gehen ganz leicht hinkte. Falls Er später je von irgendjemandem gesucht würde, würde es schwieriger, ihn mit jener Beschreibung zu finden, sobald Er diese Eigenarten wieder abgelegt hatte.
Für die Zukunft seiner Gemeinschaft hatte sich eine Idee herauskristallisiert, die einfach und simpel war, auch wenn sie wohl nicht all seinen Anhängern gefallen würde. Er tröstete sich damit, dass man im Leben nicht immer alles so bekam, wie man es sich gewünscht hatte.
Nach einem kurzen Nickerchen ass Er eine Kleinigkeit, bevor der Jet zum Landeanflug ansetzte. Er freute sich auf seinen kurzen Aufenthalt im schweizerischen Engadin, bevor Er nach Italien weiterreisen würde.
9
Dirk Frantzen war als Lebensmittelgrossist international bekannt. Dass er wie Frank im Nahrungssektor tätig war, betrachtete er als reinen Zufall. Die rührende Geschichte seines Bruders mit dem Tofu, die dieser überall erzählte und mit der jede seiner Biografien begann, fand er lächerlich und er ärgerte sich, wenn er selbst danach gefragt wurde, wie er dies damals empfunden hätte.
Seine Laufbahn begann Dirk bei der Spedition, in der er als Ökonom rasch Karriere machte. Irgendwann erhielt er ein Angebot, sich auf Lebensmittel zu fokussieren und wechselte in jenes Fach. Dabei kamen ihm sein Organisationstalent und seine Erfahrungen aus dem Transportwesen zugute.





























