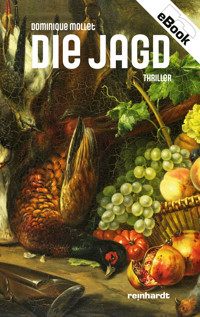Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Friedrich Reinhardt Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine Reihe von Attentaten gegen Kirchen erschüttert Europa und versetzt die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Kardinal Montagnola nutzt dies geschickt, um die Macht des Vatikans auszubauen. Auch die Aktivistin Dagmar sieht ihre Stunde gekommen, organisiert online den Widerstand gegen den Papst und fordert demokratische Kirchen. Gleichzeitig verfolgt der Journalist Piet eine heisse Spur, bis er selbst ins Visier der Terroristen gerät. Der Kunsthändler Mike wiederum verkauft derweil bekannte Werke mit unklarer Herkunft und wirbelt damit nicht nur den Kunstmarkt auf. Als die Zusammenhänge zwischen Kirche, Kunst und Terror langsam klar werden, mischen weitere Akteure die Jagd nach den Attentätern neu auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DOMINIQUE MOLLET
DIE WAHL
THRILLER
Friedrich Reinhardt Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 Friedrich Reinhardt Verlag, Basel
Projektleitung: Manuela Seiler-Widmer
Korrektorat: Daniel Lüthi
Gestaltung: Célestine Schneider
Satz: Siri Dettwiler
Titelbild: François Didier de Nomé: King Asa of Judah
Destroying the Idols. Öl auf Leinwand, 73,9 x 100,9 cm,
© The Fitzwilliam Museum, Cambridge
eISBN 978-3-7245-2672-8
ISBN der Printausgabe 978-3-7245-2668-1
Der Friedrich Reinhardt Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
www.reinhardt.ch
«Divide et impera»
Niccolò Machiavelli zugeschrieben
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Dank
Autor
Krimis im Friedrich Reinhardt Verlag
1
Die Explosion ereignete sich exakt um 9.53 Uhr. Er sass wie meist um diese Zeit in einem der typischen Pariser Bistros in der Nähe der Metrostation Cluny – La Sorbonne im Quartier Latin und genoss dort seinen Espresso mit Croissant. Er liebte diese Restaurants mit ihren schwarzen Bistrostühlen, den silbern glänzenden Kolbenkaffeemaschinen, auf denen meist Kleber eines Fussballvereins angebracht waren, die alten kleinen Emailleschilder, die zur Toilette wiesen, und die stets etwas arroganten, mürrischen Kellner, welche die Mineralwasserflaschen noch immer zwischen den Beinen öffneten. Die Explosion kam vollkommen unerwartet. Nichts hatte darauf hingewiesen, dass irgendwo irgendeine Gefahr bestand, noch war zuvor eine Spannung in der Stadt zu spüren.
An seinem Tisch war er einerseits so nahe am Explosionsort, dass er die Detonation heftig mitbekam, andererseits aber so weit weg, dass er weder direkt getroffen noch durch Gegenstände verletzt wurde. Später glaubte er sich zu erinnern, dass er auch die Druckwelle gespürt hatte. Gesehen hatte er allerdings nichts, er sass im Gebäudeinnern und die Sicht zum Explosionsort war versperrt.
Unmittelbar nach der Detonation schien es einen kurzen Moment vollkommen still zu werden, der Verkehr verstummte, Gespräche ebbten ab und vom Ort des Geschehens war eine Rauchsäule zu sehen, die sich beinahe in Zeitlupe ausdehnte. Dann aber brach Chaos aus, Schreie waren zu hören, Menschen rannten in Panik vom Geschehen weg, waren verletzt, bluteten oder wirkten verstört. Dazwischen Neugierige, die versuchten, mit ihrem Handy ein Foto zu machen in der Hoffnung, dadurch berühmt zu werden und hemmungslos Opfer fotografierten oder den Weg versperrten.
Ein ähnliches Bild bot sich auf den notorisch verstopften Strassen der Pariser Innenstadt mit Autos, deren Fahrer zu wenden versuchten, die wegfahren wollten, hupten, ausgestiegen waren, um das Geschehen zu erfassen oder in ihrem Schock nicht wussten, wie reagieren. Motorradfahrer versuchten, sich einen Weg zu bahnen, wurden aber durch die geöffneten Autotüren und die eng aneinandergefahrenen Fahrzeuge behindert und blieben stecken.
Immer lauter waren die Sirenen der herannahenden Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, Ambulanz und Zivilfahrzeugen mit Blaulicht zu hören und mischten sich in einer Gegenbewegung zum Tatort hin ins Chaos. Wild gestikulierten Gendarmen, uniformiertes Militär, das zum Schutz von Touristenattraktionen in Paris stationiert war, und Feuerwehrleute wollten den Verkehr kanalisieren und versuchten, sich den Weg zum Tatort zu bahnen. Autos wurden weggeschoben, Fahrer versuchten, in Einfahrten und Hinterhöfe auszuweichen.
Tumultartige Szenen spielten sich beim Eingang zur Metro ab mit Menschen, die im Untergrund Schutz suchten und aus der Szenerie via U-Bahn flüchteten, und anderen, welche die Treppe hinaufstürzten und auf keinen Fall in einem Tunnel gefangen sein wollten. Sie mischten sich mit den Passagieren, die aus der U-Bahn kamen und von allem noch nichts mitbekommen hatten. Ältere Menschen und Kinder wurden zu Boden gerissen, Kinderwagen kippten um und verzweifelte Mütter versuchten, ihre Kinder zu retten.
Piet war ebenso geschockt wie alle anderen und konnte die Katastrophe zuerst gar nicht erfassen. Zwar war er Journalist, aber nicht die Art von Reporter, die in jeder Situation sofort eine Geschichte witterten und sich mit ihrem Killerinstinkt ins Geschehen stürzten, um Originalbilder und -töne einzufangen. Vielmehr war er den schönen Dingen des Lebens zugetan, berichtete über Kunst, Reisen oder recherchierte Hintergrundgeschichten. Instinktiv flüchtete er tiefer ins Innere des Bistros, das sich immer mehr füllte, gerade noch, bevor die Menge der Flüchtenden vom Explosionsort her das Café überrannte und Tische und Stühle in alle Ecken flogen. Eigentlich kam es ihm lächerlich vor, dass die Fensterscheiben des Bistros Schutz vor einem Anschlag bieten sollten, aber er fühlte sich trotzdem sicherer dort.
Draussen spielten sich dramatische Szenen ab. Der Vorplatz des benachbarten Blumenladens, auf dem Töpfe, kleine Büsche, Arrangements und Accessoires sorgfältig und liebevoll aufgebaut waren, wurde von den in Panik Fliehenden überrannt. Überall flogen Blumen, Scherben, Tablare umher, der Storen wurde heruntergerissen und die Auslage erlitt wohl einen Totalschaden.
Nicht besser sah es vor dem Bistro aus. Wie eine Flutwelle hatten die Flüchtenden alles zerstört, was im Weg stand, und hatten gleichzeitig versucht, Schutz im Bistro zu suchen, dessen Kellner in der Zwischenzeit den Eingang notdürftig verbarrikadiert hatten, da sie unmöglich die Menschenmassen bei sich aufnehmen konnten.
Nachdem einige Zeit vergangen war, überlegte sich Piet, wie er von dort wieder wegkäme, da die Metros und der Busverkehr vermutlich bald stillgelegt und vielleicht auch Strassensperren errichtet würden, womit er einen grossen Umweg machen müsste, um in seine nördlich der Seine gelegene Wohnung zu gelangen. Gleichzeitig beobachtete er die Menschen, die am Bistro vorbeiströmten und irgendwo Schutz suchten. Nur unterbewusst nahm er die beiden Männer wahr, die eine grosse Tasche in einem kleinen weissen Nissan deponierten, der vor dem Bistro geparkt war, um sich dann zu Fuss zu entfernen. Das Fahrzeug war ihm vorher schon aufgefallen, da es einerseits ein belgisches Nummernschild trug, dessen Nummer identisch mit den letzten Ziffern seiner Handynummer war, und andererseits einen Walfischkleber auf dem Heck hatte, das Logo einer italienischen Fährgesellschaft, die nach Sardinien und Korsika fuhr.
Nach und nach beruhigte sich die Szenerie wieder etwas, als überall Polizisten mit Panzerwesten und Maschinengewehren in den Strassen patrouillierten und ein gewisses Mass an Sicherheit vermittelten. Die Menschen um ihn herum schienen davon auszugehen, dass der Anschlag vorbei sei und der oder die Attentäter unschädlich gemacht worden oder geflohen waren. Piet machte sich auf den Weg und wurde etwa viermal kontrolliert, bevor er ans Seineufer gelangte und von dort bis zum Pont Royal weiterging. Mit ihm bahnten sich Tausende Touristen, Firmenangestellte, Schüler und Passanten einen Weg, um möglichst rasch vom Geschehen wegzukommen und eine U-Bahn oder einen Bus zu erreichen, der sie über Umwege wenigstens irgendwann nach Hause brächte. Nach der Brücke marschierte er beim Louvre vorbei zurück ins 9. Arrondissement, wo er erschöpft in seiner Wohnung ankam. Sofort schaltete er in alter Journalistenmanier seinen Fernseher ein, um über die verschiedenen Newskanäle herauszufinden, was eigentlich genau geschehen war, und er sah Bilder der Zerstörung auf dem Vorplatz der Kathedrale Notre-Dame.
2
Der Landsitz in der Nähe von Castiglione della Pescaia war prächtig in den sanften Hügeln der Toskana gelegen, bot eine triumphale Aussicht und war gleichzeitig vor den Blicken Neugieriger gut geschützt. An diesem Nachmittag erwartete der italienische Kardinal Giuseppe Montagnola drei Gäste, die sich seit Jahren gut kannten.
Als Erstes traf der polnische Prälat Kacper Kowalczyk ein. Die beiden kannten sich aus einer Zeit, als der junge Kowalczyk die polnische Gewerkschaft Solidarność gegen das kommunistische Regime unterstützte und immer wieder auf die Hilfe aus Italien zählen durfte. Allerdings zog er sich später aus der Politik zurück, als die Gewerkschaft immer mehr soziale und gesellschaftspolitische Anliegen aufnahm, die mit seinen Vorstellungen kaum mehr übereinstimmten, und begann eine Karriere in der Kirche.
Kurz darauf erschien Benoît Lemaire, ein untersetzter französischer Kardinal aus der Bretagne, der als sehr konservativ und einflussreich galt und schon verschiedenen französischen Präsidenten bei ihrer Wahl ins Amt geholfen haben soll. Montagnolas Fahrer hatte ihn am Flughafen in Florenz abgeholt. Zwar durfte Montagnola als Vertreter des Vatikans auch den nahe gelegenen Militärflughafen in Grosseto benutzen, ein Privileg, von dem auch in Rom kaum jemand wusste, doch wollte er mit seinem Treffen kein unnötiges Aufsehen erregen und vor allem sollte möglichst wenig nachverfolgbar sein.
Aus Rom kam schliesslich ein weiterer Vertrauter, Kardinal Rico Giordano, der das Quartett komplettierte. Er war etwas jünger als die anderen, hatte aber durch zahlreiche Aufsätze auf sich aufmerksam gemacht und verfügte bereits über ein breites Netzwerk in Norditalien und Spanien, wo er zuerst tätig gewesen war. Wie Montagnola war er sehr konservativ geprägt und stand den Veränderungen in der Kirche skeptisch bis ablehnend gegenüber. Montagnola sah in ihm auch einen potenziellen Nachfolger, sollte er einmal seine zahlreichen Posten und Funktionen abgeben müssen, obwohl er noch lange nicht ans Kürzertreten dachte. Alle vier Kardinäle gehörten der Kurie zur Förderung der Einheit der Christen an, einem wichtigen Beratungsgremium im Vatikan.
Im schlicht, aber geschmackvoll eingerichteten Salon war, nachdem sie Platz genommen hatten, natürlich der Anschlag von Paris zentrales Thema.
«So entsetzlich dieser Anschlag in Paris auch ist», begann Montagnola das Gespräch, «sollten wir nicht ausser Acht lassen, dass daraus durchaus ein paar positive Erkenntnisse resultieren. So zeigt dieser Anschlag, dass unser christliches Abendland und unsere Leben zunehmend durch einen anderen Glauben bedroht werden, auch wenn niemand bisher wahrgenommen hat, dass wir dadurch eine wachsende Konkurrenz erhalten.»
«Du kannst aber einen solch infamen Anschlag nicht zum Anlass nehmen, dich gegen den Islam zu wehren. Schliesslich sind wir keine weltliche Organisation und sollten uns zurückhalten», entgegnete Lemaire bestürzt. «Ich habe bereits mit der französischen Präsidentin gesprochen, die den Antiterrorkampf verstärken und mehr Überwachung in der Öffentlichkeit einsetzen will.»
Giordano schloss sich dieser Haltung an, wollte aber Montagnola nicht unnötig verärgern, war dieser doch in bedeutenderen Gremien im Vatikan vertreten als er selbst und profitierte er bisweilen davon.
«Deine Gedanken, lieber Giuseppe, sind durchaus überlegenswert», wandte Kowalczyk ein. «Sogar in Polen», ärgerte er sich, «ist die Gesellschaft zunehmend säkularisiert und die Kirche findet immer weniger Gehör. Vielleicht bildet ein Ereignis wie der Anschlag in Paris durchaus eine Gelegenheit, die Menschen zurück in den Schoss der Kirche zu lenken.»
«Leider ist aber unser Oberhirte ein etwas zaghafter Papst und würde solche Ideen missbilligen, weshalb Wir euch heute inoffiziell zu uns eingeladen haben», antwortete Montagnola. Um seine Bedeutung herauszustreichen, sprach er von sich immer im Plural. Zwar gehörte der Landsitz ihm nicht wirklich, doch wussten die meisten Würdenträger in Rom nicht einmal mehr, dass das Gut eigentlich vatikanisches Eigentum war, denn der Kardinal hatte es seit Jahren in Beschlag genommen und nach seinen Wünschen umbauen lassen.
Dann erläuterte er ihnen sein Vorhaben. Die Kirche sollte die wachsende Angst in der Bevölkerung nach dem Anschlag nutzen, um sie vor den Gefahren durch den Islam und anderer gegen das christliche Europa und die USA gerichteter Mächte und Ethnien zu warnen, ihnen konservativere Werte zu vermitteln und sie damit zurück in den Schoss der Kirche zu führen, zum richtigen Glauben.
Alle vier gehörten zum konservativen Flügel der Kirche und hatten enge Beziehungen zu innerkirchlichen Organisationen wie Opus Dei oder dem von Marcel Lefebvre im schweizerischen Écône gegründeten und umstrittenen konservativen Priesterseminar. Damit verfügten sie über ein breites Netzwerk an Kontakten zu konservativen Priestern, Kardinälen, Bischöfen und anderen Würdenträgern, die sie anweisen konnten, in Predigten, Talkshows, Podiumsdiskussionen, Blogs oder Publikationen den Kampf gegen den islamistischen Terror zu thematisieren und die Bedeutung einer starken Kirche bei der Verteidigung der westlichen Werte und Lebensart hervorzuheben.
Die drei Gäste in Castiglione konnten einem solchen Vorhaben nur zustimmen, entsprach es auch ihrer Haltung und sahen sie darin eine Möglichkeit, den Einfluss in ihren Ländern zu stärken. Zudem waren sie es müde, in der Öffentlichkeit immer nur als Prügelknaben mit verstaubten Vorstellungen zu Frauenrechten und Zölibat zu dienen, von den elenden Diskussionen um jugendliche Missbrauchsopfer in der Kirche ganz abgesehen. Endlich hatten sie ein neues Thema, mit dem sie in der Gesellschaft punkten konnten.
Nach einem frugalen Abendessen verabschiedeten sie sich von Montagnola und reisten ab, um die Botschaft umzusetzen. Der Kardinal war sehr zufrieden, dass sie sein Anliegen so diskussionslos angenommen hatten, obwohl er daran nicht gezweifelt hatte, da es auch den Idealen seiner Kollegen entsprach. Dass er allerdings schon viel weitergedacht hatte und seine Idee nur ein erster Schritt war, hatte er ihnen wohlweislich nicht erzählt.
In den darauffolgenden Wochen staunten zahlreiche Gläubige in den Predigten in ihrer Gemeinde oder die Zuschauerinnen und Zuschauer von Talkshows mit der Beteiligung von Geistlichen über die pointierten Äusserungen zahlreicher Priester, Bischöfe oder anderer klerikaler Würdenträger über den Islam und welche Gefahr dieser für den Westen mittlerweile darstellen würde.
3
Die französische Präsidentin war ausser sich vor Wut nach dem Attentat in Paris. Bisher wusste man bloss, dass es sich um einen Selbstmordattentäter, der sich in die Luft gesprengt, sowie um eine Autobombe gehandelt hatte, die mitten in einer der belebten Touristenzonen explodiert war. Einer zufällig in der Nähe befindlichen Armeepatrouille war es wahrscheinlich zu verdanken, dass nicht noch mehr passiert war, konnte diese doch eine Tasche mit Waffen und Munition beim Tatort sicherstellen, was darauf hindeutete, dass sich noch mehr Terroristen vor Ort befanden, die aber nicht zu ihrem Einsatz gekommen waren.
Die Ermittlungen kamen wie immer schleppend voran und der von Europol für die Ermittlung der Terroranschläge in Europa in den letzten Monaten eingesetzte Pierre Barbu taugte ihrer Meinung nach wenig. Der hochdekorierte und ausgezeichnete Ermittler war von den Polizeiministern der Europäischen Union vor allem deswegen mit der Aufgabe betraut worden, da er im Libanon aufgewachsen war, fliessend Arabisch sprach und sein Vater die Ermittlungen der Anschläge auf die französische Armee in Beirut in den Achtzigerjahren geleitet hatte.
Für die Präsidentin war dies noch kein valabler Grund für eine Ernennung und seine Langsamkeit bestätigte sie. Was sie nun brauchte, waren rasche Resultate, welche die Angst in der Bevölkerung dämpften, sie konnte nicht riskieren, dass der Tourismus in Paris plötzlich einbräche. Zudem setzte sie klar auf mehr Überwachung und die Installation von Kameras an allen neuralgischen Punkten in der Stadt.
Selbstverständlich lud sie die Regierungschefs der EU zu einem Krisengipfel nach Paris ein, der gleichzeitig zum solidarischen Traueranlass genutzt wurde, um der Opfer des Anschlages zu gedenken. Das Treffen selbst brachte erwartungsgemäss nichts ausser der Erkenntnis, dass die europäischen Staaten noch immer weit davon entfernt waren, sich gemeinsam und zum Wohl aller auf eine Linie zu einigen und sich miteinander gegen den Terror zu verbinden. Vom spanischen Ministerpräsidenten, der sich wegen Datenschutz und Menschenrechten gegen mehr Kontrolle wehrte, bis zu den osteuropäischen Staaten, die für mehr Kontrolle waren, dies aber gleichzeitig als Mittel sahen, etwas mehr Geld aus einem EU-Topf zu erhalten, reichten die nutzlosen Ideen der Teilnehmer.
Immerhin erhielt sie damit eindrückliche Fernsehbilder, die um die ganze Welt gingen und ein Gegengewicht zu den verstörenden Reportagen voller Blut, Autowracks, zerborstenen Schaufenstern und Leuten bildeten, die den Tathergang aus ihrer Perspektive schilderten. Die europäischen Staatschefs vereint in der Kathedrale von Paris, ergreifende Chöre, der Besuch des vorher sorgfältig aufgeräumten und hergerichteten Tatorts sollten etwas Vertrauen zurückbringen und den Touristinnen und Touristen zeigen, dass Paris nach wie vor sicher war und die Politik alles unternähme, um solche schrecklichen Taten zu verhindern.
Die Präsidentin tat, was sie in solchen Situationen immer tat, sie verliess sich nicht auf Europa. Neben Europol wies sie ihren eigenen Geheimdienst an, zu ermitteln und nahm damit in Kauf, die europäische Zusammenarbeit ebenso zu unterlaufen, wie sie es ihren Amtskollegen bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten immer wieder vorwarf. Kurz darauf erschien der Geheimdienstchef Frédéric Maître im Élysée-Palast.
Maître hatte schon zahlreiche Einsätze hinter sich und zählte wohl zu den besten Fachleuten auf seinem Gebiet. Neben seiner militärischen Ausbildung war er Absolvent der französischen Eliteschule für Verwaltungsbeamte ENA, wodurch er die meisten führenden Politikerinnen und Politiker kannte, was bei seiner Arbeit sehr nützlich war. Er informierte die Präsidentin über seine Erkenntnisse, welche die Öffentlichkeit bisher noch nicht erfahren hatte. So ging er von drei bis vier Attentätern aus, von denen sich einer mitten in einer Touristengruppe in die Luft gesprengt hatte. Die anderen Terroristen hätten wohl auch noch zum Einsatz kommen sollen, flüchteten jedoch plötzlich und hinterliessen nicht nur Munition, sondern auch Waffen in der Nähe des Tatorts. Die Vermutung lag nahe, dass die Bombe zu früh detoniert war und das geplante Attentat somit nicht mehr richtig durchgeführt werden konnte.
Von anderen Anschlagsversuchen und -plänen etwa aus Deutschland wusste Maître, dass verschiedene Gruppen planten, sich bei einem Attentat in der Nähe der Explosion zu postieren und danach auf Flüchtende zu schiessen, um das Blutbad zu vergrössern. Diese Schilderungen stimmten die Präsidentin nicht gerade zuversichtlicher. Trotzdem war sie erleichtert, dass das Attentat nicht verheerender herausgekommen war. Die Frage war nur, ob damit das Schlimmste überstanden sei oder nach diesem Versuch bereits der nächste Überfall in Planung war. Daher sagte sie ihrem Geheimdienstchef alle Vollmachten, die er brauchen würde, und ihre volle Unterstützung zu.
4
Jeden zweiten Donnerstag besuchte Piet seinen Verleger am Boulevard de Sébastopol. Dabei kam er wie immer an einem Alters- und Pflegeheim mit einer grossen Auffahrt vorbei. Auf einem Personalparkplatz stand ein kleiner weisser Nissan, den er im ersten Moment beinahe übersehen hatte. Das Walfischlogo einer Reederei und das belgische Nummernschild machten ihn stutzig und er erinnerte sich, dass er das Auto irgendwo gesehen hatte.
Nach seinem Verlegerbesuch ging er zurück zum Heim und betrachtete sich den Wagen nochmals. Das Nummernschild hatte noch immer dieselben Ziffern wie seine Handynummer, und nun kam ihm in den Sinn, dass er den Wagen vor dem Attentat vor seinem Lieblingsbistro bereits einmal gesehen hatte. Und plötzlich erinnerte er sich an die beiden Männer, die in der ganzen Panik seelenruhig zum Nissan geschlendert waren und dort eine Tasche deponiert hatten, ohne anschliessend wegzufahren.
Aus der Berichterstattung wusste er, dass die Polizei noch weitere Attentäter vermutete, die aber nicht zum Einsatz gekommen waren. Wäre es möglich, dass er zufällig auf eine heisse Spur gestossen war? Obwohl er weder an Schicksal noch an Zufall glaubte, begann er, seine Erinnerungen auf weitere Informationen abzusuchen.
Beinahe automatisch trieb es ihn zu diesem Altersheim hin, in der vagen Hoffnung, dort etwas zu entdecken. Als er im Eingangsbereich stand, fiel ihm auf, dass der Grossteil der Pfleger Araber waren oder zumindest aus dem Nahen Osten zu stammen schienen, was in Paris allerdings keine Seltenheit war.
Irgendwie musste er sich hier Zugang verschaffen, damit er das Heim etwas genauer unter die Lupe nehmen konnte und er suchte nach einem Vorwand. Dieser präsentierte sich plötzlich, als ein Lehrling mit einer gepflegten, hochbetagten Dame im Rollstuhl erschien und sich bei der Rezeptionistin beklagte. «Frau Groot spricht wieder einmal nur Niederländisch und ich verstehe kein Wort. Weshalb werden die Leute heutzutage denn immer älter und dementer, das bringt doch nichts», wetterte er.
Piet konnte am Rollstuhl den Vornamen erkennen und hatte eine Idee. Er ging kurz darauf an die Rezeption und fragte nach Marie Groot. «Ich bin ein entfernter Grossneffe von ihr und wollte sie besuchen, da ich neu nach Paris gezogen bin», sprach er mit betont niederländischem Akzent. Die Dame an der Rezeption schaute kurz auf und war sichtlich erfreut, dass nun jemand aufgetaucht war, der die Wünsche dieser Bewohnerin für sie übersetzen konnte. Sie fragte Piet nach seinem Ausweis und seiner Telefonnummer und führte ihn in die Demenzabteilung im dritten Stock.
Marie Groot sass in einem grossen, lichtdurchfluteten Gemeinschaftsraum mit ein paar weiteren Demenzpatienten. Piet stellte sich ihr vor und erzählte, dass sein Grossvater als junger Mann wie viele Holländer nach Südafrika ausgewandert war und er nun nach Paris gezogen sei. Zu Hilfe kam ihm bei dieser Geschichte, dass er effektiv südafrikanische Verwandte hatte und für seine Reportagen und Reiseberichte über lange Zeit immer wieder dort gewohnt hatte. Marie Groot wusste zu Beginn nicht, was mit ihm anfangen. Sie hatte drei Halbbrüder, die sich vor etwa siebzig Jahren nach Johannesburg abgesetzt hatten und mit denen sie nur selten Kontakt hatte. Jeweils zu Weihnachten hatte sie von ihnen Bildbände über Südafrika geschenkt bekommen, war aber selbst nie dort gewesen.
Der junge, sympathische Mann konnte durchaus mit ihr verwandt sein. Auf jeden Fall sprach er Holländisch, kannte sich in Südafrika wirklich aus und schien auch ihre Verwandtschaft zu kennen. Auf der anderen Seite bekam sie ohnehin nie Besuch und es spielte für sie eigentlich keine grosse Rolle, ob dies nun wirklich ihr Grossneffe war oder nicht. Sie konnte endlich mit jemandem sprechen, der ihr zuhörte und der ihre Wünsche ans Personal weitergeben konnte.
Piet hörte Marie Groot beim Erzählen zu und versuchte, all ihre Informationen bei sich zu speichern. Marie war zu Beginn sehr unsicher, ob sie wirklich einen Verwandten vor sich hatte und versuchte, ein paar Fangfragen in ihre Erzählung einzubauen. Ihre Konzentrationsfähigkeit hatte inzwischen so nachgelassen, dass sie sich bei Piets Antworten nicht immer erinnern konnte, was sie eine Minute zuvor gefragt hatte. Auch wich er diesen Fallen aus, erzählte aber selbst einiges aus seinem Familienleben, das durchaus mit der anderen Erzählung zusammenpasste. Dank seinen Ortskenntnissen und seinen eigenen Erfahrungen in Südafrika konnte er die beiden Familiengeschichten einander angleichen und es so erscheinen lassen, als wären Maries Verwandte wirklich seine eigenen.
Marie Groot schienen gewisse Unstimmigkeiten nicht zu kümmern. Endlich konnte sie ihre zahlreichen Geschichten loswerden, über die Ungerechtigkeit wettern, dass ihr Halbbruder schon in der Jugend immer mehr gehabt hatte und wie gerne sie selbst seinerzeit ausgewandert wäre. Sie beklagte sich auch über gewisse Zustände im Heim, dass sie manchmal kein Abendessen bekämen und manchmal drei und bat Piet, mit der Altersheimleitung zu sprechen, was dieser versprach. Vielleicht konnte er bei einem Besuch bei der Heimleitung auch sonst einiges in Erfahrung bringen.
Im Aufenthaltsraum sassen noch ein paar weitere demente Patientinnen und Patienten. Die meisten waren in sich versunken und nahmen die Umwelt kaum mehr wahr oder sie philosophierten lautstark vor sich hin. Marie hatte kaum Kontakte im Heim ausser mit einer immer schwarz gekleideten Elsässerin, die von ihrem verstorbenen Mann erzählte, einer früheren Opernsängerin, einem ehemaligen Buchhalter mit Nickelbrille und einem Mann mit weissen Haaren, der aus Jordanien oder Jemen kam oder irgendeinem Land, das mit J begann, dessen Name ihr entfallen war.
Immer wieder versuchte Piet, durch die grossen Fenster einen Blick in den riesigen Garten zu erhaschen, wenn Marie dies nicht bemerkte. Irgendwann sah er einen Mann durch den Garten eilen und am Ende wie durch eine Mauer verschwinden. Später tauchte an derselben Stelle ein anderer Mann auf und Piet war sich sicher, dass er dort keine Tür gesehen hatte.
Als er endlich bei Marie Groot aufbrach, wollte er in den Garten gehen und selbst nachschauen, was er von oben gesehen hatte. Aber der Garten war für die Patienten bereits geschlossen und die Tür konnte nur mit einem Badge geöffnet werden. Er musste daher Marie nochmals besuchen.
Marie hatte seit Langem keinen solch anregenden Nachmittag mehr erlebt, auch wenn sie nicht sicher war, ob Piet wirklich ihr Neffe war. Sie fragte den Herrn aus dem Land, das mit J begann, was er dazu meine und ob er ihrem Besucher glauben würde, worauf dieser nur verständnislos mit den Schultern zuckte.
5
Der Raum war schmucklos, ärmlich und das Mobiliar bestand aus einem schäbigen Holztisch, ein paar Stühlen und einem Kühlschrank. Die Wände waren aus unverputztem Mauerwerk, eine Neonröhre beleuchtete das Zimmer und im Nebenraum war ein altes Bettgestell mit einer uralten, rot-weiss gestreiften Matratze zu sehen, die an den Rändern abgeschabt war.
Sie trafen sich zu fünft zum vereinbarten Zeitpunkt, das heisst, jeder mit etwa fünf Minuten Abstand, falls jemand verfolgt worden wäre. Diese Vorsicht war allerdings ziemlich unbegründet, denn alle wirkten wie heruntergekommene Kleinkriminelle, Dealer oder Sozialhilfeempfänger, die auf der Strasse praktisch unsichtbar waren und von niemandem beachtet wurden.
Sie waren sich schon ein paar Mal begegnet, ohne etwas voneinander zu wissen, nicht einmal ihre Namen. Nur ihr Chef, den alle «Vater» nannten, musste mehr wissen, denn sonst hätte er sie weder einladen noch ihnen Befehle geben können. Auch lebten sie in verschiedenen Städten, die sie jedoch aus Sicherheitsgründen immer wieder wechseln mussten. Ihr Leben war allerdings so karg und einfach, dass ihnen dies nicht viel ausmachte.
Vater übte zuerst eine strenge Manöverkritik und kanzelte einen der Teilnehmer ziemlich heftig ab. «Der Anschlag in Paris war unprofessionell und du hast klar gegen unsere Weisungen gehandelt. Du hattest deine Kollegen überhaupt nicht im Griff, sie sollten nach der Explosion der Autobombe auf die flüchtenden Touristen schiessen», sagte er in scharfem Ton. «Und nun sind sie sogar untergetaucht und du musst sie sofort stellen und eliminieren.» «Dazu muss ich aber zurück nach Paris und alle Verkehrswege werden immer noch stark überwacht», entgegnete der Angeschuldigte, auch wenn ihm klar war, dass er nicht widersprechen durfte. Ebenso war er unsicher, was mit ihm anschliessend geschehen würde.
Das wusste allerdings niemand im Raum, denn die Organisation war so aufgebaut, dass jeder nur eine Verbindungsperson zur nächsthöheren Ebene kannte sowie die ihm untergebenen Personen. Die für eine Aktion benötigte Infrastruktur wie Waffen, Sprengstoff, Pässe, Handys, aber auch Geld, Wohnungen oder Fahrzeuge wurde jeweils zur Verfügung gestellt oder konnte von der nächsten Entscheidungsebene angefordert werden.
Für die Kommunikation diente ein ausgeklügeltes Netzwerk. Harmlose Websites und deren Foren wurden dazu genutzt, verschlüsselte Botschaften zu übermitteln, etwa durch Kommentare bei Softwarediskussionen. Sah ein Vertreter der Organisation eine Frage zu einer Computerfehlermeldung mit dem Namen eines bestimmten Absenders, konnte er in anderen Foren weitere Informationen zusammensuchen wie Termine, Adressen oder Telefonnummern, die er kontaktieren musste. Auf diese Weise konnte das Internet genutzt werden, ohne Spuren zu hinterlassen, da keinerlei Zusammenhänge ersichtlich waren.
Vater hätte gerne etwas mehr gewusst als nur, dass er sich für eine gute Sache im Namen Allahs einsetzte. Immerhin konnte er konkrete Aktionen und Anschläge planen und sah anhand der Reaktionen der Staaten, der Polizei, der Medien und der Gesellschaft, dass diese zur Destabilisierung des Westens führten.
Auch über das neue Unterfangen war er kaum informiert. Trotzdem erläuterte er stolz: «Wir sind dazu ausersehen, etwas viel Grösseres zu schaffen, ein Symbolbild für den Westen, das wir ihm für immer rauben respektive unverrückbar in alle Zukunft mit uns verbinden. Die Aktion ist komplizierter als alles Bisherige und bedarf präziser Arbeit. Patzer wie Paris können wir uns nicht mehr leisten.» Dabei überlegte er sich, mit welchen Sanktionen er eigentlich einem überzeugten Selbstmordattentäter überhaupt drohen könnte, verwarf den Gedanken aber sofort wieder.
Vom nächsten Auftrag hatte er immerhin schon Informationen über die Stadt erhalten. Sein Vorgesetzter, den er vor Kurzem getroffen hatte, schärfte ihm damals ein, dass er vor allem die Vorbereitung so sorgfältig gestalten solle, dass möglichst wenig Spuren hinterlassen würden. Dies sei entscheidend, da der Aufschrei diesmal nach dem Attentat besonders gross würde. Vor allem dürften die Grenzen noch besser gesichert und kontrolliert werden, was eine Flucht und ein Untertauchen etwas erschwerte. Vater schilderte den geplanten Ablauf, wer wofür zuständig war und wie sie sich organisieren sollten. Das Anschlagsziel und die dazugehörige Stadt sollten die vier allerdings erst später erfahren, um das Unternehmen nicht zu gefährden. Jeder würde einen separaten Einsatzplan erhalten.
Nachdem die anderen gegangen waren, überlegte sich Vater, wie er das Problem mit seinen Attentätern in Paris lösen sollte. Dabei schmunzelte er, denn vermutlich hatte er es mit seinem nächsten Projekt bereits gelöst.
6
Die Art Basel Miami Beach war wieder einmal das Highlight der Saison, auch wenn es nicht einfach war, das exaltierte Leben der Reichen und Schönen an der Südspitze Floridas mit ihren lauten, farbigen Partys und all dem Luxus zu toppen. Einer der wichtigsten Kunstmessen der Welt gelang dies doch immer wieder. Die Reichen und Schönen strömten mit ihren Privatjets, Booten oder auf dem Landweg zu diesem Anlass, alle versuchten, ein VIP- oder Vorvernissageticket zu erhalten, denn die interessantesten Kunstwerke waren meist schon verkauft, wenn das normale Publikum Einlass erhielt.
Der deutsche Kunsthändler Arno Schmitz gehörte seit Jahren zu den prominenten Ausstellern und hatte sein Vermögen zur Hauptsache mit Kunst gemacht. Zu den Kunden seiner drei Standorte in München, San Diego und Hongkong zählten sowohl namhafte Sammlerfamilien wie auch reiche Anleger, die zwar von Kunst nichts verstanden, aber auf seine Empfehlungen hörten. Auch verstanden nicht alle in der Branche, weshalb er San Diego, das kunstmässig nichts bot, dem spannenderen Los Angeles vorzog. Für ihn war die Grenznähe zu Mexiko und damit zu Mittelamerika ein unschlagbares Argument.
Zu den Besonderheiten seines diesjährigen Stands gehörten zwei Werke von Amedeo Modigliani, die nicht zu den wichtigsten Werken des Künstlers zählten, aber immerhin für total siebzehn Millionen Dollar angeboten wurden. Und ganz besonders war, dass die Werke bereits verkauft waren, als sie von Schmitz für die Messe verschickt worden waren. Sein Verkaufsanteil war mit zwei Millionen vergleichsweise bescheiden, verdiente er normalerweise doch bis zu fünfzig Prozent des Verkaufspreises, nur musste er sich in diesem Fall weder um Verkäufer noch Käufer kümmern, was die kleinere Marge vollumfänglich rechtfertigte.
Die VIP-Vernissage war in vollem Gang mit Champagner an jeder zweiten Ecke, aufgetakelten Damen und Herren in diesem betont legeren Look, damit sie nicht als steife Banker oder Finanzanalysten identifiziert würden, sondern als Kunstliebhaberinnen und -liebhaber, die noch so abstruse Werke verstehen und bewundern. Man traf sich, um über die letzte Messe oder Ausstellung zu schnöden, begeistert von eigenen Entdeckungen und Käufen zu schwärmen, das Gegenüber eifersüchtig zu machen oder sich über ein Wiedersehen zu freuen.
Mike Evans, ein initiativer Kunstbroker, war ebenfalls unterwegs. Er fühlte sich in dieser Umgebung zu Hause, für seine Kundschaft besuchte er praktisch alle grösseren Messen, kannte zahlreiche Galeristen, Künstler und Museumskuratoren und kam an Vernissagen kaum vorwärts, ohne alle paar Meter jemanden zu begrüssen oder ein Gerücht auszutauschen. Dieses Mal war allerdings sein Ziel bereits klar, denn er war mit Arno Schmitz verabredet. Die beiden kannten sich nicht persönlich, hatten aber schon ein paar Geschäfte miteinander gemacht.
«Ich interessiere mich für die beiden Modiglianis», begann Evans das Gespräch und nannte das vereinbarte Codebegrüssungswort. «Nehmen Sie Platz», entgegnete Schmitz, der nun wusste, dass dies sein Käufer sein würde. Bereits mehrere Male hatte er am Abend Anfragen ablehnen müssen mit dem Hinweis, die beiden Bilder seien bereits reserviert und hatte gehofft, dass auch alles klappen würde. Die beiden sprachen ein wenig über den Kunstmarkt, die Entwicklungen und die aktuelle Messe. «Wahrscheinlich gehe ich recht in der Annahme, dass Sie nicht der eigentliche Käufer sind, sondern diesen nur vertreten», fragte Schmitz den Amerikaner. «Ja natürlich, auch wenn ich die beiden Werke gerne in meiner Sammlung haben würde, sind sie noch eine Schuhnummer zu gross für mich.» «Wollen Sie die beiden Werke selbst mitnehmen oder sollen wir sie liefern?», fragte Schmitz weiter. «Ich hoffe, sie bleiben nicht in den USA.» «Nein», entgegnete Evans. «Ich lasse sie am Messeende abholen und sie werden auf die Bahamas gebracht.» Schmitz war erleichtert, die Bilder waren noch immer in einem Freilager und somit nicht in die USA importiert worden, was steuerlich alles viel einfacher machte.
Als sie den Kaufvertrag unterschrieben hatten, übergab Evans seinem Gegenüber einen Schlüssel und entsprechende Codes. Die Bezahlung fand in bar statt, das heisst, der Spediteur von Evans hatte das Geld zusammen mit Werken, die er an die Messe gebracht hatte, Mobiliar für zahlreiche Aussteller, Katalogen, Beleuchtungen, klimatisierten Kisten für Kunstwerke und sonstigem Material mitgebracht und im Backoffice-Bereich der Messe sicher gelagert. Dort konnte es vom Spediteur von Schmitz nun abgeholt und auf die gleiche Weise wieder aus der Messe gebracht werden, ohne dass irgendjemand davon Notiz genommen noch der US-Zoll oder die Steuerbehörden davon erfahren hätten. Die Modiglianis selbst waren auch nur via Zollfreilager in die Messe gelangt und der neue Besitzer konnte von den günstigen Importkonditionen der Bahamas profitieren. Das Zollfreilager bot zudem den Vorteil, dass ein Bild nur dann in ein Land importiert werden musste, wenn es verkauft wurde und sonst nach der Messe wieder zollfrei an die Galerie zurückgesandt werden konnte.
Wie immer bei bekannteren Werken war die Provenienz wichtig, eine Art Biografie eines Werks, die möglichst lückenlos alle Besitzerinnen und Besitzer aufzeigte, was dessen Wert steigerte. Bei den nun verkauften Werken war dies leider nicht möglich, da sie während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich verschollen und erst vor Kurzem über einen Händler von einer öffentlichkeitsscheuen französischen Adelsfamilie zum Verkauf angeboten worden waren. Glücklicherweise fand etwa zum selben Zeitpunkt eine grosse Auktion statt, bei der ein Werk wieder einmal einen Weltrekord brach. Die Medien stürzten sich auf dieses Ereignis, weshalb sich kaum jemand für die beiden Modiglianis interessierte, die in Miami Beach gezeigt wurden, besonders auch, da sich Schmitz nicht besonders darum gekümmert hatte, dies publik zu machen. Den Käufer interessierte die Geschichte der beiden Kunstwerke nicht sonderlich und er wollte keine schlafenden Hunde wecken, da es im Kunstmarkt von findigen Anwälten und Journalisten wimmelte, die hinter jedem nicht deklarierten Bild stets Raubkunst witterten.
Sowohl Evans als auch Schmitz waren sehr zufrieden mit ihrem Handel und der Vernissage, wobei Evans natürlich nur einen etwas kleineren Anteil am Verkauf hatte. Wenigstens taten solche Verkäufe seiner Biografie gut und deckten trotzdem seine ziemlich hohen Lebenskosten. Was die beiden nicht wussten, war, dass die französische Adelsfamilie nie im Besitz der beiden Modiglianis gewesen war und von diesem Verkauf wohl nie erfahren würde, sondern die Bilder bei Schmitz eingeschleust und der Käufer vom Verkäufer organisiert worden war, um Gelder verschwinden zu lassen.
7
Der Nachmittag im Demenzheim beschäftigte Piet noch einige Stunden. Inzwischen hatte er recherchiert, wem das Heim gehörte, und stiess auf eine Investorengruppe aus Katar, was an und für sich nicht ungewöhnlich war, besass das Scheichtum auch den Fussballklub Paris Saint-Germain, die Warenhauskette Le Printemps und einige weitere renommierte Institutionen in Frankreich und Europa. Trotzdem passte ein solch kleines Unternehmen nicht in dieses Schema.
Der Zufall wollte es, dass er am Abend an ein Journalistendinner eingeladen war und dort Mireille Legros traf. Mireille war Investigationsjournalistin, hatte bereits zahlreiche Wirtschaftsreportagen gemacht und erhielt mehrfach Auszeichnungen dafür. Piet hatte sie vor Jahren kennengelernt, eine kurze Affäre mit ihr gehabt und war ihr danach immer freundschaftlich verbunden geblieben. Zu vorgerückter Stunde erzählte er ihr seine Geschichte und bat sie um Hilfe, hatte er doch zu wenig Kenntnisse, um wirtschaftlichen Verflechtungen nachzugehen und um sie bewerten zu können.
Mireille fand es etwas übertrieben, das Altersheim mit einem Terroranschlag in Verbindung zu bringen, aber einerseits mochte sie Piet noch immer und andererseits war sie ohnehin im Thema drin und recherchierte über industrielle Beteiligungen in Frankreich.
Am nächsten Morgen machten sie sich gleich nach dem Frühstück an die Arbeit. Während sie die Besitzverhältnisse zu untersuchen begann, analysierte er die Medienberichte und Meldungen zum Anschlag, um herauszufinden, ob es irgendwelche Hinweise zu den Tätern und dem Attentat gab, die für ihn interessant sein und Aufschlüsse darüber geben könnten, ob sich seine Beobachtung erhärten liesse.
Die Medienberichte waren kaum aufschlussreich. Zwar wurde kurz nach dem Anschlag berichtet, dass am Tatort mehrere Waffen und Munition gefunden wurden, was weitere Täter vermuten liess. Die Polizei schien diesen Punkten nicht nachzugehen oder wollte keine zusätzliche Verunsicherung in der Bevölkerung schüren. Überhaupt gab es ausser ein paar Spekulationen darüber, welcher Ableger welcher Terrororganisation nun in Paris zum Einsatz gekommen war, kaum schlüssige Berichte. Die Medien wandten sich lieber herzergreifenden Geschichten einzelner Opfer und deren Angehörigen zu.
Mireille selbst konnte auch wenig in Erfahrung bringen. Das Heim gehörte einer Investorengruppe, die ihrerseits von zwei anderen Gruppen kontrolliert wurde. Das Netz der Beteiligungen wies in den Mittleren Osten mit Schwerpunkt in Katar und im Emirat Schardscha. Immerhin fand sie heraus, dass diese Gruppe nicht nur das Heim betrieb und die Liegenschaft besass, sondern sämtliche Liegenschaften in diesem Strassenviereck mit zahlreichen Wohnungen, aber auch Handwerksbetrieben und Kleingewerbe, das wohl finanziell kaum lukrativ war. Zudem bestand keine Möglichkeit, diese Blöcke abzureissen und ein Geschäftshochhaus zu errichten, was Voraussetzung für ein gewinnbringendes finanzielles Engagement gewesen wäre. Es musste wohl einen anderen Grund geben, weshalb sich die Investoren für diese Objekte entschieden hatten.
Die zwei Journalisten beschlossen, Marie Groot nochmals einen Besuch abzustatten. Piet würde Mireille als seine Freundin ausgeben. Sie sollte mit der Heimleitung sprechen, angeblich wegen ein paar Reklamationen der alten Dame, die sie Piet gegenüber geäussert hatte. Er würde nach dem Besuch bei Marie den Garten untersuchen.
Die beiden wurden an der Rezeption freundlich empfangen. Offenbar gab es nur wenige Besucher und deshalb wurde Piet sofort wiedererkannt. Marie freute sich ebenfalls und auch darüber, dass Piet seine äusserst sympathische Freundin mitgebracht hatte, auch wenn sie leider kein Holländisch sprach. Auch der Mann aus Jordanien oder sonst einem Land mit J nickte ihnen freundlich zu. Mireille wollte sogleich zur Verwaltung des Heims gehen und sich um Maries Beschwerden kümmern. Diese war vor allem mit der medizinischen Betreuung unzufrieden, die ihr ihre Medikamente verweigerte, mit dem Essen und der Tatsache, dass ab 19 Uhr abends kaum noch jemand vom Betreuungspersonal gerufen werden konnte.
«Unser Alters- und Pflegezentrum wurde ursprünglich für gut situierte Muslime gegründet, die in Paris ihren Lebensabend verbringen möchten», erwiderte der Verwalter, als er von Mireille auf den Besitzer angesprochen wurde. «Dies war der Wille der Familie, die hinter den Investoren steht. Doch die Grosswetterlage hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten verändert und die Fremdenfeindlichkeit so zugenommen, dass die meisten Araber es vorziehen, im Alter in ihre Heimat zurückzukehren. Deshalb haben wir unsere Altersresidenz nun auch für Nichtmuslime geöffnet mit Full Service, also auch ohne Einschränkungen bei der Ernährung oder im Fastenmonat. Geblieben sind die günstigen Konditionen, da wir grosszügige Unterstützung erhalten.»
Viel mehr konnte Mireille nicht in Erfahrung bringen. Weder schien der Verwalter zu wissen, wem die Liegenschaften in der Umgebung gehörten, noch wie das Personal rekrutiert wurde. Am Ende ihres Gesprächs war sie überzeugt, dass Piet wohl übertrieben hatte und nichts Verdächtiges vorlag. Sie konnte auch nicht sehen, dass der Verwalter nach dem Gespräch auf seinem Computer die Information über die Familiengeschichte, die er von Marie Groot hatte, mit Piets Lebenslauf verglich und kaum Berührungspunkte zwischen den beiden Familien ausmachen konnte.
Nachdem Mireille zu Marie in den Aufenthaltsraum mit den verschiedenen dementen Bewohnerinnen und Bewohnern zurückgekehrt war, machte sich Piet auf den Weg und verschwand unter einem Vorwand im Garten. Dieser war im zum Haus gelegenen Teil sehr gepflegt und wirkte, je weiter man sich davon entfernte, desto verwilderter. Piet folgte den unscheinbaren Trampelpfaden und gelangte zur Gartenmauer, die das Grundstück abschloss. Mitten in dieser Mauer fand er eine Metalltür, die neueren Datums war und aussah, als wäre sie in letzter Zeit benutzt worden. Allerdings wies sie weder einen Griff noch ein Schloss auf und Piet sah keine Möglichkeit, wie er sie hätte öffnen können. Zwar suchte er rings um die Tür die Umgebung ab, entdeckte aber keinen Hinweis auf einen Öffnungsmechanismus. Ebenso wenig bemerkte er die kleine Überwachungskamera, die diskret in die Mauer eingelassen war.
Nachdem sich die beiden von Marie verabschiedet hatten mit dem Versprechen, bald wiederzukommen, inspizierten sie das Gebäudeviereck. Der Bau, der mit seinem Garten wohl an den Altersheimgarten grenzte, sah ziemlich heruntergekommen aus. Bereits vor dem Gebäude lungerten zahlreiche Jugendliche in ihren Hoodies, rauchten oder kifften und hörten sich Musik an. Die meisten waren wohl arbeitslos, Sozialfälle oder sonst aus dem Raster der Gesellschaft gefallene Individuen und es war für Mireille und Piet undenkbar, zwischen diesen Leuten das Haus zu betreten und sich umzusehen. Piet wollte sich auf seinem Handy nochmals die genaue Lage des Hauses anschauen, ob es sich wirklich gegenüber des Altersheims befand. Dabei wurde er stutzig, war doch das WLAN-Netz für diese Wohngegend ausserordentlich stark und stabil, was in Paris eher ungewöhnlich war.
8
Der Mailänder Dom gehört zu den imposantesten Kirchengebäuden in Italien. Majestätisch thront er mitten in der Altstadt mit einem grossartigen, weiten Vorplatz und Umschwung auf alle Seiten. Schon am frühen Morgen bildeten sich lange Schlangen von Touristen aus Asien bis Amerika, Gläubigen, Kunstkennern mit ihren Kunstreiseführern, Familien mit quirligen Kindern, die mitgekommen waren, da ihnen anschliessend ein Eis versprochen worden war und Schulklassen, die sich von ihren Lehrerinnen und Lehrern kaum bändigen liessen. Auf dem Platz verkauften fahrende Händler Kitschpostkarten, Jo-Jos, Wimpel mit dem aufgedruckten Bild des Papsts oder dem Logo von AC Milan.
Im Kircheninnern war es wesentlich ruhiger, die überall präsenten Kerzen und die Farben der Kirchenfenster sorgten für eine feierliche Atmosphäre und die Besucherinnen und Besucher waren von den ausladenden Dimensionen des gewaltigen Kirchenschiffs beeindruckt. Hinzu kamen der Duft von Weihrauch, die Schritte der Menschen, die vom Steinboden widerhallten und die jahrhundertealte Geschichte, die wie ein Gewicht über dem Gebäude lag.
In den Bänken im Mittelschiff sassen zahlreiche Leute. Zum Teil handelte es sich um Gläubige, die zum Beten gekommen waren, zum grossen Teil aber um Touristinnen und Touristen, die vom langen Anstehen erschöpft waren und froh, dass sie sich nun irgendwo setzen konnten. Alle filmten, schossen Fotos oder Selfies und wollten somit selbst zum Teil dieses grossartigen Bauwerks mit seinen imposanten Gemälden, den bemalten Fensterscheiben und der beinahe in den Himmel ragenden Orgel werden.
Nonnen waren daran, Schulklassen, die sie beaufsichtigten, zu ermahnen, sich in der Kirche ruhig zu verhalten, Priester gaben Auskünfte und Besuchergruppen lauschten ihren Fremdenführern, die mit Wimpeln an ihren Regenschirmen versuchten, alle zusammenzuhalten. Die Explosion wirkte zuerst wie ein Element aus einer Welt, das nicht in eine Kirche passte. Doch der grelle Blitz, die gewaltige Rauchwolke und die Druckwelle belehrten die Besucher eines Besseren. Zahlreiche Glassplitter der zerberstenden Fenster prasselten auf die Menschen nieder, Holzteile der Bänke flogen durch die Luft, gefolgt von aus der Wand gerissenen Metallabsperrungen der Seitenaltäre. In Panik versuchten Gläubige und Touristen zu fliehen, drängten zum Ausgang, schoben sich gegenseitig und drückten einander gegen Wände und auf den Boden. Schreie waren zu hören, Verletzte mit zerfetzten Kleidern und blutigen Körpern mischten sich unter die Anwesenden und alle versuchten, möglichst rasch durch die engen Ausgänge an der Stirnseite zu fliehen.
Offenbar hatte sich der Anschlag im rechten Seitenschiff ereignet, einem Ort, an dem sich neben den Altären aus dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert auch zahlreiche Gräber und Glasfenster mit Szenen aus dem Alten Testament befanden. Die Aussenmauern des Gebäudes schienen intakt und der Dom stürzte auch nicht zusammen. Trotzdem verwandelte sich das Innere des Doms innert kürzester Zeit in ein Inferno. Eltern suchten ihre Kinder, andere versteckten sich hinter Säulen, Gräbern oder flüchteten in die Sakristei, die aber eine Sackgasse bildete und keinen Ausgang besass, und wiederum andere warfen sich zu Boden aus Angst, es könnten noch weitere Anschläge drohen oder Bewaffnete auf alles schiessen, was sich bewegt. Erschwerend kamen dicker Rauch und Staub hinzu, die den Innenraum einhüllten und die Sicht und das Atmen beinahe verunmöglichten. Durch die mangelnde Luftzirkulation blieben diese wie eine Säule über dem Geschehen schweben.
Wie üblich gab es im Innern des Gebäudes kaum Sicherheitspersonal, da dieses damit beschäftigt war, im Eingangsbereich Taschen zu durchsuchen. Durch die Masse von Besuchenden, die in Panik flüchten wollten, gelang es den Sicherheitsleuten nicht, sich einen Weg ins Innere zu bahnen, auch wenn sie dort wohl kaum hätten ordnend eingreifen können.
Nach wenigen Minuten trafen Polizei, Feuerwehr und zahlreiche Ambulanzen ein und begannen, die Betroffenen zu betreuen, Wunden zu verbinden und schwerer Verletzte in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen. Dem Einsatzleiter der Rettungskräfte bot sich ein Bild der Verwüstung und die ersten Spuren sowie die Art der Explosion wiesen auf einen Anschlag hin. Später würde er herausfinden, dass es sich um einen Selbstmordanschlag gehandelt hatte.
Draussen begann die Polizei, die Umgebung abzuriegeln. Einerseits wollte sie keine Neugierigen in der Nähe haben, andererseits konnte sie mit Kontrollen möglicherweise fliehende Attentäter finden. Dies war aber alles andere als einfach, befindet sich der Dom von Mailand doch mitten in der Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und zahllosen möglichen Unterschlupfen – und zudem wusste die Polizei gar nicht, wonach sie eigentlich suchte.
Im Vorfeld hatte es zwar verschiedene Hinweise gegeben, dass die Terrorserie in Europa weitergehen würde, nur blieben diese zu ungenau, um konkrete Abwehrmassnahmen einzuleiten. Es blieb nichts anderes übrig, als in mühsamer Kleinarbeit Spuren zu sichern und diese mit anderen Anschlägen abzugleichen. Dies musste aber zum grossen Teil den Geheimdiensten und Europol überlassen werden, da die lokale Polizei damit restlos überfordert war.
Ein paar Hundert Kilometer von Mailand entfernt sass Vater vor seinem Fernseher und freute sich über die Bilder, die er auf beinahe allen Kanälen verfolgen konnte. Auch wenn die benutzte Bombe vergleichsweise klein war, wog der Umstand stärker, dass sie überhaupt ins Gebäude hineingeschmuggelt werden konnte und die gewünschte Wirkung erzielte. Im Vorfeld hatte er seinen Attentäter sogar beruhigen und motivieren müssen, der ob der geringen Reichweite seines Sprengstoffgürtels enttäuscht gewesen war und Angst gehabt hatte, nicht ins Paradies zu gelangen. Aber als er ihm erklärt hatte, wie wichtig und symbolträchtig sein Auftrag sei, war jener zufrieden gewesen.
9
Noch nie hatte Monsignore Montagnola den Papst derart aufgewühlt und wütend erlebt wie kurz nach dem Anschlag auf den Mailänder Dom. Natürlich hatte es immer wieder Überfälle auf Kirchen oder deren Vertreter gegeben, etwa in Ländern mit einer christlichen Minderheit, die dort verfolgt wurde, oder in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ebenso wurde die christliche Kirche auch vom Kommunismus oder in China bedrängt, vertrieben oder verboten. Und nicht zu vergessen gab es Kirchenplünderungen und -zerstörungen während der grossen Religionskriege im Rahmen der Reformation. Dies ereignete sich jedoch im sechzehnten Jahrhundert und nicht in den letzten Jahrzehnten.