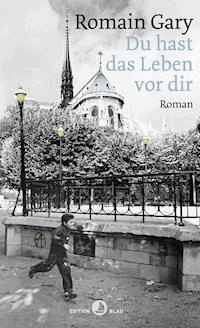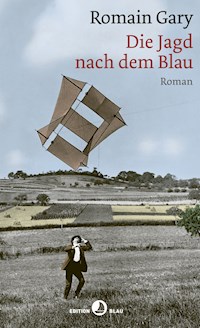
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Edition Blau
- Sprache: Deutsch
Der elternlose Ludo lebt in einem Dorf in der Normandie bei seinem Onkel, dem Landbriefträger Ambroise Fleury. Der gilt als leicht durchgeknallt und erfreut die Kinder rundum mit seinen selbst gebauten Drachen: BLAUER VOGEL, ZITTERBACKE, JEAN-JACQUES ROUSSEAU. Ludo, als wahrer Fleury, einer Familie, der die "Fähigkeit des Vergessens" nicht gegeben ist, leidet an "Gedächtnisüberschuss"; er kann das halbe Kursbuch der Eisenbahn aufsagen. Auch nicht aus dem Kopf geht ihm Lila, Tochter polnischer Adliger, die ihn nach Jahren des Wartens endlich auf den Sommersitz der Familie einlädt. Die Liebe ist kompliziert, im Weg steht nicht nur Lilas deutscher Cousin Hans, sondern bald auch der Krieg. Nach der Besatzung der Deutschen, verbunden mit Razzien und Deportationen, schließt Ludo sich der Résistance an, während der Onkel sieben gelbe Sterne am Himmel aufsteigen lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der elternlose Ludo lebt in einem Dorf in der Normandie bei seinem Onkel, dem Landbriefträger Ambroise Fleury. Der gilt als leicht durchgeknallt und erfreut die Kinder rundum mit seinen selbst gebauten Drachen: BLAUER VOGEL, ZITTERBACKE, JEAN-JACQUES ROUSSEAU.
Ludo, ein wahrer Fleury, denen die »Fähigkeit des Vergessens« nicht gegeben ist, leidet an »Gedächtnisüberschuss«; er kann das halbe Kursbuch der Bahn aufsagen. Auch nicht aus dem Kopf geht ihm Lila, Tochter polnischer Adliger, die ihn nach Jahren des Wartens endlich auf den Sommersitz der Familie einlädt. Die Liebe ist kompliziert, im Weg steht nicht nur Lilas deutscher Cousin Hans, sondern bald auch der Krieg. Nach der Besatzung der Deutschen, verbunden mit Razzien und Deportationen, schließt Ludo sich der Résistance an, während der Onkel sieben gelbe Sterne am Himmel aufsteigen lässt.
Romain Garys letzter zu Lebzeiten publizierter Roman erzählt rasant, ironisch, hintergründig von der Weigerung, sich anzupassen, dem großen Widerstand im Kleinen und einer unerschütterlichen Liebe.
Romain Gary
Die Jagdnach dem Blau
Roman
Aus dem Französischenvon Jeanne Pachnicke
Das Buch erschien erstmals 1989 unter dem Titel Gedächtnis mit Flügeln im Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar. Die Übersetzung von Jeanne Pachnicke wurde für die vorliegende Ausgabe neu durchgesehen.
Die Originalausgabe ist 1980 unter dem Titel Les Cerfs-volants bei Gallimard erschienen. © Editions Gallimard, Paris, 1980
Der Rotpunktverlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2019 Edition Blau im Rotpunktverlag, Zürich
(für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Umschlagbild: »Le cerf-volant, Louis et M. Hubert Laroze, Rouzat (Puy-de-Dôme), août 1911«, Jacques Henri Lartigue
© Ministère de la Culture France/AAJHL
Lektorat: Daniela Koch
1. Auflage
eISBN 978-3-85869-837-7
Der Erinnerung gewidmet
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Kapitel XXXIV
Kapitel XXXV
Kapitel XXXVI
Kapitel XXXVII
Kapitel XXXVIII
Kapitel XXXIX
Kapitel XL
Kapitel XLI
Kapitel XLII
Kapitel XLIII
Kapitel XLIV
Kapitel XLV
Kapitel XLVI
Kapitel XLVII
I
Das kleine, den Werken Ambroise Fleurys gewidmete Museum in Cléry ist heute nur noch eine zweitrangige touristische Attraktion. Die meisten Besucher begeben sich dorthin, nachdem sie im Clos Joli gespeist haben, das, da sind sich sämtliche Reiseführer Frankreichs einig, zu den bedeutendsten Stätten des Landes zählt, während auf das Museum mit dem Hinweis »Ein Abstecher lohnt sich« hingewiesen wird. In seinen fünf Räumen befinden sich die meisten Werke meines Onkels, die den Krieg, die Okkupation und die Kämpfe in der Zeit der Befreiung überstanden haben sowie all die anderen Widrigkeiten und Momente von Mattigkeit, die unser Volk durchlebt hat.
Alle Papierdrachen, gleich welcher Herkunft, entspringen der volkstümlichen Bilderwelt, was ihnen immer einen leicht naiven Anstrich gibt. Die von Ambroise Fleury machen da keine Ausnahme; selbst seine letzten, im hohen Alter angefertigten Stücke zeichnen sich durch Seelenreinheit und Unschuld aus. Trotz des geringen Interesses, das das Museum hervorruft, und der bescheidenen Subventionen, die es von der Gemeinde erhält, besteht keine Gefahr, dass es seine Pforten schließen könnte, dafür ist es allzu sehr mit unserer Geschichte verbunden. Doch meist sind die Säle leer, denn wir leben in Zeiten, wo die Franzosen nicht gerade darauf aus sind, sich zu erinnern, sondern lieber vergessen wollen.
Das beste Foto von Ambroise Fleury hängt gleich am Eingang des Museums. Man sieht ihn in seiner Landbriefträgertracht – mit seinem Käppi, seiner Uniform und seinen großen Tretern, auf dem Bauch die lederne Umhängetasche – zwischen einem Marienkäfer-Drachen und dem GAMBETTA, dessen Gesicht und Körper den Ballon und die Gondel darstellen, womit der radikale Republikaner bekanntermaßen während der Belagerung von Paris aufstieg und davonflog. Es gibt noch eine Menge anderer Fotos von dem, den man lange »den leicht durchgeknallten Briefträger« von Cléry nannte, denn die meisten Besucher seines Ateliers von La Motte hatten ihn geknipst, einfach aus Spaß. Mein Onkel machte bereitwillig mit. Er hatte keine Angst, lächerlich zu wirken, und beklagte sich nicht über seinen Beinamen, ebenso wenig über das »niedliche Original«; auch wenn er wusste, dass die Einheimischen ihn den »verrückten Fleury« nannten, so schien er darin sehr viel eher ein Zeichen von Achtung als von Verachtung zu sehen. In den Dreißigerjahren, als das Ansehen meines Onkels größer zu werden begann, kam der Inhaber des Restaurants Clos Joli, Marcellin Duprat, auf die Idee, Postkarten drucken zu lassen, die meinen Vormund in Uniform inmitten seiner Drachen zeigten und die mit der Aufschrift »Cléry. Der berühmte Landbriefträger Ambroise Fleury und seine Drachen« versehen waren. Leider sind diese Karten alle in Schwarz-Weiß, und man kann auf ihnen nicht die Farben- und Formenfreudigkeit erkennen, nicht die lächelnde Herzensgüte und nicht, was ich das Augenzwinkern nennen würde, das der alte Normanne gen Himmel schickte.
Mein Vater war im Ersten Weltkrieg gefallen, und meine Mutter starb wenig später. Der Krieg kostete auch dem zweiten der drei Fleury-Brüder, Robert, das Leben; mein Onkel Ambroise kehrte aus diesem Krieg heim, nachdem eine Kugel seine Brust durchbohrt hatte. Zur Verständnis der Geschichte muss ich hinzufügen, dass mein Urgroßvater Antoine auf den Barrikaden der Commune umgekommen war, und ich glaube, dass dieses kleine Aperçu unserer Vergangenheit und vor allem die Namen der beiden Fleurys auf den Gedenksteinen für die Gefallenen von Cléry eine entscheidende Rolle im Leben meines Vormundes gespielt haben. Er war sehr anders geworden als jener Mann, der er vor vierzehn-achtzehn gewesen war und von dem man hier in der Gegend sagte, er habe eine lockere Hand gehabt. Man wunderte sich darüber, dass ein Kriegsteilnehmer, der die militärische Verdienstmedaille erhalten hatte, nun keine Gelegenheit ausließ, seine pazifistischen Ansichten zu bekunden, die Kriegsdienstverweigerer verteidigte und alle Formen der Gewalt verurteilte, und zwar mit einer Flamme im Blick, die letzten Endes vielleicht nur der Widerschein derjenigen war, die auf dem Grab des unbekannten Soldaten brennt. Rein äußerlich hatte er gar nichts Niedliches. Ausgeprägte Gesichtszüge, hart und eigensinnig, zu einer Bürste geschnittenes graues Haar und einen jener dichten und langen Schnurrbärte, die man als »Gallier-Schnäuzer« bezeichnet, denn die Franzosen vermögen es noch, Gott sei Dank, an ihren historischen Erinnerungen festzuhalten, selbst wenn es nur mehr die ihrer Behaarung sind. Seine Augen waren schwermütig, was immer einen guten Hintergrund für Heiterkeit abgibt. Allgemein ging man davon aus, dass er »bekloppt« aus dem Krieg heimgekehrt sei; so erklärte man sich seinen Pazifismus und auch diese Marotte, seine gesamte Freizeit mit seinen Drachen zu verbringen: mit seinen gnamas, wie er sie nannte. Dieses Wort, gefunden in einem Buch über Äquatorial-Afrika, bezeichnet angeblich all das, was von einem Lebensfunken beseelt ist: Menschen, Fliegen, Löwen, Gedanken oder Elefanten. Er hatte den Beruf des Landbriefträgers zweifellos gewählt, weil seine militärische Verdienstmedaille und die beiden Auszeichnungen mit dem Kriegskreuz ihn zu einem Vorzugsposten berechtigten, vielleicht sah er darin aber auch eine Tätigkeit, die einem Friedfertigen gut ansteht. Er sagte oft zu mir: »Mit ein bisschen Glück, mein kleiner Ludo, und wenn du gut lernst, wirst auch du vielleicht eines Tages einen Posten bei der Post ergattern können.«
Ich brauchte eine Menge Jahre, um mich zurechtzufinden in dem, was bei ihm feierlicher Ernst und tiefe Ehrlichkeit war, und einer anderen, schalkhaften Ader, die jenem gemeinschaftlichen Vermögen zu entspringen schien, wo die Franzosen nach sich suchen, wenn sie sich verirrt haben.
Mein Onkel sagte, dass »die Drachen das Fliegen lernen müssen wie jeder andere auch«, und vom siebenten Lebensjahr an begleitete ich ihn nach der Schule mit einem gnama, der noch herrlich nach frischem Klebstoff duftete, bald auf die Wiese vor La Motte, bald ein bisschen weiter ans Ufer der Rigole.
»Man muss sie gut festhalten«, erklärte er mir, »denn sie ziehen an dir, und manchmal reißen sie sich los, sie steigen hoch in den Himmel, sie machen sich auf, dem Blau nachzujagen, und dann siehst du sie nie wieder, außer wenn andere Leute sie zerschellt hierher zurückbringen.«
»Und wenn ich sie zu sehr festhalte, werde ich dann nicht mit ihnen fortfliegen?«
Er lächelte, was seinen dicken Schnurrbart noch gütiger werden ließ.
»Das könnte schon passieren«, sagte er. »Aber man darf sich nicht fortreißen lassen.«
Mein Onkel gab seinen Drachen liebevolle Namen: FLIEGENBEISSER, SPRINGINSFELD, HUMPELBEIN, DICKERCHEN, BRUDER LUSTIG, ZITTERBACKE, CHARMEUR, und ich wusste nie, weshalb es ausgerechnet dieser ganz bestimmte Name sein musste und nicht irgendein anderer, warum ein lustiger Frosch mit Pfoten, die einem im Wind zuwinkten, TAUMLER hieß und nicht eher PLATSCH, was wiederum ein breit lächelnder Fisch war, der in den Lüften mit seinen silbrigen Schuppen und seinen rosafarbenen Flossen rauschend hin- und herwogte, oder warum er über den Wiesen von La Motte seinen ALLERWERTESTENhäufiger aufsteigen ließ als seinen MIMILE, einen Marsmenschen, den ich äußerst nett fand mit seinen runden Augen und den ohrenförmigen Flügeln, die anfingen zu wedeln, wenn er sich in die Lüfte erhob; ich übte mich darin, diese Bewegungen nachzuahmen – mit Erfolg, sodass ich bei Wettstreiten dieser Art alle meine Klassenkameraden schlug. Wenn mein Onkel einen Drachen steigen ließ, dessen Formen ich nicht verstand, erklärte er mir: »Man muss versuchen, welche zu machen, die anders sind als alle, die man je gesehen und kennengelernt hat. Etwas wirklich Neues. Aber gerade die muss man noch fester an der Leine halten, denn wenn man sie loslässt, jagen sie dem Blau nach und können unter Umständen großen Schaden anrichten, wenn sie wieder herunterfallen.«
Manchmal war es so, schien mir, dass die Drachen Ambroise Fleury an der Leine hielten.
Lange Zeit war das DICKERCHEN mein Liebling; sein Bauch blähte sich erstaunlich auf, wenn er an Höhe gewann, und er vollführte, sobald auch nur ein Lüftchen wehte, Kapriolen, wobei er mit den Pfoten ganz komisch seinen Wanst schlug, wenn mein Onkel die Schnur anzog und wieder locker ließ.
Ich gestattete DICKERCHEN, bei mir zu schlafen, auf der Erde braucht ein Drachen nämlich sehr viel Zuwendung, denn da verliert er an Form und Leben und verzweifelt leicht. Er braucht Höhe, freie Lüfte und viel Himmel um sich herum, damit er sich in voller Schönheit entfalten kann.
Mein Vormund verbrachte seine Tage in Ausübung seines Berufes, indem er die Landschaft durchquerte und den Einheimischen die Post zustellte, die er morgens im Postamt abholte. Doch wenn ich nach einem Fußmarsch von fünf Kilometern aus der Schule kam, traf ich ihn fast immer auf der Wiese von La Motte – denn bei uns zu Hause sind die Luftströmungen am späten Nachmittag immer günstiger – in seiner Briefträgeruniform, die Augen zu einem seiner Kumpel erhoben, die zitternd hoch über der Erde schwebten.
Und doch: Als wir eines Tages unseren VIER-MEERES-BUMMLER mit seinen zwölf Segeln verloren, den mir der Wind, die Segel auf einen Schlag blähend, mitsamt der Haspel aus der Hand riss, und ich zu heulen anfing, sagte mein Onkel, mit dem Blick sein sich ins Blaue verlierendes Werk verfolgend: »Weine nicht. Dazu sind sie ja da. Er ist glücklich da oben.«
Am nächsten Morgen brachte uns ein Landwirt aus der Nachbarschaft in seinem Heuwagen einen Haufen Holz und Papier, das war alles, was von VIER-MEERES-BUMMLER übrig geblieben war.
Ich war zehn Jahre alt, als die Gazette von Honfleur »unserem Mitbürger Ambroise Fleury, Briefträger in Cléry, ein sympathisches Original, dessen Drachen unweigerlich eines Tages für die Berühmtheit dieses Orts stehen werden, so wie die Spitzen den Ruhm von Valenciennes, das Porzellan den von Limoges und die Pfefferminzkissen den von Cambrai begründeten«, einen spöttischen Artikel widmete. Mein Onkel schnitt ihn aus und hängte ihn unter Glas an die Wand seiner Werkstatt.
»Ich bin ein bisschen eitel, wie du siehst«, sagte er mit einem Augenzwinkern.
Der Bericht der Gazette wurde inklusive Foto von einer Pariser Zeitung nachgedruckt, und bald bekam unsere Scheune, von da an »Atelier« betitelt, nicht nur Besucher, sondern auch Aufträge. Der Chef des Clos Joli, der ein alter Freund meines Onkels war, empfahl seinen Gästen, diese »lokale Sehenswürdigkeit« aufzusuchen. Eines Tages hielt ein Automobil vor unserem Hof, und es entstieg ihm ein sehr eleganter Herr. Mich beeindruckte vor allem sein Schnurrbart, der sich bis zu den Ohren rankte, mit dem Backenbart vermischte und auf diese Weise das Gesicht in zwei Hälften teilte. Später erfuhr ich, dass es sich um Lord Howe, einen großen englischen Sammler, handelte; er war von einem Diener und einem Koffer begleitet; als dieser geöffnet wurde, entdeckte ich – sorgfältig auf einem speziell dafür eingerichteten Samtboden gelagert – herrliche Drachen aus verschiedenen Ländern, aus Burma, Japan, China und Siam. Mein Onkel wurde eingeladen, sie zu bewundern, was er mit aller Aufrichtigkeit tat, denn er hatte keinerlei chauvinistische Ader. Seine einzige kleine Manie in dieser Hinsicht war es, zu behaupten, dass der Drachen seinen Adelsbrief erst in Frankreich errang, im Jahre 1789. Nachdem er die von dem englischen Sammler vorgeführten Stücke gebührend gewürdigt hatte, zeigte er Lord Howe seinerseits einige eigene Schöpfungen, darunter einen durch das berühmte Nadar-Foto angeregten, von Wolken getragenen VICTOR HUGO, der durchaus Gottvater ähnlich war, wenn er sich in die Lüfte erhob. Nach ein oder zwei Stunden Besichtigung und gegenseitigem Loben begaben sich die beiden Männer auf die Wiese und boten – jeder aus Höflichkeit den Drachen des anderen wählend – dem normannischen Himmel Unterhaltung, bis dass alle Rangen der Umgebung herbeieilten, um an dem Fest teilzuhaben.
Die Berühmtheit Ambroise Fleurys wuchs kontinuierlich, stieg ihm aber nicht zu Kopf, nicht einmal, als seine GRANDE DEMOISELLE MIT JAKOBINERMÜTZE – er war durch und durch Republikaner – beim Treffen in Nogent den ersten Preis erhielt oder er von Lord Howe nach London eingeladen wurde, wo er einige seiner Werke während einer Kundgebung im Hyde Park vorführte. Das politische Klima Europas begann sich zu dieser Zeit, nach Hitlers Machtergreifung und der Besetzung des Rheinlandes, einzutrüben, und es handelte sich um eine der damals zahlreichen Manifestationen des britisch-französischen Bündnisses. Ich habe das Foto aus der Illustrated London News aufgehoben, auf dem man Ambroise Fleury mit seiner die Welt erleuchtenden LIBERTÉ zwischen Lord Howe und dem Prinzen von Wales stehen sieht. Nach dieser quasi offiziellen Konsekration wurde Ambroise Fleury zunächst zum Mitglied, dann zum Ehrenpräsidenten der Französischen Drachen gewählt. Die Besuche der Schaulustigen wurden immer zahlreicher. Elegante Damen und feine Herren, die mit dem Auto aus Paris kamen, um im Clos Joli zu essen, begaben sich anschließend zu uns und baten den »Meister«, ihnen einige seiner Stücke vorzuführen. Die eleganten Damen setzten sich ins Gras, die feinen Herren gaben sich, Zigarre im Mundwinkel, alle Mühe, ernst zu bleiben, und man ergötzte sich daran, den »leicht durchgeknallten Briefträger« zu beobachten, der seinen MONTAIGNE oder seinen WELTFRIEDEN an der Leine hielt und das Himmelsblau mit dem durchdringenden Blick der großen Seefahrer fixierte. Mir wurde schließlich bewusst, wie beleidigend dieses Kichern der eleganten Damen, die überlegenen Mienen der feinen Herren waren, und es kam vor, dass ich eine bald kränkende, bald mitleidige Bemerkung aufschnappte. »Der soll nicht ganz richtig im Kopf sein, seit er vierzehn-achtzehn eine Granate an den Nüschel gekriegt hat.« – »Er nennt sich Pazifist und Kriegsdienstverweigerer, aber ich glaube, dass er einfach ein ganz gerissener Bursche ist, der unheimlich gut Reklame für sich zu machen weiß.« – »Zum Totlachen!« – »Marcellin Duprat hatte wirklich recht, das lohnt den Abstecher!« – »Finden Sie nicht, dass er mit seinem grauen Bürstenschnitt und seinem Schnurrbart aussieht wie Marschall Lyautey?« – »Er hat was Irres im Blick.« – »Aber natürlich, meine Teuerste, das ist die Leidenschaft.« Dann kauften sie einen Drachen, so wie man eine Eintrittskarte für eine Vorstellung erwirbt, und warfen ihn achtlos in den Kofferraum ihres Autos. Das war umso peinlicher, als mein Onkel, wenn er sich so seiner Leidenschaft hingab, gleichgültig allem gegenüber wurde, was um ihn herum passierte, und nicht merkte, dass einige unserer Besucher sich auf seine Kosten lustig machten. Eines Tages konnte ich auf dem Heimweg meine Empörung nicht zurückhalten vor lauter Wut über die Bemerkungen, die ich aufgeschnappt hatte, während mein Vormund seinen absoluten Liebling – einen JEAN-JACQUES ROUSSEAU mit Flügeln in Form aufgeschlagener Bücher, deren Seiten im Wind flatterten – aufsteigen ließ. Ich lief mit ausladenden Schritten hinter ihm her, die Brauen gerunzelt, Fäuste in den Taschen, so hart aufstampfend, dass meine Strümpfe auf die Fersen rutschten.
»Onkel, diese Pariser haben sich über Sie lustig gemacht, sie haben gesagt, Sie seien übergeschnappt.«
Ambroise Fleury blieb stehen. Nicht im Entferntesten beleidigt, schien er sogar eher zufrieden.
»Ach ja? Das haben sie gesagt?«
Da schleuderte ich ihm aus der Höhe meiner ein Meter vierzig diesen Satz entgegen, den Marcellin Duprat einmal über ein Kundenpaar des Clos Joli fallen ließ, das sich über die Rechnung beschwert hatte: »Das sind Leute niederer Herkunft!«
»Es gibt keine Menschen niederer Herkunft«, sagte mein Onkel.
Er beugte sich vor, legte vorsichtig JEAN-JACQUES ROUSSEAU ins Gras und setzte sich hin. Ich ließ mich neben ihm nieder.
»Sie haben mich also für verrückt erklärt. Tja, stell dir vor, diese feinen Herren und Damen haben recht. Es liegt doch auf der Hand, dass ein Mann, der sein ganzes Leben den Drachen widmet, irgendwie einen kleinen Spleen haben muss. Nur stellt sich hier die Frage der Interpretation. Manche nennen das einen ›Spleen‹, andere sprechen vom ›göttlichen Funken‹. Manchmal ist es schwierig, das eine vom anderen zu unterscheiden. Doch wenn du jemand oder irgendetwas wirklich liebst, dann gib ihm alles, was du hast, ja sogar alles, was du bist, und kümmere dich nicht darum, was andere dazu sagen …«
Heiterkeit huschte über seinen dicken Schnurrbart.
»Das ist es, was du wissen musst, wenn du ein guter Postbeamter werden willst, Ludo.«
II
Unser Hof befand sich in Familienbesitz, seit einer der Fleurys ihn aufgebaut hatte, kurz nach dem, was man zu Lebzeiten meiner Großeltern bei uns noch »die Ereignisse« nannte. Als sich eines Tages in mir die Neugier regte, zu erfahren, welches die besagten »Ereignisse« gewesen seien, erklärte mein Onkel mir, dass es sich um die Revolution von 1789 handle. Auf diese Weise erfuhr ich, dass uns ein ausgesprochenes Langzeitgedächtnis gegeben war.
»Tja, ich weiß nicht, ob das ein Ergebnis der allgemeinen Schulpflicht ist, jedenfalls hatten die Fleurys schon immer ein erstaunliches historisches Gedächtnis. Ich glaube, dass keiner der Unseren je etwas von dem vergaß, was er einmal gelernt hatte. Mein Großvater ließ uns manchmal die Erklärung der Menschenrechte vortragen. Mir ist das so zur Gewohnheit geworden, dass es mir noch heute unterläuft.«
Damals – ich war gerade zehn geworden – machte ich die Erfahrung, dass mein eigenes Gedächtnis, obgleich es noch nicht diesen »historischen« Charakter angenommen hatte, für meinen Lehrer, den im Chor von Cléry Bass singenden Herrn Herbier, zu einer Quelle des Erstaunens und schließlich sogar der Besorgnis wurde. Die Mühelosigkeit, mit der ich mir alles merkte, was ich irgendwann lernte, wie ich nach ein- bis zweimaligem Lesen mehrere Seiten meines Lehrbuches auswendig aufsagen konnte, sowie meine einmalige Begabung fürs Kopfrechnen schienen ihm eher von irgendeiner Missbildung des Hirns herzurühren als von den Fähigkeiten eines guten Schülers, und seien diese noch so außergewöhnlich. Er neigte umso mehr dazu, dem zu misstrauen, was er nie mein Talent, sondern immer nur meine »Veranlagung« nannte – und weil er dieses Wort mit ziemlich düsterer Betonung aussprach, fühlte ich mich beinahe schuldig, da ich angesichts des von allen als solchen anerkannten »Spleens« meines Onkels ebenfalls von irgendeiner erblichen Belastung gezeichnet schien, die sich als verhängnisvoll erweisen konnte. Die Äußerung, die ich aus Herrn Herbiers Mund am häufigsten hörte, war: »Mäßigung ist oberstes Gebot«, und während er diese veritable Warnung aussprach, sah er mich gewichtig an. Als meine Veranlagungen sich mit solcher Evidenz manifestierten, dass ein Freund mich verpetzte, weil ich eine Wette gewonnen und ein hübsches Sümmchen dafür kassiert hatte, dass ich zehn Seiten des Kursbuches der Eisenbahn auswendig hersagte, hinterbrachte man mir, Herr Herbier habe in Bezug auf mich den Ausdruck »kleines Ungeheuer« gebraucht. Ich verschlimmerte meinen Fall, indem ich mich dem Quadratwurzelziehen im Kopf und dem blitzschnellen Multiplizieren von mächtig langen Zahlen widmete. Herr Herbier begab sich nach La Motte, sprach lange mit meinem Vormund und riet ihm, mich in Paris von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Das Ohr an die Tür gepresst, entging mir kein Wort von dieser Unterredung.
»Ambroise, es handelt sich da um eine nicht ganz normale Fähigkeit. Man hat schon erlebt, dass die im Kopfrechnen erstaunlich talentierten Kinder später geistig zurückblieben. Sie wurden auf Varieté-Bühnen zur Schau gestellt, und das war’s dann. Ein Teil ihres Gehirns entwickelt sich ungeheuer schnell, aber ansonsten werden sie richtige Kretins. In seinem jetzigen Zustand könnte Ludovic fast die Aufnahmeprüfung der Ecole polytechnique machen.«
»Das ist in der Tat seltsam«, sagte mein Onkel. »In der Familie hat man sonst eher Talent fürs historische Gedächtnis. Einer von uns ist während der Pariser Commune sogar füsiliert worden.«
»Ich sehe da keinen Zusammenhang.«
»Auch so einer, der sich erinnert hat.«
»Woran erinnert?«
Mein Onkel schwieg einen Moment lang.
»An alles, wahrscheinlich«, sagte er schließlich.
»Sie werden doch nicht behaupten wollen, dass der Grund für die Erschießung Ihres Vorfahren ein Gedächtnisüberschuss war?«
»Doch, genau das behaupte ich. Wahrscheinlich wusste er in- und auswendig, was das französische Volk im Laufe der Jahrhunderte durchgemacht hat.«
»Ambroise, Sie sind hier bekannt als ein – entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das sage – nun ja, ein Erleuchteter, aber ich komme nicht her, um mit Ihnen über Ihre Drachen zu sprechen.«
»Tja, was soll’s, ich bin eben auch geistig zurückgeblieben.«
»Ich komme einfach, um Ihnen mitzuteilen, dass der kleine Ludovic Gedächtnisfähigkeiten hat, die weder seinem noch übrigens irgendeinem Alter gemäß sind. Er hat das Kursbuch auswendig aufgesagt. Zehn Seiten. Er hat eine vierzehnstellige Zahl mit einer ebenso langen im Kopf multipliziert.«
»Na gut, bei ihm ist es eben auf die Zahlen geschlagen. Er scheint nicht von historischem Gedächtnis befallen zu sein. Das wird ihn vielleicht davor bewahren, beim nächsten Mal füsiliert zu werden.«
»Welches nächste Mal?«
»Was weiß ich? Irgendeins gibt’s immer.«
»Sie müssten ihn ärztlich untersuchen lassen.«
»Hören Sie, Herbier, Sie fangen langsam an, mich zu nerven. Wäre mein Neffe wirklich normal, wär er ein Kretin. Auf Wiedersehen und danke für Ihren Besuch. Ich weiß ja, dass Sie es gut meinen. Ist er in Geschichte auch so begabt wie im Rechnen?«
»Nochmals, Ambroise, man kann hier nicht von Begabung sprechen. Nicht mal von Intelligenz. Intelligenz setzt Urteilskraft voraus. Ich betone ausdrücklich: Urteilskraft. Und in dieser Beziehung ist er weder besser noch schlechter als andere Kinder seines Alters. Was nun die französische Geschichte betrifft, so ist er in der Lage, sie von A bis Z herzusagen.«
Es trat eine noch längere Pause ein, dann hörte ich plötzlich meinen Onkel brüllen: »Bis Z? Was denn für ein Z? Als ob da auch schon ein Z in Sicht wäre, oder was?«
Herrn Herbier fiel keine Erwiderung ein. Später dann, nach der Niederlage von 1940, als das Z sich klar am Horizont abzeichnete, musste ich oft an diese Unterhaltung denken.
Der einzige Lehrer, den meine »Veranlagungen« überhaupt nicht beunruhigten, war mein Französischlehrer, Herr Pinder. Nur einmal schien er verärgert, als ich – in meinem Wunsch, mich selbst zu übertreffen – das Gedicht »Les Conquistadors« verkehrt herum aufsagen wollte, beginnend mit dem letzten Vers. Herr Pinder unterbrach mich und drohte mir mit dem Zeigefinger.
»Mein kleiner Ludovic, ich weiß nicht, ob du dich auf diese Weise auf das vorbereitest, was uns alle zu bedrohen scheint, das heißt ein verkehrtes Leben in einer verkehrten Welt, aber ich bitte, dich, wenigstens die Poesie zu verschonen.«
Es war derselbe Herr Pinder, der uns wenig später ein Aufsatzthema stellte, an das ich mich oft erinnerte und das eine gewisse Rolle in meinem Leben spielen sollte: »Untersucht und vergleicht die beiden Redensarten: Bei Sinnen bleiben und Den Sinn seines Lebens bewahren. Sagt, ob für euch zwischen diesen beiden Gedanken ein Widerspruch besteht.«
Man muss aber gerechterweise anerkennen, dass Herr Herbier nicht ganz unrecht hatte, als er meinem Onkel seine mich betreffenden Besorgnisse mitteilte: Er befürchtete, dass die Mühelosigkeit, mit der ich mir alles merkte, nicht von Fortschritten der geistigen Reife, der Ausgeglichenheit und des gesunden Menschenverstandes begleitet würde. Vielleicht ist das bei all denen ein bisschen so, die an Gedächtnisüberschuss leiden, wofür man ja einige Jahre später den Beweis erhielt, als so viele Franzosen in den Lagern zugrunde gingen oder hingerichtet wurden.
III
Unser Hof befand sich im Hinterland des Weilers Clos, am Rande des Waldes von Voigny, in dem sich Farne und Ginster, Buchen und Eichen vermischten und es Hirsche und Wildschweine gab. Weiter hinten begannen die Sümpfe, wo Knäkenten, Fischotter, Libellen und Schwäne in Frieden lebten.
La Motte lag ziemlich isoliert. Unsere nächsten Nachbarn, die Cailleux, wohnten eine gute halbe Stunde Fußmarsch von uns entfernt; der kleine Jeannot Cailleux war zwei Jahre jünger als ich, und ich war für ihn der »große Bruder«; seine Eltern hatten einen Milchladen in der Stadt; der Großvater Gaston, der bei einem Sägeunfall ein Bein verloren hatte, züchtete Bienen. Weiter weg gab es die Magnards: verschlossen, gleichgültig allem gegenüber, was nicht Kuh war, Butter oder Feld; Vater, Sohn und die beiden alten Jungfern sprachen nie mit irgendjemand.
»Außer, um Preise zu nennen oder nach ihnen zu fragen«, murmelte Gaston Cailleux.
Darüber hinaus gab es zwischen La Motte und Cléry nur noch die Höfe der Monniers und der Simons, deren Kinder in meine Klasse gingen.
Ich kannte die Wälder der Umgebung bis in ihre geheimsten Winkel. Mein Onkel hatte mir geholfen, am Ende eines Hohlwegs, der den Flurnamen Vieille-Source trug, einen Indianer-Wigwam zu bauen, eine mit Wachstuch bedeckte Hütte aus Zweigen, in die ich mich mit Büchern von James Oliver Curwood und von James Fenimore Cooper flüchtete, um von Apachen und Sioux zu träumen oder um mich bis zur letzten Patrone zu verteidigen, wenn ich von feindlichen Mächten belagert wurde, die immer »zahlenmäßig überlegen« waren, wie es die Tradition verlangt. Mitte Juni, vollgefressen und vor mich hin dösend, erblickte ich, als ich die Augen öffnete, vor mir ein sehr blondes Mädchen unter einem großen Strohhut, das mich streng ansah. Unter den Zweigen war Schatten und Sonne, und noch heute, nach so vielen Jahren, scheint es mir, dass dieses Helldunkel niemals aufgehört hat, Lila zu umspielen, und dass ich in diesem kurzen Moment der Erregung, deren Ursache und Wesen ich damals nicht verstand, in gewisser Weise erfahren hatte, was mich erwartete. Instinktiv, unter der Wirkung irgendeiner inneren Stärke oder Schwäche, vollführte ich eine Geste, deren endgültigen und unwiderruflichen Charakter ich auch nicht annähernd ahnte: Ich reichte dieser blonden und strengen Erscheinung eine Handvoll Erdbeeren. So billig kam ich aber nicht davon. Das Mädchen setzte sich neben mich und bemächtigte sich, ohne meiner Opfergabe auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu schenken, des ganzen Korbes. Damit waren die Rollen ein für allemal verteilt. Als nur noch wenige Erdbeeren auf dem Boden des Korbes lagen, gab sie ihn mir zurück und ließ mich, nicht ohne Vorwurf, wissen: »Mit Zucker schmeckt’s besser.«
Da gab es nur eines zu tun, und ich zögerte nicht einen Augenblick. Mit einem Satz aufspringend, stürmte ich, die Fäuste an den Körper gepresst, durch Wald und Feld bis La Motte, schnellte in die Küche wie eine Kanonenkugel, griff zu einer Tüte Zucker und legte im selben Tempo den Weg in entgegengesetzter Richtung zurück. Sie war noch da; im Gras sitzend, den Hut neben sich, beobachtete sie einen Marienkäfer auf ihrem Handrücken. Ich reichte ihr den Zucker.
»Ich will jetzt keinen mehr. Aber du bist nett.«
»Wir werden den Zucker hierlassen und morgen wiederkommen«, sagte ich mit der Eingebung des Verzweifelten.
»Vielleicht. Wie heißt du?«
»Ludo. Und du?«
Der Marienkäfer flog davon.
»Wir kennen uns noch nicht gut genug. Vielleicht werde ich dir eines Tages meinen Namen sagen. Ich bin ziemlich rätselhaft, weißt du. Du wirst mich sehr wahrscheinlich niemals wiedersehen. Was machen deine Eltern?«
»Ich habe keine Eltern. Ich lebe bei meinem Onkel.«
»Was macht er?«
Ich spürte unbestimmt, dass »Landbriefträger« jetzt nicht gerade angebracht war.
»Er ist Herr über die Drachen.«
Sie schien beeindruckt.
»Was ist denn das?«
»Das ist wie ein großer Kapitän, aber am Himmel.«
Sie dachte noch einen Augenblick nach und erhob sich dann.
»Vielleicht komme ich morgen wieder«, sagte sie. »Ich weiß noch nicht. Ich bin sehr unberechenbar. Wie alt bist du?«
»Ich werde bald zehn.«
»Oh, da bist du viel zu jung für mich. Ich bin schon elfeinhalb. Aber ich mag Walderdbeeren. Warte hier morgen um dieselbe Zeit auf mich. Ich werde wiederkommen, falls ich nichts Besseres zu tun habe.«
Nachdem sie mir einen letzten strengen Blick zugeworfen hatte, verließ sie mich.
Am darauffolgenden Morgen muss ich so mindestens drei Kilo Erdbeeren gepflückt haben. Alle paar Minuten rannte ich los, um zu sehen, ob sie da war. Sie kam nicht. Ebenso wenig am nächsten Tag, und auch nicht tags darauf.
Ich wartete den ganzen Juni jeden Tag auf sie, den ganzen Juli, August und September. Ich setzte zunächst auf die Erdbeeren, dann auf die Blaubeeren, später auf die Brombeeren und schließlich auf die Pilze. Ähnlich schmerzlich-angstvolles Warten sollte ich erst wieder von 1940 bis 1944 erleben, als ich während der Okkupation auf die Rückkehr Frankreichs lauerte. Als auch die Pilze mich im Stich ließen, ging ich trotzdem weiterhin in den Wald, an den Ort unserer Begegnung. Das Jahr verging, dann ein weiteres und noch eines, und ich entdeckte, dass Herr Herbier nicht so ganz unrecht gehabt hatte, als er meinen Onkel warnte, mein Gedächtnis habe etwas Beunruhigendes. Bei den Fleurys musste doch so etwas wie eine angeborene Behinderung existieren: Ihnen war die lindernde Fähigkeit des Vergessens nicht gegeben. Ich lernte, half meinem Vormund im Atelier, doch selten waren die Tage, an denen mir nicht ein blondes Mädchen in einem weißen Kleid, mit seinem Strohhut in der Hand, Gesellschaft leistete. Es handelte sich wirklich um einen »Gedächtnisüberschuss«, wie Herr Herbier ganz richtig festgestellt hatte und an dem er selbst wohl kaum litt, denn er hielt sich sorgsam von alldem fern, was sich unter den Nazis so inbrünstig und gefährlich auf das Erinnern berief. Noch drei, vier Jahre nach unserer ersten Begegnung kam es vor, dass ich, sobald die Erdbeeren reif wurden, meinen Korb vollpflückte und, mit den Händen im Nacken unter den Buchen liegend, die Augen schloss, um sie zu ermutigen, mich zu überraschen. Ich vergaß nicht mal den Zucker. Natürlich war da auf die Dauer auch ein Augenzwinkern im Spiel. Ich begann zu begreifen, was mein Onkel »dem Blau nachjagen« nannte, und ich lernte, mich selbst und meinen Gedächtnisüberschuss nicht ganz ernst zu nehmen.
IV
Mit vierzehn machte ich mein Abi, nachdem ich mithilfe einer vom Gemeindeschreiber »nachgebesserten« Geburtsurkunde, laut der ich nun fünfzehn war, dazu die Erlaubnis erhalten hatte. Ich wusste noch nicht, was ich aus meinem Leben machen würde. Inzwischen hatten meine Mathematiktalente Marcellin Duprat angeregt, mir die Buchhaltung des Clos Joli anzuvertrauen, wohin ich mich zweimal wöchentlich begab. Ich las alles, was mir unter die Finger kam, von den Fabliaux des Mittelalters bis zu Romanen wie Das Feuer von Barbusse oder Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque, die mein Onkel mir geschenkt hatte, obwohl er mir in Bezug auf meine Lektüre selten Ratschläge erteilte, denn er hatte volles Vertrauen in die »allgemeine Schulpflicht«, vor allem aber in das, was zuvor, später und seitdem immer wieder heftig diskutiert worden ist, was Ambroise Fleury aber für ganz sicher zu halten schien: die Erblichkeit der erworbenen Anlagen, insbesondere, so fügte er hinzu, »bei unsereins«.
Er hatte sein Amt schon vor mehreren Jahren aufgegeben, doch Marcellin Duprat riet ihm lebhaft, seine alte Landbriefträgerkluft anzulegen, wenn er Gäste empfing. Der Chef des Clos Joli hatte, was man heute einen ausgeprägten Sinn für »public relations« nennen würde.
»Verstehst du, Ambroise, um dich gibt es jetzt eine Legende, und diese Legende musst du pflegen. Ich weiß ja, dass du darauf pfeifst, aber du schuldest das einfach unserem Landstrich. Die Kunden fragen mich oft: ›Und dieser berühmte Briefträger Fleury mit seinen Drachen, ist der noch da? Kann man ihn besuchen?‹ Schließlich verkaufst du deine ulkigen Dinger ja und lebst davon. Also musst du dein Markenzeichen beibehalten. Eines Tages wird man vom ›Briefträger Fleury‹ sprechen, wie man vom ›Zöllner Rousseau‹ spricht. Wenn ich zu meinen Gästen an den Tisch gehe, behalte ich meine Mütze auf und meine Kochjacke an, genau so will man mich sehen.«
Marcellin mochte ein noch so alter Freund sein – der kleine Kuhhandel, den er meinem Onkel da vorschlug, gefiel diesem ganz und gar nicht. Es hagelte ein paar zünftige Beschimpfungen. Der Chef des Clos Joli betrachtete sich ein wenig als eine nationale Glorie und anerkannte als seinesgleichen nur Point in Vienne, Pic in Valence und Dumaine in Saulieu. Er war eine stattliche Erscheinung, sein Schädel war schon ein wenig abgeräumt, die Augen hell, von stahlfarbenem Blau; ein kleiner Schnurrbart verlieh ihm einen autoritären Zug. Er hatte etwas Militärisches in seiner Haltung, was vielleicht von den Jahren herrührte, die er im Schützengraben verbracht hatte. In den Dreißigerjahren hatte Frankreich noch nicht die Absicht, sich auf seine kulinarische Größe zurückzuziehen, und Marcellin Duprat hatte das Gefühl, verkannt zu werden.
»Der Einzige, der mich versteht, ist Edouard Herriot. Neulich hat er mir im Weggehen gesagt: ›Jedesmal, wenn ich hierherkomme, bin ich beruhigt. Ich weiß nicht, was die Zukunft für uns bereithält, doch ich bin sicher, dass das Clos Joli alles überdauern wird. Nur auf deine Ehrenlegion, Marcellin, wirst du noch ein bisschen warten müssen. Frankreich erfreut sich heute noch eines Überflusses an kulturellen Reichtümern, und das macht, dass einige unserer bescheideneren Werte vernachlässigt werden.‹ Das genau hat Herriot mir gesagt. Also, Ambroise, tu mir den Gefallen. In dieser ganzen Ecke hier sind nur wir beide berühmt. Ich versichere dir, wenn du für die Kundschaft hin und wieder deine Briefträgertracht anziehst, wird das ganz anders was hermachen als deine Kuhbauerncordhose.«
Mein Onkel lachte schließlich doch. Ich war immer glücklich, wenn ich auf seinem Gesicht diese Fältchen erscheinen sah, die sich von Fröhlichkeit nähren.
»Der gute Marcellin! Es ist schon eine schwere Last, Größe tragen zu müssen. Aber was soll’s! Er hat nicht ganz unrecht, und außerdem lohnt es ein kleines Opfer an Eigenstolz, wenn es darum geht, die friedliche Drachenkunst populärer zu machen.«
Dabei glaube ich, dass mein Onkel seine alte Briefträgerkluft gelegentlich nicht ungern wieder anzog, um auf die Wiesen zu gehen, umringt von Kindern, die zu zweit oder zu dritt nach der Schule oft nach La Motte kamen, um »Übungsstunden« zu nehmen.
Wie ich schon sagte, wurde Ambroise Fleury zum Ehrenpräsidenten der Französischen Drachen gewählt, eine Vereinigung, aus der er, Gott weiß warum, in dem Moment austrat, als München passierte. Ich habe nie ganz verstanden, wie ein überzeugter Pazifist so entrüstet hatte sein können, so niedergeschlagen, als der Frieden – wenn auch manche ihn als »Schandfrieden« bezeichneten – in München gerettet worden war. Zweifellos war es wieder dieses verfluchte historische Gedächtnis der Fleurys, das ihm da einen Streich spielte.
Auch mein Gedächtnis ließ nicht locker. Jeden Sommer ging ich wieder in den Wald der Erinnerung. Ich hatte mich bei den Leuten aus der Gegend erkundigt und wusste deshalb, dass ich nicht einer »Erscheinung« zum Opfer gefallen war, wie ich gelegentlich glauben wollte. Elisabeth de Bronicka existierte wahrlich und wahrhaftig; ihre Eltern waren die Besitzer des Sommersitzes Les Jars, der die Straße von Clos nach Cléry säumte, an dessen Mauern ich jeden Tag auf dem Schulweg entlangging. Sie waren seit mehreren Sommern nicht mehr in die Normandie gekommen; mein Onkel teilte mir mit, dass man ihnen die Post nach Polen nachsandte, wo sie an der Ostsee, nahe der Freien Stadt Gdansk, damals bekannter unter dem Namen Danzig, ein Landgut besaßen. Niemand wusste, ob sie je wiederkommen würden.
»Das ist weder der erste noch der letzte Drachen, der dir in deinem Leben abhanden kommen wird, Ludo«, sagte mein Onkel, als er mich mit meinem leider nach wie vor vollen Erdbeerkorb aus dem Wald kommen sah.
Ich erhoffte nichts mehr, und wenn dieses Spiel für einen Vierzehnjährigen auch ein wenig kindisch wurde, so hatte ich doch das Beispiel eines reifen Mannes vor Augen, der in sich jene Portion Naivität zu bewahren gewusst hatte, die nur dann zur Weisheit wird, wenn sie mit dem Altern Probleme hat.
Fast vier Jahre waren vergangen, seit ich »meine kleine Polin«, wie ich sie nannte, nicht wiedergesehen hatte, aber mein Gedächtnis hatte kein bisschen versagt. Ihr Gesicht war so fein gezeichnet und zart, dass man immer das Bedürfnis hatte, es in den Händen zu bergen. Der harmonischen Lebhaftigkeit, die in jeder ihrer Bewegungen lag, verdankte ich sogar ein »Sehr gut« in meinem Philosophie-Abi. Ich hatte im Mündlichen Ästhetik gewählt, und der Prüfer, nach einem vollen Arbeitstag völlig erschöpft und überreizt, hatte gesagt:
»Ich werde Ihnen nur eine Frage stellen, und ich bitte Sie, mir mit einem einzigen Wort zu antworten. Was kennzeichnet die Anmut?«
Ich dachte an die »kleine Polin«, an ihren Hals, ihre Arme und daran, wie ihr Haar sich bauschte, und antwortete ohne Zögern: »Bewegung.«
Ich bekam neunzehn von zwanzig Punkten. Ich verdanke mein Abi der Liebe.
Außer an Jeannot Cailleux, der manchmal kam, um sich in eine Ecke zu setzen und mich ein bisschen traurig anzugucken – »Du hast wenigstens jemanden«, hatte er eines Tages sehnsüchtig zu mir gesagt –, schloss ich mich niemandem an. Ich war gegenüber alldem, was mich umgab, schon fast so gleichgültig geworden wie die Magnards. Zuweilen kreuzte ich ihren Weg, wenn sie – der Vater, der Sohn und die zwei Töchter – mit ihren Obstkisten im Kippkarren dahinrumpelten, um sich zum Markt zu begeben. Jedesmal sagte ich ihnen Guten Tag, sie antworteten mir nie.
Anfang Juli 1936 saß ich neben meinem Erdbeerkorb im Gras. Ich las Gedichte von José Maria de Heredia, der mir – auch heute noch – sehr zu Unrecht vergessen scheint. Vor mir, zwischen den Buchen, lag ein Tunnel aus Helligkeit, wo das Licht sich am Boden wälzte wie eine wolllüstige Katze. Aus einem benachbarten Sumpf stiegen hin und wieder fliehende Meisen auf.
Ich schaute hoch. Sie war da, stand vor mir, ein junges Mädchen, das von den vergangenen vier Jahren mit einer Ehrerbietung behandelt worden war, die gleichsam eine Huldigung an mein Gedächtnis darstellte. Ich erstarrte – nachdem mein Herz in der Brust einen Sprung vollführt hatte, der mir die Kehle zuschnürte. Dann verging die Aufregung, und ich legte in aller Ruhe mein Buch zur Seite. Sie war mit leichter Verspätung zurückgekommen, das war alles.
»Du sollst angeblich seit vier Jahren auf mich warten.«
Sie lachte.
»Und du hast nicht mal den Zucker vergessen!«
»Ich vergesse nie irgendetwas.«
»Ich dagegen vergesse alles sehr leicht. Ich erinnere mich nicht mal an deinen Namen.«
Ich ließ ihr ihr Spielchen. Da sie wusste, dass ich sie überall gesucht hatte, musste sie auch wissen, wer ich war.
»Warte, lass mich überlegen … Ach ja, Ludovic, das war’s. Ludo. Du bist der Sohn des berühmten Briefträgers Ambroise Fleury.«
»Sein Neffe.«
Ich reichte ihr den Erdbeerkorb. Sie kostete eine Beere, setzte sich neben mich und nahm mein Buch.
»Mein Gott! José Maria de Heredia! Aber das ist doch ganz unmodern! Du solltest Rimbaud lesen und Apollinaire.«
Da gab’s nur eines. Ich rezitierte:
»Von der, die Engelslieb er zärtlich hat genannt
Irrt stets, wenn Liebesleid sein wehes Herz umspannt,
Die göttlich’ Seel’ umher im Saitenbeben.
Dies Lied, das einst er schrieb für einen Ackersmann,
Gibt er dem Wind nun preis, der weit es trägt und dann
Liebkosend könnt’ das treulos’ Weib umwehen.«
Sie schien geschmeichelt und zufrieden mit sich. »Unsere Gärtner haben mir gesagt, dass du sie ausgefragt hast, ob ich wiederkommen würde. Das nennt man Liebe, leidenschaftliche Liebe.«
Mir war klar, dass ich verloren war, wenn ich mich jetzt nicht wehrte.
»Weißt du, manchmal ist ein Wiedersehen das beste Mittel, jemanden zu vergessen.«
»Meine Güte! Sei doch nicht gleich beleidigt. Ich mach doch nur Spaß. Ist es übrigens wahr, was man sagt, dass sie alle so sind?«
»Wie, so?«
»Dass sie nicht vergessen?«
»Mein Onkel Ambroise behauptet, die Fleurys hätten ein so gutes Gedächtnis, dass einige daran gestorben sind.«
»Wie kann man an Gedächtnis sterben? Das ist doch idiotisch.«
»Das findet er auch, und deshalb ist er Landbriefträger geworden und verabscheut den Krieg. Er interessiert sich nur noch für seine Drachen. Sie sind sehr schön anzusehen, wenn sie am Himmel fliegen, aber denen kann man wenigstens eine Schnur an den Hintern kleben, und selbst wenn sie sich losreißen und herunterfallen, ist das doch immer nur Papier und Holz.«
»Ich möchte, dass du mir erklärst, wie man an Gedächtnis sterben kann.«
»Das ist ziemlich kompliziert.«
»Ich bin ja nicht völlig blöd. Vielleicht könnte ich es verstehen.«
»Ich meine ja nur, dass es ziemlich kompliziert zu erklären ist. Angeblich waren alle Fleurys Opfer der allgemeinen Schulpflicht.«
»Wovon?«
»Der allgemeinen Schulpflicht. Man hat ihnen zu viele schöne Sachen beigebracht, die sie sich zu gut gemerkt haben, an die sie voll geglaubt haben, die sie, vom Vater zum Sohn, weitervermittelt haben, von wegen der Erblichkeit erworbener Anlagen und …«
Ich merkte genau, dass ich die Sache nicht meisterte, und ich wollte hinzufügen, dass bei alldem ein kleiner Spleen im Spiel sei, den man auch den göttlichen Funken nennt, aber unter diesem blauen, auf mich gerichteten strengen Blick verrannte ich mich nur noch mehr und beschränkte mich dann darauf, stur zu wiederholen: »Man hat ihnen zu viele schöne Sachen beigebracht, an die sie geglaubt haben; für die haben sie sich sogar umbringen lassen. Deshalb ist mein Onkel Pazifist geworden und Kriegsdienstverweigerer.«
Sie schüttelte den Kopf und machte »pfff«.
»Ich versteh kein Wort. Was dein Onkel dir erzählt, ist doch glatter Unsinn.«
Da hatte ich eine Idee, die mir ganz geschickt erschien.
»Komm uns in La Motte besuchen, dann wird er es dir selbst erklären.«
»Ich habe nicht die Absicht, meine Zeit damit zu verschwenden, mir Ammenmärchen anzuhören. Ich lese Rilke und Thomas Mann und nicht José Maria de Heredia. Im Übrigen lebst du mit ihm zusammen, und offenbar hat er nicht einmal dir erklären können, was er meint.«
»Man muss Franzose sein, um das zu verstehen.«
Sie war eingeschnappt.
»Verdammt nochmal, etwa weil die Franzosen ein besseres Gedächtnis haben als die Polen?«
Ich kam aus dem Konzept. Das war absolut nicht die Art von Unterhaltung, die ich nach einer tragischen Trennung von vier Jahren erwartet hatte. Andererseits wollte ich auf keinen Fall eine lächerliche Figur abgeben, ob ich auch gleich weder Rilke noch Thomas Mann gelesen hatte.
»Es handelt sich um das historische Gedächtnis«, sagte ich. »Da sind massig Sachen drin, an die sich die Franzosen erinnern und die sie einfach nicht vergessen können, und das geht das ganze Leben so, außer bei denen, die Gedächtnislücken haben. Ich habe dir ja schon erklärt, dass das die Auswirkung der allgemeinen Schulpflicht ist. Ich begreife überhaupt nicht, was du da nicht verstehst.«
Sie erhob sich und warf mir einen mitleidigen Blick zu.
»Du denkst wohl, dass nur ihr Franzosen dieses ›historische Gedächtnis‹ habt? Dass wir Polen keins haben? Ich hab noch nie so einen Esel gesehen. Allein im Verlauf der letzten fünf Jahrhunderte sind hundertsechzig Bronickis umgebracht worden, die Mehrzahl unter heroischen Bedingungen, und wir haben Dokumente, die das beweisen. Adieu. Du wirst mich nie mehr wiedersehen. Oder vielmehr doch, du wirst mich wiedersehen. Du tust mir leid. Seit vier Jahren kommst du hierher, um auf mich zu warten, und statt einfach zuzugeben, dass du unsterblich in mich verliebt bist – wie alle –, machst du mein Land schlecht. Was weißt du überhaupt von Polen? Na, schieß los, ich höre.«
Sie kreuzte die Arme über der Brust und wartete.
Das war so maßlos anders als alles, was ich erhofft und ersonnen hatte, wenn ich von ihr träumte, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Schuld daran war nur mein Onkel, dieser alte Irre, der mir den Kopf mit einer Menge Kram vollgestopft hatte, statt sich zu begnügen, seine Papiertäubchen daraus zu basteln. Ich unternahm derartige Anstrengungen, um nicht loszuheulen, dass sie plötzlich beunruhigt war.
»Was hast du? Du bist ja ganz grün geworden.«
»Ich liebe dich!«, murmelte ich.
»Das ist doch kein Grund, grün zu werden, zumindest noch nicht. Dazu musst du mich erst besser kennen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Aber komm mir nie wieder mit Lehren für uns Polen in Bezug auf das historische Gedächtnis. Versprochen?«
»Ich schwöre dir, ich hatte überhaupt nicht die Absicht … Ich denke nur Gutes über Polen, es ist berühmt für …«
»Wofür?«
Ich schwieg. Ich stellte mit Grauen fest, dass das Einzige, was mir zu Polen einfiel, die Redewendung »voll wie ein Pole« war.
Sie lachte.
»Schon gut. Vier Jahre, das ist nicht übel. Es ist selbstverständlich zu überbieten, aber dazu braucht man Zeit.«
Und mit dieser in ernstem Ton vorgetragenen Binsenweisheit verließ sie mich, eine lebhafte weiße Silhouette, die sich zwischen den Buchen quer durch Helligkeiten und Schatten entfernte.
Ich schleppte mich bis La Motte und legte mich – Gesicht zur Wand – ins Bett. Ich hatte den Eindruck, mein Leben verpfuscht zu haben. Ich verstand einfach nicht, warum und wieso ich, statt ihr meine Liebe zu gestehen, mich hatte hinreißen lassen zu dieser sinnlosen Diskussion über Frankreich, Polen und deren jeweiliges historisches Gedächtnis, das mich nicht die Bohne interessierte. Daran war nur mein Onkel schuld, mit all seinen regenbogenflügeligen JAURÈS und seinem Knirps ARCOLE, von dem heute, so erklärte er mir, zu Recht oder zu Unrecht, nur noch der Name einer Brücke geblieben ist.
Am Abend kam er zu mir hoch.
»Was hast du?«
»Sie ist zurückgekommen.«
Er lächelte voll Zuneigung.
»Und ich wette, es ist gar nicht mehr sie«, sagte er. »Es ist immer sicherer, sie sich selber zu basteln, aus schönen Farben, Schnur und Papier.«
V
Tags darauf, so gegen vier Uhr nachmittags, als ich mir gerade sagte, dass alles verloren sei und dass ich diesen übermenschlichsten aller Kraftakte bewerkstelligen müsse, der im Vergessenkönnen besteht, hielt vor unserem Haus ein riesiger blauer Wagen ohne Verdeck. Der vornehme Chauffeur in grauer Uniform teilte uns mit, dass ich eingeladen sei, im »Sommersitz« zu vespern. Ich beeilte mich, meine Schuhe zu wichsen, zog meinen einzigen, zu klein gewordenen Anzug an und nahm neben dem Chauffeur Platz, der sich als Engländer erwies. Er informierte mich, dass Stanislas de Bronicki, der Vater von »Mademoiselle«, ein genialer Financier sei; seine Frau sei eine der größten Schauspielerinnen Warschaus gewesen, die sich über ihren Weggang vom Theater hinwegtröste, indem sie ständig Szenen mache.
»Sie haben riesige Ländereien in Polen und ein Schloss, wo der Herr Graf Staatschefs und Berühmtheiten aus aller Welt empfängt. Oh ja, der ist wer, das kannst du mir glauben, my boy. Wenn er sich für dich interessiert, wirst du nicht ewig bei der Post bleiben.«
Der Sommersitz Les Jars war eine große dreistöckige Nobelhütte mit Türmchen, spalierversehenen Balkonen und Veranden mit geschnitzten Balustraden; sie hatte keine Ähnlichkeit mit irgendwas von uns zu Hause. Es war die genaue Kopie des Hauses, das die Ostrorogs – Vettern der Bronickis – am Bosporus in Istanbul besaßen. Tief in einen Park gebaut, von dem man durch die Gittertore nur die Alleen ausmachen konnte, gab sie eine beliebte Postkarte ab, die im Petit-Gris, dem Tabakladen der Rue du Mail in Cléry, verkauft wurde. Das Haus war 1902 vom Vater Stanislas de Bronickis im damals wahnsinnig modernen türkischen Stil errichtet worden, und zwar als Hommage an seinen Freund Pierre Loti, der sich häufig dort aufgehalten hatte. Die Jahre und die Feuchtigkeit hatten dem Holz eine schwärzliche Patina verliehen, die anzutasten Bronicki in dem Bemühen um Authentizität verbot. Mein Onkel kannte den Sommersitz gut und hatte mir oft davon erzählt. Als er noch seinen Briefträgerberuf ausübte, war er fast täglich dorthin gegangen, denn die Bronickis erhielten mehr Post als ganz Clos und Cléry zusammen.
»Die Reichen wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht«, brummelte er. »Sie haben ein türkisches Haus in der Normandie gebaut, und ich wette, dass sie in der Türkei einen normannischen Landsitz errichtet haben.«
Wir hatten Ende Juni, und der Park erschien in voller Pracht. Ich kannte die Natur vor allem in ihrer ursprünglichen Schlichtheit, nie hatte ich sie derart gepflegt gesehen. Die Blumen sahen so wohlgenährt aus, als kämen sie geradewegs aus dem Clos Joli Marcellin Duprats.
»Sie haben fünf ganztags beschäftigte Gärtner«, sagte der Chauffeur. Vor der Veranda ließ er mich allein.
Ich nahm meine Baskenmütze ab, befeuchtete meine Haare mit Spucke und stieg die Treppen hoch. Sobald ich geklingelt hatte und die Tür mir von einem höchst aufgeregten Dienstmädchen geöffnet wurde, begriff ich, dass ich nicht ungelegener hätte kommen können. Eine blonde Dame, bekleidet mit etwas, was mir eine Verwicklung von blauen und rosafarbenen Seidenstoffen zu sein schien, lag halb ausgestreckt in einem Sessel und schluchzte; mit seiner großen Zwiebel von Uhr in der Hand fühlte Doktor Gardieu besorgt ihren Puls; ein eher kleiner, aber kräftig gebauter Mann in einem Morgenmantel, der wie eine silberne Rüstung glänzte, spazierte kreuz und quer durch den Salon, ihm folgte bei diesem Hin und Her Schritt für Schritt ein Butler mit einem Tablett voller Getränke. Stas de Bronicki hatte übermäßig viele babyblonde Locken und einen Backenbart, der bis zur Hälfte die Wangen bedeckte – ein Gesicht, dem es an Adel mangelte, sofern dieser sich mit bloßem Auge und ohne Rückgriff auf beweiskräftige Dokumente ausmachen ließe. Es war ein rundes, wangenschweres Gesicht mit einem leicht schinkenrosigen Teint; man konnte es sich sehr gut über einen Fleischerstand gebeugt vorstellen; ein dünner Schnurrbart, besser ein Flaum, zierte die Lippen eines hühnerstietzförmigen Schmollmundes, der machte, dass er ständig verstimmt aussah, was ganz besonders in dem Moment der Fall zu sein schien, als ich ankam. Er hatte große, leicht vorquellende Augen von ausgewaschenem Blau, starr und glänzend wie die Flaschen auf dem Tablett des Butlers, was auch irgendeinen Zusammenhang mit deren Inhalt haben musste. Lila saß ganz ruhig in einer Ecke und wartete, dass ein Zwergpudel sich bequemte, auf die Hinterbeine zu gehen, um sich ein Zuckerchen zu verdienen. Ein raubvogelähnliches, völlig schwarz gekleidetes Individuum saß an einem Schreibtisch über einen Stapel Papier gebeugt, den es mit seiner langen, schnüfflerischen Nase zu durchwühlen schien.
Ich wartete schüchtern, die Mütze in der Hand, dass jemand sich freundlicherweise für mich interessieren wolle. Lila, die mir zunächst einen zerstreuten Blick zugeworfen hatte, belohnte endlich den Pudel, kam zu mir und nahm mich an die Hand. Just in diesem Moment wurde die schöne Dame von noch herzzerreißenderen Schluchzern überwältigt, was übrigens die anwesenden Personen mit völliger Gleichgültigkeit aufnahmen. Und Lila sagte zu mir:
»Es ist nichts, es ist wieder mal die Baumwolle.«
Und da mein Blick offenbar von Unverständnis strotzte, fügte sie als Erklärung hinzu:
»Papa hat sich schon wieder auf Baumwolle eingelassen. Er kommt einfach nicht davon los.«
Und mit einem leichten Schulterzucken:
»Dabei standen wir im Kaffee viel besser da.«
Damals wusste ich nicht, dass Stanislas de Bronicki an der Börse mit derartiger Geschwindigkeit ganze Vermögen gewann und verlor, dass niemand mit Sicherheit sagen konnte, ob er gerade reich war oder ruiniert.
Stanislas de Bronicki – Stas für seine Freunde aus Spielkasinos und von Rennbahnen sowie für die Damen des »Chabanais« und des »Sphinx« – war damals fünfundvierzig Jahre alt. Ich war jedesmal überrascht und ein wenig unangenehm berührt von dem Kontrast zwischen seinem massiven, schweren Gesicht und dessen Zügen von solcher Kleinheit, dass man sie – einem Ausdruck der Comtesse de Noailles zufolge – »suchen musste«. Auch in seinem babyblonden Lockenhaar, dem rosigen Teint und dem porzellanblauen Blick war irgendetwas Unpassendes; die ganze Familie Bronicki, ausgenommen der Sohn Tadée, schien aus Blau, Blond und Rosa gemacht. Bronicki war Spekulant und Spieler, der das Geld mit ebensolcher Ungeniertheit auf den Spieltisch warf wie seine Vorfahren die Soldaten auf das Schlachtfeld – das Einzige, was er im Spiel noch nicht verloren hatte, war sein Adelsbrief: Er gehörte einer der vier oder fünf großen aristokratischen Linien Polens an wie die Sapiehas, die Radziwiłłs und die Czartoryskis, die lange Zeit das Land unter sich aufgeteilt hatten, bis dass es in andere Hände überging und andere Teilungen erlitt. Ich hatte bemerkt, dass seine Augen häufig von einem leichten Rollen erfasst wurden, so als hätten sich die Bewegungen all der Kugeln, die sie auf dem Roulette verfolgt hatten, auf sie übertragen.
Lila führte mich erst zu ihrem Vater, doch da dieser – die Hand vor der Stirn und den Blick zur Zimmerdecke gerichtet, von der augenscheinlich der Ruin herabgefallen war – mir nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte, wurde ich zu Madame de Bronicka geschleppt. Man hörte auf zu weinen, man warf mir einen Blick zu, wo ich mehr Wimpern sah, als mir je um ein menschliches Auge herum begegnet waren, man entfernte das Seufzertuch ein Stück von den Lippen und fragte mit leiser, noch ganz schmerzerfüllter Stimme:
»Wo kommt denn der her?«
»Ich habe ihn im Wald getroffen«, sagte Lila.
»Im Wald? Mein Gott, wie schrecklich! Hoffentlich hat er nicht die Tollwut. Alle Tiere haben zur Zeit die Tollwut. Das habe ich in der Zeitung gelesen. Wer gebissen wird, muss eine sehr schmerzhafte Behandlung über sich ergehen lassen. Da muss man aufpassen …«
Sie beugte sich vor, nahm den Pudel und presste ihn an sich, wobei sie mich argwöhnisch ansah.
»Ich bitte Sie, Maman, beruhigen Sie sich«, sagte Lila.
Auf diese Weise begegnete ich der Familie Bronicki zum ersten Mal in ihrem natürlichen Element, das heißt: mitten in einem Drama. Genia de Bronicka – später erfuhr ich, dass das »de« verschwand, sobald die Familie nach Polen zurückkehrte, wo dieses Partikel nicht üblich war, um in Frankreich wieder aufzutauchen, wo man weniger bekannt war – Genia also war von einer Schönheit, die verheerend wirkte, wie man früher sagte; heute ist diese Redewendung unmodern geworden, wohl wegen der Inflation von Verheerungen, die die Welt seither erlebt hat. Sehr schlank, aber von jener Schlankheit, die einen respektvollen Bogen um Hüften und Brust macht, war sie eine dieser Frauen, die nicht mehr wissen, was tun vor lauter Schönheit.
Ich wurde endgültig durch eine Bewegung mit dem Taschentuch beiseite geschoben, und Lila, die mich noch immer bei der Hand hielt, ließ mich einen Korridor durchqueren und ging die Treppe hoch. Zwischen der großen Eingangshalle, wo das Baumwolldrama seinen Lauf nahm, und dem Dachboden lagen drei Etagen, aber ich glaube, dass ich während dieses kurzen Aufstiegs mehr Einzelheiten über gewisse seltsame Dinge, die sich zwischen Frauen und Männern abspielen, erfahren habe als in meinem gesamten bisherigen Dasein. Wir hatten gerade ein paar Stufen hinter uns gelassen, als Lila mir mitteilte, der erste Ehemann Genias habe sich in der Hochzeitsnacht das Leben genommen, noch bevor er das Brautzimmer betrat.
»Er hatte Lampenfieber«, erklärte Lila mir, wobei sie mich weiter fest an der Hand hielt, vielleicht weil sie Angst hatte, ich könnte die Flucht ergreifen.
Der zweite Mann dagegen war an zu großem Selbstbewusstsein zugrunde gegangen.
»An Erschöpfung«, teilte Lila mir mit, wobei sie mir voll in die Augen sah, wie um mich zu warnen, und ich fragte mich, was sie damit wohl meinen könnte.
»Meine Mutter war einmal die größte Schauspielerin Polens; es wurde ein spezieller Diener benötigt, um die Blumen in Empfang zu nehmen, die immerzu eintrafen. Sie wurde von König Alfons XIII. und von König Carol von Rumänien ausgehalten, aber sie hat in ihrem ganzen Leben immer nur einen Mann geliebt. Dessen Namen kann ich dir nicht sagen, es ist ein Geheimnis …«
»Rudolf Valentino«, sagte eine Stimme.
Wir waren gerade auf dem Dachstock angelangt, und als ich mich in die Richtung umdrehte, aus der diese Bemerkung mit sarkastischem Unterton kam, sah ich einen Jungen, der mit gekreuzten Beinen, einen aufgeschlagenen Atlas auf den Knien, neben einem Globus unter dem Giebelfenster auf der Erde saß. Er hatte das Profil eines jungen Adlers, mit einer Nase, die das ganze übrige Gesicht – einem Hausherrn gleich – dominierte; die Haare waren schwarz, die Augen braun, und obwohl er nur ein oder zwei Jahre älter war als ich, schien bereits Ironie die Schmalheit seiner Lippen geprägt zu haben; man wusste nicht einmal, ob er lächelte oder ob er so geboren war.
»Hör gut zu, an dem, was meine kleine Schwester dir da erzählt, ist kein einziges Wort wahr, es schult einzig die Fantasie. Lila braucht das Lügen so sehr, dass man ihr nicht einmal böse sein kann. Es ist ihre Berufung. Ich selbst bin von wissenschaftlicher und rationalistischer Denkungsart, was in dieser Familie absolut einmalig ist. Ich heiße Tad.«
Er erhob sich, und wir drückten uns die Hand. Ganz hinten auf dem Dachboden war ein roter Vorhang, dahinter spielte jemand Klavier.
Lila schien von den Äußerungen ihres Bruders in keiner Weise aus der Fassung gebracht und beobachtete mich mit leicht amüsiertem Gesichtsausdruck.
»Glaubst du mir oder nicht?«, fragte sie.
Ich zögerte keinen Augenblick.
»Ich glaube dir.«
Sie warf ihrem Bruder einen triumphierenden Blick zu und setzte sich in einen großen zerfledderten Sessel.