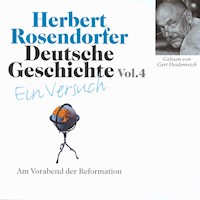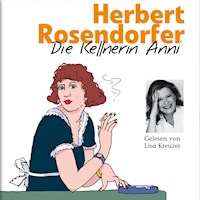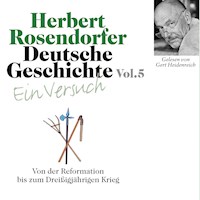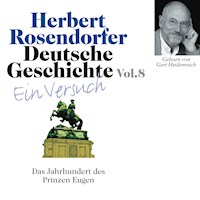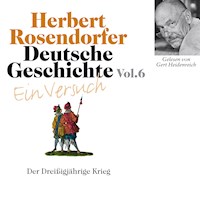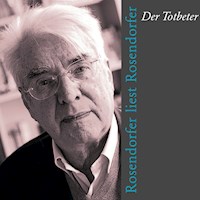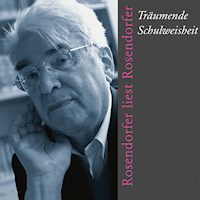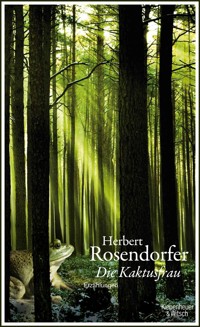
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Phantastische Geschichten vom Meister der literarischen HochkomikHerbert Rosendorfer hinterlässt uns neue Geschichten, die mit viel Charme und mit hintersinnigem Humor erzählt sind. Den Leser locken sie in eine wundersame Welt, in der das scheinbar Normale, das scheinbar Reale ins Phantastische übergeht.Herbert Rosendorfers neue Erzählungen, die nun posthum erscheinen, stecken voller Metamorphosen, Wanderungen und Träume, sie sind oft märchenhaft und bevölkert von grotesken Gestalten: Da wäre die kongeniale Gogol-Parodie vom braven Leibburschen Fedja und dem vermeintlich zum Frosch verwandelten Generalmajor Turkin, da ist der Kaktus eines unfreiwilligen Steuersünders, der allmählich zum reizenden Pygmalion wuchert. Es gibt einen Ulmer Hundehochzeitsunternehmer und seine Frau, die als Onassis- und Jackie-Kennedy-Darsteller auftreten, es gibt Drachen und Zwerge, Zentauren, die als Forstmeister arbeiten, und ein diplomatisches Maultier in den Anden. Ganz nebenbei wird der verloren gegangene Schluss von Kafkas Roman »Das Schloss« offenbart, ein gläsernes Buch kündet vom Goldenen Wind, der die Welt zur Wüste hobelt, das Vexierspiel um eine opulent-barocke Geheimgesellschaft in Venedig mündet in ein literarisches Rätsel und die Intrige um eine Chopin-Mazurka endet tödlich.Mit diesen surreal-skurrilen Geschichten erweist sich Herbert Rosendorfer als Meister einer ins Komische gebrochenen literarischen Phantastik, die der modernen rationalen Welt und ihren »Gewissheiten« auf höchst unterhaltsame Weise den Zerrspiegel vorhält. Nur eines ist nach großem Lesevergnügen gewiss: Ihren Kaktus sehen Sie fortan mit anderen Augen – und Wetterfrösche im Glas erst recht! »Ein bayerischer Autor mit internationalem Renommee« Jurybegründung zur Verleihung des Corine-Ehrenpreises 2010»Rosendorfer stammt aus der Familie eines E.T.A. Hoffmann oder Jean Paul, und damit sind wir mitten in einer Welt geistvoller Ungereimtheiten.« Martin Gregor-Dellin, Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Herbert Rosendorfer
Die Kaktusfrau
Erzählungen
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Herbert Rosendorfer
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Herbert Rosendorfer
Herbert Rosendorfer, 1934 in Bozen geboren, ist Jurist und Professor für Bayerische Literaturge-schichte. Er war Gerichtsassessor in Bayreuth, dann Staatsanwalt und ab 1967 Richter in München, von 1993 bis 1997 in Naumburg/Saale. Seit 1969 zahlreiche Veröffentlichungen, unter denen die ›Briefe in die chinesische Vergangenheit‹ am bekanntesten geworden sind. Herbert Rosendorfer, Mitglied der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sowie der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen geehrt, u.a. dem Tukan-Preis, dem Jean-Paul-Preis, dem Deutschen Fantasypreis, dem Bundesverdienstkreuz Erster Klasse und zuletzt 2010 mit dem Corine-Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten. Er lebt mit seiner Familie in Südtirol.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit leichter Hand und mit hintersinnigem Humor lockt Herbert Rosendorfer die Leser dieser Geschichten in eine wundersame Welt, in der das scheinbar Normale, das scheinbar Reale ins Phantastische übergeht.
Herbert Rosendorfers neue Erzählungen stecken voller Metamorphosen, Wanderungen und Träume, sie sind oft märchenhaft und bevölkert von grotesken Gestalten: Da wäre die kongeniale Gogol-Parodie vom braven Leibburschen Fedja und dem vermeintlich zum Frosch verwandelten Generalmajor Turkin, da ist der Kaktus eines unfreiwilligen Steuersünders, der allmählich zum reizenden Pygmalion wuchert. Es gibt einen Ulmer Hundehochzeitsunternehmer und seine Frau, die als Onassis- und Jackie-Kennedy-Darsteller auftreten, es gibt Drachen und Zwerge, Zentauren, die als Forstmeister arbeiten, und ein diplomatisches Maultier in den Anden. Ganz nebenbei wird der verloren gegangene Schluss von Kafkas Roman »Das Schloss« offenbart, ein gläsernes Buch kündet vom Goldenen Wind, der die Welt zur Wüste hobelt, das Vexierspiel um eine opulent-barocke Geheimgesellschaft in Venedig mündet in ein literarisches Rätsel und die Intrige um eine Chopin-Mazurka endet tödlich.
Mit diesen surreal-skurrilen Geschichten erweist sich Herbert Rosendorfer als Meister einer ins Komische gebrochenen literarischen Phantastik, die der modernen rationalen Welt und ihren »Gewissheiten« auf höchst unterhaltsame Weise den Zerrspiegel vorhält. Nur eines ist nach großem Lesevergnügen gewiss: Ihren Kaktus sehen Sie fortan mit anderen Augen – und Wetterfrösche im Glas erst recht!
»Rosendorfer stammt aus der Familie eines E.T.A. Hoffmann oder Jean Paul, und damit sind wir mitten in einer Welt geistvoller Ungereimtheiten.« Martin Gregor-Dellin in ›Die Zeit‹.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © plainpicture/Fancy Images; maSpi – Fotolia.com (Wald); Vignette
Buchklappe: © Laura Rosendorfer
Autorenfoto: © Julia Andreae
Zeichnungen im Innenteil: © Herbert Rosendorfer
ISBN978-3-462-30627-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Der Frosch
Das Mädchen mit dem Nasenringelchen
Die Kaktusfrau
Die Rolle
Requiem für die Welt
Die junge Wasserträgerin
An Himmels Tor
Das diplomatische Maultier
Die Heimat der grünlichen Schwestern
Die Jungfrau
Mazurka in cis-Moll
Gnadenwald
Steinmann
Gulden
Im Bärenthale
Meinen Enkeln gewidmet:
Laura, Olivia, Stella, Tizia, Elias, Severin und Markus
Der Frosch
Es war noch zu den Zeiten des, wie man so sagte, real existierenden Sozialismus, da war ich, warum, habe ich nie erfahren, zu einem internationalen Juristenkongreß nach Bukarest eingeladen. In Rumänien herrschten noch Ceauçescu und seine grämliche Ehefrau. »Haben Sie nicht auch das Gefühl«, meinte Jewgraf Konstantinowitsch, »daß der Mißmut, den dieses Paar ausstrahlt, das ganze Land verfinstert?«
»Das sagen Sie«, sagte ich, »als Angehöriger eines Brudervolkes? Eines sozialistischen?«
Jewgraf Konstantinowitsch Tichonov war Professor für Rechtsvergleichung an einer weit östlich in der Sowjetunion gelegenen Universität. Er sprach vorzüglich Deutsch, nannte mich schon am ersten Abend »Gerbert Osipowitsch«, nachdem er sich nach dem Namen meines Vaters– Josef – erkundigt hatte, bat, ihn »Jewgraf Konstantinowitsch« und nicht »Herr Professor Tichonov« zu nennen, und war nur enttäuscht über meinen nach seinem Dafürhalten unnennenswerten Soika-Konsum. Soika entspricht in Geschmack, Brutalität und Konsummenge auf rumänischer Seite dem russischen Wodka.
»Die russischen Namen kommen oft aus dem Griechischen«, sagte er, nachdem ich mich über den seinen, über Jewgraf, gewundert hatte. »Dmitrij von Demetrios, Alexander sowieso, Fjodor soviel wie Theodoros und so weiter. Jewgraf kommt von Eugraphos, das Eu wird zu Jew, denken Sie an Jewgenij: ist gleich Eugen oder Eugenios, der Wohlgeborene, Jewgraf: der Wohlgeschriebene oder vielleicht auch Wohlschreibende, aber das lassen wir angesichts des strohtrockenen Zeugs, das ich verfasse, dahingestellt.«
»Aber eher selten, dieser Vorname?«
»Schon, aber immerhin heißt eine Figur bei Dostojewski so, ich glaube, in Onkelchens Traum, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls in einem der früheren Werke Dostojewskis, die mir ohnedies die lieberen sind als die späten, in denen es oft sechsunddreißig Stunden lang Nacht ist, die Menschen nichts essen und nur Seele sind. In den früheren ist er noch ganz Gogol, dessen Seele die eigentlich russische war.«
»Auch ich erlaube mir, Jewgraf Konstantinowitsch, Gogol außerordentlich zu schätzen, und ich bedaure, seine Werke nicht in der Originalsprache lesen zu können. Aber in deutscher Übersetzung habe ich, bin ich mir fast sicher, alles gelesen, was er geschrieben hat.«
»Dann kennen Sie auch den Frosch, meine Lieblingsgeschichte, werter Freund Gerbert Osipowitsch?«
»Den Frosch? Nein. Dann habe ich in der Tat nicht alle Werke Gogols gelesen.«
»Ich glaube nicht, daß es in einer der windigen Buchhandlungen hier in Bukarest Gogols Werke in deutscher Sprache gibt. Ceauçescus Werke schon, auch in deutscher Sprache, in rotes Leder gebunden, habe sie in einer Aus-lage gesehen, sehr preiswert, aber ich nehme an, die 25 Bände sind bedauerlicherweise zu schwer für Ihr Fluggepäck? Ja, ja.« Und so erzählte er mir am folgenden Abend, als wir eine Einladung beim Ersten Wirklichen Stellvertreter des Justizministers schwänzten, Gogols Geschichte vom Frosch. (Nebenbei ist vielleicht zu erwähnen, daß es vier Erste Wirkliche Stellvertreter des Justizministers gab. Wir wären immerhin beim zweiten eingeladen gewesen.)
»Es traf sich, erzählt Gogol, in gewissem Sinn unglücklich‚ daß drei, wenn man so sagen kann Ereignisse zusammenstießen, nämlich daß Seine Exzellenz, der General-major Wasilij Wasiljewitsch Turkin, ein würdiger Herr im besten Alter mit dem, so die allgemeine Ansicht, schönsten Backenbart der russischen Armee, seinem Leibburschen, einem etwas verstandesbeeinträchtigten Bauernlümmel aus dem Gouvernement Saratow, fünf Tage Urlaub gab, um ihm zu ermöglichen, bei der Hochzeit seiner Schwester den Trauzeugen zu machen. Der Bursche hieß Fedja.
Fedja also fuhr mit der Eisenbahn, dann auf dem Karren eines Lohnfrächters, der ihn mitnahm, in sein Dorf, das so unwichtig und unbedeutend ist, daß es sich nicht lohnt, schreibt Gogol, einen Namen dafür hier hinzusetzen. Die letzten fünfzehn Werst ging Fedja selbstverständlich zu Fuß, denn der Lohnfrächter bog in die Kreisstadt ab. Was hätte er auch in so einem elenden Nest wie dem, aus dem Fedja stammte, zu suchen gehabt.
An dem Abend des Tages, an dem Fedja, seinem Generalmajor Exzellenz dankbar die Hand küssend, abgereist war und sich der General ohne Burschen behelfen und seine Stiefel fluchend und ächzend eigenhändig anziehen mußte, war Exzellenz Wasilij Wasiljewitsch Turkin, eben unser General, zu einem Wohltätigkeitsbasar bei der Fürstin S. eingeladen. Es ließ sich nicht umgehen, daß Turkin zwei Lose kaufte, weil schon sein direkter Vorgesetzter, Seine Exzellenz General Baron Donnerkrantz, drei Lose gekauft hatte. Und gewann: einen Wetterfrosch im Glas. Dies das zweite schicksalsschwere Ereignis.
Neuerlich fluchend darüber, daß er seinem Burschen Urlaub gegeben hatte, mußte Turkin seinen Frosch im Glas selber nach Hause tragen. Der Frosch glotzte, dicht am Boden am Fuß seiner Leiter sitzend, den General aus dem Glas heraus an.
Das dritte, die ganzen Verwicklungen begründende Ereignis bestand darin, daß am vierten Tag von Fedjas Urlaub Turkin ein Telegramm seines Vetter Dmitrij Petrowitsch Turkin erreichte, der ihn damit zur Jagd einlud, die er anläßlich seines Namenstages veranstaltete, und zwar auf seinem Gut in Kurland. Da sich Turkin dieses von ihm sehr geschätzte Vergnügen nicht entgehen lassen wollte und zudem die spezielle saure Lunge, die Dmitrij Petrowitschs unverheiratete Schwester Afanasja Petrowna kochte, das heißt, die strenge Aufsicht über die Zubereitung dieser violetten Köstlichkeit führte, packte Wasilij Wasiljewitsch unverzüglich und wiederum fluchend, weil er es selber machen mußte, das Notwendigste und eilte nach Kurland zur Jagd. Unter das Glas mit dem Wetterfrosch legte er einen Zettel mit dem Vermerk: ›Fedja, du Schurke, mit Fliegen füttern!‹ In Großbuchstaben, Kurrentschrift konnte Fedja nicht lesen.«
»Sagen Sie, verehrter Jewgraf Konstantinowitsch«, warf ich ein, »hat es zu Zeiten Gogols schon Telegramme gegeben? Und Eisenbahnen?«
»Hm«, sagte Jewgraf Konstantinowitsch, »Gogol ist 1852 gestorben. Da gab es, Sie werden staunen, schon den elektrischen Telegraphen.«
»Auch in Russland?«
»Wenn es Gogol schreibt? Er wird es wohl gewußt haben.«
»Und die Eisenbahnen?«
»Da bin ich mir weniger sicher, geehrter Gerbert Osi-powitsch. Daß diese Neuerung gegen Ende von Gogols Lebzeiten langsam Fuß faßte, steht fest. Daher gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder hat es doch einige anfängliche Eisenbahnstrecken gegeben, als Gogol die Geschichte vom Frosch aufschrieb – sie ist leider nicht datiert –«
»Oder?«
»Die Geschichte ist doch nicht von Gogol.«
»Vielleicht von Ljeskow? Oder Turgenjew? Oder Tschechow? Von ihnen habe ich viel gelesen, von Tschechow sogar sehr viel, aber wohl nicht alles.«
»Mag sein, Väterchen, mag sein«, sagte Jewgraf Konstantinowitsch nachdenklich, »aber ich meine doch: Gogol.«
Und er fuhr fort.
»Pünktlich am fünften Tag kam der Bursche Fedja, schwer bepackt mit Schinken und Würsten und eingelegten Gurken, was ihm alles seine Mutter mitgegeben hatte, dem armen Sohn, der in der grausamen Stadt leben mußte, in die zu seinem Erstaunen leere Wohnung zurück.
Er suchte in allen Zimmern, das hintere Schlafzimmer des Generals wagte er – befehlsgemäß – nicht zu betreten. Er schrie aber: ›Exzellenz, melde mich gehorsamst zurück! Fedja!‹ Sie wissen: Russische militärische Meldungen enden immer mit der sozusagen gebrüllten Unterschrift.
Der Frosch machte: ›Quak‹.
Fedja erschrak, ließ alles fallen, was er in der Hand hatte. Das Gefäß mit den eingelegten Gurken hatte er zum Glück vorher schon auf den Küchentisch gestellt. Fedja trat vorsichtig an die Kommode, auf der das Glas mit dem Frosch stand. Der Frosch saß auf der obersten Sprosse seiner Leiter und schaute scharf.
›Exzellenz!‹ sagte Fedja mit belegter Stimme, ›belieben zu befehlen …‹ Die Stimme versagte ihm. Er stand vielleicht eine Stunde starr da, so starr wie der Frosch, der ihn fixierte. Zumindest kam es Fedja so vor, als sei es eine Stunde. Dann bemerkte er den Zettel, las ihn unter Aufbietung aller geistigen Kräfte und sagte dann: ›Zu Befehl, Exzellenz!‹, ging in die Küche und – wenn auch einer wie Fedja, ein Bauernlümmel aus dem Gouvernement Saratow, wo damals auch noch keine Morgendämmerung an höherer Bildung hingelangt war, nur Großbuchstaben und die nur mit Mühe lesen konnte, war er doch und vielleicht gerade deshalb in praktischen Dingen voll auf der Höhe. Er träufelte einige Tropfen Honig auf den Küchentisch, und schon versammelten sich zwei Dutzend Fliegen hier, von denen Fedja vier mit der Hand fing. Fliegen haben tausendmal schnellere Augen als Menschen, aber Fedja wußte, wie man Fliegen fängt: von vorn und nach ihrer Flugbahn berechnet.
Fedja öffnete den Deckel des Froschglases, warf die Fliegen hinein und schloß es schnell wieder. ›Belieben Exzellenz zu gestatten, daß ich gesegnete Mahlzeit wünsche!‹ Der Frosch schnappte die Fliegen und setzte sich dann auf den Boden des Glases, drehte sich von Fedja weg.
Am nächsten Tag, Fedja hatte schlecht geschlafen, er hatte geträumt, daß auch er in einen Frosch verwandelt ist, fing er wieder einige Fliegen und fütterte damit den Generalmajor, dann aß er ein heißes Brot mit Zwiebeln, schnitt ein Stück vom heimischen Speck ab und aß es, schnipselte nach längerem Nachdenken ein kleines Eck Fett vom Speck und warf es in das Glas, aber der Generalmajor rührte es nicht an.
›Dann eben nicht‹, dachte Fedja und ging hinunter zur Beschließerin, die ebenerdig seitlich des Vorhofes hauste, eine gewisse Jelisaweta Alexejewna, die gerade damit beschäftigt war, aus einer Hose zwei zu machen, denn ihr Mann war ein Einbeiniger.
›Guten Morgen, Mütterchen‹, sagte Fedja, ›es ist was passiert.‹
›Und was, Väterchen Fedja?‹
›Der Generalmajor ist ein Frosch geworden.‹
›Du sündiger Untäter, was erzählst du mir für Sachen?‹
›Wenn es wahr ist‹, sagte Fedja.
Die Beschließerin legte ihre Arbeit weg, raffte die Röcke und lief mit Fedja in die Wohnung des Generalmajors hinauf. Auf Zehenspitzen und respektvoll betrat sie hinter Fedja das Zimmer, in dem das Glas mit dem Wetterfrosch stand. Der Frosch saß immer noch am Boden und schaute zur Wand.
›Es ist mir schon immer aufgefallen‹, sagte Fedja leise, ›daß Seine Exzellenz sehr oft die Hände so halten‹, er zeigte seine Hände und spreizte die Finger flach auseinander, ›und jetzt ist er tatsächlich ein Frosch geworden.‹
›Es ist genau die Farbe der Uniform des Pawlowschen Infanterieregiments‹, sagte die Beschließerin.
›Eben‹, sagte Fedja.
Der Frosch wandte den Kopf.
›Verzeihung, Exzellenz‹, sagte die Beschließerin und verließ schnell das Zimmer. Fedja schloß die Tür.
›Und?‹ fragte draußen die Alte.
›Weiß auch nicht‹, sagte Fedja, ›jedenfalls muß ich ihn mit Fliegen füttern. Speck frißt – Pardon, ißt er nicht.‹
›Es ist gut‹, sagte die Alte, ›daß noch heute vormittag Vater Therapont kommt, vom Smolnyj-Kloster. So eine Merkwürdigkeit ist womöglich nicht gottgefällig.‹
Sowohl Vater Therapont, ein nahezu kugelförmiger Mönch mit einem roten Bart, der ihm bis zum Gürtel reichte, als auch wenig später der Synodalregistrator Ky-rill Sergejewitsch Niwischtschajin, ein blasser jüngerer Mensch in englischen Tuchhosen, der in der Straße als Intellektueller galt, begutachteten im Lauf des Tages, von Fedja und von Jelisaweta Alexejewna informiert, den Frosch. Dabei erklärte Jelisaweta Alexejewna, daß die Verwandlung vermutlich gegen zwei Uhr in der Nacht sich vollzogen haben müsse, denn genau um diese Stunde sei sie plötzlich und scheinbar grundlos erwacht, und sie habe so ein komisches Gefühl gehabt. Daß es zwei Uhr gewesen sei, wisse sie deshalb, weil sie die Stunde von der Wosnessenskij-Kirche schlagen gehört habe.
Der Mönch Therapont betrachtete lange den Frosch und sagte dann, er könne nicht entscheiden, ob diese Verwandlung Teufelswerk oder aber im göttlichen Heilsplan vorgesehen sei. Beides sei möglich, Jelisaweta Alexejewna möge das Epiphanios-Wasser herbeibringen, das sie, wie in jedem rechtgläubigen Haushalt, vorsorglich aufbewahrt hatte. In der Tat war das so bei der Beschließerin, allerdings, muß man sagen, bewahrte sie es in einer alten Spiritusflasche auf, die keinen Verschluß mehr hatte. ›Aber‹, so dachte sie, ›im Gegensatz zu Spiritus raucht das Epiphanios-Wasser nicht aus.‹
Der Mönch besprengte also das Glas des Wetterfrosches. Der verdrehte die Augen und sprang auf die zweithöchste Sprosse seiner Leiter.
›Hm‹, sagte Vater Therapont, ›das kann alles bedeuten und nichts auch.‹
›Immerhin‹, sagte Jelisaweta Alexejewna, ›ist Exzellenz nach oben gesprungen. Mehr freudig.‹
›Das ist richtig‹, sagte Vater Therapont.
›Und er vertilgt Fliegen‹, sagte der Synodalregistrator, ›die bekanntlich teuflische Wesen sind.‹
›Auch das ist richtig‹, sagte Vater Therapont, ›es bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Hat er‹, er wandte sich an Fedja, ›irgend etwas gesagt?‹
›Quak‹, sagte Fedja.
Der Mönch kratzte sich hinter dem Ohr, schüttelte den Kopf und wiederholte dann: ›Abwarten. Und Sie, verehrte Jelisaweta Alexejewna, sind sicher so gütig, mir ein Gläschen einzuschenken. Es soll Ihnen Segen bringen.‹
Sie verließen das Zimmer. Der Synodalregistrator aber sagte zu Fedja: ›Ich vermute, man wird das an höherem Orte melden müssen.‹
Fedja zog sich auf sein Bett neben der Kohlenkiste im Vorratsraum zurück und dachte über den Vorschlag des Synodalregistrators nach. Nachdenken war nicht seine Stärke. Es ermüdete ihn so, daß er – am hellichten Vormittag – einschlief. Schlafen hingegen war eine seiner herausragenden Stärken, und er konnte es sogar, wenn es sein mußte, im Stehen.
Aber wir müssen uns inzwischen wieder dem Generalmajor zuwenden, der bei seinem Vetter in Kurland ein paar Tage fröhlicher Jagd zubrachte mit herrlichen Schmausereien und Whist-Partien bis spät in die Nacht hinein. Aber dann ereignete es sich, daß ein weiterer Jagdgast eintraf, ein deutscher Graf, und in dessen junge Frau verliebte sich Wasilij Wasiljewitsch so schnell und mit einer derartigen Heftigkeit, daß es ihm förmlich seine ordensgeschmückte Brust zersprengte. Clara hieß die Gräfin, und der Vetter, der im Gegensatz zum deutschen Grafen – dies ein Glück– die Seufzer des Generalmajors bemerkte, sagte: ›Daß du die deutsche Geiß beturtelst, ist mir schetzkojewo, aber mach den Skandal bitte nicht in meinem Haus.‹ So bezähmte sich, schwer genug, Wasilij Wasiljewitsch, aber als nach einer Woche der Graf mit seiner Gräfin wieder nach Deutschland abreiste, hielt es den Verliebten nicht mehr, und er reiste dem Paar nach.
Wenn ein Offizier einige Tage fehlt, vielleicht sogar ein paar Wochen, geht er erfahrungsgemäß niemandem ab. Aber Wasilij Wasiljewitsch richtete, so viel Verstand hatte er immerhin noch, ein Gesuch um Urlaub an das Armeekommando: er müsse eine Gastritis, die er sich im Dienst zugezogen, in Bad Kissingen auskurieren.
Das Gesuch ging in der Armeekanzlei verloren. Das heißt, es kam in die Hände des Stabsschreibers Anatolij Semjonowitsch Pestilenskij, eines außerordentlich unsauberen Menschen, der ununterbrochen Tabak schnupfte, und, es ist leider nicht anders zu sagen, ein Schnupftabakgemisch tropfte auf Generalmajor Turkins Gesuch, der Stabsschreiber merkte es nicht, legte ein anderes Schriftstück darauf, das Gesuch blieb kleben und wanderte somit in eine andere, völlig fremde Akte, wo es für die nächste Ewigkeit unauffindbar blieb, zumal niemand danach suchte, was aus dem, was ich Ihnen gleich erzählen werde, ohne weiteres hervorgeht.
Fedja ächzte und stöhnte lang unter der gewaltigen Anstrengung, den Entschluß zu fassen, die Meldung von der Froschwerdung seines Generalmajors einzubringen. ›Greife nicht mit der Hand nach oben, wenn du nicht siehst, was dort liegt‹, heißt ein russisches Sprichwort, es reimt sich im Russischen –«
»Im Deutschen«, sagte ich, »reimt sich’s auch: ›Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.‹«
»So ist es«, sagte Jewgraf Konstantinowitsch, »und so dachte auch Fedja, aber letzten Endes war ihm die Sache doch so unheimlich, daß er dem Rat des Synodalregistrators folgte, seine Uniform so gut es ging ausbürstete, die Knöpfe mit Spucke reinigte, sich vorschriftsmäßig beim Frosch abmeldete und – ja: wohin soll er gehen?
Bevor er zum – sehr angenehmen – Dienst als Bursche des Generalmajors Turkin abkommandiert wurde, hatte er sein Quartier in einer der Kasernen am Sagorodnij-Prospekt neben dem Zarskoje Seloer Bahnhof. Dorthin ging Fedja. Es traf sich, daß ein Kamerad, den er kannte, Wache stand.
›Der Segen aller Heiligen decke dich zu Tag und Nacht, Sascha, du gottloser Sünder‹, sagte Fedja.
›Du Fluchbeladener‹, sagte Sascha, ›du weißt doch, daß du mit einem, der Wache steht, nicht reden darfst.‹
›Ich bin dienstlich hier vor dir, Väterchen, und das, was ich rede und frage, ist dienstlich. Mein Generalmajor, also Seine Exzellenz Wasilij Wasiljewitsch, bei dem ich als Leibbursche diene, haben beliebt ein Frosch zu werden.‹
Auf Wache zu lachen ist auch verboten, vermutete der Soldat Sascha, wahrscheinlich strenger als nur reden. Er unterdrückte also das Lachen, das aber in ihm so heftig und gewaltig war, daß es seinen Kopf förmlich aufblähte und seine Augen furchterregend aus den Höhlen rollten. Und in dem Augenblick, als ein Hauptmann daherkam und Sascha wie auch Fedja salutieren wollten, platzte das Lachen aus Sascha heraus, daß man meinen konnte, der Pulvervorrat der Kaserne explodiere. Zum Glück war dieses Lachen so ansteckend, daß auch der Hauptmann, der eigentlich die militärische Strenge wahren wollte, unwiderstehlich lachen mußte, und das Gebrüll, vermischt mit den mahnenden Rufen Fedjas, daß alles gar nicht zum Lachen sei, war so laut, daß oben ein Fenster aufflog und der Oberst Anatolij Nikititsch Salsitzkij seinen Kopf herausstreckte und schrie: ›Sind wir in einem Narrenturm oder in einer Kaserne?‹
Sofort verstummten der Hauptmann und Sascha, und Fedja erkannte seine Chance, stampfte aufs Pflaster, daß es nur so knallte, salutierte und schrie: ›Bringe gehorsamst zur Kenntnis, daß Seine Exzellenz Generalmajor Wasilij Wasiljewitsch Turkin bevorzugt haben, nunmehr ein Frosch zu sein. Fedja. Leibbursche.‹
Der Oberst blinzelte. Nach einer Weile sagte er: ›Turkin?‹
›Jawohl, wenn gestatten, Herr Oberst.‹
›Frosch?‹
›Frosch, Herr Oberst, ich kann auch nichts dafür.‹
›Trägt er Uniform?‹
›Nein, aber er ist grün.‹
›Komm herauf.‹
So erzählte der Soldat Fedja, dem der Oberst leutselig sogar gestattet hatte, sich auf einen Stuhl zu setzen (›Hast du eine saubere Hose, du Bauernferkel?‹ ›Jawohl, Euer Gnaden Oberst!‹), die ganze Geschichte, auch die Äußerungen des Mönchs und den Ratschlag des Synodalregistrators.
›Und du warst also fünf Tage auf Urlaub, und wie du zurückgekommen bist, war Exzellenz Turkin weg und an seiner Stelle der Frosch da?‹
›Jawohl, Väterchen Oberst, glauben Sie einem einfachen, unschuldigen, rechtgläubig getauften Menschen. Und hier ist der Zettel, den er geschrieben hat.‹
Der Oberst drehte den Zettel hin und her.
›Das hat der Frosch geschrieben?‹
›Der Frosch, halten zu Gnaden, Väterchen Oberst, kann, glaube ich, nicht schreiben. Exzellenz haben es wohl grad noch vor der … vor der …‹
›… vor der Verwandlung geschrieben. Ja, ja.‹ Der Oberst stand auf und ging auf und ab. Selbstverständlich sprang auch Fedja sofort auf. ›Bleib hocken, du Mücke‹, sagte der Oberst, ›hm, hm, ein Frosch. Solche Dinge kommen vor. Mit solchen Dingen ist nicht zu spaßen. Hm, hm. Ein Frosch. Jedenfalls … jedenfalls muß die Sache untersucht werden. Es war richtig, daß du Meldung gemacht hast, mein Sohn.‹
›Erlauben Herr Oberst, daß Soldat Fedja abtritt, ich glaube, es ist nämlich Zeit, daß Exzellenz Herr Generalmajor seine Fliegen bekommt.‹
Begreiflicherweise erregte die nun förmlich abgefaßte Meldung, die der Oberst nach oben an das Armeekommando leitete, erhebliche Aufregung. Insbesondere die Frage gab zur Besorgnis Anlaß, ob die Froschwerdung des Generalmajors Turkin etwa ansteckend sei, und daß befürchtet werden müsse, die ganze Generalität der russischen Armee verwandle sich nach und nach in Frösche. Der kommandierende Armeegeneral, der schon erwähnte Baron Donnerkrantz, tobte zudem und beschimpfte seine Adjutanten, obwohl die an der Sache völlig unschuldig waren, daß er es als ungehörig, ja als subversiv empfinde, wenn ein Generalmajor sich eigenmächtig in einen Frosch verwandle. Jedenfalls solle der Generalmajor, ob als Frosch oder in seiner vorherigen Form, gefälligst zum Dienst erscheinen, und es solle ihm in aller Strenge befohlen werden, sich unverzüglich wieder in menschliche Form zurückzubegeben.
Der Befehl wurde von Stufe zu Stufe nach unten weitergegeben und erreichte so zuletzt Fedja, der das Glas mit dem Frosch nahm, nachdem er ihn vorher noch mit einigen Fliegen als Reiseproviant versehen hatte, und damit zum Armeekommando marschierte. Unglücklicherweise war der diensthabende Leutnant nicht über die Verwandlung des Generalmajors Turkin informiert. Als Fedja das Glas mit dem Frosch drin vorzeigte und sich meldete: ›Erlaube mir befehlsgemäß Seine Exzellenz, Herrn Generalmajor Wasilij Wasiljewitsch Turkin zu überbringen. Fedja, Rekrut‹, schrie ihn der Leutnant an: ›Du Überflüssiggeborener, ich werde dir deine Späße austreiben! Drei Tage Arrest!‹ Und sogleich kamen die Wachen und sperrten Fedja, der krampfhaft das Glas mit dem Frosch respektive mit Seiner Exzellenz dem Generalmajor Turkin festhielt, in ein finsteres Verlies.
Da gleichzeitig mit Fedja die Strohlieferanten für die Ställe kamen, und da es nach der Liste des Leutnants sieben Wägen sein sollten, es aber nur sechs waren und daher mit dem Lieferanten eine Diskussion entstand, zudem der Leutnant nach vier Tagen Verstopfung endlich den befreienden Drang empfand, dem er aber wegen der Diskussion mit dem Strohbauern nicht nachgeben konnte, und über allem auch die Schneiderin kam, eine gewisse Wenedikta Wjätscheslawowna Flowalzowa, die die Hosenträger des Leutnants ausgebessert hatte, diese zurückbrachte und sechzig Kopeken – und zwar in Silber – verlangte, die der Leutnant aber nicht bei sich hatte, was die Alte aufgrund Schwerhörigkeit nicht begriff, unterließ es der Leutnant, bei dem Durcheinander, vielleicht verzeihlich, aber dennoch pflichtwidrig, ein Protokoll über die Arretierung Fedjas zu veranlassen. Die Folge davon war, daß Fedja im Karzer vergessen wurde.
Inzwischen umschwärmte Wasilij Wasiljewitsch in Bad Kissingen weiterhin die deutsche Gräfin. Es stellte sich heraus, daß die Sorge von Wasilijs Vetter, es möchte ein Skandal entstehen, unbegründet gewesen war. Als der Graf einmal seine Frau und den Generalmajor in enger Umarmung begriffen in einer Laube des Kurparkes entdeckte und der Generalmajor, die Gräfin auf die Marmorbank sinken lassend (sie prellte sich dabei das Steißbein), aufsprang und ›Ich stehe Ihnen selbstredend zur Genugtuung zur Verfügung!‹ sagte, erwiderte der Graf nur: ›Wie bitte? Ich höre nicht mehr so gut. Aber wissen Sie, eine Sensation ist vorgefallen. Es ist nicht zweimal, nein dreimal hintereinander 17 gekommen. Leider hatte ich das dritte Mal nicht mehr zu setzen gewagt. Dann einen schönen Abend weiter. Ich komme nicht zum Abendessen. Ich lasse mir ein kaltes Huhn ins Casino bringen.‹ Und ging.
So verlebten Wasilij und die Gräfin so etwas wie Flitterwochen, während der Graf praktisch ständig nicht an einem, sondern an mehreren Spieltischen saß und – genauso ständig gewann.
Etwa drei Wochen, nachdem Fedja unschuldig ins Loch geworfen worden war, besuchte der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, der Inhaber eines der Regimenter, die zum betreffenden Armeekorps gehörten, die Kaserne. Zu seinen Ehren wurde ein Liebesmahl für die höheren Offiziere veranstaltet, bei dem es als Zwischengericht Froschschenkel in Aspik gab. Da fiel dem General Baron Donnerkrantz die Sache mit Turkin wieder ein, und er erzählte es dem Großfürsten.
›Und warum‹, fragte der Großfürst, ›ist dieser froschgewordene Turkin nicht zum Liebesmahl eingeladen worden?‹, lachte aber sogleich und fügte hinzu: ›Klar, man kann ja nicht gut einem Frosch Froschschenkel vorsetzen.‹
›Wo ist er denn überhaupt?‹ fragte Donnerkrantz.
So begann die Suche. Befehle jagten von oben nach unten. Kein Mensch hatte eine Ahnung, nur jenem Leutnant dämmerte etwas, und er ließ im Karzer nachschauen. Fed-ja war halbverhungert. Er war nicht ganz verhungert, weil ihm ab und zu der eine oder andere Kamerad, der ein paar Tage absitzen mußte, etwas von der Ration abgab. Aber der Frosch war tot und vertrocknet.
Die Bestattung erfolgte mit den für einen Angehörigen der vierten Rangklasse vorgesehenen militärischen Ehren. Nur als General Donnerkrantz den zündholzschachtelgroßen Sarg sah, fand er das zu lächerlich und unwürdig und befahl, daß der kleine Sarg in einen großen, normalen Sarg getan und so beerdigt wurde.
Aber damit endet die Geschichte noch nicht. Denn in Bad Kissingen trug es sich zu, daß der deutsche Graf, es war etwa ein halbes Jahr, nachdem Wasilij Wasiljewitsch den Frosch gewonnen hatte, es wagte, nachdem dreimal 24 gekommen war, noch einmal die höchstzulässige Summe auf 24 zu setzen. Und 24 kam. Die Bank war gesprengt. Noch am Spieltisch ereilte den Grafen ein von der Freude ausgelöster Gehirnschlag, und er verschied. Die Gräfin erbte, heiratete Wasilij Wasiljewitsch und zog mit ihm nach Nizza. Über die kaiserlich russische Botschaft in Paris richtete Turkin das Gesuch um Quieszierung an das Kriegsministerium. Als das Gesuch dort ankam, waren Turkins Personalakten schon archiviert, das heißt: unauffindbar. ›Ist nicht‹, fragte der zuständige Titularrat, er hieß Oleg Semjonowitsch Konjakskij, ›ist nicht dieser Turkin ein Frosch geworden? Und vertrocknet? Wie kann er dann ein Gesuch um Quieszierung einbringen?‹ Und er legte das Gesuch in die große Schublade mit der Aufschrift: Rätselhafte Aktenvorgänge. Und damit endet die Erzählung vom Frosch endgültig.«
»Von Gogol?« fragte ich.
»Ja«, sagte Jewgraf Konstantinowitsch, »von Gogol. Glaube ich.«
Das Mädchen mit dem Nasenringelchen
Das einzige, was mich stören würde, dachte ich (was mich aber dann später erstaunlicherweise gar nicht mehr störte), war ihr Nasenring. Kein großer, nach unten von der durchbohrten Nasenscheidewand hängender Ring, sondern ein kleines, silbernes Ringlein seitlich am linken Nasenflügel. Um aufzufallen, jedenfalls um mir aufzufallen, der ich mir einbilde, ein guter Beobachter zu sein, hätte es des Nasenringleins nicht bedurft, denn die Nase des Mädchens, nein, ich verbessere mich, der jungen Frau war an sich auffallend genug, und zwar im guten Sinn: Es war eine sogenannte klassische oder griechische Nase, ohne Knick an der Wurzel, von der Stirn in nicht zu übertreffend edler Linie sich ungebrochen fortsetzend.
Sie war betrunken. Wie kann eine junge Frau, zudem eine mit so einer Nase betrunken sein? Sie stand in der U-Bahn nahe der Tür, obwohl fast der ganze Wagen und so gut wie jeder Sitzplatz leer war. Sie schwankte hin und her, aber sichtlich nicht aus Trunkenheit, sondern weil die Bahn schnell fuhr und der Wagen wackelte. Es lag nicht an der edlen Nase, daß nichts von dem Ekel, den eine betrunkene Frau bisweilen verbreitet, an ihr war. Sie wirkte, ich hoffe, man versteht das, sie wirkte wie unschuldig betrunken.
Sie lächelte mich an, als wären wir uns schon einmal begegnet. Eins war mir von vornherein ganz klar: Eine solche ist das nicht. Das ist kein solches Signal: dieses Lächeln. Das war außer Frage, sofort.
Sie sagte: »Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wohin ich muß.« Sie sagte es zu mir.
Normalerweise bin ich nicht schlagfertig, und wenn mich ein fremder Mensch unvermittelt anspricht, zucke ich normalerweise in mich selber zurück und versuche sofort zu verschwinden oder tue so, als habe ich es nicht gehört. So nicht hier. Das Lächeln der betrunkenen jungen Frau forderte zu viel Sympathie ein. »Das ist schon viel«, sagte ich also auf ihre Bemerkung.
Sie trug die Uniform der neuen Spießigkeit: Blue Jeans, ein T-Shirt, eine wollene Jacke mit irgendeiner Aufschrift, einen schwarz-weißkarierten Schal um den Hals und selbstverständlich die unvermeidlichen Turnschuhe. Das Ganze war, nicht ungern bei solcher Adjustierung, leicht verkrustet, sie selber aber, auch das war sofort keine Frage, obwohl außer Gesicht und Händen nicht sichtbar, sauber, sogar gepflegt. Ich gestehe wiederum einen Gedanken: Die, dachte ich, läßt die Locken an ihrem dionysischen Dreieck nicht ungepflegt wuchern.
»Ich habe sonst nichts mit dem Alkohol«, sagte sie. Sie redete klar und nicht wie Betrunkene. War sie gar nicht betrunken? Glasig aus anderen Gründen?
In der Hand hatte sie eine Coca-Cola-Dose, zur Hälfte ausgetrunken. Und über die Schulter eine Tasche am Riemen, blau, glaube ich.
Sie empfand es offenbar als selbstverständlich, daß ich mit ihr ausstieg, und ich hatte das Gefühl, es war ihr klar, daß ich eigentlich weiterfahren hätte wollen. Wir gingen nebeneinanderher. Es war das, was ein Dichter früher eine laue Sommernacht genannt hätte. Eher: Frühsommernacht. Ich berührte sie nicht; sie schwenkte ihre Coca-Cola-Dose, trank aber nicht draus.
»Ziehen Sie«, sagte ich, »bitte Ihre Schuhe aus.«
Völlig unerstaunt stellte sie die Dose auf den Boden, zog die Schuhe aus, stand nun barfuß da und schaute mich an: »Soll ich sie wegwerfen?«
»Wenn die Läden noch offen hätten, würde ich dir andere kaufen.«
Sie warf die Turnschuhe hinter einen Bauzaun, der sich seitlich hinzog, und wir gingen weiter. Die Coca-Cola-Dose vergaß sie.
Ich war in einer fremden Stadt und auch nicht. Ich hatte hier vor vielen Jahren viele Jahre gelebt. Es ist eine große Stadt. Die Stadt war mir noch geläufig, aber dieses Viertel, durch das ich jetzt mit der barfüßigen jungen Frau ging, war mir eher weniger bekannt. Ich las einen Straßennamen. Hätte mich jemand nach dieser Straße gefragt, hätte ich keine Auskunft geben können. Es war ein Stadtviertel mit Mietshäusern aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Ein Stadtviertel, das noch nicht, wie andere dieser Art, chic geworden war. Ein rotbraunes Stadtviertel aus nachgedunkelten Ziegelmauern. Ab und zu unterbrach ein kleiner Laden die Straßenfronten, ab und zu trennte die Häuser eine Durchfahrt mit eisernem Gitter. Die junge Frau blieb unvermittelt stehen, ohne etwas zu sagen.
»Wohnen Sie hier?« fragte ich.
»Nein«, sagte sie, schob aber den einen der beiden Flügel des eisernen Gittertores auf. Der Eingang zum Haus lag seitlich im Hof. Wenig Grün, ich sah eine Teppichklopfstange, an der wohl schon lang kein Teppich mehr geklopft worden war. Am Nachbarhaus war ein Gerüst aufgestellt, von dem eine Plastikplane im Wind wehte. Ich hatte die Plastikplane beobachtet, und deshalb war mir im Moment entgangen, ob die junge Frau die Tür aufgesperrt, also einen Schlüssel gehabt hatte, oder ob die Tür nicht verschlossen gewesen war.
Ein eher enges Stiegenhaus mit gußeisernem Stiegengeländer, viele der grünen und blauen Kacheln fehlten an den Wänden.
Wieder blieb die junge Frau stehen. Ich hatte nicht das Gefühl, daß sie unschlüssig war, etwa, ob sie mich zu sich mit hinaufnehmen solle oder nicht, sondern, daß sie überhaupt nicht wußte, wo sie war, und auch, daß sie dieser Zustand keineswegs beunruhigte.