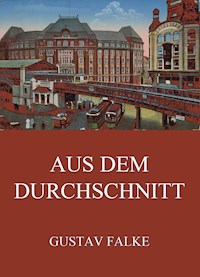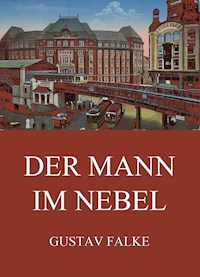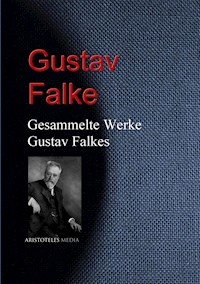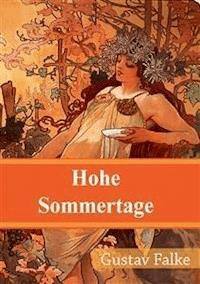0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alle diese verräucherten und verwitterten Häuser, die sich in dem engen Sackgäßchen zusammendrängten, wie gebrechliche Greise in einem Alterswinkel, die sich gegenseitig stützen und wärmen und die alten Köpfe voll von Erinnerungen eines langen Lebens zusammenstecken, auch im Schweigen noch mit dem beredten Ausdruck eines nachdenklichen Gemütes - alle diese altersschwachen, schiefen, halb in sich zusammengesunkenen Häuser waren Heimstätten menschlichen Glückes und menschlichen Elendes, Heimstätten der Hoffnung und Heimstätten der Sorge. Wenn man von der lichtüberfluteten Hafenstraße mit ihrem nimmerruhenden Lärm der Straßenbahn, der Rollfuhrwerke, des rastlos auf und ab wogenden Welthandels, durch den niederen Torweg in dieses dämmerige Gäßchen hineinsah, erschien es freilich nichts weniger als heimisch und wohnlich. Man sah dann auch seinen schönsten Schmuck nicht, den Kirchturm von St. Michael, der im Hintergrund über die niedrigen Häuschen schlank und schön in den Himmel stieg. Zu Zeiten konnte der schmale Torweg sogar einen unheimlichen Eindruck machen, wenn der dunkle Abend von hier seinen Ausgang zu nehmen schien, und die einzige Laterne, die ihn erhellte, noch nicht ihren traulichen Schimmer auf die schmutzigen Wände und das schadhafte Pflaster warf. Oder wenn der Wind, der auf dem Strom durch die Schiffstaue pfiff, einen plötzlichen Seitenstoß in diesen dunklen Winkel wagte, daß die Scheiben der alten Laterne erschrocken klirrten. Aber es gab auch Stunden, wo die Sonne die eine Hälfte des engen Gäßchens überleuchtete, daß die alten Baracken aussahen, wie fröhliche Greise, die in behaglicher Sonntagsstimmung eine lustige Geschichte aus ihrer Jugend erzählen. Und wenn gar der Mond, beweglicher als die Sonne, in schönen, stillen Nächten seinen milden Schimmer über das Gäßchen breitete, und St. Michael wie in einem flüssigen Silber dastand - ja, dann hatte es manchmal etwas Feierliches, märchenhaft Heimliches, und die Ratten, die über das spitze Pflaster huschten, konnten aussehen, wie verwunschene Prinzen und Prinzessinnen. Dann träumten die Menschen, die diese alten Häuser bewohnten, in ihren Betten auch wohl von Glanz und Glück. Ihre Seelen, entzauberte Prinzen, spazierten in einem stolzen freien Schritt in ihren königlichen Gärten umher und vergaßen, daß sie am Tage eigentlich nur ein Rattendasein führten, in einem ärmlichen Winkel, umgeben von Reichtum und Glück, wovon sie nur träumen durften. Ohlsens Gang hieß dieses Gäßchen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Kinder aus Ohlsens Gang
Die Kinder aus Ohlsens GangErstes BuchZweites BuchDrittes BuchImpressumDie Kinder aus Ohlsens Gang
Gustav Falke
Roman
Erstes Buch
Erstes Kapitel
Alle diese verräucherten und verwitterten Häuser, die sich in dem engen Sackgäßchen zusammendrängten, wie gebrechliche Greise in einem Alterswinkel, die sich gegenseitig stützen und wärmen und die alten Köpfe voll von Erinnerungen eines langen Lebens zusammenstecken, auch im Schweigen noch mit dem beredten Ausdruck eines nachdenklichen Gemütes – alle diese altersschwachen, schiefen, halb in sich zusammengesunkenen Häuser waren Heimstätten menschlichen Glückes und menschlichen Elendes, Heimstätten der Hoffnung und Heimstätten der Sorge.
Wenn man von der lichtüberfluteten Hafenstraße mit ihrem nimmerruhenden Lärm der Straßenbahn, der Rollfuhrwerke, des rastlos auf und ab wogenden Welthandels, durch den niederen Torweg in dieses dämmerige Gäßchen hineinsah, erschien es freilich nichts weniger als heimisch und wohnlich. Man sah dann auch seinen schönsten Schmuck nicht, den Kirchturm von St. Michael, der im Hintergrund über die niedrigen Häuschen schlank und schön in den Himmel stieg.
Zu Zeiten konnte der schmale Torweg sogar einen unheimlichen Eindruck machen, wenn der dunkle Abend von hier seinen Ausgang zu nehmen schien, und die einzige Laterne, die ihn erhellte, noch nicht ihren traulichen Schimmer auf die schmutzigen Wände und das schadhafte Pflaster warf. Oder wenn der Wind, der auf dem Strom durch die Schiffstaue pfiff, einen plötzlichen Seitenstoß in diesen dunklen Winkel wagte, daß die Scheiben der alten Laterne erschrocken klirrten. Aber es gab auch Stunden, wo die Sonne die eine Hälfte des engen Gäßchens überleuchtete, daß die alten Baracken aussahen, wie fröhliche Greise, die in behaglicher Sonntagsstimmung eine lustige Geschichte aus ihrer Jugend erzählen. Und wenn gar der Mond, beweglicher als die Sonne, in schönen, stillen Nächten seinen milden Schimmer über das Gäßchen breitete, und St. Michael wie in einem flüssigen Silber dastand – ja, dann hatte es manchmal etwas Feierliches, märchenhaft Heimliches, und die Ratten, die über das spitze Pflaster huschten, konnten aussehen, wie verwunschene Prinzen und Prinzessinnen. Dann träumten die Menschen, die diese alten Häuser bewohnten, in ihren Betten auch wohl von Glanz und Glück. Ihre Seelen, entzauberte Prinzen, spazierten in einem stolzen freien Schritt in ihren königlichen Gärten umher und vergaßen, daß sie am Tage eigentlich nur ein Rattendasein führten, in einem ärmlichen Winkel, umgeben von Reichtum und Glück, wovon sie nur träumen durften.
*
Ohlsens Gang hieß dieses Gäßchen. Mit großen, schwarzen Buchstaben stand es über dem niederen Torweg. Asmus Andreas Ohlsen war der Schiffshändler rechts neben dem Torweg. Ihm gehörte dieses hohe schmale Haus in der Hafenstraße, dessen altertümlicher Treppengiebel über den breiten Strom hinweg auf die gegenüberliegende Werft von Thoms und Dieckmann sah, und ihm zinsten auch die zwölf kleinen Wohnungen, die sich in dem engen Gang versteckten. Außer diesem Zinsverhältnis gab es noch ein Band, das die kleine dämmerige Welt der Hinterhäuser mit der großen hellen des Vorderhauses verband. Das war Mutter Krautsch. Mutter Krautsch, wie man sie, trotz ihrer Jugend, ihrer breiten Behäbigkeit wegen allgemein nannte. Sie hatte im Vorderhaus den Geschäftekeller inne, hinter dessen immer blitzblankem Fenster sie so appetitliche Dinge wie Grün- und Rotkohl, gelbe Rüben, weiße Teltower und was der Markt gerade brachte, zu einem reizvollen Bilde aufzustapeln wußte. Da stand sie tagsüber mit ihrer großen breiten Figur hinter dem niederen Ladentisch, oder bewegte sich in dem kleinen Raum mit einer Gewandtheit, die man ihrer Fülle nicht zugetraut hätte. Schien die Sonne, stand sie auch wohl, die vollen Arme in die Seite gestemmt, in der Tür oder auf halber Höhe auf der Treppe, die aus ihrem Kellergewölbe ans Licht des Tages führte, und wandte ihr volles, gutmütiges Gesicht dem vorüberfließenden Strom täglicher Arbeit zu. Und selten stand sie so, daß nicht einer oder der andere der Vorüberschreitenden ihr einen Gruß zurief. »Dag, Mudder Krautsch.« »Süh, Krautschen, auch 'n büschen auskucken?« »Was macht der Mann? Noch immer in der Südsee?« »Ja, wi Schippersfrun sünd man halbe Frun.«
Aber Mutter Krautsch sah nicht aus wie eine halbe Frau, wenn man das Wort so nehmen wollte. Sie brauchte Platz für zwei, wenn sie so dastand, ein Bild der Zufriedenheit und Gesundheit und einer dauerhaften Jugend. Sie war jetzt fünfunddreißig Jahre alt. Eine junge Frau. Und sie würde in zehn Jahren noch eine junge Frau sein, sagte Schiffshändler Ohlsen, der sie nicht nur als seine beste Mieterin gern leiden konnte.
Oft, wenn Mutter Krautsch sich einen Augenblick auf der Treppe sonnte, galten ihre Blicke ihrem einzigen Kinde, einem runden, untersetzten, strammen Jungen von sieben Jahren, der auf der Straße, unbekümmert um die Fußgänger, seinen Kreisel trieb oder mit andern Kindern Marmel spielte.
»Anton, daß du mich nich von Haus gehst.«
»Nee, ich geh schon nich, man nich bange.«
»Es gibt n Jackvoll.«
Nach solchen kurzen, aber meist lauten und heftigen Zwiegesprächen verschwand die Mutter wieder in ihrem Keller, und Anton marmelte oder kreiselte gleichgültig weiter, als wär n Jackvoll etwas, dem nicht weiter Gewicht beizulegen ist.
Heute, es war ein Mittwoch in der ersten Hälfte des Juli, ein heißer, trockner, staubiger Tag, stand Mutter Krautsch nicht hinter dem Ladentisch und sah auch nicht mit eingestemmten Armen auf die glühende Straße. Heute stand da Lene Lerch, ein halbwüchsiges, blasses Kind von vierzehn Jahren, einen großen, grauen Wollstrumpf in der Hand, das Knäuel unter die Achselhöhle geklemmt, und sah mit ihren wasserblauen Augen starr auf den blauen Schornsteinring eines Schleppers, der gerade vor Schiffshändler Ohlsens Haus seinen Liegeplatz hatte.
Wo aber war Mutter Krautsch? Mutter Krautsch hatte heute ein schwarzes Kleid angelegt und war in diesem feierlichen Staat nach dem letzten kleinen Haus an der rechten Seite von Ohlsens Gang gegangen. Ihre großen, gutmütigen, braunen Augen sahen verweint aus, und wer grade in der Tür oder am Fenster stand, sah ihr mit einem mitleidigen Kopfschütteln nach. Ein paar alte Frauen hatten ihr sogar die Hand gedrückt und sich ihr dann angeschlossen.
»Das ist der Krautschen ihr schwerster Tag. Man gut, daß ihr Mann schon wieder abgereist ist«, sagte die alte Cyriaks, die die weißen Zuggardinen von ihrem Fenster zurückgezogen hatte und nun mit ihrem Vogelgesicht hinter den Scheiben lauerte.
Inzwischen fuhr vorne ein schlichter, schmuckloser Leichenwagen vor. Die vier Träger – viel Umstände waren hier nicht nötig – saßen gleich darin und ließen die Beine pendeln. Grade vor Lene Lerch hielt der Wagen und verdeckte ihr den schönen blauen Ring um den Schornstein des Schleppers. Die mageren Arme erwachten aus ihrer Regungslosigkeit, die starren, wasserblauen Augen bekamen einen lebhaften, fast triumphierenden Glanz, und der ganze hagere Körper geriet in eine zappelnde Beweglichkeit. Sie lief die paar Stufen vollends hinauf, wobei ihr das Knäuel entfiel. Es rollte mit einem langen Faden bis unter den Wagen. Sie sprang ihm hastig nach und kroch halb unter das unheimliche Fuhrwerk, wo sie es wieder erhaschte. Sie ließ sich keine Zeit, den Faden wieder aufzuwickeln, und raffte ihn mit ein paar schnellen Griffen zusammen. Sie sah um die Ecke in den Torweg hinein, lief wieder zurück, in den Keller hinunter, kam wieder nach oben und beteiligte sich mit wichtiger Miene an der lebhaften Unterhaltung der jugendlichen Gaffer, die plötzlich wie hergeweht dastanden. Die vier Leichenträger in ihren abgetragenen schwarzen Röcken mit sammetnen Ärmelaufschlägen verschwanden im Torweg, während der Kutscher an den schwarzen Pferdedecken herumzupfte, die schwarzen Federbüsche zwischen den Ohren der Tiere ein wenig grader rückte und sich sonst an dem Wagen zu schaffen machte.
Der Bürgersteig war jetzt fast gesperrt von neugierigen Kindern, meistens Mädchen. Auch ein paar Frauen standen müßig dabei. Alle sahen dem Kutscher zu, als sähen sie solche Hantierung zum erstenmal. Der schwarze Wagen des Todes, so plötzlich in die helle, grelle Tagessonne gestellt, schien ihnen aber nichts Schreckliches zu haben. In dem Getöse des Lebens, umgellt von dem Pfeifen der Dampfschiffe auf dem Strom, dem Läuten der Straßenbahnen, fügte er sich in seiner schmucklosen Nüchternheit dem Ganzen als etwas Dazugehöriges ein.
Was alle diese Gesichter ausdrückten, war Neugierde, nichts als Neugierde. Selbst die Gesichter der Alten verrieten wenig tiefere Anteilnahme. Sie hatten das so oft in ihrem Leben gesehen. Eine Beerdigung. Und auch die Kinder waren dagegen abgestumpft. Es war auch ihnen nur ein Schauspiel für die immer neugierigen Augen. Die wollten sich nichts entgehen lassen, nicht das Geringste. Sie sahen alles, was auf der Straße vorging. Sie flogen links, sie flogen rechts. Ihre hastigen, oberflächlichen Blicke betasteten alles, faßten es an, warfen es weg. Ohne ein besonderes Interesse daran. Aber sie mußten es anfassen. Alle diese frechen, hastigen, neugierigen Augen tasteten an dem schwarzen Wagen herum, an den schwarzen Pferden und an dem Kutscher mit dem Dreimaster und dem langen Trauerflor.
Dieser, gewohnt so angegafft zu werden, trocknete sich mit dem Schnupftuch die Stirn und wischte seinen Hut aus. Dann begann er mit dem Wirt einer nahen Schenke, der sich barhaupt, mit einer weißen Schürze vor, der Menge zugesellt hatte, ein Gespräch. Er lachte ein paarmal laut und roh auf und ließ sich zuletzt einen Schnitt Bier und einen kleinen Kognak aus der Schenke holen.
»Ach, Herr Kleesand, mir auch n kleinen«, rief eine freche Knabenstimme.
In diesem Augenblick fuhr eine einfache Droschke vor. Der Pastor, ein langer, hagerer Mann, stieg schnell aus und bahnte sich, mit der linken Hand das Testament an seine Brust drückend, hastig einen Weg durch die Umstehenden. Alle rissen die Augen weit auf, und ein paar Frauen schüttelten wehleidig die Köpfe, als finge es jetzt erst an, recht traurig zu werden.
Nur die freche Knabenstimme fand keinen Geschmack mehr an der Sache.
»Nun dauerts noch drei Stunden«, gellte sie in das Schweigen hinein. »Da lur up.«
Und pfeifend trollte sich der Bengel quer über den Fahrdamm.
*
Endlich wurde der Sarg die kleine schmale, ausgetretene Treppe im Trauerhause heruntergetragen, erschien in der hellen Sonne, die die eine Seite von Ohlsens Gang erfüllte, leuchtete im Schmuck seiner billigen Kränze verschämt auf und verbreitete schnell einen strengen Duft von Koniferen und Tubarosen durch das kleine Gäßchen.
Im obern Stockwerk des gegenüberliegenden Hauses drückten sich zwei kleine Kindernasen an den Scheiben platt. An jedem Fenster, an jeder Tür, erschien jetzt ein Gesicht, dem langsam in der Mitte des schmalen Ganges, grade über dem Rinnstein hinschaukelnden Särglein nachzublicken. Eine noch junge, aber blasse, verhärmte und abgearbeitete Frau im dürftigen Trauerkleid schritt hinter dem Sarg her, still und verweint. Das war Frau Mau. Neben ihr ging ein etwas älterer Mann mit breitem, rotem Gesicht, dem sein Trauerkleid schlecht stand, und der verlegen einen Fuß vor den andern setzte. Er trug den abgenutzten schwarzen Zylinder in der Hand und setzte ihn erst auf, als der Torweg den kleinen Zug auf einen Augenblick den fremden Blicken entzog. Niemand kannte den Mann. Er war ein entfernter Verwandter der Frau Mau, der einzige, den sie in dieser Stadt hatte.
Der aber im Sarge lag, war noch vor kurzem als ein kleiner blonder, lebhafter, sechsjähriger Junge durch diesen Torweg ein und aus gesprungen. Ostern hatte er zum ersten Male seine Fibel aufgeschlagen. Nun hatte er sie so bald wieder zumachen müssen. Und welchen Spaß hatte es ihm gemacht, als er die ersten Wörter lautieren konnte. Und die Bilder in der Fibel, wie hatte er sich ihrer gefreut. »Sieh mal, Mama, ein Adler. Sieh mal, Mama, das is ein Affe.« Und was hatte er nicht alles von seinem Lehrer zu erzählen gehabt. »Du, Mama, der Herr Heinrich, das is aber einer. Zu nett is er.«
Daran mußte die arme Mutter denken, als der Sarg nun aus dem niedern Torweg in das helle, grelle Licht der Straße hinausschwankte, an all den kleinen neugierigen Kindergesichtern vorbei. Da waren welche darunter, mit denen er oft Marmel gespielt hatte. Und da waren viele, die immer freundlich mit ihrem kleinen Willi gewesen waren. Und da stand auch der Kommis von Schiffshändler Ohlsen, der ihm mal fünf Pfennige geschenkt hatte, weil er so kläglich um einen verlorenen Kreisel weinte. Aber da stand auch Lene Lerch mit ihren stechenden Augen und ihren gekreuzten Armen und erschreckte sie. Sie hatte nichts gegen Lene Lerch, aber Lene Lerch stand in dieser sonderbaren, herausfordernden Haltung auf der oberen Stufe von Krautschens Kellertreppe. Einen Augenblick krampfte sich das Herz der Mutter zusammen, und ein harter Zug erschien in ihrem Gesicht. Aber dann hörte sie wieder Mutter Krautsch laut aufschluchzen, als der Pastor von der unschuldigen Hand sprach, deren der liebe Gott sich bedient hätte, um ihren Willi aus diesem Tal der Schmerzen früh in seine himmlische Heimat zurückzuführen. Und plötzlich mußte auch sie, den einen Fuß schon auf dem Wagentritt, krampfhaft aufweinen, so daß ihr Begleiter nicht wußte, wohin vor Verlegenheit, und die alten Weiber unter den Zuschauern ein wehleidiges »ach Gott, ach Gott« hören ließen.
Wie froh war der Vetter, als er in der Droschke saß und die Tür zuschlagen konnte, was zu seinem Schrecken einen sehr lauten und nach seiner Meinung in diesem Augenblick höchst unpassenden Knall gab.
Langsam setzte sich der kleine Zug in Bewegung. Es war kein anderes Gefolge, als diese eine Droschke mit der Mutter und ihrem Vetter. Jetzt, unter dem tosenden Lärm des rastlosen Lebens langsam dahinziehend, das kleine bekränzte Särglein auf dem schwarzen Wagen, dahinter die eine alte klappernde Droschke, jetzt war es ein fremder Ton in dieser vielstimmigen Symphonie. Jetzt ging ein leiser Schauer aus von diesem düsteren Fahrzeug, diesem kärglichen Gepränge der Trauer, und faßte hier und da einen der hastig Vorübereilenden mit leisem Frösteln ans Herz.
Vor Ohlsens Gang hatten sich die Gaffer schon verlaufen, als die lange, hagere Gestalt des Geistlichen gebückt aus dem niedern Torweg ins Freie trat. Er hatte noch ein viertel Stündchen mit Mutter Krautsch gesprochen. Gesenkten Blickes ging er mit eiligen Schritten durch die Menge. Er überragte sie alle um Kopfeslänge. Der schwarze Talar wehte trotz der stillen Luft um seine Füße, so hastig ging er, als fühlte er sich in die helle, grelle Sonne und unter die eilenden, treibenden Menschen nicht hingehörend und suchte ihnen zu entfliehen. Vielleicht war es nur eine Amtshandlung, die ihn so eilen ließ. Noch ein Toter? Oder ein Täufling, der aufgenommen sein wollte in die Gemeinschaft der Gläubigen, um sich für dereinst einen Platz in der himmlischen Heimat zu sichern?
In Ohlsens Gang aber stand schon ein Apfelsinenhändler mit seiner Karre und rief laut sein »Appelsina, scheune Appelsina! Dutzend föftig Penn!«
Und die alte Cyriaks kaufte sechs Stück der schon etwas überreifen Früchte. Sie wollte sich die besten aussuchen. Aber der Händler sah es nicht gern.
»Sünd all zuckersöt, Madam, scheune Appelsinas.«
Zweites Kapitel
Acht Tage waren seit der Beerdigung des kleinen Willi Mau vergangen, acht schöne Tage, mit leichten östlichen Winden. Helle, heitere Tage, an denen die Sonne sich in den breiten Fenstern der großen Handelskontore spiegelte, daß es aussah, als sehe aus jedem dieser Fenster so ein lachendes Gesicht, das mit den Augen zwinkerte: »Ist das Leben aber schön, und wie vergnügt gehts in der Welt zu. Alles Gold! alles Gold!« Helle, heitere Tage, an denen die Sonne auch in den kleinen blinden Scheiben der alten Speicher noch ein Leuchten weckte, sich in die schmalen Fleete hineinstahl und über die staubigen Schuten eine goldene Decke warf, und draußen auf dem Strome alles in ein Funkeln und Blitzen kleidete. Acht schöne Tage, an welchen geschmückte Dampfer, fröhliche fremde oder heimische Ausflügler an Bord, mit Musik die Elbe hinunterglitten. Acht schöne Tage, während welcher Lene Lerch zweimal getanzt hatte, auf der Straße, zu den Klängen eines Leierkastens. Einmal hatte sie es voll ausgekostet, mit erhitzten Backen und fliegenden Zöpfen; Mutter Krautsch war nicht da, und keine Kundschaft störte ihr Glück. Das andere Mal aber hatte Mutter Krautsch sie hereingerufen: »Lene, büst nich klug? Son große Deern mang all die Kleinen?«
Was kann sich in acht Tagen nicht alles ereignen. Jeder Tag bringt etwas Neues. Eins wird über das andere vergessen. Sowie es dem kleinen Willi Mau erging. Wer dachte von all den neugierigen Leuten, die sich am Torweg aufgepflanzt hatten, noch an Willi Mau? Inzwischen war in der Nachbarschaft schon wieder eine Leiche gewesen, ein alter Pantoffelmacher. Wer dachte noch an den? Was zählt ein alter Pantoffelmacher in acht Tagen. Vor zwei Jahren, als die Cholera hier aufräumte, da ging es anders her. Aus Ohlsens Gang waren zwar nur zwei ausgezogen und hatten draußen in Ohlsdorf Quartier genommen. Ohlsens Gang war immer ein sauberer Winkel gewesen, wo einer den andern auf Reinlichkeit kontrollierte und der Hauswirt selbst nach dem Rechten sah. Aber anderswo hatte das Gift besseren Boden gefunden. Jeden Tag fuhren die schwarzen Wagen. Aber das sind alte Geschichten, sehr alte Geschichten. Zwei Jahre alt. Das Neueste war der Pantoffelmacher, und der war schon vergessen. Und vor ihm kam Willi Mau.
Nein, so schlimm stand es doch nicht um Willi Maus Gedächtnis, als um das des alten Pantoffelmachers. Auf der Straße freilich sprach man nicht mehr von ihm. Aber in Ohlsens Gang lebte er weiter. Da war seine kleine Schwester, die Marie. Die fragte alle Tage nach ihm. »Mama, wann kommt Willi wieder? – Is Willi bei Onkel, Mama? – Kommt er denn bald wieder?« Dann kniff die blasse junge Frau mit dem alten Gesicht die schmalen Lippen noch fester zusammen und strich der Kleinen beschwichtigend über den Scheitel. Und wenn sie dann doch die Lippen öffnete, klangen ihre Worte fast hart. Wie die Kleine sie quälte mit den Fragen. Wie oft hatte sie ihr schon gesagt, daß ihr Brüderchen tot sei, beim lieben Gott sei, wo er es jetzt viel schöner habe. Aber was wußte das Kind von tot. Es klammerte sich an ihre erste Antwort, die sie ihm damals aufschluchzend gegeben hatte: »Willi ist aus, Willi ist mit Onkel.«
Diese Frau hatte das Leben nur auf der Schattenseite gelebt. Ihre Mädchenjahre waren harte Arbeit gewesen, zu Hause und bei fremden Leuten, ihre junge Ehe verdüstert durch das langsame Dahinsiechen des schwindsüchtigen Mannes. Sein Tod hatte sie mit den Kindern alleine gelassen, mit zwei Kindern. Andere Frauen, die alleine standen, hatten vier und fünf durchzubringen. Sie klagte nicht. Sie arbeitete, und sie konnten sich satt essen. Sie ging als Waschfrau aus und übergab die Kinder der Hut freundlicher Nachbarn. Sie liebte die Kinder, still, wortkarg. Sie war von Haus eine herbe verschlossene Natur. Ihr Mann war weicher gewesen, fröhlichen, mitteilsamen Gemütes. Und wenn ihnen die Sonne nur ein wenig geschienen hätte, wäre sie an ihm aufgetaut. Aber die Sonne wollte ihrem Manne nicht helfen bei seiner Frühlingsarbeit an ihr. Und da kam die Krankheit, und auch seine Wärme und Heiterkeit erlosch. Woran sollte sie nun auftauen? An den Kindern? Ja. Ihr Junge war so eine aufgehende Sonne, warm und heiter wie der Vater und dabei, was ihr ja immer eine stille Freude gewesen war, zäh und geschmeidig wie sie. Jetzt lag er auf dem Kirchhof.
Als es vier Wochen her war, daß sie ihn nach Ohlsdorf gebracht hatte, kam Mutter Krautsch nach Feierabend und setzte sich langsam und verlegen auf den nächsten Stuhl an der Tür. Einen Korb mit Wurzeln, Sellerie und ein paar Kohlköpfen stellte sie neben sich auf den Fußboden.
Frau Mau schickte Mariechen, die am Fenster mit einem hölzernen Schäfchen spielte, in die Küche.
Mutter Krautsch atmete schwer und hörbar und fing an zu schluchzen.
»Heut sind es grade vier Wochen«, stieß sie unter Tränen heraus. »Es steht mir noch allens so vor, als wenn es gestern gewesen wär.«
Die blasse Frau sah sie mit einem harten, fast feindseligen Blick an und strich mechanisch die kleine gehäkelte Tischdecke glatt.
»Das alte Steinewerfen«, schluchzte Mutter Krautsch, »ich hab es ja immer gesagt. Das gibt noch mal 'n Malör. Wenn sein Vater das wüßte. Er schlüg ihn ja wohl tot.«
Jetzt setzte auch Frau Mau sich, legte die gefalteten Hände in den Schoß und sah starr vor sich nieder.
»Mit Willen hat er es ja nich getan«, sagte Mutter Krautsch. »Das wissen Sie ja auch. Er ist ja auch so 'n gutes Kind sonst.«
»Mit Willen nicht, nein, mit Willen nicht«, wiederholte Frau Mau leise und sah dabei immer vor sich hin. Sie konnte diese breite, gesunde, kräftige Frau mit den guten, jetzt in Tränen schwimmenden Augen nicht ansehen. Gerechtigkeit, das war schon in der Jugend immer ihr letztes Wort gewesen. Gerecht und selbstgerecht. So war sie. Aber dieser wohlgenährten Frau gegenüber verlor sie diesen Grund unter ihren Füßen. Hatte sie nicht Ursache zu Neid und Haß? Und wie redselig war diese Frau bei allen Tränen. Was wollte sie denn? Warum redete sie denn? Ach, da fing sie schon wieder an.
»Wenn er es nun erfährt, mein armer Anton. Sagen Sie es ihm nich, um Gottes Barmherzigkeit willen. Sagen Sie es ihm nich. Machen Sie ihn nich unglücklich.« Die ganze mütterliche Liebe weinte in diesen Worten. Da wandte Tilde Mau ihr ihr hartes Gesicht zu und sagte laut und bestimmt: »Nein, das wäre Sünde. Er soll es nie erfahren. Von mir nicht.« Und als ob dieser Entschluß sich ihr aus dem tiefsten Herzen losgerissen und dabei die eisige Kruste, die sich um ihren Schmerz gelegt, gesprengt hatte, schlug sie plötzlich die Hände vor das Gesicht und weinte bitterlich.
Da stand Mutter Krautsch leise auf und strich ihr mit der großen roten Hand immer über den dünnen blonden Scheitel, während sie sich mit der Linken heftig schnäuzte. Und als Frau Mau unter ihrem Streicheln stillhielt, wie ein Kind, und nichts sagte, sondern nur leise vor sich hinweinte, ließ sie von ihr ab und ging hinaus. Den gefüllten Korb ließ sie zurück, schob ihn aber im Hinausgehen mit dem Fuße möglichst unauffällig noch etwas weiter ins Zimmer hinein.
Auf der Treppe rieb sie sich mit der Schürze tüchtig die Augen. Die andern Weiber sollten nicht sehen, daß sie geweint hatte. Schludersch waren sie alle und steckten immer gleich die Köpfe zusammen, und die Cyriaks war die Schlimmste.
Die Cyriaks saß aber doch hinter ihrer Gardine, und am andern Tag wußten sie es alle, daß die Krautschen bei Tilde Mau gewesen war.
»Das soll sie auch man ja tun. Das is sie ihr ja auch woll schuldig. Mit all ihren Rüben und Wurzeln kann sie ihr das nich wieder gut machen.«
Aber in einem waren sich alle diese alten Weiber einig, auch die alten Jungfern, die nie ein Kind an ihrer Brust oder auch nur auf dem Schoß gehabt hatten: Wissen durfte es der Krautschen ihrer nie, daß er den kleinen Willi Mau totgeschmissen hatte. Er würde ja nie wieder eine ruhige Stunde haben können.
Totgeschmissen. So sagten alle diese alten Weiber. Und die Cyriaks hatte es selbst gesehen. Der Junge war ja sonst nicht so, aber er konnte so jähzornig werden. Und da hatte er blindlings den Stein geworfen. Acht Tage hatte der kleine Mau gelegen, da war er gestorben. Der Stein war schuld. Der Doktor hatte es ja selbst gesagt. Also richtig totgeschmissen. Das war nun so. Und das sein lebelang auf dem Gewissen haben. Der arme Junge. Er durfte es nie erfahren. Und sie gaben sich alle das Wort darauf und sprachen immer nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit von dem Schrecklichen. Wenn aber Anton Krautsch seine Spiele bis in Ohlsens Gang ausdehnte, was nicht selten geschah, wenn er mit Hugo Winsemann, der Maus gegenüberwohnte, marmelte, dann sahen alle diese Weiber den Jungen mit so traurigen, vorwurfsvollen Blicken an, als wäre er ein ganz unglückliches und verlorenes Kind.
Anton Krautsch aber, der von nichts wußte, und dem es ganz gleichgültig war, wie man ihn ansah, richtete beim Spielen seine hellen Augen immer nur auf die Marmeln. Er kümmerte sich auch sonst um nichts weniger als um andere Leute. So ein siebenjähriger Knirps, dem das Leben aus den Augen lachte. So eine kleine stämmige Range, die den Hugo Winsemann mit einer Hand umwarf, so ein fixes Kerlchen, das schon mit seiner Mutter zu Markt fuhr und ihr die vollen Körbe zureichte, daß die Marktleute und Karrenschieber sagten: »Büst jo n bannigen Kerl« – so einer brauchte die Leute nicht, er war sich selbst genug, Mittelpunkt der Welt. Für ihn schien die Sonne, für ihn wuchsen die Apfel, backte der Bäcker das Brot, stopfte der Schlachter die Würste, für ihn lagen alle die Schiffe da draußen auf dem Strom, für ihn war Hamburg da, vor allem aber seine Mutter, die ihn waschen und kämmen und anziehen, ihm Morgen- und Mittagbrot geben, kurz, allezeit für ihn sorgen und ihn lieb haben mußte. Er hatte sie auch lieb. Aber wenn er ihr mit seinen Kinderkräften half, wo er nur konnte, so war es nicht, weil er ihr ihre Liebe lohnen wollte, sondern weil es ihm Spaß machte, weil das Herumarbeiten und das Sich-ein-bischen-wichtigmachen seine größte Lust war.
Vor allen aber war der Hugo Winsemann für ihn da. Den hatte der liebe Gott extra für ihn in die Welt gesetzt. Der gehörte ihm. Und wehe, wenn er sich dieser Hörigkeit entziehen wollte. Es war sein Glück, daß er hierzu von Haus aus wenig Anwandlung verspürte. Er hatte einen großen Respekt vor dem stämmigen Anton, dessen frischer, forscher Führung er sich gern überließ. Dieser kleine Schlepper, immer unter Dampf, schleppte ihn, wohin er ihn haben wollte, und immer mit einem unverhältnismäßigen Gebrauch an Kohlen. Das qualmte und puffte aus dem Schornstein, als gelte es, eine ganze Kette von schwerbeladenen Ewern gegen den Strom zu schleppen und es war doch nur die kleine, leichte Schute Hugo Winsemann.
Mutter Krautsch aber, wenn sie ihren Jungen so voller Leben sah, dachte manchmal: »Wo hat er das nur her? Sein Vater is so 'n ruhigen sinnigen Mann.« Dann mußte er es also wohl von ihr haben. Und sie war stolz darauf. »Dat is min Anton.«
Hugo Winsemann, dieser kleine Schwächling, ach, was war das doch für ein Junge! Immer verträumt. Immer »dösig«. Er lutschte noch, saß in irgend einer dunklen Treppenecke und ergötzte sich an seinem Daumen. Er hatte viel Spott deswegen aushalten müssen, namentlich von Anton. Da trieb er es nur noch heimlich. Im Bett, vorm Einschlafen, war er vor jeder Störung sicher. Die Mutter, eine schwache, leidende Frau hatte ihn gewähren lassen, froh, daß dieser Schlummerbalsam so sanft und sicher wirkte. Der Vater hatte des Abends Schreiberarbeiten zu verrichten und wollte durchaus Ruhe haben. Er war so nervös. Er war »Geistesarbeiter«, wie er seiner Frau mindestens einmal in der Woche ins Gedächtnis rief. Er stricke keine Strümpfe, seine Arbeit wäre höher zu werten. Er brauche Stille, Schonung, Verständnis, nur ein bischen Verständnis. Und Frau Winsemann verstand ihren Gemahl, schloß leise die Tür hinter sich und steckte Hugo ins Bett. Arno Winsemann hatte von jeher seine Familie mit seinem Ruhebedürfnis tyrannisiert. Er war Lehrer gewesen, hatte aber einen Dichter in sich entdeckt und daraufhin den Dienst quittiert. Arno Winsemanns Gedichte konnten nur in Freiheit erblühen. Aber es war entweder nicht die rechte Freiheit, oder nicht das rechte Talent. Arno Winsemanns Gedichte gediehen nicht. Wie konnten sie auch! Bei Kindergeschrei, Küchenlärm, Nähmaschinengeklapper!
Arno Winsemann lief auf die Straße, aber die Muse haßt den Lärm der modernen Großstadt. Arno Winsemann saß im Kaffee, aber die Muse trank keinen Kaffee. Da kaufte er sich ein Rad, auf Abzahlung natürlich. Hinaus, nur hinaus! an den Busen der Natur!
Aber ach, es war ein kalter Busen, auch er war nicht der Ort, wo Arno Winsemann ruhen konnte. Er hätte weit weg müssen, auf irgend eine einsame Insel, wo Marmorpaläste aus Myrten schimmerten, und die Musen selbst ihn in ihre Mitte nahmen. Aber mit dem Rad war diese Insel nicht zu erreichen, und Armut drückte ihn nieder.
So war die Insel, auf der Arno Winsemann zuletzt landete, der Kontorbock in der Schreibstube eines Advokaten. Sein verhungertes Aussehen und seine schöne Handschrift hatten ihn dem mitleidigen Manne empfohlen. Frau Winsemann hatte diese Anstellung als ein großes Glück begrüßt, Arno sie mit der Resignation eines gebrochenen Titanen auf sich genommen.
Jetzt hatten die fünf Jahre Advokatenstube längst allen Trotz und alle Verbitterung aus seiner schwammigen Seele herausgepreßt. Ach, sie war so trocken geworden, diese Seele, daß sie wirklich von Zeit zu Zeit einer Anfeuchtung bedurfte, und seit dem Cholerajahr, wo man den bösen Feind so tapfer mit Kognak bekämpfte, war ihm diese Kriegsgewohnheit geblieben. Der Hang zum Trinken fing an, sich in ihm auszubilden, um so mehr, als er in diesen anfangs noch seltenen Stunden irdischer Entrücktheit sich wieder als der alte verkannte Arno Winsemann fühlte, dem eigentlich ein Rosenpfühl im Kreise der Musen aufgeschüttet sein sollte, und nicht dieses harte Feldbett, eine Treppe hoch, Ohlsens Gang Nr. 9. So schlürfte er mit dem einen Gift auch das andere.
Der kleine Hugo war äußerlich ganz das Ebenbild des Vaters, und die Mutter gewahrte mit Besorgnis, daß er auch seines Geistes Kind zu werden versprach. Aber sie wollte schon über ihn wachen und ihn leiten. Und nie, nie sollte er Verse machen. Sie hätte ihr Kind nie geschlagen, aber das würde sie ihm ausprügeln, unerbittlich. Und da er so war, so verträumt und in sich hinein, ein so gefährliches Kind, so sah sie es mit großer Freude, daß er sich an den Anton Krautsch so anschloß, und hoffte, der würde ihn mit sich reißen und einen gesunden Jungen aus ihm machen.
Ein paarmal war Anton bei Winsemanns gewesen und hatte mit Hugo aus schmutzigen, kleberigen Dominosteinen Häuser gebaut. Natürlich war dann der Vater nicht zu Hause gewesen; dem würden die einstürzenden Schlösser und Burgen zu sehr auf die Nerven gefallen sein. Aber dem Anton war es bald langweilig bei Winsemanns geworden, er war nicht für Stubenspiele. Im Sommer nun gar nicht! Und im Winter gab es doch Glitschen und Schneeballen. Was sollte das dumme Dominospiel!
So sahen sich die beiden Jungen nur noch auf der Straße. Neuerdings, im ersten Schuljahr, kam Anton wohl einmal heraufgesprungen, um Hugo nach einer Aufgabe zu fragen. Und dann war Frau Winsemann erfreut, daß ihr Junge der klügere war, aber auch besorgt, daß es in seines Vaters Klugheit umschlagen könnte. Und unter dieser hatten sie beide zu sehr gelitten, als daß ihr das »Höhere« noch erstrebenswert erscheinen sollte.
Kam Anton selten, so kam die kleine Marie Mau um so häufiger herüber. Die Mutter hatte sie auch früher, wenn sie auf Arbeit ging, der Frau Winsemann anvertraut, lieber, als der kinderlosen Nachbarin. Seit dem Tode des kleinen Willi aber hatte das verlassene Schwesterchen sich ganz nach Winsemanns hingewöhnt und verkehrte mit Hugo wie mit ihrem Bruder. Mit ihrer Puppe wollte er freilich nichts zu tun haben. Aber sie war es zufrieden, wenn sie mit seinen Dominosteinen spielen durfte und beneidete ihn vor allem um seine beiden Bilderbücher, die größer und bunter waren als das ihrige, und woraus er ihr schon alle Verse vorlesen konnte. Daß er nur das von der Mutter Gehörte aus gutem Gedächtnis nachplapperte, wußte sie ja nicht. Sie nahmen es beide für Lesen und taten sehr wichtig dabei.
War Hugos Papa nicht daheim, durften sie auch einigen Lärm machen, Häuser bauen aus den Dominosteinen, hohe Türme, die dann beim leisesten Anstoß mit lautem Geprassel zusammenstürzten, was manchmal mit einem Freudengekreisch, manchmal mit einem lauten Gejammer begleitet wurde. Große Paläste bauten sie, worin sie wohnten und sich König dünkten. Herrliche Parks umgaben sie mit diesen Dominosteinen, deren vieläugige Mauer selbst verwundert in diese Pracht zu staunen schien. Und Mann und Frau spielten sie, König und Königin, und hatten Pferd und Wagen, worin sie in die weite Welt kutschierten, aus der sie mit brennenden Backen und leuchtenden Augen heimkehrten.
Holte Frau Mau Mariechen dann abends ab, einen frischen Geruch von Chlor und grüner Seife um sich verbreitend, dann flog wohl ein flüchtiger Schimmer von Weichheit über das stille, harte Gesicht, und es war, als wollte sich von der Liebe zu ihrem kleinen Toten etwas warm und weich um den kleinen Freund ihres Mariechens legen. Aber dies flüchtige Licht erlosch schnell, wenn ihr aus dem Gutenabendgruß des Herrn Schreibers einmal wieder der Duft des genossenen Rums entgegenwehte. Dann konnte sie einen strengen Blick auf den kleinen unschuldigen Hugo werfen, ihr Kind fester an die Hand nehmen und eiligst mit ihm das Zimmer verlassen, als drohe ihm hier eine böse Ansteckung.
Drittes Kapitel
Käpt'n Krautsch, der grade vor dem unglückseligen Steinwurf abgereist war, schrieb nach zweijähriger Fahrt an der indischen Küste, daß er Fracht nach Amsterdam habe. Mutter Krautsch solle um die und die Zeit sich auf die Bahn setzen und den Jungen natürlich mitbringen. Er würde nicht abkommen können. Und ich? sagte Mutter Krautsch. Aber sie mußte hin, das war natürlich. Und machen ließ es sich auch. Alles läßt sich machen, pflegte Mutter Krautsch zu sagen. »Nur n Doden nich wieder lebendig.«
Und dann schrieb sie nach Moorburg, wo sie zu Hause war, und ihre dort verheiratete Schwester versprach, ihr Geschäft solange in Obhut zu nehmen. »Daß du mich aufpaßt, Deern«, ermahnte Mutter Krautsch Lene Lerch, »und daß du mich folgsam büst und Tante Mile recht zu Hand gehst. Hörst du?«
Das versprach Lene Lerch, und als die Depesche kam, daß die »Henriette« in Amsterdam vor Anker gegangen sei, setzte sich Mutter Krautsch auf die Bahn, verstaute Anton in eine Ecke des Kupees und setzte sich dicht neben ihn, so daß er wirklich fest saß. »So Jung, dies ist nu deine erste Reise. Und iß nun man nich gleich all die Pfeffermümms auf.«
»Och«, sagte Anton beleidigt und dachte: »Bis Amsterdam werden sie ja wohl reichen.« Es waren aber nur für zehn Pfennige, und bald hinter Harburg war die Tüte leer.
Na, in Amsterdam gabs mehr. Käpt'n Krautsch freute sich über seinen strammen Jungen und stopfte ihn mit Kuchen und Süßigkeiten voll. Er hatte ihn in zwei Jahren nicht gesehen. Was war er für ein fixer Bengel geworden.
»Und die Schule? Wie ist es mit dem Lernen?«
»Och, gut«, sagte Anton.
Und Mutter Krautsch konnte bestätigen, daß die Lehrer mit ihm zufrieden waren. Nur mit dem Schreiben wolle es nicht. Im Schönschreiben gäbe es immer eine Fünf.
Käpt'n Krautsch machte ein ernstes, nachdenkliches Gesicht. Er hatte ein hageres, langes Gesicht, mit schmalen, gekniffenen Lippen.
»Welche von seinen Kollegen haben da Nachhilfestunden in«, sagte Mutter Krautsch. »Aber das Geld soll ja man da sein.«
»Das Geld ist da, Mutter«, sagte Käpt'n Krautsch. »Wenn er es haben muß, soll er es haben. Schreiben muß ein Mensch können. Setz dich mal hin, Jung. Schreib mal was.«
Und Anton saß am Kajütentisch und malte komische Buchstaben aufs Papier. »Lieber Vater.« Das stand dreimal hintereinander da. Ob dem Jungen nichts anderes einfallen wollte, oder ob er Diplomat war? Käpt'n Krautsch lachte. Die Buchstaben standen auch zu drollig da, hatten alle einen ordentlichen Sturm, wie es schien. Oder freute sich Käpt'n Krautsch über den »lieben Vater«?
Fünf Tage dauerte die Herrlichkeit in Amsterdam. Dann hieß es wieder Abschied nehmen. Auf wie lange? Ja, wer das wüßte. Erst ginge die »Henriette« mal direkt in die Südsee. Es könnte ein Jahr, es könnten drei Jahre werden. Käpt'n Krautsch mußte sich tummeln. Das Ausruhen kam nachher Und dann wollten er und Mutter es gut haben.
Tränen flossen, Küsse gab es, hin und her, und dann saßen Anton und seine Mutter wieder in der Eisenbahn und dampften nach Hamburg zurück. »Pfeffermümms« waren diesmal nicht dabei, aber eine große Tüte »Kienjes«. Und Mutter Krautsch aß mit aus der Tüte. Käpt'n Krautsch hatte sie selbst gekauft, noch auf dem Weg nach dem Bahnhof. Ob er ihr wohl je wieder Kienjes kaufen würde? »Die alte leidige Fahrerei. Was hat man von so n Mann?«
Tante Mile empfing die Reisenden mit einem Seufzer der Erleichterung. Sie war eine akkurate, äußerst gewissenhafte Person, die über jeden Pfennig gerne Rechenschaft abgelegt hätte. Und sie war mit Lene Lerch schwer fertig geworden. Nicht, daß Lene Lerch nicht willig gewesen wäre, aber sie war ihr zu fahrig, flusig und zu unbekümmert.
»Ach, das wird wohl zwanzig Pfennige kosten, das geben Sie man so.«
»Eine Buddel mehr kaput, da haben wir uns nicht um. Das muß dabei über sein.«
Und Lene Lerch gab immer den Ausschlag, weil sie fix mit dem Mund war und nichts schwer nahm. Tante Mile ärgerte sich darüber, konnte es aber nicht ändern.
»Gott sei Dank, Jette, daß ihr wieder da seid«, rief sie aus. »Ich find da auch nich mehr durch. Und nu zähl man erst mal die Kasse nach. Stimmen muß es. Hier hab ich allens aufgeschrieben. Und den Schlüssel hab ich immer abends mit ins Bett genommen, unters Kopfküssen.«
Und dabei legte sie Mutter Krautsch einen großen, vielfach befleckten Bogen Papier vor, auf dem sie jeden vereinnahmten Pfennig aufgeschrieben hatte.
Anton fragte, wahrscheinlich durch den Anblick dieses Bogens angeregt: »Mutter, bekomm ich nu Schreibstunde?«
»Wat, kann de Jung noch nich schrieven?« fragte Tante Mile ganz verwundert.
»Mit de lateinischen Bokstaben hätt he noch sin Not«, sagte Mutter Krautsch und verschwieg, daß es mit den deutschen nicht viel besser war.
»Jung, leer schrieven«, sagte Tante Mile. »Wat harr ick woll anfangen wullt, in bisse Tid, wenn ick nich schrieven leert harr.«
Da kam Anton zu Lehrer Heinrich, um sich im Schreiben zu vervollkommnen, um nicht einst hinter Tante Mile zurückzustehen.
*
Es war in diesem Schreibstundenjahr, als Hugo Winsemann mit Mariechen Mau vorne im Torweg zu Ohlsens Gang eine bescheidene »Ehrenpforte« hergerichtet hatte. Ein kleines Sandhäuflein, auf dessen Gipfel ein Wachsstummelchen vom letzten Weihnachtsbaum brannte, umgeben von ein paar weißen Papierfetzen, die auf abgebrannte Streichhölzer gespießt, Blumen vorstellten. Der ganze Prachtbau war durch ein paar alte Hosenknöpfe, drei Marmeln, die Hugo nach einigem Besinnen herausgerückt, und einer alten verrosteten Gürtelschnalle – alles in symmetrischer Anordnung in den Sand hineingedrückt – gar erfindungsreich eingefaßt und zu wahrer Herrlichkeit erhoben worden. Mariechen stand mit leuchtenden Augen dabei, und Hugo fiel von Zeit zu Zeit einen Vorübergehenden an, hielt ihm die Mütze hin und bat mit klopfendem Herzen im kläglichen Tone, als handle es sich um dringende Hilfe für gänzlich Verarmte, um eine Gabe »för de Ehrenport«.
Nur wenige verstanden sich zu diesem Wegezoll, indem sie ein oder zwei Pfennige opferten, aber ein Schauermann mit einem strahlenden Gesicht, dem sicher grade was Angenehmes widerfahren war, verstieg sich auf dem Gipfel seiner Freude zur Spende eines ganzen Zehnpfennigstückes.
»Junge, n Groschen!« rief Hugo und hielt ihn Mariechen unter die etwas feuchte Nase. »Das wird fein, solls mal sehn, heut kriegen wir was zusammen.«
Und vielleicht wäre es auch noch fein geworden, wenn nicht grade Fritz Kleesand, der lange Windhund, daher gekommen wäre. Der hatte keinen Spaß mehr an Ehrenpforten, der elfjährige »Schlüngel«. So ganz gleichgültig schob er sich daran vorbei – doch nein, er griente plötzlich, als hätte er einen ganz köstlichen Spaß im Sinn, schlenkerte so einmal mit dem Fuß, und in alle Winde flog die schöne Ehrenpforte mit Licht, Papierblumen, Hosenknöpfen und Schnalle. Und pfeifend, als ob nichts geschehen wäre, ging der Schlingel weiter.
Weit kam er nicht. Mit einmal saß ihm ein wohlgezielter Puff im Genick, und ehe er sich umsehen konnte, sprang ihn jemand von hinten an und legte ihn schlank auf den Rücken. Er bemühte sich umsonst, aufzuspringen. Antons rotes Gesicht fauchte über ihm: »Hund! gemeiner!« Und zwei kräftige, tintebefleckte Fäuste drückten ihn nieder.
Dieser Sieg Antons tröstete Hugo und Manschen schnell über die Zerstörung. Hatten sie doch zusammen zwanzig Pfennige eingeheimst, die, in Bonbon umgetauscht, alle Bitternis reichlich versüßen konnten. Ob sie ihren Schatz zeigten? Aber dann wollte Anton natürlich auch Bonbons haben, dachte Manschen. Und Hugo hätte gern noch ein paar Pfennige übrig behalten, weil am andern Tag Mariechens Geburtstag war. Er wollte ihr einen Bogen buntes Papier schenken. Seine Neigung zu Mariechen siegte, und Anton ging leer aus. Zuletzt regte sich aber in Mariechen doch der bessere Mensch, und sie hielt Anton einen Pfennig hin.
»Willst du einen ab?«
»Deinen alten schieterigen Pfennig behalt man«, lachte er spöttisch.
Mariechen hatte ihn zwar in der leisen Hoffnung angeboten: vielleicht nimmt er ihn nicht. Aber »schieteriger Pfennig« – das kränkte sie. Sie streckte ihm die Zunge heraus und lief heulend nach Hause. Hugo suchte unterdes die Marmeln und die Hosenknöpfe wieder zusammen. Anton sah ihm verächtlich zu. »Son Bettelkram. Wie magst das noch tun!« schalt er.
Mariechen Mau bekam ihren bunten Papierbogen, und Anton hatte den guten Einfall, seinen Gegner durch ein paar Äpfel zu versöhnen, die ihm nicht teuer kamen. Er trug nicht nach, nahm so eine Prügelei nicht tragisch, und hatte auch den Wunsch, mit dem größeren und stärkeren Fritz Kleesand nicht in Feindschaft zu leben. Dieser aber traute seiner Überlegenheit nicht recht und hatte Respekt vor Antons Fäusten. Wie alle hinterlistigen Schabernackspieler gehörte er nicht grade zu den allzeit Tapfern, ohne daß man ihn einen Feigling schelten durfte. Es war mehr seine Eitelkeit, die jede Niederlage fürchtete und ihn nur da anbinden ließ, wo er des Sieges gewiß war. So war nach ein paar Tagen der Friede wieder hergestellt.
Nur Manschen war noch nicht ganz friedlich gestimmt. Sie dachte noch an den schieterigen Pfennig und ging dem rohen Bengel aus dem Wege, oder war kalt gegen ihn. Anton merkte das gar nicht mal. Er mochte überhaupt nichts mit Deerns zu tun haben. Die waren ihm zu »heulig«.
Eine Folge hatte freilich Fritz Kleesands Vandalismus gegen die Ehrenpforte noch. Fräulein Cyriaks hatte sich über die Verunreinigung des Torweges beklagt, und Schiffshändler Ohlsen hatte ein für allemal verboten, durch Ehrenpforten und dergleichen die freie Passage zu sperren.
»Ich will überhaupt, daß Ordnung herrscht, peinliche Ordnung«, sagte er zu Fräulein Cyriaks, die steif und lang in seinem Kontor vor ihm auf dem Stuhle saß und jedes seiner Worte mit einem schnellen, stoßenden Kopfnicken bekräftigte. »Unordentliche Elemente dulde ich nicht, habe ich nie geduldet und werde ich nie dulden. Melden Sie mir bitte alle Ungehörigkeiten. Ich bin Ihnen nur dankbar dafür.«
Fräulein Cyriaks verließ ihn mit dem sittlichen Vorsatz, nichts Ungehöriges ungemeldet zu lassen, und Schiffshändler Ohlsen schloß die Tür hinter ihr und sagte: »Alte Schraube«.
Im Wohnzimmer traf er Pastor Brügge bei seiner Frau, die eine Pastorentochter aus der Kieler Gegend war und geistlichen Umgang hatte. Pastor Brügge berichtete ihr über das Resultat der Vereinssammlung für die innere Mission.
»Na, Pastor«, fragte Ohlsen kordial, »is de ol Klingbüdel düchtig vull?«
»Klingbeutel?« sagte der Herr Pastor mit etwas pikiertem Lächeln. »Unser lieber Herr Ohlsen drückt sich immer gern recht deutlich aus.«
Und Frau Melitta – Ohlsen nannte sie übrigens immer Lite – warf ihm einen bitterbösen Blick zu. Asmus Andreas fand, daß er diesen Blick nicht verdiente. Er hatte fünfzig Mark für die innere Mission gegeben, mit Rücksicht auf Litens Pastorale Herkunft; sonst hätte er sich mit zehn abgefunden. Fünfzig Mark! Eine nette Summe. Dafür wollte er aber die Sache beim rechten Namen nennen können. Klingbeutel war doch keine Beleidigung?
»Das muß man auch, das gibt klar Wasser«, sagte er daher auf Pastor Brügges Bemerkung über seine deutliche Ausdrucksweise. »Wenn ich mit meinen Leuten damals, als ich noch die ›Gesa‹ fuhr, wissen Sie – ja, wenn ich da Pensionsfranzösisch hätte sprechen wollen.S'il vous play, Jan Türk, sehen Sie sich doch mal das Segel bitte n bischen an. Wo de oll Kasten nu woll lingen deh.«
Da lachte der Herr Pastor breit und jovial. »Ja, ja. Es ist wohl so. Ich muß ja auch manchmal ein kräftig Wörtlein reden, wenn ich meine verirrten Schafe wieder auf den rechten Weg zurückbringen will.«
Da ging Asmus Andreas wieder hinaus. Von verirrten Schafen mochte er nicht gerne was hören.
Viertes Kapitel
Was ist ein Jahr für einen stillen Winkel, wie Ohlsens Gang. Vorne, an der Straße, ging kein Jahr spurlos vorüber. Ihr Aussehen änderte sich rastlos. Hier ein neuer Anstrich, da eine neue Fassade, dort ein ganzer Neubau. Gleichgültige bemerkten es erst spät. Aufmerksame folgten der steten Verwandlung und ärgerten oder freuten sich. An Ohlsens Gang, schien es, gingen selbst zehn Jahre spurlos vorüber. Ein paar Schritte nur, und jenseits des Torweges trug der Strom die Fülle brausenden Lebens hinaus ins Meer. Dort begrüßten sich die Länder aller Erdteile mit ihren Flaggen und ihren Erzeugnissen. Hier, hinter diesem dunklen Torweg, schien das Leben stillzustehen. Es blieben immer dieselben alten Häuser mit denselben alten Fenstern, denselben alten Gardinen, denselben alten Blumentöpfen vor den kleinen Scheiben. Standen auch vorübergehend mal Nelken vor dem Fenster der Cyriaks, im allgemeinen hielt sie sich doch an Goldlack, und die Schulzen über ihr zog Geranien.
Jeden Morgen öffnete die Cyriaks ihr Fenster und warf die Brotkrumen von ihrem Frühstück den Sperlingen hin, die sich pünktlich auf diesem Futterplatz einfanden. Und jeden Sonnabend roch es nach Seife in Ohlsens Gang, und lief Seifenwasser in der Mitte im Rinnstein, denn alle Haustüren und Fenster wurden da einer gründlichen Reinigung unterzogen. Es hatte alles seinen geregelten, eintönigen, schleppenden Gang hier im Winkel.
Und in diesen greisenhaften, hinträumenden Häusern, waren es nicht immer dieselben Leute? Es starb mal einer, machte Platz. Aber wer an seine Stelle kam, sah er nicht aus wie er? Sie trugen alle die Kleider der Armut, hatten alle die Gewohnheiten und Hantierungen der kleinen, abseits lebenden, in die Ecke gedrängten Stiefkinder des Lebens. Etwas Altes, Müdes, Graues wie ihre Häuser. Auch die Jungen, auch die Kinder. Ja, auch diese.
Hugo Winsemann und Mariechen Mau, hatten sie nicht beide diese suchenden Augen, als ob sie immer nach etwas aussahen, nach einem Stückchen Himmel, nach einem bischen Glück, nach ein bischen Sonnenschein auf den gegenüberliegenden Dächern, nach einem einzigen Stern an dem schmalen Himmelsband, das von den schiefen, schmutzigen Giebeln von Ohlsens Gang eingefaßt wurde, oder nach St. Michaels grüner Spitze, die da so hoch und einsam über allem Dächergewirr in die Luft ragte?
Und Anton Krautsch, hatte der nicht so offene, helle Augen, die alles mit einem großen, flinken Blick zu umfassen schienen? Augen, vor denen die ganze Welt ausgebreitet lag? Sie brauchten nicht zu suchen, sie öffneten sich und sahen alles. Tausend Sterne mit einem Blick, den Strom mit all seinen Schiffen, seine Masten und Segel, das brausende Leben auf der Straße, das auf dem Wasser und im Winde, und das geräuschvolle drüben auf den Werften, dessen heißer Atem durch hundert Schlote in den weiten Ozean der Luft hinaufströmte.
Hugo, der jetzt endlich aufzuleben und ein Junge zu werden schien und sich viel mit Anton und anderen Kameraden umhertrieb, behielt trotzdem diesen suchenden, etwas ängstlichen, verkümmerten Blick, wenn ihn nicht besondere Knabenfreude mit fortriß.
*
Sie waren jetzt alle vier Jahre älter. Große Bengels von zwölf und dreizehn Jahren, rechte Hamburger Jungens von der Wasserkante, die nicht nur auf der Straße zu Hause waren, sondern auch auf dem Strom. Sie konnten rudern wie ein richtiger Jollenführer, kannten alle Schiffe und bewegten sich in Ausdrücken, die meist nach Seewasser und Tabak rochen. Den Ton gab Fritz Kleesand an. Der hatte die Schule schon verlassen und sollte im Sommer auf See gehen. Er sprach schon wie ein Matrose und priemte. In der Schenke seines Vaters verkehrten genug Lehrmeister, die seine Erziehung in dieser Hinsicht übernahmen, ohne daß sie etwas mehr taten, als ihn durch Beispiele zu leiten, indem sie tranken, fluchten, aufschnitten, Karten spielten und kauten und schnupften.