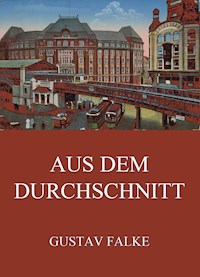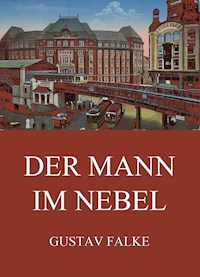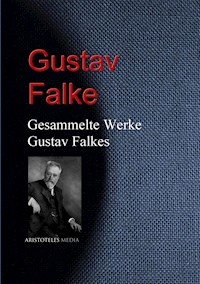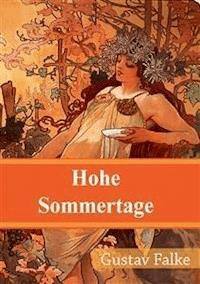1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Autobiografie des Schriftstellers Gustav Falke, der mit seinen Romanen, seiner Lyrik, der Mitarbeit an der literarischen Gestaltung der Stollwerck-Sammelbilder und Alben sowie seinen Kinderbüchern um die Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhundert große Erfolge erzielte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Die Stadt mit den goldenen Türmen
Die Stadt mit den goldenen TürmenErstes BuchZweites BuchDrittes BuchViertes BuchImpressumDie Stadt mit den goldenen Türmen
Die Geschichte meines Lebens
Gustav Falke
Erstes Buch
I
In Lübeck bin ich geboren, im Schatten von Sankt Marien. Es war in meinem achten Jahre, als sich meiner kindlichen Seele die Vaterstadt in einem unauslöschlichen Bilde einprägte, und immer leuchtender wurden mit der Zeit seine Farben, sodass es über ein bloßes Abbild meiner irdischen Geburtsstätte weit hinauswuchs und zum Symbol einer himmlischen Heimat erblühte, der mein Sehnen und Suchen galt.
Unser Hausdiener, ein kleiner, freundlicher Mann, der sich später als Gärtner selbstständig machte, war ein großer Freund der Natur. Ob wir nicht einmal die Sonne aufgehen sehen möchten, fragte er eines Tages mich und meinen um ein Jahr jüngeren Bruder; das sei das Herrlichste, was man sehen könne. Und da die Mutter es erlaubte, weckte er uns am Pfingstsonntag vor Tagesanbruch und führte uns auf den Stadtwall hinauf. Uns fror, und wir zitterten an der Hand des guten Mannes, der uns mit allerlei Geschichten zu unterhalten und zu erwärmen suchte und uns von Zeit zu Zeit zum Laufen und Springen ermunterte, worauf wir denn wie zwei junge Böcklein ein paarmal auf und nieder hüpften. Auch auf den Gesang der Vögel ließ er uns lauschen, die nach und nach ihre Stimmen erhoben und den Tag einsangen. Aber alles das machte uns nicht warm, erst der Anruf: »Jetzt! Jetzt kommt sie!« ließ uns alles vergessen und richtete unsere großen Kinderaugen auf die Himmelstür, aus der die Königin in ihrem goldenen Kleide nun heraustreten sollte.
Noch lagen die Dächer und Türme der Stadt, wie auch die wenigen Masten in ihrem stillen Hafen, in einem kalten Zwielicht. Hier und da stieg schon ein Rauch aus den Schornsteinen, der uns anzeigte, dass wir nicht die einzigen Frühaufsteher waren, und uns zugleich an den Morgenkaffee erinnerte, der uns mit seinem Festkuchen noch bevorstand.
Da öffnete sich der Himmel, die hohe Fürstin war im Anzuge, und ein Saum ihres Gewandes wurde sichtbar. Wir sagten kein Wörtchen zu ihrer Begrüßung, sondern verstummten in großer Ergriffenheit. Franz aber zog uns in diesem Augenblick fester an sich, und mich will heute bedünken, als hätte er sich ebenso sehr an unserer Freude als an dem himmlischen Schauspiel geweidet. Und nun trat langsam, in immer größerer Glorie, die Sonne hervor und schüttete ihre flammenden Rosen über die erwachende Stadt aus. Zuerst erglühten die schlanken Türme von St. Jakobi in einem märchenhaften Rot, aber blitzgleich folgten St. Marien und St. Ägidien und die ernsten Türme des Domes; und das schimmernde Licht lief an ihnen hernieder und über die hohen Dächer hin. Die spitzen Giebel der Häuser erglänzten, und wir suchten neben St. Marien unser väterliches Dach und waren erfreut, dass es gleichfalls wie eitel Gold funkelte; aus dem Hafen aber wiesen die Masten wie feurige Finger in den aufgetanen Himmel.
Als hätten die Vögel bisher nur zaghaft ihre kleinen Kehlen gestimmt und wollten sich jetzt mit dem himmlischen Gloria messen, hub ein vermehrtes Trillern und Flöten an; und dass auch die Büsche und Bäume in der allgemeinen Morgenmusik nicht zurückstanden, erwachte ein Säuseln und Rauschen in allen Zweigen und Kronen.
Wie nun alles so recht in heiligem Eifer war, nahm Franz uns sacht an der Hand und führte uns den grünen Wall hinab, durch lauter Morgenglanz und -klang, der harrenden Mutter wieder zu.
Als dann aber nachher von allen Türmen die Pfingstglocken ihre frommen und frohen Stimmen erschallen ließen, sodass die ganze Luft über der nunmehr erwachten Stadt von ihrem Klingen erschüttert war, wie fühlte sich da mein Gemüt, in heiliger Frühe köstlich vorbereitet, auf das Innigste ergriffen!
In der Nacht aber baute sich das feurige Morgenbild noch einmal vor mir auf. Mir träumte, ich ginge in den Straßen der himmlischen Stadt spazieren, barfuß, in meinem weißen Hemdchen, alle Leute waren wie ich gekleidet, und wir wandelten fromm und friedlich miteinander in all dem Glanz umher; und von den goldenen Türmen sangen die Glocken.
*
Unser Vaterhaus lag so recht im Mittelpunkt der Stadt; St. Marien sandte ihm stündlich ihre nachbarlichen Grüße, und die schwarzen Giebel und Türmchen des alten, ehrwürdigen Rathauses sahen ihm in die Fenster. Es war ein altes Kaufmannshaus mit festen, breiten Mauern und schien für die Ewigkeit gebaut. Es war ein Eckhaus. Die Mutter betrieb darin mithilfe eines Geschäftsführers eine Manufakturwarenhandlung: Seiden-, Leinen- und Wollzeuge.
Der Vater war früh gestorben, ich erinnere mich seiner kaum. Er hatte die Seinigen in einem behäbigen Wohlstand zurückgelassen, denn er war ein tüchtiger Kaufmann gewesen, der sein Detailgeschäft zu einer respektablen Höhe gebracht und in der Handelswelt meiner Vaterstadt eine geachtete Stellung eingenommen hatte. Von seinem guten Herzen und seiner Liebe zu uns Kindern erzählte die Mutter oft genug, sodass wir wohl glauben durften, den besten Vater gehabt zu haben.
Er war in Ratzeburg geboren, wo unser Großvater die Posthalterei innehatte. Da hat er sich mit seinen sieben oder acht Brüdern in den schönen Wäldern um den See herum weidlich getummelt, im Sommer barfuß; denn es mag dem Großpapa Posthalter nicht immer leicht geworden sein, für die reichliche Nachkommenschaft Strümpfe und Stiefel in genügender Anzahl herbeizuschaffen. Es sind aber aus den Barfüßern hernach meist tüchtige, angesehene Leute geworden, von denen einige es zu leidlichem Wohlstand gebracht, wie mein Vater, andere sogar in gelehrten Berufen sich ausgezeichnet haben, sodass ich mich dieser nächsten barfüßigen Vorfahren nicht zu schämen brauche.
Lübeck war in meinen Kinderjahren eine stille Stadt, und die Straßen mit den alten, meist schmalfrontigen Giebelhäusern boten uns Raum genug für unsere Spiele.
Aber lieber noch als die Straße suchten wir unseren Hausboden auf. Unter dem schrägen Dach mit seinen roten Ziegeln, welch eine glückliche Kinderwelt baute sich hier auf! Durch die zwei oder drei kleinen, runden Fenster fiel das Tageslicht mit einem märchenhaften Glanz; von einem silbernen Staubmantel umgeben, stellte es goldene Teller auf den Fußboden, von denen die unsichtbaren Schutzgeister dieses wundersamen Reiches speisten. Waren wir im Spieleifer, so achteten wir des güldenen Gedeckes natürlich nicht, sondern sprangen mutwillig über so edles Geschirr hin und her, als wäre es nichts als ein paar Sonnenflecken; waren wir doch Buben, und stand doch unser Schlachtross hier, ein lebensgroßes, ausgestopftes, fuchsfarbenes Füllen. Auf diesem Schaukelpferd galoppierten wir um die halbe Welt oder sprengten mit viel Geschrei in den Kampf. Ziemlich arg durften wir es schon treiben, bevor man unten im Hause etwas davon spürte. Manchmal aber erschien doch das Haupt eines Abgesandten in der Lukenöffnung, der je nach Temperament und Auftrag schalt oder bat; dann wurde die Lust ein wenig gedämpft.
Auf der geräumigen Hausdiele durften wir wegen der Nähe des Ladens nicht lärmen. Wir trieben wohl manchmal auf den bunten Fliesen unseren Kreisel oder spielten Marmel oder »Picker«, wie wir es nannten; doch das Gefühl, nur geduldet zu sein, ließ uns hier nicht recht heimisch werden. Von dieser Diele führte eine verdeckte Treppe in den ersten Stock hinauf; zeisiggelb gestrichen, machte ihre sonst schmucklose, glatte Verschalung, in der sich ein viereckiges Ausguckfenster befand, einen lustigen Eindruck.
Hier saßen wir nach Feierabend oft im Halbdunkel auf der obersten Stufe und ließen uns von Franz Geschichten erzählen. Das verstand er vortrefflich. Seine Vorliebe galt den alten Sagen und Geschichten unserer Vaterstadt, die er alle auswendig wusste. So hörten wir denn früh aus seinem Munde von »Papedöhne«, einem anderen Ritter Blaubart, und seiner Mordhöhle, von »Habundus und der weißen Sterberose«, von »Herrn Nikolaus Bardewiek, dem Trunkfesten« und derlei mehr.
Die Mutter störte eine solche Sagenwelt nicht, sondern mahnte wohl nur einmal: »Quält den Franz nicht zu arg.« Wir aber waren uns nicht bewusst, ihn zu quälen, saßen vielmehr regungslos und sahen mit klopfendem Herzen den bösen »Papedöhne« die Frauen in sein Versteck schleppen und waren voller Grauen und Empörung.
Franz genoss das vollste Vertrauen unserer Mutter. Er war ein bewegliches Männchen mit einem großen Kopf und einem gutmütigen, bartlosen Gesicht, das älter aussah, als es eigentlich war, ein greisenhaftes Kindergesicht. Seine Stimme war hoch und hell, und er hatte in allem etwas Weibisches. Er liebte die Vögel und die Blumen und machte sich durch aufmerksame Pflege unseres Kanarienvogels und der Blumenfenster sehr verdient; ihm wurde darin völlig freie Hand gelassen, und wir sahen denn auch immer einen Flor blühender Töpfe hinter unseren Scheiben.
Er hatte noch eine Mutter, eine hochbetagte Frau, die wir von Zeit zu Zeit mit ihm besuchen durften. Sie wohnte in der Nähe des Domes, »An der Mauer«, der alten Stadtmauer, die teilweise noch erhalten war. Hier lebte sie in einem jener kleinen Stifte, deren es in meiner Vaterstadt viele gab und deren Wohltat alten, hilfsbedürftigen Männern und Frauen zugute kam; meistens den Frauen, wie denn das schwache Geschlecht sich überall einer größeren Rücksichtnahme erfreut. Dieses Stift bestand aus sechs kleinen, einstöckigen Wohnungen, die sich, je drei und drei unter einem Dach, gegenüber lagen, da denn die einen in meiner Erinnerung beständig in heller Sonne leuchten, während die anderen in einem kühlen Schatten gebettet bleiben. Sie bildeten zusammen einen kleinen, hübschen Hof, zu dem man von der Straße aus durch einen schlanken, anmutigen Torbogen gelangte, den der Steinmetz mit Fruchtgirlanden und Rokokoschnörkeln auf das Reichste geschmückt hatte. Hinten schloss ihn ein Gärtchen ab, das sich an eine weinumsponnene Mauer anlehnte; aber die wenigen Trauben waren sauer und schienen nie zu reifen, und nur das bunte Laub erfüllte als leuchtender Schmuck einen schönen Zweck.
Schon die enge Straße, die sich mit ihren alten und schmalen Giebelhäusern hinter der Mauer hinzog, war eine andere Welt für uns. Vollends war es uns wie am Anfang eines Märchens zumute, wenn wir in den Schatten des Torbogens eintraten und dann nach einigen Schritten auf dem stillen Hof standen und von beiden Seiten die kleinen Fenster der Pfefferkuchenhäuschen wie ebenso viel Augen auf uns gerichtet sahen. Meist herrschte ein wunderliches Schweigen hier, sodass wir über unsere eigenen Schritte auf dem holperigen Steinpflaster schier erschraken; kamen wir aber einmal in einer Spätstunde, so saßen die guten Stiftlerinnen auf den weißen Bänken vor ihren Türen beisammen, jede mit einem Strickzeug in den alten Händen, und wir hatten rechts und links Grüße auszuteilen. Wir kannten sie alle bei Namen, wie sie uns, und wir galten etwas Rechtes bei ihnen; waren wir doch die einzigen Kinder aus besserer Familie, die hier einmal einsahen. Sie fühlten sich alle ein wenig geschmeichelt und beneideten Frau Heydenreich, Franzens Mutter. Diese war eine große, schwerfällige Frau mit einer tiefen, klagenden Stimme. Sie war auch wirklich leidend, denn das Reißen plagte sie, doch ließ sie sich nicht gehen, blieb tätig und beschränkte sich darauf, von Zeit zu Zeit zu jammern, wie wenig sie noch auf Gottes Welt zu brauchen wäre.
Hatte sie uns umständlich ins Haus und in ihre Stube hineingeschoben, tätschelte sie zuerst meinen Bruder. Er war ihr Liebling, weil er ihrem Franz so ähnlich sähe; gerade so hätte der als kleiner Junge auch in die Welt geguckt. Nun war aber mein Bruder ein hübscher, derber Knabe, und es war keineswegs glaubhaft, dass der Franz auch einmal so gewesen war. Sie hatten zwar alle beide eine tüchtige Nase, alles andere aber stimmte doch herzlich schlecht. Doch mag etwas da gewesen sein, was Mutter Heydenreich an ihren Franz erinnerte und ihre merkliche Bevorzugung meines Bruders begründete. Während sie nun meist mit ihm beschäftigt war, konnte ich mich um so ungestörter mit einem prächtigen Spielzeug vergnügen, das ich in dem kleinen Zimmer entdeckt hatte.
Es war ein Rokokoherrchen in rotem Seidenfrack, mit Dreispitz, Galanteriedegen und Zopf, das unter einer Glaskugel auf der Kommode stand. Es hatte unter sich vier oder fünf Zinnzünglein, vermittels deren man seine Glieder in Bewegung setzen konnte. Da verneigte es sich dann höflich, nahm den Hut ab, hob den Stock auf, drehte den Kopf nach rechts und links, kurz, zeigte sich als ein gehorsames Gliedermännchen. Hatte die gute Frau die Glaskuppel vorsichtig abgehoben und an einen sicheren Platz gestellt, konnte ich eine halbe Stunde lang vor ihm auf den Knien liegen und mir die zierlichsten Verbeugungen machen lassen. Ich erinnere mich, dass ich einmal ganz laut ein kindliches Zwiegespräch mit ihm hielt.
»Guten Tag, mein Herr.«
»Guten Tag.«
»Mit wem habe ich die Ehre?«
»Ich bin der Prinz Tausendschön.«
»Und wie geht es Ihrer lieben Frau?«
»Danke, es geht ihr recht gut.«
Dann schreckte ein lautes Gelächter mich auf; ich sah die belustigten Gesichter der anderen, wurde rot, sprang von meinem Stuhl herunter und war durch nichts zu bewegen, wieder hinaufzuklettern. Wie dieses feine Spielzeug in den Besitz der einfachen Frau gekommen, weiß ich nicht; mir war es ein köstliches Kunstwerk, und mein größter Wunsch war, es zu besitzen. Wie freudig war ich daher erstaunt, als der gute Franz mich zu meinem Geburtstage mit dem geliebten Gliedermännchen überraschte. Die Mutter meinte freilich, ich dürfe solch ein Geschenk nicht annehmen, und erst die gewaltsamen Tränen, in die ich ausbrach, und die verlegene Scham des zurückgewiesenen Gebers erzwangen ihre Zustimmung. Seitdem grüßte denn das seine Herrchen mit eleganten Verbeugungen von unserem Sekretär herab und verharrte gleichsam wie fragend in dieser Stellung, bis ich ihm und mir den Willen tat und meiner Mutter die Erlaubnis abschmeichelte, ihn seine gute Erziehung in dem höflichsten Betragen zeigen lassen zu dürfen.
Einmal aber konnte ich doch nicht widerstehen, den Mechanismus, der so Wunderbares ermöglichte, näher zu untersuchen. Ich zog und wackelte ein wenig heftiger an dem Zünglein, beklopfte den tastenartigen Untersatz und zog und wackelte wieder. Knacks sagte es, und der rechte Arm mit dem Dreispitz fiel schlaff herab; das Männchen konnte sich nur noch verbeugen und den Kopf bewegen.
Erschreckt schlich ich aus dem Zimmer. Eine Zeitlang blieb der Schaden unentdeckt. Dann aber musste ich gestehen, was ich mit möglichst unschuldiger Miene tat. Da das Männchen mein war, hatte ich mir inzwischen auch ein Recht zugesprochen, ihm Arme und Beine zu brechen, wenn es mir belieben würde. Ich erhielt auch weiter keine Strafe, aber meine Freude an dem Spielzeug war dahin. Es behauptete sich in seinem invaliden Zustande noch eine Weile auf seinem Platze; als ihm dann aber auch unter den Fingern meines Bruders der Kopf einmal nach links stehen blieb und in keiner Weise mehr zu bewegen war, sich zu rühren, kam es zuletzt auf den Boden, wo es verstaubte und ich weiß nicht, welchem unglücklichen Ende entgegenging.
Wie dieses Männchen, so kam mir auch ein kleines Mädchen, dessen Bekanntschaft ich in demselben Altweiberspittel machte, als etwas Besonderes und Feines vor, obgleich es nur ein Arbeiterkind war, und ich hätte es gleichfalls gern als ein liebes Spielzeug mit nach Hause genommen. Es landete eines Tages mit uns zusammen auf dem Stiftshof, wo es eine Großmutter wohnen hatte. Da es zu einer Zeit war, wo die alten Frauen sich alle vor den Türen in der Abendsonne gütlich taten, und daher alle auf einer Seite des Hofes beisammen saßen, je zwei und zwei auf einer Bank, und des Kindes Großmutter bei Frau Heydenreich Platz genommen hatte, so konnte es nicht ausbleiben, dass wir Bekanntschaft schlossen. »Sag' schön guten Tag, Lisbeth«, mahnte die Großmutter, und die Kleine, etwa ein Jahr jünger als ich und mit meinem Bruder in einem Alter, streckte uns ihre Hand entgegen, in die wir nur zögernd einschlugen; nicht aus Hochmut, sondern aus natürlicher, bubenhafter Befangenheit.
Mir erschien sie wie ein kleiner Engel, und ich traumwandelte sogar einmal mit ihr in den Straßen meiner goldenen Stadt, Hand in Hand, und mit einem scheuen, kindlichen Glücksgefühl. Ich ging in der Folge immer mit der Hoffnung nach dem Agnesstift, meine kleine Freundin dort anzutreffen; doch sollte mir das nur noch zweimal glücken, ohne dass wir uns dadurch besonders näher kamen. Sie hielt sich von den feineren Knaben scheu zurück, und auch in meiner Natur lag viel Blödigkeit; meinem Bruder aber war sie völlig gleichgültig. So kam es zu keiner weiteren Anfreundung. Aber der erste Heiligenschein, den ein zärtliches Knabengemüt zu verschenken hatte, schwebt über dem blonden Lockenkopf dieses kleinen Mädchens, von dem ich später nie wieder etwas erfuhr, und das in der großen Welt der harten Arbeit irgendwo untergetaucht sein wird.
Aber für immer halte ich ihr liebes Bild an meiner Knabenhand, ihr weißes Hemdchen leuchtet gleich dem Meinen, und unsere bloßen Füße gehen durch goldene Straßen, von dem feierlichen Klange großer Glocken umsummt.
*
Ich war ein Kind, das sich früh mit den Büchern beschäftigte; ich kroch damit unter das alte Tafelklavier und konnte da lange mäuschenstill sitzen, das aufgeschlagene Buch mit den bunten Bildern auf dem Schoß. Früh regte sich die Fantasie des Kindes, das sich gerne Ecken und Winkel, auch die kleinsten, bevölkerte und zu einer eigenen Welt umgestaltete. Die Falten auf der Bettdecke wurden mir zu Berg und Tal, die ich mit Gämsen und Jägern belebte, oder ich tiefte mir in dem weichen Federbett eine große Seemulde aus und segelte mit meinem Schiff von einem Strand zum anderen, wobei ich mit den Knien auf höchst einfache Weise eine stürmische Wellenbewegung hervorrief. Um die Blumentöpfe auf dem Fensterbrett, wie in den dunklen Höhlen meiner kleinen Hausschuhe führte ich meine erdichtete Welt spazieren, und die wonnigen Schauer des Geheimnisvollen und des Rätselhaften, die noch heute jede Wegbiegung mir macht, suchte ich mir schon damals zu verschaffen, indem ich das Auge um irgendeinen beliebigen Gegenstand, einem Kästchen, einem Lampenfuß oder was es war, sich herumtasten ließ, bis es an eine Ecke, eine Biegung kam, hinter der nun ein Reich mit tausend Wundern begann.
Meine Vorliebe für den Schlupfwinkel unter dem Klavier wurde scherzhaft als erste Ankündigung einer musikalischen Begabung gedeutet, die sich denn auch in der Folge bei mir und ebenso bei meinen Geschwistern zeigte; vorläufig aber äußerte sie sich nur in dem atemlosen Lauschen, womit wir dem Klavierspiel und dem Gesang unserer Mutter folgten. Diese war durchaus eine musikalische Seele und hatte es zu einer hübschen Fertigkeit gebracht, die sie unter anderem Chopinsche Walzer mit ebenso viel Anmut als Feuer vortragen ließ. Doch neigte ihre Natur mehr zu der schlichten Innigkeit des Volksliedes, und mit nichts machte sie uns mehr Freude, als wenn sie uns durch ihren schönen weichen Sopran allerlei Kinderlieder vorsang, die wir bald nachsingen lernten. Da saßen wir denn um sie herum mit heller Kehle, die Hälse wie zwitschernde Vögel aufreißend, und hielten tapfer Takt und Melodie. »Hänschen sitt in Schosteen und flicket sine Schoh«, »Ein Schäfermädchen weidete«, oder »Wer will unter die Soldaten«, das waren so unsere Lieblinge. Ab und zu sang die Mutter uns auch wohl ein Mendelsohnsches oder Schubertsches Lied. Sie wurde oft in Gesellschaft aufgefordert, etwas zu singen, und die Lieblichkeit ihrer Stimme und die Innigkeit und Schönheit ihres Vortrages entzückten immer.
Erschrecklich wirkte dagegen auf uns das Konzert eines Klaviervirtuosen, der, ich weiß nicht woher, in unser Haus geschneit war. Mit gewaltigem Getöse hielt er Einzug in unsere Kinderseelen.
Eine kohlschwarze Mähne hing ihm wild um Kopf und Schulter und umrahmte ein blasses, zigeunerhaftes Gesicht, aus dem zwei schwarze, stechende Augen uns anfunkelten. Er spielte das Erwachen des Löwen von Kontski, jenes jahrelang beliebte triviale Salon- und Virtuosenstück, schüttelte seine Mähne, und brüllte und donnerte, dass ich noch heute nicht begreife, wie unser altes Klavier das aushielt. Die Wirkung auf uns verdutzte Kinder war denn auch, dass wir immer verängstigter wurden und zuletzt weinend aus dem Zimmer liefen. Das hielt jedoch den brüllenden Löwen nicht ab, sich noch weiter mit majestätischem Lärm zu produzieren.
An solchen Gesellschaftsabenden durften wir Kinder immer auf ein Viertelstündchen ins Zimmer kommen, jedem die Hand geben und uns hätscheln lassen. Ich wurde besonders von einer zarten, blassen Dame, einer Freundin der Mutter, gerne gesehen, die wir Tante Pollinka nannten. Sie hatte am Markt eine Konditorei inne und hatte es sich, da sie kinderlos war, in den Kopf gesetzt, ich sollte einmal ihr Nachfolger werden. So gerne ich nun Süßigkeiten aß, so war mir doch die Vorstellung, mich in der weißen Konditortracht, mit der großen Schürze, mein Leben lang bewegen zu sollen, eine lächerliche, für einen Jungen beschämende, und ich erinnere nicht, jemals Neigung dazu auch nur vorübergehend gespürt zu haben. Dennoch erhielt sich der Wunsch der guten Tante Pollinka hartnäckig, bis sie endlich wohl einsah, dass an mir ein Zuckerbäcker verloren war. Aber noch in späteren Jahren bin ich nie an dem schmalen Eckhause vorübergegangen ohne das Gefühl: ›Das hätte eigentlich alles dir gehören sollen, und du könntest nun dahinten in dem kleinen Raum stehen und Mandeln schälen, Zimmet stoßen, Teig rühren und mit buntfarbigem Fruchtgelee die Torten zierlich dekorieren.‹
*
Viele Gesellschaften gab die Mutter nicht, dafür widmete sie sich, soviel der Hausstand ihr nur Zeit ließ, uns Kindern, und ging namentlich gern mit uns vors Tor hinaus, wo sie uns bald in diesem, bald in jenem Kaffeegarten mit Milch und Kuchen traktierte. Wir durften dann nach Herzenslust umhertollen, während sie, mit einer Handarbeit beschäftigt, ab und zu einen wachsamen Blick nach uns aussandte.
Von diesen Kaffeegärten wurde einer von uns bevorzugt, weil er den besten Tummelplatz für unsere Spiele bot. Er hieß »Die Lachswehr« und lag oberhalb der Stadt am Ufer der Trave. Graf Johann V. von Holstein, der Milde und Freigebige, hatte einem Lübecker Bürger, »der es nicht sonderlich um ihn verdient hatte«, wie es in der Chronik heißt, einen Fischstand geschenkt, darin unzählig viele Lachse gefangen wurden. Es sind aber dazumal die Lachse in Lübeck so häufig gewesen, dass die Dienstboten sich ausbedungen, ehe sie ihren Dienst angetreten, allerhöchstens zweimal in der Woche mit Lachs gespeist zu werden. Dieser Reichtum hatte nun lange aufgehört, und wenn wir einmal unsere Knabenangel in den Fluss warfen, biss höchstens einmal ein Rotauge oder ein Barsch an. Doch das Angeln war nicht unsere Leidenschaft; das Wasser aber zog uns an, und aus dem verbotenen Boot, das, am Steg angekettet, wohlgeschützt im hohen Schilf lag, mussten wir oft genug verjagt werden. Die Angst unserer guten Mutter war nicht unbegründet, denn namentlich mein Bruder war weniger tollkühn als unvorsichtig, und musste denn auch einmal seine Unbedachtsamkeit mit einem kalten Bade büßen. Wie erschrak ich, als ich ihn in der kreisenden, im Schatten des überhängenden, dunklen Sommerlaubes fast schwarzen Flut verschwinden sah. Er tauchte jedoch alsbald wieder auf, prustete und paddelte sich wie ein ins Wasser gefallener Pudel soweit wieder an das Boot heran, dass ich ihm meine Hand entgegenstrecken konnte. Da saß er nun triefend auf der Ruderbank und wollte aus Furcht vor Strafe nicht ans Land. Es blieb aber nachher bei einer Strafpredigt der zu Tode erschrockenen Mutter; der Triefende wurde notdürftig umgekleidet, in eine Droschke gepackt und heimgeschickt. Franz aber nahm am anderen Tag Veranlassung, uns zur Warnung von der Travennixe zu erzählen.
»1630 ging Herr Gert Reuter, welcher mit Ziegelbrennen und Steinen sein Verkehren gehabt hat, zu Abend mit Torschluss nach Moisling, um die Nacht daselbst zu bleiben; wie er nun unterwegs auf dem Damm oder Hohenstegen ist, sieht er aus dem Wasser eine nackte Gestalt sich etliche Male erheben, welche sich allenthalben umgeschaut und gerufen: ›Wehe, wehe, die Stunde ist da, aber der Mensch ist nicht kommen!‹ Gert Reuter weiß zwar nicht, was es bedeutet, geht aber ruhig seines Weges fort: Da kommt vom Berge herab ein Knabe in vollem Laufen gerannt und will nach dem Wasser zu. Diesen kriegt Gert Reuter zu fassen, hält ihn fest und fragt ihn: ›Wo willst du hin, mein Sohn?‹ Der Knabe spricht: ›O, lass mich gehen, ich will baden; ich muss baden.‹ Da sagt Gert Reuter: ›Du sollst um Gottes willen nicht!‹ Der Knabe wird nun traurig, lässt sich aber still nach Moisling führen, und hat ihm Herr Gert vermutlich damals sein Leben gerettet. Desgleichen Geschrei hat man öfter gehört, wie glaubwürdige Leute versichern, und ist jedes Mal an dem Tage ein Knabe ertrunken.«
So erzählte Franz, wenn auch nicht mit diesen Worten der Chronik, und ich war sogleich bereit, ein solches Geschrei gehört haben zu wollen.
»Es ist doch wahr!« verteidigte ich mich gegen meinen Bruder, der es bestritt.
»Du lügst!«, fuhr er mich grob an. »Was hat sie denn gerufen?« »Wehe! Wehe!«
Weder Franz noch mein Bruder schenkten mir Glauben, wie ich recht gut merkte, obwohl sie schwiegen. Ich aber spann mich in mein Märchen weiter ein.
Nun hatte ich, während wir im Boot saßen, meine Mutter einmal laut nach meiner Schwester rufen hören: »Gretchen! Gretchen!« Jetzt redete ich mir ein, mich verhört zu haben, es hätte nicht anders als »Wehe! Wehe!« geklungen und wäre nicht aus dem Garten, sondern vom Wasser hergekommen.
»Gibt es Wassernixen?«, fragte ich die Mutter. Sie verneinte es lächelnd. Aber wenn ich von der dunklen Allee aus, die sich am Ende des Kaffeegartens am Wasser hinzog, einen Blick auf den stillen Fluss warf, in dem sich die breiten, dichten Kronen der Bäume tiefschwarz spiegelten, und der an seinem anderen Ufer umschilfte Wiesen bespülte, die in geheimnisvollem Schweigen dalagen, so glaubte ich doch manchmal einen suchenden Blick nach der Wassernixe senden zu sollen, und schrak wohl einmal zusammen, wenn ein plötzlicher Windstoß den grünen Binsenwald heftiger schüttelte und einen Schauer kleiner Wellen über die Wasserfläche trieb.
II
Früh schon fing ich an, auf dem Klavier herumzufingern. Eine alte Tante der Mutter, die einst zu den gesuchtesten Klavierlehrerinnen gehört hatte, erbot sich, uns den ersten Unterricht zu geben, und bald hockte ich stolz und glücklich vor den Tasten und lernte unter ihrer Anleitung Noten lesen, und erste Melodien hervorbringen.
Ich hatte die alte Tante sehr lieb und war ein lernbegieriger Schüler. Alle Notenhefte, die mir in die Hände kamen, blätterte ich durch und tat wie ein gelehrter Kapellmeister. Ungeduldig harrte ich der Zeit, wo ich alle diese krausen Zeichen enträtseln können würde. Noch waren sie stumm für mich, aber ich wusste, ich würde sie einst zum Sprechen bringen, zum Singen und Klingen. O, wie wollte ich fleißig sein, um bald die schöne Kunst zu lernen! Wie glücklich war ich über jedes Lob der Tante und wie unglücklich über ihre Unzufriedenheit. Mein Fleiß spornte auch meinen Bruder an, und wir waren bald in regem Wetteifer. Die Tante wusste diesen Eifer auf kluge Weise zu nähren: Wenn wir besonders fleißig gewesen waren, durften wir sie besuchen und konnten uns unsere Lieblingsspeise ausbitten. Ich wählte dann immer Milchreis mit recht viel Zucker und Zimmet, mein Bruder zog arme Ritter vor.
In der Vorschule lernte ich lesen und schreiben. Sie befand sich in dem Hinterflügel eines alten Kaufmannshauses, dessen dämmrige, geräumige Fliesendiele uns anheimelte. Fässer und Ballen lagen hier aufgestapelt und füllten die Luft mit ihren wunderlichen Gerüchen, Gerüche, wie sie uns wohlvertraut waren, da sie überall aus den dunklen Dielen und Kellern auf die engen Straßen herausströmten, die wir täglich passierten.
In unser Schulzimmer aber blickten die blauen Dolden blühenden Flieders und die weißen Kugeln des Schneeballs herein, und die liebe Sonne streichelte unsere Köpfe und vergoldete uns mitleidig Schiefertafel und Fibel. Es waren drei freundliche Schwestern, die den kleinen Abc-Schützen den ersten Unterricht erteilten, und wir lernten eifrig. Traten wir morgens in das Schulzimmer, begrüßte uns das Brodeln des Teekessels, der über einer Spritflamme hing, denn wir bekamen in der ersten Pause heiße Milch und Semmeln. Das Summen und Singen der bläulichen Flamme, das leise Klappern des Deckels auf dem Kessel, ein freundliches Frauengesicht und viel Sonnenschein – das ist mein erstes Schuljahr.
»Wir werden nicht recht klug aus ihm, er geht still seine Wege.« Das war das Urteil des Schulvorstehers über mich, als ihn meine Mutter über meine Fortschritte befragte. In den höheren Klassen aber hatte ich immer einen ersten Platz und ließ die Lehrer nicht länger über meine Fähigkeiten in Zweifel. Und fast will mir scheinen, als ob ich alles, was ich von der Schule mit ins Leben genommen habe, dieser Vorschule verdanke. Es war ein frisches, fröhliches Lernen unter freundlichen, tüchtigen Lehrern.
Dann aber hieß es sich entscheiden, ob ich in die Lateinklassen oder in die Realabteilung des Katharineums, der altehrwürdigen Gelehrtenschule meiner Vaterstadt übergehen wollte.
Um diese Zeit heiratete die Mutter wieder. Wir durften bei der Hochzeit sein, Pasteten schlecken, Eis schmausen und waren des neuen Vaters von Herzen froh. Als ich nun aber die Vorschule verlassen sollte, machte er sogleich seine Autorität geltend und entschied gegen meinen Wunsch, dass ich nicht das Gymnasium, sondern das Realgymnasium zu besuchen habe. Er machte Gründe geltend, die ich selbst zu prüfen noch nicht imstande war, und bei denen ich mich daher beruhigen musste.
Das Katharineum war an die alte Kirche des Katharinenklosters angebaut. Ein Teil der Klassen hatte in ehemaligen Kapellen und Zellen Unterschlupf gefunden, deren hohe, gewölbte Decken einst von den Gebeten der Mönche widerhallten, jetzt aber die Übungen lateinischer Abc-Schützen anhören mussten. Aus dem Klassenzimmer traten wir in den alten Klostergang hinaus, wo denn unsere Füße laut genug über die verschlissenen Steinplatten und ihre unleserlich gewordenen Inschriften hintrabten, an alten, aufgerichteten Grabsteinen vorüber, die uns nicht kümmerten, denn wir strebten nur immer, in die Sonne des Spielhofes zu kommen, den der moderne Vorderbau einschloss, und blieben von ehrwürdigen Schauern der Vergangenheit unberührt.
Der Unterricht verlief in einem hergebrachten Trott, wie es derzeit überall nicht anders war, wo nicht überragende Lehrerpersönlichkeiten die Zwangsjacke des Systems zerrissen. Lernen, lernen, lernen. Vokabeln, Namen, Jahreszahlen. Von den herrlichsten alten Baudenkmälern umgeben, auf dem Boden einer ruhmreichen Vergangenheit, lebten wir ohne Führung und Anregung dahin. Heimatkunde war ein unbekannter Begriff. Lübeck? Deutschland? Gab es damals ein Deutschland? Ja, es gab ein Deutschland; zweimal in der Woche in der Geografiestunde: Flüsse, Städte, Berge, Einwohnerzahl. Und in der Geschichte gab es ein Deutschland: die Namen der deutschen Kaiser und ihre Jahreszahlen; vor- und rückwärts. »Setz' dich einen rauf, setz' dich einen runter!«
Zwei Kriege bewegten diese Zeit. 1864 füllten fremde Truppen die Stadt. Preußen und Österreicher waren auf dem Marsch gegen Dänemark. Wir saßen abends mit der Mutter um einen runden Tisch und zupften Scharpie. Die Siegesnachrichten trafen ein, und wir sangen und spielten den »Düppelstürmer«.
Nachher kam Königgrätz. Aber hinter den Schulmauern merkte man nicht viel von dem, was draußen vor sich ging; hier tobten noch immer die punischen Kriege. Was ging uns der König von Preußen an?
Nur einmal ein Lichtblick: Ein neuer, junger Lehrer der Naturwissenschaft kam zu uns; Professor Küstermann. Das war einer von denen, die nicht auswendig lernen ließen, sondern lehrten, zeigten, lebendig machten. Mit offenem Munde drängten wir uns um ihn und tranken, was er bot: Leben, nicht totes Wissen. Und einmal eine flüchtige Sonnenstunde, die uns zeigte, wie trübe eigentlich der Himmel war, unter dem wir sonst dahinlebten:
Unser Ordinarius, bei dem wir Deutsch haben sollten, fehlte, und der Direktor vertrat ihn.
Deutsch? Was war das? Das war Aufsatz und Grammatik und wieder Aufsatz und Grammatik. Subjekt, Objekt und Prädikat.
Nun sollten wir von dem »Alten« selbst Deutsch haben. Ich sehe den, würdigen, grauköpfigen Schulregenten, sonst eine seltene Erscheinung in den Realklassen, noch heute, wie er, ein Buch unterm Arm, ins Zimmer trat, uns mit einem wohlwollenden Blick überflog und dann schmunzelnd aufs Katheder stieg. Hier schlug er sein Buch auf, sah uns noch einmal freundlich an und fragte: »Kennt ihr den ›Siebzigsten Geburtstag‹ von Johann Heinrich Voß?«
Verlegenes Schweigen. »Wer war Voß?«
Zwei, drei Finger kamen zaghaft zum Vorschein. »Er hat ein langes Gedicht gemacht, das heißt ›Luise‹.
»Gut. Was wisst ihr weiter?«
Schweigen.
»Nun hört aufmerksam zu. Er hat neben der ›Luise‹ auch noch anderes gedichtet und hat als Erster eine herrliche Übersetzung des Homer geliefert. Und nun lese ich euch den ›Siebzigsten Geburtstag‹.«
So ungefähr redete er mit uns und las uns dann das Gedicht:
»Auf die Postille gebückt ...«
Wie andächtig hörten wir zu, lebten die schlichte Idylle mit, fühlten uns gemütlich bereichert und zugleich an unserer bescheidenen Bildung gewachsen. Und nun, als das Gedicht beendet war, hieß es: »Jetzt wollen wir einmal Hexameter machen. Versuch' es ein jeder, so gut er es kann.«
Er sagte ein paar Worte der Erklärung, und dann hub ein lautloses Verseschmieden an. Wir hatten nie so etwas getrieben, und der Alte mochte uns mit seinen Primanern verwechselt haben, und wenn man will, kann man es belächeln. Aber wie viel Unsinn auch zusammengeschrieben wurde, wir bekamen dabei ein lebendiges Gefühl des eben gehörten Verses. Zu den paar leidlich gelungenen Hexametern gehörten auch meine. Weniger wollte es mir bei unserem Ordinarius, dem Mathematikprofessor, mit einem dichterischen Versuch glücken, auf den ich mir etwas einbildete, weil er der Mutter und den Geschwistern viel Spaß gemacht hatte. Wie konnte ich aber ahnen, dass gerade diese Verse die Ursache meiner ersten öffentlichen Niederlage werden sollten?
In unserem Schlafzimmer hing ein farbiges Bild: Ein alter Schäfer hält eine kranke Ente im Arm und erteilt der besorgten Bäuerin Ratschläge. »Der Dorfarzt« betitelt sich dieses Kunstwerk, das, wenn ich nicht irre, Düsseldorfer Herkunft war. Ich hatte es besungen, und die Mutter hatte dies rührsame Gedicht unserem Arbeitslehrer gezeigt. Der gute, wohlwollende Mann aber mochte es im Lehrerkollegium kolportiert haben, denn wie erschrak ich, als ich in einer Mathematikstunde vom Katheder herab angeherrscht wurde: »Enten kannst du besingen, aber rechnen kannst du nicht.« Ich glaubte vor Scham in die Erde sinken zu sollen. Alle Augen richteten sich auf mich, verwundert, fragend, spöttisch. Wie sollten sie das auch verstehen? Seit jener Stunde trug ich, der für seine Jahre schon recht lang aufgeschossen war, den Spitznamen »die lange Ente«. Glücklicherweise hatte ich Humor genug, mir den neuen Namen gefallen zu lassen, und da ich im ganzen bei meinen Mitschülern wohlgelitten war, so stellten sie allmählich auch die Neckerei ein.
Dem alten Herrn aber trug ich es nicht nach; er war ein lieber, freundlicher Mann, der es gut mit seinen Schülern meinte. Auch war ich mir wohl bewusst, dass ich wenig Ansprüche auf sein Wohlwollen hatte, denn ich war in der Mathematikstunde unbestritten sein größter Esel.
*
Für das öde Einerlei des Unterrichts, das nur durch einzelne Lichtblicke erhellt wurde, suchten wir uns außerhalb der Schule nach Kräften zu entschädigen. Der Sommer rief uns natürlich vors Tor, im Winter aber warfen wir uns auf allerlei häusliche Beschäftigungen, wie sie Kinder gern betreiben. Auch die Musik nahm uns sehr in Anspruch. Wir hatten, schnelle Fortschritte gemacht, konnten uns schon an die Symphonien unserer Klassiker wagen, und selbst der Vater verschmähte es nicht, sich ein Stündchen in die Sofaecke zu setzen und unserem vierhändigen Spiel zuzuhören. Vor allem war es Haydn, den wir liebten; seine Anmut, seine Sonnigkeit, sein Humor waren so recht für unsere jungen Knabenherzen. Ich hatte auch Mozart besonders lieb. Aus einem alten, vergilbten Heft lernte ich zuerst die A-dur-Sonate mit dem lieblichen Andantethema und dem Finale a la Turca kennen. Mozart! Ich konnte förmlich mit dem Namen auf dem Titelblatt liebäugeln, und noch heute wenn ich die Sonate spiele und höre, sehe ich dieses alte, stockfleckige Mozartheft vor mir.
*
Das ist die Melodie meiner Kindheit, die Zauberformel, mit der ich sie in ihrer ganzen Unschuld und in ihrem sonnigen Glanze wieder wachrufen kann.
Neben der Musik trieben wir noch andere Künste: Wir zeichneten und tuschten Bilderbögen, die sich jährlich mit neuen Farbkästen auf dem Weihnachtstisch einstellten, und auch das Ausschneiden fand seine Liebhaber. Namentlich ich zog eine Zeitlang das Arbeiten mit der Silhouettenschere dem Kolorieren der Neu-Ruppiner Kunsterzeugnisse vor; sauber in ein Schreibheft geklebt, machten diese zierlichen schwarzen Bilder mir und anderen viel Freude.
Mehr als alle diese Handfertigkeiten nahm uns das Theaterspielen in Anspruch. Die Anregung dazu gab ein Puppentheater mit einem reichen Marionettenvorrat, wovon mir besonders die Figuren zum Freischütz im Gedächtnis geblieben sind; so der grasgrüne Max mit wallenden blonden Locken, und die lange Figur des schwarzen Kasper mit roter Feder auf dem Hut. Mächtig regte die Wolfsschlucht unsere kindliche Fantasie an. Ich als der Geschickteste zu solchen Künsten, musste meistenteils mit diesen pappenen Helden agieren, und übte mich dabei im Erfinden der schönsten Ritter- und Räuberkomödien. Wir Brüder hatten damals im ersten Stock ein langes, schmales Zimmer, dessen eines Fenster nach dem Hof hinausging, als Schlaf- und Arbeitsraum inne. Hier war in dem schmalen Türrahmen der gegebene Platz für das Theater. Ein Vorhang war leicht hergestellt, eine alte Tischglocke zur Hand, und eine Reihe von Stühlen, auf dem Korridor aufgestellt, harrte eines kunstbegeisterten Publikums.
Fielen nun bei dem Puppentheater alle Aufgaben mir zu, und ebenso bei dem Kasperletheater, womit uns einmal der Weihnachtsmann überraschte, so stellte sich bei so mannigfacher Anregung bald die Lust bei mir ein, statt mit Drahtpuppen und Kasperlefiguren, in eigener Person zu agieren, und mich so erst recht als König, Räuberhauptmann oder Teufel zu fühlen.
Bisher Direktor, Dichter und Dramaturg in einer Person, hatte ich auch jetzt die Aufgabe, meinen lebendigen Schauspielern Stücke mit glänzenden und möglichst dankbaren Rollen zu verschaffen, und in solchen Lagen pflegt die Not den Meister zu machen. Nun hatte sich aber der Not eine ebenso kräftige als holde Verbündete zugesellt. Unter dem Stammpublikum meines Marionettentheaters befand sich ein Mädchen, das mir mit seinem schwarzen Haar und seinen großen tiefbraunen Augen der Inbegriff aller Lieblichkeit zu sein schien, obgleich sonst meine Vorliebe den Blondinen galt. Diese junge Schöne genoss als einziges Töchterchen eines der reichsten Weinhändler unserer Stadt das Ansehen einer kleinen Prinzessin. Sie hatte in der Ruhe etwas ungemein Ernstes, fast Melancholisches, welcher Eindruck von dem Kontrast zwischen ihren nachtdunklen Augen und Haaren und der Blässe ihres Teints, der einen leisen Hauch gelblicher Elfenbeinfarbe hatte, noch erhöht wurde. Anders, wenn sie sich bewegte; da konnte sie die Ausgelassenste beim Spiel sein, und ihre dunklen Augen leuchteten dann wie zwei Frühlingssonnen.
Ich hätte schwerlich sagen können, wie sie mir lieber war, heiter oder ernst. Saß sie vor meinem Puppentheater, spielte ich eigentlich nur für sie, und manches feurige und gefühlvolle Wort aus pappenem Mund war nur an sie gerichtet. Jetzt sollte sie aus dem Parkett auf die Bühne steigen und durch keine noch so papierne Rampe gehemmt mit mir in lebendige Berührung treten; denn dafür zu sorgen, war die erste und heiligste Pflicht, die ich als Dichter empfand. Man verlangte durchaus etwas Lustiges von mir, und ich versprach alles, damit nur überhaupt etwas zustande käme. Tagelang lief ich umher und zerbrach mir den Kopf, und kam mir in dieser sorgenvollen Existenz höchst wichtig vor. »Weißt du schon etwas?«, fragte mich Bruder und Schwester jeden neuen Tag, und in dem Ton ihrer Frage lag unbegrenzte Hochachtung vor meinem dichterischen Genie und das felsenfeste Vertrauen, dass mir schon etwas Gutes einfallen würde. Endlich glaubte ich denn auch eine herrliche Idee gefunden zu haben. »Ich hab's! Ich hab's!« rief ich, hüllte mich aber den Fragern gegenüber in geheimnisvolles Schweigen; erst müsse ich das Stück ganz fertig haben, früher könne ich nicht darüber sprechen. Mein Stück betitelte sich, und soviel verriet ich schon vorher: »Der lustige Postillon.« Mir standen nur vier Akteure zur Verfügung, zwei männliche und zwei weibliche. Nun war die Titelrolle natürlich in den Augen der anderen die Hauptrolle, mir aber war es darum zu tun, sei es in welcher Rolle, der Heldin, der hübschen Alma, einen Kuss zu geben, den zu dulden sie nach den Gesetzen der Bühne meiner Meinung nach ohne Widerrede verpflichtet war. So überließ ich denn gerne meinem Bruder, schon um jedem Verdacht des Eigennutzes zu begegnen, die Rolle des lustigen Postillons, und begnügte mich mit der des Grafen, mich zugleich an dem vornehmen Titel schadlos haltend. Der Plan meines Stückchens aber war der: die Gräfin gedenkt ihres abwesenden Mannes, als die Kammerzofe den Postillon anmeldet, der durchaus einen Brief eigenhändig an die Frau Gräfin abzugeben den Auftrag haben will. Der Postillon wird vorgelassen, benimmt sich höchst albern, und will den Brief nur gegen einen Kuss abliefern. Die Aufschrift verrät die Hand des Grafen, und Gräfin Alma brennt darauf, den Inhalt zu erfahren. Aber kein Befehlen, Drohen, Bitten hilft, der Frechling will den geforderten Brief nur gegen den gewünschten Lohn ausliefern. Das Kammerkätzchen erbietet sich höflich, ihn einzulösen, aber der Flegel besteht auf einen »herrschaftlichen« Kuss. Was bleibt da zu tun übrig? Ohne männliche Hilfe, dem Aufdringlichen gegenüber wehrlos, voll Sehnsucht, den Brief des Gemahls zu lesen, gibt die schöne Gräfin nach, und die Zofe muss sich als Anstandsschirm zwischen sie und das Publikum stellen. In diesem Augenblick aber erscheint der Gemahl selbst, den heiße Sehnsucht seinem Briefe auf dem Fuße hat folgen lassen. Den frechen Flegel ohrfeigen und zum Tempel hinauswerfen ist das Erste, leidenschaftliche Vorwürfe sind das Zweite. Aber das Kammerkätzchen entlastet die weinende Gräfin, und der Graf schließt seine Gemahlin mit einem Kuss in die Arme, worüber dann schnell der Vorhang zu fallen hat.
Ich glaubte, meine Sache meisterlich gemacht zu haben, und war ebenso verwundert als siegesgewiss, als keiner der Beteiligten sich gegen meine Rolle auflehnte, und fand es, wenn auch ärgerlich, doch auch wieder natürlich, dass Alma sich in den Proben gegen den Kuss sträubte und ihn nur markierte. »Aber bei den Aufführungen muss alles nach Vorschrift gehen«, sagte ich und nahm ihr Schweigen für Zustimmung. Dennoch war ich den ganzen Tag fast krank vor Aufregung und Zweifel, ob ich nun wohl meinen Kuss bekommen würde; und so flott ich in der Probe gespielt hatte, als nun am Abend sich der Vorhang hob, das heißt die beiden Flügeltüren, die die Verbindung zwischen dem roten und dem grünen Zimmer herstellten, sich auftaten, überfiel mich vierfache Angst: die des Dichters, des Theaterdirektors, des Schauspielers und des Liebhabers. Unser Publikum bestand meist aus Erwachsenen, dem Elternpaar und einigen weiblichen Gästen. Es hieß also, sich zusammennehmen und das Beste geben. Jene vierfache Angst aber ließ mich eine ziemlich hölzerne Figur machen, wohingegen der Schlingel von Postillon all sein Pulver für den Abend aufbewahrt zu haben schien. Denn als nun der große Augenblick gekommen war, sprang er mit einem übermütigen Satz aus der vorgeschriebenen Rolle und küsste Alma unter dem schallenden Gelächter des Publikums herzhaft auf den Mund. Erbost langte ich aus, ihm die vorgeschriebene Ohrfeige nun auch recht kräftig zu geben; allein er verstand es, gewandt auszuweichen. Ich, aus der Rolle fallend, mache mich hinter ihm her und jage ihn einmal um die Bühne, ohne zu meinem Zweck zu gelangen. Der Zuschauer, die dieses alles als zum Stück gehörig nahmen, bemächtigte sich gesteigerte Heiterkeit, die sich zuletzt auch auf meine Mitspieler übertrug. Sollte das ganze Stück nicht in die Brüche gehen, musste ich mich fassen, die verdrießliche Jagd aufgeben, und meine Rolle vorschriftsmäßig weiter spielen. Mit vor Erregung zitternder Stimme hielt ich meine vorwurfsvolle Strafpredigt, die ehrlich genug geklungen haben mag, und wartete auf den Augenblick, wo ich die gerechtfertigte Gattin versöhnt in die Arme schließen und nun auch meinerseits einen Kuss auf ihren Lippen anbringen konnte. Aber auch hier verlor ich das Spiel. Wohl warf sie sich an meine Brust, sodass ich einen Augenblick das hübsche Wesen warm und weich in meinen Armen fühlte, aber den Kopf wegwendend, machte sie es mir unmöglich, sie zu küssen; ein kurzes Ringen entstand, wobei sie mir entschlüpfte, und abermals war ich dem Gelächter ausgesetzt. Was blieb mir anders übrig, als mit einzustimmen, wollte ich mich nicht, den Gekränkten spielend, nun wirklich lächerlich machen; so aber kam ich noch billig davon, und das alberne Stück errang wenigstens ehrlich einen Heiterkeitserfolg, wenn auch auf ungewollte Weise. Ich erholte mich schnell von meiner Niederlage, und redete mir ein, dass meine Neigung zu der dunklen Alma gar nicht so groß sei, ja, gar nicht sein könne, da meine Vorliebe doch immer den Blonden gegolten habe, und nur eine solche könne es sein, die mein Herz wirklich auf die Dauer gewönne. Der Trost, den mir diese Sophisterei gewährte, hielt zwar nicht lange vor. Doch versuchte ich nicht ein zweites Mal, mich dem Mädchen vertraulich zu nähern; eine nochmalige Abweisung hätte ich nicht verwunden. Wir spielten noch oft Theater, aber nie hat Alma sich wieder herbeigelassen, mitzuspielen. Sie wuchs zu einer stadtbekannten jungen Schönheit heran, heiratete später einen Offizier und hat es, wenn ich nicht irre, bis zur Generalin gebracht.
*
Galt ich auch nicht mit Unrecht für einen Stillen, der keineswegs überall mit dabei zu sein brauchte, so war doch meine Fantasie rege genug, um auch an den Sioux- und Comanchesspielen Freude zu finden. Chingachkook, der große Delaware, stellte alle Helden der Weltgeschichte in den Schatten, und jeder Einzelne von uns war überzeugt, dass er ihm gleichkam an Haltung, Gebärde, Tapferkeit und Edelmut.
Ich zählte zu seinen Kriegern und diente ihm mit Eifer als Treuster der Getreuen, der am Lagerfeuer neben ihm lag, zuerst die Friedenspfeife aus seinem Munde empfing, und den Becher nach ihm an die Lippen führen durfte. Und nie wieder im Leben habe ich das beseligende Gefühl hingebender Freundschaft so kennengelernt. Er war ein schöner, starker, blonder Junge mit lachenden Augen. Hatte ich ihn einmal einen Tag lang nicht gesehen, so war ich unglücklich; doch da er mit mir in derselben Klasse war, so kam das selten vor. Auch trafen wir uns beim Baden, wo er denn wieder in seiner jungen Knabenschönheit alle anderen überstrahlte. Es war mehr als Freundschaft, es war Liebe, die mich seine Nähe beglückend empfinden ließ. Natürlich verbarg ich diese Neigung auf das Sorgfältigste. Um so überraschter war ich, als eines Tages mein Bruder mich mit der Frage überfiel: »Magst du Kurt S. auch so gerne leiden?« Wir stiegen zusammen um die Mittagsstunde die Treppenleiter in unser Bodenparadies hinauf, ich voran. Ich erschrak, als diese Frage hinter meinem Rücken laut wurde. Ich fühlte, wie ich errötete, und antwortete ohne mich umzusehen mit einem ebenso verlegenen als verwunderten Ja.
»Ich auch, ich liebe ihn«, erwiderte mein Bruder.
Seit jenem Augenblick war der Zauber gestört, wir unterhielten uns über unseren Freund, er trat damit in die Reihen der anderen zurück, und der Himmel einer ersten, scheuen, reinen Knabenliebe war entgöttert.
Ich hatte aber in jener Zeit noch einen zweiten Freund. Er besuchte eine andere Schule, wohnte aber in unserer Straße, wo wir schon früh beim Pferdespiel Bekanntschaft schlossen. Auch er war ein hübscher Junge mit krausem Blondhaar, und sein sympathisches Äußere sprach gewiss mit, dass ich mich zu ihm hingezogen fühlte. Mehr aber waren es die gleichen Interessen, die uns verbanden. Er hieß Fritz und war der Sohn eines kleinen Beamten, der in einem mäßigen Wohlstand lebte. Er war klug, lebhaft und für alles Schöne begeistert. Er hatte einen Hang zum Philosophieren, und wir redeten über Gott und die Welt mit heißen Herzen und heißen Köpfen und dachten wunder was von unserer Tertianerweisheit.
»Glaubst du an die Unsterblichkeit der Seele?«, fragte er mich eines Tages.
»Gewiss, glaube ich daran«, antwortete ich. »Alle großen Geister haben daran geglaubt. Goethe und Schiller und alle. Natürlich denke ich es mir nicht so, wie die Pastoren es predigen.«
»Ach die Pfaffen!«, rief er verächtlich.
»Ja, diese Pfaffen«, pflichtete ich emphatisch bei.
Die Stirn runzelnd starrten wir beide ins Leere, als ob wir uns schwere Sorgen machten, was aus der Welt unter den Händen dieser hassenswerten Pfaffen noch werden sollte.
In Wahrheit lag uns das sehr wenig am Herzen. Wir waren zufrieden, uns an großen Worten berauschen zu können. So war auch die Unsterblichkeit nur ein Klang, der meine Seele bewegte. Im Übrigen war ich des Lebens froh, genoss den Tag und ließ das Jenseits Jenseits sein. Dass es einen Gott gäbe, galt mir für bewiesen und allen Zweifeln entrückt. Ja, ich war im Grunde eine ganz fromme Seele, die sich ohne ihn gar nicht hätte zurechtfinden können. Ich betete in allen Stunden, wo mich etwas bedrückte und beängstigte, zu ihm, und war voll kindlichen Vertrauens. Ein Bild machte ich mir nicht von ihm; irgendwie und irgendwo würde er schon sein, und seiner Macht wäre nicht zu entrinnen.
Von diesen unreifen Schwärmereien, worin sich jedoch ein erstes Ahnen und Begehren, die Welt zu begreifen, regte, zog uns glücklicherweise ein anderes ab, das uns zu praktischer Betätigung zwang.
Da Fritz sich trotz seiner schöngeistigen Neigungen für den Kaufmannsstand vorbereitete, weil der Vater nicht die Mittel hatte, ihn studieren zu lassen, so trieb er, durchaus dafür begabt, fleißig fremdsprachliche Studien, darunter auch in der für Lübecks Handel so wichtigen schwedischen Sprache. Zu Schweden hatten nun auch wir einige Beziehungen, als unser Stiefvater während einiger Jahre Kompagnon des schwedischen Konsuls war. So sahen wir manchen schwedischen Besuch in unserem Hause und hatten an dem Wohllaut der Sprache unsere Freude. Dass wir sie nicht beherrschten, bedauerten wir nie lebhafter, als da wir eines Tages am Hafen die Bekanntschaft eines kleinen schwedischen Schiffsjungen machten, woraus sich eine Art Freundschaft entspann. Wir wussten genau, wann die »Drothning Luise« wieder im Hafen war, und unser kleiner Freund sah schon nach uns aus und lachte uns über die Reeling erfreut an, wenn er uns am Bollwerk entdeckt hatte. Obgleich wir uns nur mit Zeichen und Mienen verständigen konnten, waren sich unsere jungen Herzen doch einig geworden. Ihm musste es wohltun, im fremden Hafen Kinder zu wissen, die ihm, dem gar nicht so viel Älteren, zeigten, dass sie ihn gerne hatten. Und er lohnte es uns, indem er uns ein paarmal heimlich ein paar Schiffszwiebäcke zusteckte, woran wir denn unsere Zähne wetzten. Als er uns einmal zu verstehen gegeben hatte, dass er nicht wiederkommen würde, vergossen wir Tränen beim Abschied, und auch er stand länger als sonst und winkte uns zu, während das schöne Schiff langsam die Trave hinunterglitt.
So waren wir denn gern bereit, schwedisch zu lernen, als Freund Fritz sich anbot, uns die Anfangsgründe beizubringen. Die Eltern ließen uns lächelnd gewähren; die nötigen Bücher wurden angeschafft, und wir zogen uns mit unserem Mentor zweimal wöchentlich auf unser Zimmer zurück.
Dieses Zimmer war für uns, seitdem die Schwester so weit herangewachsen war, dass sie nicht mehr bei den Eltern schlief, sondern eines Raumes für sich bedurfte, auf dem ersten Bodengeschoss hergerichtet worden. Es war eigentlich nur ein Bretterverschlag, innen aber mit einer hellen, freundlichen Tapete versehen; ein höchst gemütlicher, wohnlicher Raum. Wir schliefen nicht nur hier, sondern machten auch unsere Schularbeiten an einem runden Tisch, der in der Nähe des einzigen Fensters stand. Dieses führte auf das Dach des Nachbarhauses hinaus, wo wir denn in der Dachrinne die Katzen spazieren gehen sahen und leichtiglich von ihnen Besuch erhalten konnten, was aber meines Erinnerns nie vorgekommen ist; aber die Sperlinge, denen wir Brosamen streuten, kamen zutraulich heran, und ab und zu huschte auch wohl mal ein Mäuschen längs der Rinne.
Eigentlich war mir dieser Ausblick auf das hohe, schmale, schräge Ziegeldach des Nachbarhauses ebenso lieb, als ein schönerer auf Gärten und Felder. Denn meine Neigung, mich mit der Fantasie in Fugen und Ritzen und Löcher zu verkriechen, fand hier reichliche Nahrung. Wenn im Winter der Schnee die Rinne füllte, bei Regenwetter der Regen über die rotbraunen Pfannen herunterrauschte und sich in der Rinne zu einem reißenden Strom sammelte und weiterschoss, oder wenn die liebe Sonne die wunderlichsten Lichter auf den roten Steinen entzündete, immer war es eine andere Welt.
Ganz abgeschieden und geborgen waren wir hier in unserem eigensten Reich, Licht und Luft kamen gerade genug herein, und immer war es im Sommer hübsch kühl und im Winter durch die Nähe des Schornsteins für uns nicht allzu empfindlichen Jungen warm genug. Hier saßen wir nun um den runden Tisch, deklinierten »flicka«, das Mädchen, und hüllten uns dabei in mächtige Rauchwolken, denn wir hatten Ort und Zeit für günstig gehalten, wenigstens diese eine unserer indianischen Gepflogenheiten wieder aufzunehmen. Das Fenster wurde vorsorglich geöffnet, damit die verräterischen Tabakwolken alsobald entweichen konnten, und es ging eine ganze Weile so gut, bis das Rauchopfer, das wir der schwedischen Nation und ihrem vokalreichen Idiom brachten, an den Tag kam, anders, als wir es mit dem Öffnen des Fensters beabsichtigten. Dazu gehörte freilich nur die Nase des Mädchens, das morgens unsere Betten machte, denn es fing allmählich alles an, nach unserem billigen, abscheulichen Kraut zu riechen. So tat sich denn eines Tages, als wir drei Schweden eifrig tobakten, die Tür auf, und unser Stiefvater erschien mit einem Lächeln, welches uns anzeigte, dass er als Wissender kam.
»Ich glaube, ihr könnt jetzt genug schwedisch und gebt die Stunde auf.«
Das war alles, was er sagte. Aber wie beschämt waren wir und war vor allem unser Mentor, mein guter Fritz. Er packte seine Bücher zusammen und ließ sich einige Zeit lang nicht in unserem Hause blicken. Das wunderliche Gesicht unseres Stiefvaters aber sehe ich noch vor mir; er mochte ähnlicher Dinge aus seiner Knabenzeit gedacht haben und innerlich mehr belustigt als erzürnt gewesen sein.
So waren die schwedischen Studien vorzeitig beendet, und mir ist aus jenen Stunden nicht einmal die Fähigkeit verblieben, »flicka«, das Mädchen, noch richtig deklinieren zu können. Nur »jag elsker dig«, ich liebe dich, ist als einzige und unvergessliche Vokabel in meinem Kopfe hängen geblieben.
»Jag elsker dig!« Wie oft, wenn auch völlig gegenstandslos, haben wir es in jenen Tagen ausgerufen. »Jag elsker dig!« und jeder dachte sich ein liebes, himmlischschönes, aber schemenhaftes Wesen dabei. »Jag elsker dig!« Ich könnte die ganze Glut einer nach Zärtlichkeit dürstenden Seele hineinlegen, dabei die Arme ausbreiten und die leere Luft mit Ungestüm an meine Brust drücken. Ich ahnte nicht, dass mein junges Herz bald einen lebendigen Gegenstand für seine Schwärmerei finden sollte.
III
Unsere Familie hatte sich inzwischen vergrößert. Ein Schwesterchen war uns geschenkt worden, das, heranwachsend, die Arbeit der Mutter vermehrte. Das war der Grund, weshalb ein Kinderfräulein, eine Stütze ins Haus genommen wurde. Sie hieß Cäcilie und war die Tochter eines besseren Handwerkers, der, kindergesegnet, die Älteste gern ihr Brot bei fremden Leuten essen sah. Sie war achtzehn Jahre alt, fast rotblond, mit dem zarten Teint, den Mädchen dieser Haarfarbe zu haben pflegen. Sie hatte eine mittelgroße, zierliche Figur, der es doch nicht an Rundung und weicher Bildung fehlte, und ein bescheidenes, freundliches Wesen machte sie angenehm.
Wir beiden Jungen empfingen sie zuerst etwas abweisend und spöttisch: ›Glaube nur nicht, dass wir uns von dir befehlen lassen; du bist nur für die Schwester da.‹ Dennoch waren wir auf Schritt und Tritt hinter ihr her, neckten sie und suchten auf jede Weise mit ihr anzubinden. Hierbei zeigte sie sich nun von soviel Munterkeit, Gutmütigkeit und Klugheit, dass unversehens aus den nicht immer harmlosen Neckereien eine Zuneigung erwuchs, die wir mehr empfanden als uns eingestanden. Damit vertrug sich sehr wohl, dass mein Bruder, der ein wenig tief in die Flegeljahre geraten war, sich gelegentlich mit ihr balgte und einmal als endliche Abwehr eine kräftige Ohrfeige empfing, ja ein anderes Mal eine solche zu beiderseitigem Schrecken austeilte. Die bestürzten Gesichter sehe ich noch vor mir, beide, in tiefer Scham erglüht, in Tränen ausbrechend. Es war in einer Abendstunde, während die Eltern außer dem Hause waren. Der Lärm des Balgens und der erschrockene Schrei der Geschlagenen mochten unten im Kontor gehört worden sein und mochten dort gestört haben. Einer der Kommis kam ärgerlich die Treppe hinauf und fragte, was denn hier los sei. Das arme Mädchen flüchtete weinend in ihr Zimmer, und ich antwortete, nichts sei hier los. Der Frager konnte angesichts der reichlich fließenden Tränen kaum mit dieser Antwort zufrieden sein, ging jedoch mit der Bitte, wir möchten uns doch ruhiger verhalten, wieder hinunter.
Wir aber schlichen uns an die Tür des Zimmers, in dem die Gekränkte nun, wie wir annehmen mussten, saß und sich ausweinte. Wir hörten denn auch unterdrücktes Schluchzen, und ich, der ich doch eigentlich ganz unschuldig war, fühlte eine solche Zerknirschung und ein solches Mitleid, dass ich mich nicht enthalten konnte, ins Zimmer zu dringen und um Verzeihung zu bitten. Mein Bruder, der mir auf dem Fuße gefolgt war, stand als armer Sünder dabei.
»Es war ja nur aus Versehen«, sagte ich.
»Ich hab' Sie gar nicht treffen wollen«, stotterte er.
Ein reizendes Lächeln lief über das verweinte Gesicht des Mädchens, dessen getroffene Backe noch brannte und unsere Scham aufs Neue aufflammen ließ.
»Du bist ein kleiner Grobian«, sagte sie vorwurfsvoll zu meinem Bruder.
»Ja«, eiferte ich, »er ist immer gleich so grob.«
»Ich hab' es doch nur aus Versehen getan«, verteidigte sich der Bruder wieder.
»Gut, so will ich dir diesmal verzeihen«, sagte sie freundlich und gab ihm die Hand.