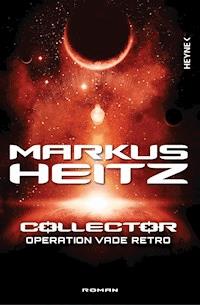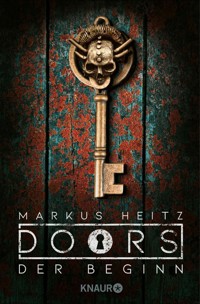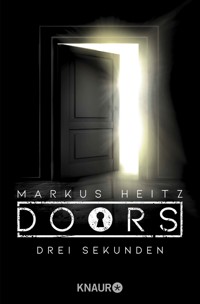14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein episches Dark-Fantasy-Abenteuer voller Geheimnisse und Gefahren! Seit vor 150 Jahren der Wald in Yarkin begonnen hat, sich unaufhaltsam auszubreiten, wurden die Menschen immer weiter zurückgedrängt. Die letzten Überlebenden finden sich auf einer Halbinsel wieder, umgeben von der unheimlichen Bedrohung. Zahlreiche Expeditionen wurden ausgesandt, um ein Mittel gegen das Vordringen der Bäume zu finden – doch keine kehrte zurück. Bis die Kriegerin Adima auf Kalena trifft, die Unglaubliches berichtet: von einer verborgenen Siedlung mitten im Wald, einem grausamen Überfall und einer Verschwörung unter den Menschen. Kalena bittet Adima um Hilfe, die Wahrheit aufzudecken. Doch kann die Kriegerin ihr wirklich vertrauen? In Die Klinge des Schicksals entführt Bestsellerautor Markus Heitz die Leser in eine düstere Welt voller Rätsel und tödlicher Gefahren. Ein atemberaubender Dark-Fantasy-Roman, der von der ersten bis zur letzten Seite fesselt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 829
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Markus Heitz
Die Klinge des Schicksals
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die gealterte Kriegerin Danèstra ist in ihrer Heimat Nankān eine lebende Legende. In unzähligen Schlachten hat sie Siege errungen und so den Beinamen »Die Klinge des Schicksals« erhalten. Doch als sie die geheimnisvolle Kalenia vor dem sicheren Tod bewahrt
und die Geschichte der jungen Frau erfährt, muss sich Danèstra ihrer bislang größten Aufgabe stellen.
Nichts weniger als das Überleben von Nankān steht auf dem Spiel, und Kalenia scheint der Schlüssel zur Rettung des ganzen Kontinents zu sein. Doch kann Danèstra ihr wirklich trauen?
Inhaltsübersicht
Widmung
Dramatis Personae
Begriffe
Einheiten
Auftakt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Nachklang
Nachwort
Den gealterten Heldinnen und Helden, ganz gleich ob in der Fiktion oder im realen Leben
Dramatis Personae
Airndt Hütts: Kommandant
Ansiwa, Dhouza, Nushira: Danèstras Töchter
Aphkenios: Hauptmann der Leibwache
Arbos Nachtschwarz: Spurenleser
Bhratigäion Tolbar: König von Nord-Lygäion
Caerg Bladsteen: Söldner
Calostro: Zauberer
Chunar: Söldner
Danèstara »Danèstra« Adima Decessa von Tiamin: Abenteuerin, Großfürstin und Erz-Königin von Uthalosa
Eraia: Magd
Ewina: Wäscherin
Fannia: Matrosin
Haneria: Bootsfrau
Heersen Kronbloim: Pflanzenkenner
Horneus: König von Taucora
Ilreen Klingrod: Spurenleserin
Iradias Bai: Krieger und Windbüchsenschütze
Isona: Sklavenmädchen
Kaalbrok Castha, Tirmin Eckelbrecht, Dreas Arbstein: Reisende
Kalenia: Köhlerstochter
Korava: Königin von Taucora
Lasaris: Söldnerin
Lers Hütts: Soldat
Lygos Tolbar: Prinz von Nord-Lygäion
Mabian: Danèstras Sohn
Mahetian Tintenfain: Schriftsteller und Buchdrucker
Motberth: Baron und Abgeordneter Kerkorias
Nymaina Sôol: Ingenia
Orphema: Gestaltwandlerin
Ovinia: Wanderin
Perdis: Priesterin von Thýain, Thýguda und Ansis
Quent »Räblein« Rabenhorst: Calostros Faktotum
Rouva: Rouvinias Tochter
Rouvinia: Magd und Händlerin
Sbinea: Abgeordnete von Siwenloith
Shantala von Maaredin: Fremdenführerin
Skerbull Schwarz: Universalgelehrter und Kämpfer
Slahan: Trumer (Kriegstrumer)
Sysca Râal: Ingenia
Tatesby: Sargmacher, Totengräber
Tauror Grauhorn: Stierzüchter
Tlindaro Sonn: Kartograf aus Athosa
Wartho: Schmied
Wilto T. C. L. von Rauhwasser: Baron und Lebemann
Vytain Dôol: Electorum-Büchsen-Schütze
Begriffe
Aggregata: Maschine, die Electorum erzeugen kann und unter Umständen damit arbeitet
Architectus/Architecta: Baumeister/-in
Augenfresser: großer Vogel
Battaria: Steine, die Electorum speichern. Die Form ist variabel.
Doctoro : Heiler in Izozath
Electorum: Energie, wie sie in Blitzen vorkommt
Electorum-Waffen: Schusswaffen, die mit Electorum angetrieben werden. Es gibt Pistola, Büchse, Stutzen und kleinere Vorrichtungen zur Montage an beliebiger Stelle. Hohe Reichweite, enorme Durchschlagskraft; mitunter sind sie laut. Darüber hinaus existieren Geschütze verschiedenen Kalibers.
Exponatorium: Ausstellung
Feldweibel: Rang
Infusio: Lösung, die in die Adern verabreicht wird
Ingenius/Ingenia: Technikkenner/-in in Izozath
Khitaylon: legendäres Seeungeheuer
Kufucka: hässliches Schimpfwort
Machina: Maschine, die mit Electorum betrieben wird
Machinisto/Machinista: Ingenius/Ingenia in Marwarod
Mamscha: verniedlichend für Mutter
Nebelaffe: fleischfressender Affe
Ordal: Gottesentscheid durch einen Kampf
Skamata: Riesenseeschlange
Srill: affenähnliches Wesen in Treydania
Treyd/-a: naturkundiger Zauberer/naturkundige Zauberin
Trumer/-in: Zauberer/Zauberin. Sie weben ihre Bannsprüche mit dem Trommelspiel nach exaktem Takt.
Windbüchse: Schusswaffen, die mit Luftdruck angetrieben werden. Es gibt Pistola, Büchse, Stutzen und kleinere Vorrichtungen zur Montage an beliebiger Stelle.
Einheiten
Feldmeile: eintausend Schritt
Gemeinjahr: dreißig Monate
Mond: vier Wochen
Seemeile: eintausendzweihundert Schritt
Auftakt
Kontinent Yarkin, Freie Grafschaft Molgand, nahe der Stadt Molgandskron im Nordwesten, vor langer Zeit in einem Spätsommer
Nahezu die ganze Stadt Molgandskron hatte die Mauern verlassen, um mit weiteren Hunderten Besuchern in einer munteren Prozession lachend, scherzend und singend hinter dem Karren mit dem Verurteilten herzuziehen. Es war ein Volksfest sondergleichen und eine Seltenheit obendrein.
Marktschreier mit Bauchläden umrundeten die Menschenmenge. Es wurden Süßwaren und Deftiges angeboten, manche hatten sich Bierfässchen auf den Rücken geschnallt und verkauften das Gebräu an die durstigen Kunden, die sich den Trunk in ihre Trinkbeutel oder Behältnisse schäumen ließen.
Die Hinrichtung eines Zauberers geschah nicht alle Tage auf Yarkin, schon gar nicht mit derlei Tamtam und Bohei, angefangen bei einer öffentlichen Anhörung und Gerichtssitzung über das Austreiben seiner magischen Kräfte bis hin zum Erscheinen von einem Dutzend Vertretern der Magischen Schulen des Kontinents. Sie wohnten dem Spektakel als Zeugen und als Aufpasser bei, falls der Verurteilte trotz der peinvollen Prozedur einen Rest seines Könnens behalten hatte und sich vor dem Tod rächen wollte.
»Sind wir bald da?« Die achtjährige Rouva hing am Rockzipfel ihrer Mutter und ging mit ihr am hinteren linken Rand der riesigen Wandergruppe, die sich durch den lichten Eichenwald bewegte. Die Straße reichte bei Weitem nicht aus, die vielen Menschen zu fassen.
»Aber gewiss.« Rouvinia nahm ihre Tochter auf den Arm und zeigte über die Köpfe hinweg zur kleinen Lichtung zwischen den Vier Hainen, wo sich der Galgenbaum befand. »Siehst du? Es sind keine hundert Schritt mehr.«
Rouva hielt Ausschau und sah die mächtige Eiche, in und um deren Stamm sich eine Birke, eine Trauerweide und eine Tanne gewunden hatten. Aufgrund dieser Besonderheit kam dem viererlei Baum die Aufgabe zu, als Hinrichtungsort zwischen den Wäldern zu dienen.
Die verrotteten Überreste von Delinquentinnen und Delinquenten hingen an Stricken und Ketten von den Ästen; andere wurden von Stahlkäfigen über den Tod hinaus gefangen gehalten, als fürchtete man deren Rückkehr als Wiedergänger.
»Gut. Ich bin nämlich müde.« Rouva war es gewohnt, bei Hinrichtungen zugegen zu sein, weil ihre Mutter großen Spaß daran hatte, wenn der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Von daher war das Mädchen mit dem Anblick von Gehenkten, Erschlagenen und Geköpften vertraut, zumal Rouvinia ihr Geld damit verdiente, den Hingerichteten Gliedmaßen abzuschneiden und sie anschließend als Glücksbringer zu verkaufen. Rouva musste in der Zeit Schmiere stehen, denn erlaubt war das Verstümmeln nicht. Sie fand es gruselig, aber nicht schlimm. Ihre Geschwister und sogar ihr Vater weigerten sich, dieses morbide Geschäft zu unterstützen, mit dem sie einen nicht unwesentlichen Teil des Lebensunterhalts bestritten. Als Tagelöhnerfamilie lebten sie von der Hand in den Mund.
»Was hast du denn den ganzen Tag gemacht, dass du jetzt müde bist?« Ihre Mutter küsste Rouva auf die Nasenspitze. »Sagte ich dir nicht, du sollst im Haus bleiben und deinen Brüdern beim Ausstanzen helfen? Du weißt, dass Schneider Riks die Knöpfe braucht.«
»Das war ich doch, Mamscha. Ich habe außerdem aufgeräumt und für die alte Grandina geputzt, danach war ich für den tattrigen Petreris im Stall und habe die Eier eingesammelt.« Rouva langte in die Tasche und präsentierte zwei Kupfermünzen. »Was kriege ich denn dafür?«
»Ist das dein Lohn?«
»Ja.«
»Nicht schlecht. Hilfst du mir nachher auch?«
Das Kind nickte.
»Wir werden uns sputen müssen, um was von dem Magier zu bekommen. Ein Zeh wäre gut. Ich habe aber schon drei, vier Glücksbringerhändler gesehen, die es auf den Leichnam abgesehen haben wie wir. Ich hoffe, der Henker hält sich an unsere Abmachung.«
»Darf ich danach in den Wald spielen gehen, Mamscha?«
»Nein. Dann wird es dunkel sein, und es kommen die Nebelwölfe und die Wasserfeen aus dem Auwald und fressen kleine Kinder wie dich«, sagte Rouvinia mit gesenkter Stimme und machte eine Fratze, dann knurrte sie und küsste den Hals ihrer Tochter so schnell hintereinander, dass es Rouva kitzelte und sie lachen musste.
»Mamscha! Hör auf, Mamscha! Ich mache mir sonst in die Hose!« Sie japste und zappelte, um den zärtlichen Attacken zu entkommen. »Lass mich runter!«
Rouvinia lachte und setzte ihre Tochter auf den Boden. »Wir werden wirklich keine Zeit haben. Ich weiß, wie gerne du in den Wäldern spielst, aber heute wird es nicht gehen. Ein anderes Mal.«
Rouva nickte artig. Auch wenn es ihre Mutter nicht billigte, wie viele Stunden sie in den Vier Hainen verbrachte, sie musste immer wieder ausbüxen und sich zwischen den Stämmen herumtreiben, um die schönsten Pilze, die prächtigsten Beeren, fettesten Frösche und schmackhaftesten Moose mit nach Hause zu bringen, die sie auf dem Markt verkauften. Das versöhnte Rouvinia mit dem unaufhörlichen Ungehorsam, zumal dies der einzige Makel ihrer Tochter war.
»So. Geschafft«, bemerkte Rouvinia. Sie waren mit der Menge bis an den Rand der Lichtung gelangt, die nicht alle Menschen aufnehmen konnte. Aus den vier Himmelsrichtungen wuchsen je ein Eichen-, Birken- und Tannenhain sowie ein Auwald aufeinander zu, und mitten auf der gemeinsamen Grenze erhob sich der Galgenbaum, dem man übernatürliche Kräfte zuschrieb.
Rouva glaubte fest daran. Wie sonst hätten die vier verschiedenen Arten sich verschränken, umwinden und zu etwas Neuem verbinden können?
Das Mädchen sah zu den Kronen der umstehenden Bäume hinauf, wo sich die Zuschauer drängten; unter der Last bogen sich die dicken Zweige, und Blätter fielen herab. Krachend ging ein großer Ast zusammen mit einem Dutzend Männern und Frauen zu Boden, das Geschrei der Gestürzten wurde vom Gelächter der Zuschauer abgelöst.
Dann erklang mehrmals eine Glocke, bis die Ansammlung leiser wurde und die Bauchladenverkäufer mit dem anpreisenden Gebrüll aufhörten.
»Bürgerinnen und Bürger von Molgandskron«, verkündete der Gerichtsdiener, den Rouva nicht sah, weil eine Wand aus Rücken ihr die Sicht raubte. »Werte Räte, werte Geheimräte und Kammerabgesandte, Ihr Hochwohlgeborenen Grafen von und zu Molgandskron«, ging die Begrüßung weiter, während sich der Lärmpegel mehr und mehr verringerte.
Rouva zupfte an Rouvinias Rock. »Mamscha, ich muss wirklich mal.«
»Dann geh und komm rasch wieder«, sagte ihre Mutter. »Präge dir die Kräheneiche zu meiner Linken ein, damit du mich wiederfindest. Und wenn nicht: Wir sehen uns nach der Hinrichtung bei dem Toten, verstanden?«
»Ist gut, Mamscha.« Rouva eilte los. Sie schob ihren dünnen Körper geschickt zwischen den eng stehenden Männern und Frauen hindurch, um die voll besetzte Lichtung zu verlassen. Manche Leute hatten sich kleine Trittleitern und Eimer mitgebracht, um sich daraufzustellen und besser sehen zu können.
Rouva musste nicht weit in den sumpfigen Auwald laufen, bis sie niemand mehr beim Verrichten ihrer Notdurft beobachten konnte. Die meisten Molgandskroner mieden diesen Teil der Vier Haine, da er ihnen am unheimlichsten von allen erschien.
Rouva hingegen war er der liebste.
Überall gab es verborgene Wasseradern, auf denen man Blattboote fahren lassen konnte, dann spuckten Sumpf und Moor gelegentlich kleine Geschenke aus, wie alte Knochen und Holzstücke, schwarz gefärbt und verbogen, aus denen man die absonderlichsten Schnitzarbeiten zu fertigen vermochte, die angeblich in Vollmondnächten sangen und tanzten.
Und nicht zu vergessen: der Nebel. Ein ganz besonderer Nebel.
Mal milchig, mal dicht wie Schneetreiben, mal schleierdurchsichtig verzauberte er die Umgebung. Aus Baumstümpfen machte er Fabelwesen, aus Farn die Krallen einer Bestie, die sich aus dem Moor zog, und aus Ranken dünne, tödliche Schlangen.
Rouva hatte geflunkert, was das Pinkeln anging. Sie verspürte einfach keinerlei Lust, der Hinrichtung beizuwohnen. Sie ging einige Schritte und atmete den Duft des Waldes ein, hörte das Blubbern im Wasser und das Rauschen des Schilfs. »Wie wunderschön du bist, mein Hain«, sagte sie und lehnte sich an den Stamm einer mächtigen Trauerweide. Die Natur war ihr wohlgesonnen, und anders als in jenen Teilen von Yarkin, die sich durch das Wirken dämonischer Mächte gewandelt hatten und von denen man ängstlich berichtete. Rouva fühlte sich hier vollkommen sicher.
Der Gerichtsdiener sprach noch immer, gelegentlich unterbrach ihn die Menge mit Beifall oder zustimmendem Rufen. Leise und wie aus großer Entfernung drang seine Stimme durch den Auwald. Er zählte auf, was der Verurteilte Schändliches getan und wie er sich verbotenerweise Geld durch Flüche angeeignet hatte. Keinem Zauberkundigen war es gestattet, seinen Mitmenschen ein Leid zuzufügen, abgesehen von Schurken und Verbrechern, derer man sich entledigen wollte.
Rouva hörte, wie der Gerichtsdiener den hundertsten nachgewiesenen Fall verlas, bei dem einer stillenden Frau die Milch in den Brüsten versiegte und ihr Neugeborenes elendig verhungern musste. »Aufgrund der Niedertracht soll der Verurteilte gehenkt werden wie ein gemeiner Verbrecher und nicht ehrenvoll hingerichtet wie ein Zauberer, der er einst gewesen war«, kam der Mann allmählich zum Ende.
Rouva hörte nicht weiter zu.
Sie hatte rätselhaft aufsteigenden Bodennebel entdeckt, aus dem sich die Konturen einer Frau erhoben, die das Mädchen zu sich winkte. Deswegen liebte Rouva den Auwald: Er wurde niemals langweilig.
Neugierig stieg sie über umgestürzte Bäume und zwängte sich durch die ausladenden Blätter des mannsgroßen Taufarns, der sich bei ihren flüchtigen Berührungen raschelnd zusammenrollte.
Der Bodennebel reichte ihr bis an die Hüfte und ließ den Untergrund verschwinden. Es schien ihr, als wäre sie in Wolken gefangen, die sich verflogen hatten.
Rouva kam der Nebelgestalt rasch näher. »Wer bist du?«, fragte sie unerschrocken.
Die Gespinstfrau legte einen Finger an die Lippen und vollführte eine Handbewegung.
Daraufhin erwuchsen drei weitere Gestalten aus dem wabernden Weiß, die sich rings um Rouva erhoben.
»Seid ihr Wasserfeen? Was möchtet ihr von mir?« Sie blieb ohne Furcht und studierte die Züge der Umstehenden.
»Oh, wir kennen dich, kleine Rouva«, sagte die Nebelfrau. »Du bist uns ans Herz gewachsen.«
»Du bist dem Wald ans Herz gewachsen«, fügte eine zweite Gestalt freundlich an. »Die Vier Haine mögen dich, weil du uns magst, Liebes.«
»Deswegen haben wir dich zu den besten Plätzen geführt, um dich Pilze, Beeren und derlei mehr finden zu lassen«, setzte eine dritte hinzu. »Nie hast du dem Wald Schaden zugefügt. Und du hast uns Lieder vorgesungen. So viele schöne Lieder, mein Kind.«
»Das vergessen wir dir nicht«, sprach die vierte.
Die Nebelfrau beugte sich nach vorn. »Wir sind die Vier Haine.« Die gespinstigen Finger streichelten Rouvas Gesicht, und es fühlte sich an wie eine Berührung von kühlem Dampf. »Und wir sind dir erschienen, um dir ein Angebot zu unterbreiten, liebe Rouva.«
»Verrecken sollt ihr!«, gellte die Stimme des Verurteilten durch den Auwald. »Ihr habt kein Recht, über mich zu urteilen! Ich werfe einen magischen Fluch über euch! Über euch alle, die ihr gekommen seid, um euch an meinem Tod zu ergötzen.«
Rouva erschrak. »Mamscha!« Sie wollte los, um nach ihrer Mutter zu sehen. Die Gespinstgestalten stellten sich ihr in den Weg. Der Farn rollte sich aus und wurde zu einer weichen, grünen Mauer, die Ranken schlangen sich zärtlich, aber fest um die Knöchel des Mädchens.
»Nein, meine Liebe«, sagte die Nebelfrau gütig. »Es ist zu spät. Die Menschen, die sich in den Vier Hainen befinden, sind dem Untergang geweiht.«
Rouva wollte den Farn beiseiteschieben, doch die Blätter hielten ihren Fingern stand. Die Ranken lagen wie Seile um ihre Knöchel und bannten sie. »Mamscha!«, schrie sie aus Leibeskräften. »Lauf! Der Zauberer wird dich sonst umbringen.« Dann sah sie die Nebelfrau an. »Kannst du sie retten? Bitte! Du musst sie retten!«
»Es tut uns leid«, erwiderte sie. »Alle werden sterben.«
Rouva schossen die Tränen in die Augen, heiße Tropfen rannen über die Wangen und fielen in den Nebel. »Mamscha!«, rief sie erneut und voller Verzweiflung. Sie riss ihr kleines Messer aus der Gürtelhalterung und schnitt die Ranken ab, rannte vorwärts und stach gegen die Farnblätter, die sich raschelnd zurückzogen. »Mamscha, lauf weg! Lauf!«
Der Nebel folgte ihr rechts und links zwischen den Stämmen, als hätte er Spaß an ihrem Wettlauf. Dann erklang ein Krachen und Knacken im Auwald. Unerwartet erhoben sich Bäume aus dem feuchten Untergrund und wuchsen binnen weniger Herzschläge vom Schössling zur fertigen Pflanze. Immer wieder musste Rouva den abrupten Hindernissen ausweichen. Nasse Erde regnete auf sie nieder und beeinträchtigte ihre Sicht, mehrmals stolperte sie und landete auf dem weichen, aufgewühlten Boden.
Keuchend erreichte Rouva das Ende des Dickichts und stürmte aus dem Unterholz auf den Rand der Lichtung, die sich deutlich geleert hatte. Sie strauchelte und fiel.
»Sagte ich es nicht? Da habt ihr meine Rache!«, rief der Verurteilte mit einem Strick um dem Hals über die Köpfe hinweg und lachte schallend vom Karren herab, auf dem er stand. Die Skelette und sterblichen Überreste am Galgenbaum pendelten im aufkommenden Wind und führten einen bizarren, makabren Tanz auf.
Die Menschen flohen derweil in Scharen aus Furcht vor dem Fluch des Verurteilten, um seiner schädlichen Magie zu entgehen. Die Bauchläden lagen achtlos umher, die Inhalte verstreut und teils zertrampelt; nach den Münzen bückte sich keiner. Die Wachen, die vom Grafen aufgestellt worden waren, wurden von der Flut an Leibern hinweggespült und drangen nicht zu dem Zauberer durch, um ihn zum Schweigen zu bringen. Die Armbrüste, Windbüchsen und Pistolas hatten kein freies Schussfeld.
»Bleib, wo du bist, Liebes«, hörte Rouva die Nebelfrau warnend neben sich sagen. »Sonst wird es dein Tod sein.«
Aus dem Boden gruben sich vermoderte, deformierte Krieger, die schauderhaft anzuschauen waren, und schwangen ihre rostigen Schwerter wider die übrig gebliebenen Gardisten und Bewaffneten. Adlige und einfache Leute kämpften Seite an Seite gegen die gerüsteten Untoten, von denen mehr und mehr aus der Lichtungserde stiegen. Vier der Magier, die zum Schutz der Bewohner erschienen waren, lagen bereits tot auf dem Boden, von den anderen fehlte jede Spur.
»Das sind Alraunen-Krieger«, erklärte ein Gespinstmann. »Nichts wird sie aufhalten. Man kann sie in kleine Fetzen schlagen, und dennoch trachtet jedes Fitzelchen von ihnen danach, die Menschen zu töten.«
Rouva wollte trotzdem auf die Lichtung, sie musste nach ihrer Mamscha schauen! Doch erneut hatten sich Ranken um ihre Beine geschlungen und verhinderten ein Weiterkommen.
»Ihr wolltet mich tot sehen«, schrie der Verurteilte triumphierend vom Karren herab. »Ihr beschissenen Narren und Kleingeister! Da habt ihr euch mit dem Falschen angelegt!« Er zog seinen Kopf aus der Schlinge und rief weitere magische Silben, um das Unheil zu verschlimmern. »Ich bin der mächtigste Zauberer, den Yarkin gesehen hat! Ihr werdet allesamt sterben!«
»Könnt ihr ihn nicht aufhalten?«, flehte Rouva und suchte nach ihrer Mutter. Dann erkannte sie ihren regungslosen Leib neben der Kräheneiche. »Mamscha!«, schrie sie und grub die kleinen Hände in die Erde.
»Sie ist tot, Liebes. Man hat sie niedergetrampelt«, befand die Nebelfrau bedauernd. »Keiner nahm Rücksicht auf sie, als sie stürzte. Umgebracht von ihrer eigenen Art.«
Rouvas Blick wurde von fließenden Tränen verschleiert, sodass sie das Geschehen auf der Lichtung kaum mehr sah. Gestalten schlugen und hackten aufeinander ein, Männer schrien, Waffen und Rüstungen schepperten, Windbüchsen pfiffen ihre Kugeln umher. Einige fehlgezielte Geschosse prasselten ins Unterholz und trennten Blätter ab.
»Steh auf, Kleines«, vernahm Rouva die freundliche Stimme. »Steh auf und habe nun keine Angst mehr. Es wird dir nichts geschehen, solange wir bei dir sind.«
Sie erhob sich und wischte sich die Feuchtigkeit mit dem Ärmel vom Gesicht, schniefte und blickte sich um.
Die Alraunen-Krieger hatten jeden Feind abgeschlachtet. Der Graf und seine Familie, die Räte von Molgandskron, selbst die Gardisten lagen niedergestreckt rings um den Galgenbaum.
»Keiner der Menschen stand deiner Mamscha bei«, wisperte einer der Gespinstmänner und streichelte Rouva mit seinen kühlen Wolkenfingern. »Wir bestraften sie dafür. War das in deinem Sinn?«
Sie atmete scharf ein, als sie die Toten in den Bäumen rings um sich erkannte.
Ranken hatten sich um die Hälse von Männern und Frauen geschlungen. Wie falsch gewachsene Früchte baumelten sie zu Hunderten und Aberhunderten an den Ästen der Birken, Eichen, Tannen und den Weiden des Auwaldes. Einige zuckten noch im Todeskampf und versuchten mit aufgescheuerten, blutigen Händen die Schlingen um ihre Hälse zu lösen; woanders wurden Flüchtende von Ranken gepackt und in die Höhe gezogen, wo sie mit hochroten, violetten Köpfen hingen und die Zungen würgend herausstreckten, um irgendwie an Luft zu gelangen.
Rouva gönnte ihnen den Tod.
Jedem Einzelnen.
Weil sie nichts getan hatten, um ihre Mamscha zu retten, sondern sie niedergetrampelt hatten wie ein Insekt, einen hilflosen Käfer auf dem Rücken. Der Gespinstmann sprach die Wahrheit. Es hätte kaum Mühe gekostet, stehen zu bleiben und eine Hand auszustrecken und ihr aufzuhelfen, damit sie gemeinsam mit den Übrigen dem Fluch entkommen konnte.
Nun war ihre geliebte Mutter tot.
Innerlich vereiste Rouva. Sie hörte auf, vor Schrecken zu zittern. Es gab nur Wut und Hass auf die Bewohner aus Molgandskron. Mit jedem Hieb, den die Alraunen-Krieger gegen die niedergestreckten Verletzten führten, verbreiterte sich das Lächeln auf ihren Lippen.
»Bleib bei uns, du armes Liebes«, sprach die Nebelfrau. »Mit den niederträchtigen Menschen außerhalb des Waldes hast du nichts mehr zu schaffen. Fortan sei ein Teil der Vier Haine.«
Vor Rouvas staunenden Augen stapften magische Kreaturen auf die Lichtung. Tiere und tierähnliche Wesen streiften umher und suchten nach Überlebenden, um sie zu töten, während die zu Hunderten gehenkten Einwohner und Besucher Molgandskrons an natürlichen Seilen von den Bäumen baumelten.
»Du gehörst zu uns. Das gehörtest du schon immer, kleine Rouva.«
Nebel floss aus dem Auwald und bedeckte das Morden sowie die umherliegenden Leichen mit weißem Schleier. Weitere Stämme schossen aus der Erde und wuchsen in den Himmel. Die Wesen verschwanden in dem wuchernden Dickicht. Der Galgenbaum wurde umschlossen von neuen Bäumen; Farn und Gebüsch sprossen hervor und machten aus der Lichtung einen dichten Wald, der ohne das Wissen um das Geschehene harmlos wirkte.
»Ich ahnte es immer.« Rouva mochte den Anblick. Und sie mochte die Wesen, denen sie vertraute. Weder Angst noch Furcht bemächtigten sich ihrer. »Seit ich laufen und denken kann.«
Unvermittelt erklang ein lautes Rumpeln und Krachen, gefolgt von dem Tönen der Alarmglocke, die in der Stadt geschlagen wurde.
Rouva warf einen verwunderten Blick den Weg entlang nach Molgandskron. Dort stemmten sich Eichen, Birken, Nadelbäume und Trauerweiden aus dem Boden, sprengten die Mauern und die gepflasterten Straßen und Plätze. Eine Staub- und Rauchwolke hing über den unentwegt einstürzenden Dächern und Giebeln. Emporwachsende Baumkronen drückten die dicksten Wände und Balken beiseite. Das Rathaus und das Schloss des Grafen wurden von Ranken umschlungen, die sich strafften und zogen und nicht eher zur Ruhe kamen, bis die prächtigen Bauten einfielen.
»Nein!« Rouva verfolgte, wie der große Wachturm der Garde von gewaltigen Spinnenwesen erklommen wurde. Sie warfen die Schindeln vom Dach, spannen ihre Fäden und sprangen auf den Boden zurück. Stein um Stein wurde aus der Mauer gerissen, bis sich Risse bildeten und das letzte Bollwerk gegen die Vier Haine polternd verging.
»Meine Familie! Ihnen dürft …«
»Du bist nun eine Waise, Liebes. Lass uns deine Familie sein.«
»Eine Waise?« Sie drehte den Kopf und sah zu dem Verurteilten, der es geschafft hatte, die Fesseln zu lösen, und nun ungläubig über das Treiben starrte. »Aber seid ihr nicht durch den Zauberer heraufbeschworen? Seid ihr nicht Teil seines Fluches? Ihr werdet doch verschwinden, wenn er seine Magie nicht mehr wirkt, und ich bin wieder alleine.« Sie schluchzte auf. »Ohne Mamscha. Ohne …«
Ihr Hass war wie weggewischt, der Zorn auf die Menschen verraucht.
Rouva blickte zu den Trümmern ihrer Heimat, wo jene unter Steinen, Balken und Ziegeln erschlagen lagen, die nicht auf die Lichtung gekommen waren, um sich an der Hinrichtung zu ergötzen. Ihr Vater, die Geschwister, die alte Grandina, der tattrige Petreris, ihre Freunde und viele andere liebe Menschen, die stets ein gutes Wort oder eine Kleinigkeit als Geschenk für sie gehabt hatten.
»Ich … ich …« Rouva wich vor der Nebelfrau zurück, die ihr unvermittelt grausam und kalt erschien. »Ihr habt sie umgebracht.«
Die Gespinstgestalten blickten sie aus traurigen Gesichtern an, aber sie verteidigten sich nicht gegen den Vorwurf.
»Ihr Mörder!« Rouva ging weg von ihnen, stolperte durch den Nebel über die unsichtbaren Leichen und erreichte den Zauberer, der auf dem Karren kniete und Ausschau hielt, wohin er entkommen könnte. Er nagte an seinen Fingernägeln und hatte die triumphierende Großspurigkeit verloren.
»Du musst sie bannen!«, rief sie aufgewühlt. »Du hast sie gerufen! Du hast zugelassen, dass …« Rouva schrie vor Schreck auf, als neben ihr der alte Graf blutüberströmt aus den milchigen Schwaden auftauchte, den Dolch gezückt und die Augen vor Entsetzen aufgerissen.
»Du vermaledeiter Hexer!«, brüllte er und zog sich auf den Wagen zu dem Verurteilten. »Du wirst für deine neuerliche Tat büßen!«
»Ich war es nicht!«, rief der Zauberer und schleuderte die abgestreiften Eisenfesseln nach dem Grafen, um ihn zurückzutreiben. »Ich wollte Euch lediglich ängstigen und entkommen.«
Der Adlige wehrte die Schellen mühsam ab, sie fielen an Rouva vorbei auf den Boden. »Lüge! Wir hörten deine Flüche und Drohungen!«
»Das hier kann ich nicht gewesen sein«, beteuerte der Magier und riss ein Brett aus der Seitenverkleidung des Karrens, um sich gegen den Grafen zu verteidigen. »Meine Macht wurde mir genommen! Glaubt mir, ich habe mit dem Abschlachten nichts zu tun! Es war Theaterspielerei, mehr nicht! Ich habe keine Ahnung, woher diese Kreaturen stammen!«
Abrupt wogte der Nebel heran und brandete gegen das Gefährt. Meeresgischtgleich stiegen die Schwaden in die Höhe, um erneut die Frauengestalt zu formen.
»Er spricht die Wahrheit«, sagte sie und schwebte übergroß in der Luft.
Und plötzlich verstand Rouva. Die dämonische Macht, von der man auf Yarkin sprach, war unbemerkt bis zu ihr gelangt und hatte das friedliche Molgand gewandelt, zu einem Hort des Bösen gemacht.
Dornige Ranken wuchsen blitzschnell über die Bordwand und bohrten sich wie hakenbesetzte Pfeile durch die Rücken der Männer und traten aus der Brust wieder aus. Sie jagten mit einem Blutschwall aus den Mündern, die sich zum Schrei öffneten, und raubten ihnen die Stimme. Die Dornen fungierten wie Sägezähne, beförderten Knochenstücke und Fleischfetzen aus den Leibern.
Rouva schrie laut. Graf und Zauberer brachen tot auf dem Karren zusammen.
Im Wald wurde es still. Das Knarren und Knistern der wachsenden Natur erklang, gelegentlich huschten Schemen und Umrisse rechts und links vorüber, um zur gefallenen Stadt zu gelangen.
Die Nebelfrau wandte sich zu dem bebenden Mädchen. »Du musst dich nicht entscheiden, Liebes. Du gehörst zu uns. So ist es beschlossen«, verkündete sie freundlich. »Sei nicht traurig, kleine Waise. Du hast eine neue Familie erhalten.«
Rouva hatte es die Sprache verschlagen. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, und stand stocksteif vor der durchscheinenden Gestalt. Das Böse war heraufgezogen – und hatte gewonnen.
»Die Vier Haine gehören zu jener Macht, die sich nicht länger von den Menschen unterjochen lässt und Yarkin unterwerfen wird. Vollends unterwerfen wird. Eines Tages wirst du verstehen, Liebes.«
Die Leute, die von den Ästen hingen, wurden schlagartig von den Ranken freigegeben.
Es regnete Hunderte und wieder Hunderte Tote, die nach ihrem kurzen Sturz in der Nebelsee verschwanden. Das leise Rumpeln der unentwegt aufschlagenden Körper erschien Rouva endlos.
Kapitel I
Nankān, im Süden des Kaiserreichs Uthalosa, Rittergut Kaltensee, Spätsommer
Dumpf rauschten die Dreschflegel in rascher, strikter Folge auf die Halme, die ausgebreitet in der Sonne auf Segeltuch lagen, und schlugen die kostbaren, sattgelben Blauroggenkörner aus den Ähren. Die schwitzenden Männer in einfachen Hemden und Hosen führten die Werkzeuge im Takt des heiteren Liedes, das die Musikanten in der nahen Scheune spielten.
»Das ist die beste Getreideausbeute, die wir je hatten. Das Fest morgen wird rauschend. Jede Magd und jeder Knecht und sogar die Tagelöhner bekommen den doppelten Lohn.« Danèstara Adima Decessa von Tiamin, etwas mehr als sechzig Gemeinjahre alt und gekleidet in ein luftiges, helles Gewand, verfolgte das Tun ihrer Untergebenen vom Rücken ihres Fuchswallachs aus, der ruhig neben einem Gespann mit prall gefüllten Kornsäcken stand.
Die Mittagsluft roch nach Spreu und Strohstaub, Mauersegler schossen in gewagten Manövern über den blauen Himmel und jagten Insekten.
Aufrecht saß Danèstra im Sattel, eine Hand locker auf den Oberschenkel gelegt. Auf ihren geflochtenen langen Silberhaaren saß ein breitkrempiger Strohhut, der sie vor den Strahlen des Himmelsgestirns schützte. Mit stahlblauen Augen und Freude auf den Zügen verfolgte sie das rege Treiben nahe dem Gehöft, das ihr der Kaiser geschenkt hatte. Vordergründig wegen der großen Verdienste.
»Ich sehe das ebenso, Mutter«, sagte ihr Sohn Mabian vom Wagen aus. Man sah ihm seine sechzehn Gemeinjahre nicht an; die meisten schätzten ihn auf gerade einmal vierzehn, der Bart wuchs spärlich und einzelhaarweise. Er kletterte flink über die Säcke, auf denen das Monogramm ihrer Familie prangte, und hielt eine Kladde sowie einen Griffel in der Rechten. Ihm oblag die Kontrolle der Ernte, was er seit seinem zehnten Geburtstag gewissenhafter als jeder sonst auf dem Gut tat.
Danèstra war stolz auf ihn. »Was ist bislang eingefahren, Lieblingssohn?«
Mabian grinste. »Da ich dein einziger Sohn bin, ist das ein schwaches Kompliment.«
»Besser als Sohn oder Nesthäkchen«, gab sie lächelnd zurück, und die vielen feinen Fältchen schlossen sich zu tieferen zusammen. »Deine drei Schwestern würden mir zustimmen.«
Mabian, der ebenfalls einen großen Hut auf den schwarzen Haaren trug, setzte sich auf einen Sack wie auf einen Thron und schlug das Buch auf. Leise murmelnd rechnete er. »Das macht mit Blauroggen, Goldgerste, Erdweizen und Hafer gut zwanzigtausend Doppelzentner. Dann kommen im Herbst noch mal viertausend Doppelzentner Erdäpfel dazu, wenn uns keine Käfer oder Krautkrankheit dazwischenkommen.« Er sah zufrieden von seinen penibel geführten Notizen in der Erntekladde auf. »Die Apfelbäume werden uns fassweise Viez bescheren. Den Most und Birnenwein nicht mit eingerechnet. Und unsere Reben. Die Keller werden nicht ausreichen, die Kisten, Säcke und Fässer zu lagern.«
»Ich lasse umgehend welche ausheben. Nichts soll verschwendet werden, was die Natur und Deiwos der Fruchtbare uns gaben. Das bedeutet ein weiteres rauschendes Fest für die Helfer. Es muss auch solche Gemeinjahre geben. Deiwos sei Lob und Dank.« Danèstra entdeckte etwas, das sich in gemächlicher Geschwindigkeit die breite Straße zwischen den abgeernteten Feldern auf sie zubewegte und eine Staubfahne hinter sich herschleppte, die vom leichten Wind in die Höhe getrieben wurde. Sie zog das Fernglas aus der Hüfthalterung und setzte es vor die Augen.
»Irgendwas Ungewöhnliches?« Mabian folgte ihren Blicken und schirmte die Hand gegen die Helligkeit des Taggestirns ab. »Räuber! Zu den Waffen!« Einen Herzschlag darauf lachte er über seinen eigenen Scherz. Niemand in Uthalosa und dem angrenzenden Reich wagte es, sich gegen das legendäre Rittergut zu wenden und damit den Zorn seiner Herrin auf sich zu ziehen, mochten die Aussichten auf fette Beute noch so hoch sein. »Ich weiß, es ist der Versorgungstross für den Kaiser, Mutter.«
Danèstra nickte kaum merklich. »Er ist größer als sonst. Ich zähle elf Gespanne, die nach Khamado hinaufwollen.« Sie schwenkte das Glas die Straße entlang, die steil ansteigend ins Gebirge und in engen Serpentinen zum schmalen Höhenpass führte. Seitdem ein Großteil von Uthalosa erobert worden war, befand sich der Herrscher in der sicheren Enklave, mehr als sechs Feldmeilen über dem Erdboden in seiner Residenz, wo ihn die Mörder aus Elayion nicht erreichten. Zum einen bildete die dünne Luft einen natürlichen Schutz gegen jene, die die Höhe nicht gewohnt waren, zum anderen lebten in dem Gebiet über zweitausend Schritt die mysteriösen Spheng, die niemanden passieren ließen. Außer den Kaiser und seine Getreuen.
Über den Gebirgsrücken, der wie ein sechs Feldmeilen senkrecht aufragender Grat durch das feindliche Elayion führte, und den Pass wurde Khamado mit Vorräten versorgt und am Leben gehalten.
»Sie sind zeitig dran. Und schwer beladen.« Danèstra steckte das Fernglas weg. »Ist dir etwas zu Ohren gekommen, was erklärt, warum sie die Versorgung vorziehen?«
»Nein, Mutter.« Mabian schwang sich auf den Kutschbock und ergriff die Zügel, mit denen die beiden Ochsen dirigiert wurden. »Denkst du, es hat mit dem Wald zu tun?«
»Hätten wir nicht längst erfahren, wenn er vorrücken würde?«
»Der Kaiser wird bessere Augen und Ohren im Irrsal haben als wir. Denen entgeht gewiss nichts, was sich an der Westgrenze tut.«
Danèstra fühlte leichte Sorge in sich aufsteigen. »Wie lange hatten wir Ruhe? Ich vergesse es stets.«
»Weil du alt bist, Mutter«, erwiderte Mabian frech.
»Sagt der Jungspund, den ich im Wettlauf abhänge«, gab sie gelassen zurück. »Ohne Pferd.«
»Verzeih meine Frotzelei. Ich konnte nicht widerstehen.« Mabian sah zu den dahinschießenden Mauerseglern. »Seit ich auf der Welt bin, rührte sich die Wildnis nicht und hat das Irrsal seine Ruhe.«
»Stimmt. Mindestens seit deiner Geburt. Ich sollte es mir leicht merken können.« Danèstra stieß die Luft aus. »Na gut. Nehmen wir an, sie sind einfach nur früher dran, weil die Menschen in Khamado mehr als üblich gegessen haben und nun weinend vor ihren leeren Tellern sitzen.«
Mabian löste die Bremse des Wagens. »Die Scheune ist bereits voll mit Säcken. Wohin soll ich den Blauroggen bringen? Zum Gut?«
»Einstweilen. Wir stellen in zwei Tagen mehrere Gespanne mit Getreide zusammen und bringen es auf den Großmarkt nach Burgstein. Wir verkaufen es an die Geldsäcke aus Orillon. Das bringt uns mehr Münzen.« Danèstra wendete den Fuchswallach und ritt langsam auf die Scheune und die schuftenden Männer zu. »Behalte genug Weizen zurück, um ihn den Arbeiterinnen und Arbeitern zu schenken. Damit sollten sie genug für den Winter haben.«
»Ja, Mutter.« Mabian ließ die Zügel knallen, und die Ochsen stapften los. »Bis später.«
Danèstra näherte sich den Dreschern, die wuchtig zuschlugen, sodass die blauen Körner auf die Plane sprangen. Dann sah sie wieder zu dem Tross nach Khamado, der die dicken Mauern des Hofes passiert hatte und sich die erste Steigung hinaufkämpfte.
Das Rittergut Kaltensee mit dem klaren Gewässer, das dem Gehöft seinen Namen gab, lag genau am engen Zugang, der zum Pass und Berggrat führte. Das Geschenk des Kaisers, um das sich mitunter düstere Geschichten rankten, war ihr mit Bedacht und Berechnung gemacht worden. Danèstra und ihre Kinder dienten als Schutz gegen Elayion. Niemand legte sich mit dem Geschlecht derer von Tiamin an. Nicht einmal das fanatische Priesterpaar im Nachbarreich.
»Die Herrin!«, erklang der Ruf, als Danèstra auf drei Schritt heran war.
Die Arbeiten wurden sogleich unterbrochen. Die Knechte und Tagelöhner zogen die Kappen ab, die Mägde machten einen tiefen Knicks. Die Musikanten in der Scheune hatten nichts mitbekommen und spielten weiterhin auf.
Danèstra lächelte ihnen zu, aufrecht im Sattel, als wäre sie gerade zwanzig. Ihre Ausstrahlung übertraf die eines jeden, ihr Auftritt wirkte stets königlich. Das erzeugte Ehrfurcht, ganz gleich, ob man ihr zum ersten oder wiederholten Male begegnete.
»Ihr habt bislang gut gedroschen und gesiebt«, sprach sie laut. »Wenn die letzten Wagen die gebundenen Ähren abgeladen haben und das Tagwerk getan ist, darf, nein, muss gefeiert werden. Morgen wird gegessen und getrunken, was die Mägen halten und die Köpfe vertragen. Wer mich dabei unter den Tisch trinkt, dem zahle ich ein Goldstück.« Die Männer und Frauen lachten leise. »Vernehmt: Ihr bekommt nach der Sommerernte den doppelten Lohn und Getreide für einen Winter«, verkündete sie und freute sich über das ungläubige Staunen in den verschwitzten Gesichtern. »Denn was wären meine Familie und ich ohne euch, die starken und fleißigen Hände? Unser Land würde verkommen. Daher ist es nur rechtens, dass ich euch mit Geschenken bedenke. Nun drescht bis zum Abendbrot und geht morgen zeitig ans Werk. Denn am Abend soll gefeiert werden.«
Danèstra wendete den Wallach und ließ ihn antraben, um nach Kaltensee zurückzukehren.
Hinter ihr erklangen die Hochrufe der Menschen, die ihr Glück nicht fassen konnten. Wo andere ihre Leibeigenen und Tagelöhner knausrig bezahlten oder mit Prügel bedachten, gab es in Kaltensee beste Kost und Unterkunft und obendrein einen Verdienst, der in Uthalosa seinesgleichen suchte.
Danèstra ließ das Pferd in Galopp verfallen und flüsterte: »Thirío! Wettrennen.«
Wie aus dem Nichts schoss der kniehohe Rüde aus einer Mulde und hetzte mit freudigem Bellen neben dem Fuchswallach her. Mühelos hielt er die Geschwindigkeit des Pferdes. Die weißen Ornamente auf seinem schwarzen Fell bewegten sich über den kräftigen Muskeln, die blauen Augen leuchteten.
»Los, Thirío!«, spornte ihn Danèstra an. »Dieses Mal wirst du nicht gewinnen!«
Der Hund bellte auf und beschleunigte. Die Ohren legten sich an, und er schoss mit zwei Längen Vorsprung durch das offene Tor des Ritterguts.
Danèstra drosselte die Geschwindigkeit und trabte auf den belebten Hof. »Schon wieder gewonnen, Thirío. Guter Junge.«
»Und wie!« Mabian streichelte ihn, der Rüde wedelte mit dem Schwanz und hechelte vor Anstrengung. Ihr Sohn beaufsichtigte das Bedecken der Säcke mit einer Plane, damit die Körner bei Regen und Tau nicht feucht wurden. »Hat er jemals verloren, Mutter? Er ist ja fast so alt wie du.«
»Nein.« Sie hielt an und stieg aus dem Sattel. »Ich fürchte, das Pferd, das ihn schlägt, wird es niemals geben.« Die Schnelligkeit war nicht das einzig Ungewöhnliche an Thirío, aber außer ihr kannte keiner das Geheimnis des ergebenen Hundes. Seine äußere Gestalt täuschte alle anderen. Die Menschen setzten die Arbeit trotz ihrer Ankunft fort, sie hatten ihre Herrin schon früher am Tag begrüßt. Ein Knecht eilte heran und kümmerte sich um den Wallach.
Danèstra ging auf das Haupthaus zu, das zusammen mit den drei Nebengebäuden ein Quadrat mit Innenhof bildete. Das Rittergut besaß darüber hinaus einen Donjon, der als Ausguck diente oder im Fall einer Attacke die letzte Zuflucht darstellte. Sie legte großen Wert darauf, dass die Zinnen Tag und Nacht besetzt waren.
Aus der Schar der Mägde löste sich ein Mädchen von geschätzt vierzehn Gemeinjahren. Es ging schüchtern auf Danèstra zu und machte dabei unentwegt Knickse und beugte das Haupt. »Verzeiht, Herrin«, sagte sie unsicher. »Darf ich Euch ansprechen?«
Mabian kniete sich neben Thirío. »Du musst jetzt gut aufpassen«, sprach er zu ihm. »Wir werden bestens unterhalten, alter Junge.«
Danèstra ahnte, was folgte, als die Magd aus ihrer Umhängetasche bedruckte Blätter in einem Einband aus Karton nahm. Ihren Lippen entwich ein leidender Seufzer. »Mabian, erinnere mich, dass ich diesen Kerl doch umbringe.«
»Gewiss, Mutter«, gab ihr Sohn gut gelaunt zurück.
»Wie heißt der Schund dieses Mal?« Danèstra nahm das Büchlein entgegen. »Aha. Die Abenteuer von Danèstra, Band elf: Die Prüfungen des Kaisers.«
»Signiert Ihr es mir, Herrin?« Das Mädchen machte wieder einen Knicks. »Ihr seid mein Vorbild.«
Danèstra legte eine Hand auf den billigen Einband. »Kind. Nichts davon ist wahr. Dieser Kerl, Mahetian Tintenfain, dichtet mir Abenteuer an, die …« Sie blätterte das Büchlein durch. »Was? Das Fest der Lüste?« Sie starrte auf die schwülstigen Zeilen einer Liebesszene und fühlte, wie ihr Blut vor Wut schneller floss und ihr Gesicht rötete. »Nun ist’s genug! Bei Deiwos, dafür lasse ich ihn seine Tinte saufen und die Drucklettern fressen! Wie kann er …«
Mabian lachte schallend, und Thirío bellte zweimal; sein anschließendes Hecheln erinnerte an ein Grinsen.
»Herrin, verzeiht!«, rief die Magd erschrocken und trat den Rückzug an. »Ich wollte Euch nicht …«
»Du kannst nichts dafür, Kind.« Danèstra nahm den Griffel, den das Mädchen mitgebracht hatte. »Du bist Eraia, richtig?«
»Ja, Herrin.«
Danèstra schrieb den Namen auf die erste Seite, gefolgt von guten Wünschen und ihrem Monogramm. »Wenn ich dein Vorbild bin, vergiss, was darin steht. Und morgen erzähle ich dir bei unserem Fest gerne, was ich wirklich erlebte.« Sie klappte das Buch zu.
»Danke, Herrin.« Sie verneigte sich. »Danke vielmals!« Schnell entfernte sie sich und kehrte zur Gruppe der kichernden Mägde zurück.
Danèstra schnaubte und sah zu ihrem Hund. »Thirío, du elender Verräter.« Langsam trottete der schwarz-weiß befellte Rüde zu ihr, hechelte dabei, als lachte er sie aus. »Ja, ja. Kein Braten für dich.« Sie zeigte auf ihren Sohn. »Und für dich auch nicht.«
»Ich? Ich habe nichts getan!«
»Dieser vermaledeite Tintenfain und seine gemieteten Schreiberlinge! Deiwos, erschlage jeden Einzelnen von ihnen!«, sandte sie ein Stoßgebet zum klaren Himmel. »Er verdient bergeweise Münzen mit gedruckten Lügen, die er in ganz Nankān verkauft. Mit meinem Namen! Ich sollte ihn wahrlich vor den Richter zerren. Wegen Verleumdung.«
»Das Königreich Siwenloith ist weit weg. Er würde flüchten, sobald sich herumspricht, dass du kommst.« Mabian half den Knechten, das Segeltuch über den Säcken festzubinden. »Rege dich nicht auf. Es steigert deinen Ruhm. Du bist eine Legende.«
»Mit dem Fest der Lüste«, murmelte Danèstra kopfschüttelnd und stapfte zum Haus. Thirío blieb neben ihr. »Ich glaube nicht, Sohn.«
»Lieblingssohn!«
»Nein, gerade nur Sohn. Das hast du verdient, weil du mich nicht gewarnt hast.« Sie stellte sich vor, dass sie über die schmierigen Hände des Druckmeisters schritt und bohrte die Absätze ihrer Schuhe tief in den Sand. Schlimmer konnte es kaum mehr werden.
Es sei denn, der Wald würde plötzlich wieder vordringen und das Irrsal verschlingen.
Unmittelbar nach Einbruch der Nacht wurde es ruhig auf Kaltensee. Danèstra saß in hellem Kerzenschein vor dem verspiegelten Ankleidetischchen in ihrem Gemach und genoss die einkehrende Stille.
Thirío lag zusammengerollt zu ihren Füßen und träumte, seine Pfoten zuckten, und er bellte leise im Schlummer. In der großen Voliere neben dem Fenster hockte ihr abgerichteter Finsterfalke, der jede ihrer Regungen mit gelben Augen verfolgte.
Die Tiere standen versorgt in den Stallungen. Knechte, Mägde und Tagelöhner schliefen in ihren Unterkünften, erschöpft von der schweren Arbeit auf den Feldern und beim Dreschen. Ein halbes Dutzend Wachen patrouillierte auf den Wehrgängen, zwei weitere hielten vom Turm Ausschau, was sich in der Ferne tat. Es ging um Abschreckung und ein Zeichen der Stärke, wie es der Familie von Tiamin angemessen war. Immerhin trug Danèstra den Adelsrang einer Großfürstin und war Erz-Königin von Uthalosa, auch wenn es sich dabei um einen Titel auf dem Papier handelte.
Ja, der Kaiser und seine Geschenke.
Sie hatte ihren Töchtern und deren Familien, die auf dem Rittergut lebten, eine gute Nacht gewünscht und traf ihre Vorbereitungen für den Schlaf.
Seit etlichen Gemeinjahren verlief das Ritual stets gleich. Ohne Ausnahme. Sogar unmittelbar nach der Geburt ihrer Töchter und des Sohnes hatte sie darauf nicht verzichtet – überwiegend aus Selbstschutz, nachdem es zum ersten Mal passiert war. Nach alter Tradition half ihr dabei das jüngste Kind, sobald es sich mit den Handgriffen vertraut gemacht hatte. So kam es Mabian seit seinem zehnten Lebensjahr zu, sie zu unterstützen, damit sie sich beruhigt zu Bett legen konnte.
Noch ließ er auf sich warten.
Danèstra vermutete, dass er über den Kladden mit den Ernteaufzeichnungen saß und nebenher Berechnungen für das Fest anstellte, wie viele Brote, Fleisch, Wein, Bier und derlei nötig waren, um alle satt und betrunken zu bekommen.
Sie bürstete ihre langen silbernen Haare, bevor sie die Strähnen zusammenflocht und sie kunstvoll um den Kopf legte. Dabei betrachtete sie ihr bejahrtes Gesicht. »Einmal mehr«, sagte sie zu sich selbst. »Zum ungezählten Male.«
Dann erhob sich Danèstra und ging zur Kleiderpuppe, auf der das gefütterte Untergewand hing. Sie streifte es sich über und zog es zurecht; der wattierte Stoff saß eng an ihrem betagten, aber gesunden Körper. Abgesehen von äußerlichen Spuren des Leben, konnte er es mit dem einer jungen Magd aufnehmen.
Da sie keine Lust hatte, länger auf ihren Sohn zu warten, schlüpfte sie mit Anstrengung und kunstreichem Verbiegen selbst in das dünne Kettenhemd, das auf der Halterung daneben gewartet hatte.
Danèstra hatte bereits die ersten Riemen enger gezurrt und die Schnallen geschlossen, als es hastig klopfte und Mabian auf ihr Geheiß eintrat.
»Wo warst du, Sohn?«
»Verzeih, ich wurde vom Zeugmeister aufgehalten. Wegen des Festes.«
»Das dachte ich mir.« Sie wandte sich zu ihm um. »Ich habe schon angefangen. Mach die Riemen enger und danach …«
»Die Haube, ich weiß«, unterbrach er sie. »Mutter, ich tue das seit sechs Gemeinjahren.« Er nahm die Kapuze aus geflochtenen Kettenringen und legte sie ihr an. Routiniert setzte er danach den Harnisch, die Halsberge, die Oberarm- und -schenkelrüstungsschienen an. Auf jedem Teil prangte das Wappen und das Monogramm derer von Tiamin, gemacht und angepasst vom besten Waffenschmied auf Nankān. Die Rüstung behinderte weder beim Laufen noch beim Kämpfen, und die Legierung war leichter als Leder, doch beständig wie Stahl. »Denkst du, bei mir wird es auch passieren?«
»Wieso bei dir?«
»Weil meine Schwestern … weil es nicht bei ihnen geschieht. Ich … ich dachte, weil neben einer Frau vielleicht ein Mann aus unserer Familie …« Er biss sich auf die Unterlippe.
Danèstra fuhr ihm einmal mütterlich über den Schopf und zog danach die dünnen Lederhandschuhe an. »Ich weiß, dass du es dir wünschst.«
Mabian seufzte. »Es ist offensichtlich, nicht wahr?«
»Seit dem Tag, an dem du die Pflicht von deiner Schwester übernommen hast.« Danèstra prüfte ihre Beweglichkeit, drehte den Kopf. Dann ließ sie sich die Panzerhandschuhe reichen und stülpte sie über. Sie hatte schon öfter mit dem Gedanken gespielt, die Rüstung auf einen Brustharnisch zu reduzieren, aber man erwartete es, sie so zu sehen, wie man sie aus den Geschichten kannte. »Ich weiß nicht, ob Deiwos dich auserwählen wird.«
»Sicher, dass es Deiwos ist, der …«
»Wer sonst, Lieblingssohn?«, unterbrach sie ihn. »Aber ist es nicht gleich?« Danèstra öffnete und schloss die Finger, nickte zufrieden. »Es geschieht. Einerlei, wer oder was dahintersteckt.«
»Gedankenspiele sind wohl erlaubt, oder?« Mabian umrundete sie, während sie die Arme abspreizte, damit er die angelegte Rüstung inspizieren konnte. »Sollte es an meinem Vater liegen?« Er rüttelte und zerrte prüfend an den Metallteilen. Sie saßen perfekt. Wie jede Nacht.
»Ich weiß, was du eigentlich fragen willst.« Danèstra senkte die Arme und sah ihm in die Augen. »Ich werde dir nicht sagen, wer dein Vater ist. Es ist nur gerecht, da ich deinen Schwestern auch nicht offenlege, wer sie zeugte. Aber es waren stattliche, edle Männer. Wie es mir gebührt.« Sie lächelte. »Du gleichst ihm und hast seinen schnellen Verstand. Aber ein Abenteurer war er nicht, Mabian. Du musst keine Tradition wahren.«
»Doch du …«
Danèstra küsste ihn auf die Stirn. »Ich bin müde, Lieblingssohn. Disputieren wir darüber nach dem Erntefest. Einverstanden?« Schnell war das Waffengehänge mit dem kostbaren Schwert und den Dolchen angelegt, eine schmale Trinkflasche durfte nicht fehlen.
»Ja, Mutter.«
Sie begab sich zum Bett und setzte sich auf die Kante, schwang sich in voller Panzerung auf die bequeme Strohmatratze.
Danèstra war es gewohnt, in diesem stählernen Nachtgewand zu schlafen. Durch die perfekte Anpassung der Teile und das dämpfende wattierte Unterkleid war es einigermaßen bequem, sofern sich das Schwert nicht verklemmte. »Jetzt noch …«
»Ich weiß doch«, sagte er und klang unzufrieden. Ihm schmeckte es nicht, dass er sich gedulden musste.
Mabian ging zum Vogelkäfig und ließ den Finsterfalken auf seinen Unterarm springen, um ihm danach eine Haube über den Kopf zu streifen. Der Vogel begehrte nicht dagegen auf. »Guter Vélos«, lobte er ihn und setzte ihn in den kleineren Transportkäfig.
»Thirío«, rief Danèstra ihren Hund, der aufstand und sich sogleich gehorsam neben das Bett stellte. Auch er kannte das Ritual seit Dekaden.
Mabian befestigte das Tragegeschirr an Thiríos Rumpf und legte ihm das Halsband um. Eine leichte Kette führte zu einem Haken, der am Gürtel von Danèstras Rüstung arretiert wurde. Danach sicherte er als letzten abendlichen, hundertfach ausgeführten Handgriff Vélos’ Käfig am Geschirr des Hundes. Erst jetzt legte sich Thirío nieder.
»Danke. Lösche die Kerzen noch und dann geh. Schlaf gut, Lieblingssohn.«
»Was ist mit dem Helm, Mutter?«
Danèstra überlegte. »Ich lasse ihn weg.«
»Wir könnten ihn Thirío aufsetzen.« Mabian grinste und ging im Gemach umher, erstickte die Flämmchen mit einem bronzenen Löschhut. »Ihn würde das nicht stören.«
»Nein, das tue ich ihm nicht an.« Danèstra schloss die Lider. Sie war wirklich sehr müde. In den letzten Tagen hatte sie bei der harten Arbeit auf den Feldern geholfen, wie sie es gerne tat, um sich zu erden. Sich zu erinnern, wie sich das Leben der einfachen Menschen anfühlte. »Ich freue mich auf das Fest morgen«, murmelte sie eindämmernd.
»Das ganze Gehöft tut das, Mutter«, erwiderte Mabian leise, und seine Stimme erklang wie aus großer Entfernung. »Du bist eine wunderbare Lehnsherrin für die Menschen …«
Der Rest seiner Worte ging in ein unverständliches Flüstern über, das sie in den Schlummer begleitete. Die Tür zu ihrer Unterkunft schloss sich mit einem Klacken, und es wurde still.
Danèstra spürte ihren Herzschlag in der Brust, vernahm das Pochen in den Ohren und das Pulsieren in den Schläfen.
Der Takt verlangsamte sich, verlor an Geschwindigkeit – bis kein weiteres Klopfen mehr kam.
Ein heißes Brennen breitete sich in ihrer Brust aus, und Danèstras Sonnengeflecht glühte auf.
Die Hitze flutete ihren Körper, vor ihren geschlossenen Lidern wurde es rot. Sie sah die Adern durch die dünne Haut und presste vor Schmerz die Zähne fest zusammen.
All das kannte Danèstra.
Das Gefühl, ins Bodenlose zu stürzen, gesellte sich zur allgegenwärtigen Hitze, und sie rang keuchend nach Luft.
Unvermittelt sprang das Herz erneut an, es wummerte und raste in der Brust, dröhnte und krachte wie Hammerschläge in ihr. Sie schmeckte aufgewühlte Erde. Es roch nach Gras, und Tau benetzte ihr Gesicht.
Schlagartig endeten das Fallen, die Hitze und die Dunkelheit.
Danèstra öffnete die Augen, die Pupillen gewöhnten sich an das Licht. Allmählich drangen Geräusche in ihre Ohren, die dumpf und undeutlich hallten. Sie passten nicht recht zu den zuckenden Figuren, die in dem Waldstück und auf der Straße vor ihr umhersprangen und torkelten.
»Thirío. Bist du da?«
Ihr Hund stieß sie als Antwort mit der Schnauze an.
Danèstra kniff die Lider mehrmals zusammen, und das Bild klärte sich.
Sie kniete zwischen lichten Tannen und Farngestrüpp. Eine unbefestigte Straße schnitt sich durch den Forst, in dem ein wüstes Scharmützel tobte.
Danèstra löste den Falkenkäfig vom Hundegeschirr, befreite Vélos und nahm ihm die Haube ab, damit der Raubvogel sich orientieren konnte. Sie hakte Thiríos Kette aus und erhob sich behutsam.
»Da sind wir also, meine Getreuen«, sagte sie zu Falke und Hund. »Das Schicksal hat uns ein weiteres Mal entsandt, um jemandem beizustehen.« Danèstra blickte sich aufmerksam in dem Getümmel um und zog ihr Schwert. »Wer könnte das wohl sein?«
Nie wusste sie, zum wem sie geschickt worden war oder wo und in welchem Reich sie sich befand.
Einzig sicher war, dass sie Nankān nicht verlassen hatte. Sie mochte im Irrsal oder in einem der anderen Länder der Halbinsel stehen – sie würde es später herausfinden.
»Hey!«, schrie einer der Kämpfenden, die keinerlei Wappen auf den schäbigen, teils rostbesetzten Rüstungen trugen. »Wer bist du, Großmutter? Wo kommst du auf einmal her?« Er erstach seinen entwaffneten Gegner und wandte sich Danèstra zu, hob seinen tropfenförmigen Langschild und reckte das blutige Schwert gegen sie. »Ergib dich!«
Sie hob ihre eigene Klinge. »Deinesgleichen nicht.«
»Ho! Dann schneide ich deine Haut in …«, setzte der Krieger an und schlug dabei nach ihr.
Danèstra duckte sich unter dem Hieb weg und rammte ihre gepanzerte Schulter gegen den Schild.
Der kräftige Stoß warf den Gegner nach hinten um. Flink sprang sie auf seine metallbeschlagene Deckung, und die Kante zertrümmerte dem Mann die Nase. Mit einem Aufschrei versank er in Ohnmacht.
»Großmutter. Das habe ich noch nie gehört. Einfallsreicher Junge!« Danèstra verharrte auf dem Schild und ging auf ein Knie herab, spähte umher. »Zeig mir, weswegen du mich gerufen hast, Schicksal«, murmelte sie. Sie wusste aus Erfahrung, dass sie nicht lange warten musste, um den Grund zu erkennen.
In dem Durcheinander aus blutigem Hauen, Stechen und Sterben wurde eine junge Frau von einem Krieger mit Beil brutal zu Boden gestoßen. Als Mutter von vier Kindern erkannte Danèstra sogleich, dass es sich um eine Schwangere handelte, die weit über den siebten Mond hinaus war. Deutlich wölbte sich der Bauch unter dem einfachen, blutbespritzten Gewand und dem Mantel.
Danèstra spürte ein mitfühlendes Stechen im Herzen bei der Vorstellung, die junge Mutter könnte von der Schneide getroffen werden. Keinesfalls darf ihr und dem Kind ein Leid geschehen. »Sie! Sie ist der Grund unseres Hierseins.« Sie rannte los, Schwert und Dolch erhoben. »Thirío, achte auf mich!«
Der schwarz-weiß befellte Rüde bellte dunkler als beim Wettlauf auf dem Feld, und seine Gestalt änderte sich im Spurt. Er wuchs, sein Körper verbreiterte sich und stemmte sich auf die Hinterläufe; die wenigen weißen Flecken nahmen ein neues Muster an. Seine Schnauze bewehrte sich mit silbrig metallenen Zähnen, die beim ersten Zuschnappen einen gegnerischen Unterarm samt Rüstung durchbissen. Blut spritzte, Hand und Waffe fielen auf den Waldboden. Der Gegner wich kreischend zurück und hielt sich den Stumpf.
Die sehnige junge Frau hob flehend die Arme, Tränen schimmerten in den braunen Augen. Der Räuber hob unbarmherzig zum Schlag mit dem Beil aus, um ihr den Schädel zu spalten. Sie krümmte sich verzweifelt zusammen und schützte das ungeborene Leben in ihrem Leib.
»Du Feigling!« Danèstra erreichte die kauernde Schwangere und den überraschten Krieger. »Halt! Weg von ihr! Wie kannst du es wagen, einer werdenden Mutter etwas anzutun!«
Der Mann schlug zu.
Nankān, im Süden des Irrsals, südlich der Stadt Dornenfeste, Spätsommer
Quent Rabenhorst stemmte seine Füße abwechselnd in den weichen, schlammigen Boden und schob sich vorwärts, während sich das Joch des einachsigen Ziehwagens in Schultern und Nacken drückte. Die Lederpolsterung nutzte kaum etwas. Das Gewicht des Vehikels, das er seit Sonnenaufgang hinter sich her über den Waldweg zerrte, war einfach zu groß.
Das lag vor allem daran, dass außer den ganzen Vorräten, dem Zelt, den Pfannen und Töpfen sowie alchemistischen Behältnissen verschiedenster Größe sein nicht eben schlanker Herr Calostro schnarchend oben auf dem Gerümpel lag und sich kutschieren ließ.
Quent, knappe achtzehn Gemeinjahre alt, schlaksig und dürr wie eine junge Birke, blieb stehen und wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht. Danach nahm er die Trinkflasche vom Gürtel und gönnte sich große Schlucke vom Rindentee, der belebende Wirkung hatte.
Die wärmende Gugel hatte er längst von den kurzen braunen Haaren gestreift, die grob gewobene Tunika war luftig wie die offenen Sandalen.
»Was ist, Räblein?«, fragte sein Herr verschlafen vom Ziehkarren herab. »Wir sind noch nicht da. Warum hältst du an?«
»Weil ich nicht verdursten will.« Quent ließ sich den Spitznamen seit acht Jahren gefallen. Damals hatte Calostro ihn als kleinen schmächtigen Jungen seinen verarmten Eltern als Sklaven abgekauft und ihn zu seinem Diener für alles gemacht. Inzwischen bekam Quent guten Lohn fürs Schleppen, Tragen, Waschen, für Botengänge und was ansonsten anfiel, der ihm die harten Worte seines Herrn erträglicher machten. Auch lernte er viel von dem Mann, nicht nur Lesen, Rechnen und Schreiben. »Ich arbeite, müsst Ihr wissen.«
Calostro lachte leise. Er war um die vierzig Gemeinjahre und hatte eine Halbglatze. Die wenigen grauen Haare hielt er kurz wie den gleichfarbigen Stoppelbart in seinem rundlichen Gesicht. Die einfache Leinenrobe hatte er vor dem Aufbruch rasch mit Fluchbannzeichen bemalt. »Tapfer, mein guter Diener.«
»Ich sehe es als neuerliche Prüfung von Thýguda.« Quent verschloss die Flasche und hängte sie zurück an den Gürtel. Danach richtete er das Joch und legte es sich bequemer auf die Schultern.
»Oje. Dieser lästige Glaube, den die Eindringlinge mitbrachten.«
»Es sind keine Eindringlinge, sondern die vertriebenen Menschen aus Yarkins untergegangenen Reichen.«
»Herrje, sie haben nicht friedlich um Hilfe gebeten, sondern sich weite Teile Nankāns unter den Nagel gerissen.« Magische Talismane baumelten an Calostros Handgelenken, beschriftete Holztäfelchen trug er wie eine Rüstung. Alles an ihm sah improvisiert und schief aus. Auch das war seit acht Gemeinjahren so. »Die würde nicht nur ich als Eindringlinge bezeichnen.«
Quent wusste, dass sein Herr diesbezüglich recht hatte. »Die Verzweiflung befahl es ihnen.«
»Oder ihre Gottheiten. Sagen manche. Und dass die vorrückende Wildnis ein Vorwand gewesen war.«
»Nein! Thýain und seine Gemahlin Thýguda hätten das niemals von ihren Gläubigen verlangt.«
»Dieses Hin und Her wegen des Glaubens geht mir doch gewaltig auf die Nerven. Die – nennen wir sie Zugezogenen – wollen missionieren. Aber uns, den Bewohnern der Altreiche, sind die neuen Götter gleich«, holte Calostro aus und legte sich gemütlicher hin. »Genau das sehen die Zugezogenen als Grund, weswegen der Wald vorrückt. Thýain und Thýguda verlangen mehr Aufmerksamkeit, um den Menschen beizustehen. Habe ich recht?«
»Ja.« Quent kannte die Dispute zwischen den Anhängern sehr gut.
»Da hast du’s. Und die Altreiche sehen es genau umgekehrt: Die Zugezogenen haben den vielgestaltigen Deiwos verärgert, und er will sie strafen. Daher brachte er das Unheil über den Kontinent, um seine Macht zu zeigen und Respekt zu erhalten.« Calostro lachte abschätzig. »Siehst du, welch Durcheinander das ist? Und wir Magier und Gelehrte sind jene, die gegen die Wildnis ziehen und versuchen, sie mit Zaubersprüchen aufzuhalten. Nicht die schlauen Priesterinnen und Priester. Von denen lässt sich keiner blicken. Die sitzen in ihren warmen Tempeln und lassen es sich gut gehen.«
Quent musste zu seinem Leidwesen erneut zustimmen. »Ich weiß. Eines Tages werde ich Priester sein. Von Thýguda. Um ihr Wort zu verbreiten und zu zeigen, dass sie und ihr Gemahl …«
»Ja, ja. Wieder nur Schwätzerei. Nun weiter«, unterbrach ihn Calostro. »Predige den Leichtgläubigen, aber verschone das gebildete Hirn eines Mannes der Wissenschaft und rechtschaffenen Magie der Dinge und Elemente.« Er blieb auf dem Wagen sitzen und trank gierig aus seiner Flasche, als hätte er beim Ziehen geholfen. Es roch nach vergorenem Saft. »Los, Räblein.«
»Es wäre leichter, wenn Ihr nebenhergehen würdet.«
»Für dich. Nicht für mich. Ich habe keine Lust zu laufen«, erwiderte der Zauberer, suchte den Himmelsweiser heraus und schwenkte ihn gegen die Wolken, blickte über die Markierungen und richtete ihn auf die Sonne aus, um im Anschluss an Rädchen und Rastern zu drehen. »Ich spare meine Kräfte.«
Mit einem Fluch warf sich Quent ins Joch und zog den zweirädrigen Wagen vorwärts.
»Frage doch deine Thýguda, wo sie steckte, als du den Unfall hattest und ich dich unter der gebrochenen Achse herausziehen musste«, erklang Calostros böser Kommentar. »Zeig ihr die Narbe auf deiner Stirn und frage sie, ob sie weiß, wer deinen gebrochenen Schädel heilte.«
»Herr, Ihr wisst: Ich bin Euch auf ewig dankbar.«
»Das wollte ich hören, Räblein. Zwar kaufte ich dich als Sklaven und zog dich groß wie einen Sohn …«
»Einen ungeliebten Sohn.« Quent stöhnte und lachte zugleich. »Da dank ich fein.«
»Nicht spöttisch werden, junger Mann. Du verdankst mir unendlich viel, nicht nur dein Leben«, wies ihn Calostro zurecht. »Dankbarkeit wäre angebracht.«
»Die bringe ich Euch doch entgegen.«
»Und das heißt: für immer in meinen Diensten.« Der Mann trank schmatzend vom hellen, gärenden Most und rülpste so laut, dass es zwischen den Stämmen widerhallte und einige Hasen erschrocken davonsprangen. »Nicht vergessen, Räblein.« Er schwenkte den Himmelsweiser suchend umher.
»Wie könnte ich?«, murmelte Quent und hielt an, weil er eine zugewachsene Kreuzung erreicht hatte. Die beschrifteten Markierungssteine waren von Lianen und Schlingpflanzen überwuchert. Der Druck der Ranken hatte den Basalt gesprengt. »Wohin?«
»Dummer Apparatus. Er will nicht, wie ich will.« Calostro schnippte gegen die Rädchen und kalibrierte sie erneut. »Das Breite ist die alte Straße der Nord-Süd-Achse, die gemeinsam von den Ländern erbaut wurde. Nun taugt sie in diesem Zustand kaum zum darauf Gehen.«
Quent erkannte nichts mehr von dem einst durchdachten, sechs Schritt breiten Weg, den die außer Kontrolle geratene Natur aufgebrochen und für schwere Wagen unpassierbar gemacht hatte. Der mit Steinen, Sand und Kies befestigte Untergrund, durch die Vermengung hart wie Granit, lag in Trümmern vor ihnen, überwuchert und bewachsen, teils gar mit tiefen Klüften. Calostro hatte es endlich geschafft, ihre Position zu bestimmen. »Wir sind richtig.«
»Was wollen wir hier?«, fragte Quent.
»Nachschauen.«
»Haben wir gemacht. Es gibt nichts. Kehren wir um.« Quent machte Anstalten, den Karren zu wenden. Für seinen Geschmack waren sie im magisch veränderten Wald weit genug vorangekommen. Er fürchtete sich vor Monstern und Bestien aus den Geschichten und wollte ihnen, bei allem Vertrauen in die Macht seines Herrn, nicht begegnen.
»Stehen bleiben, Pinsel der Einfalt!«, herrschte ihn der Zauberer an. »Von hier aus geht’s nach Norden, zwei Feldmeilen.«
Quent deutete auf die unpassierbar gewordene Straße. »Wie soll ich das bewerkstelligen? Ihr lasst mir Flügel wachsen, und ich hebe Euch samt Wagen an?«
»Du ziehst. Ich feuere dich an, während ich neben dir hergehe.« Calostro rutschte vom Ausrüstungsberg, dass die Pfannen und Kessel nur so klirrten, und landete auf dem kleinen Weg, auf dem sie gekommen waren. »Ich kann dir sagen, was wir tun: Ich habe einen Jäger befragt, wo er die Längsstreifenhörnchen herhatte. Und als ich ihm eine gute Summe bot, da verkaufte er mir die Fallen gleich mit.«
»Die Fallen, die natürlich noch an dem Ort sind, wo er sie aufstellte?«
»Gewiss.«
»Und das liegt nicht zufällig tiefer auf dem Stück Irrsal, das sich vollends im Besitz des Waldes befindet? Habt ihr die Ranken gesehen, welche die Wegweisersteine zermalmten? Das Dämonische ist längst hier.«
»Ich höre … Widerwillen.«
»Ihr hört weitaus mehr, Herr.« Quent warf das Joch ab. »Wir gehen geradewegs ins Reich der Finsternis wegen der Felle und des Fleischs von Nagetieren? Das kann nicht Euer Ernst sein! Ihr habt …«
»Räblein, diese Längsstreifenhörnchen sind nötig, um eine neue Formel auszuprobieren«, unterbrach ihn Calostro. »Meine Untersuchungen haben ergeben, dass diese Tiere der Wirkung der Wildnis widerstehen. Verstehst du, was das bedeutet?«
»Nein.«
»Sie leben in diesem magisch veränderten Dickicht, ohne den Verstand zu verlieren oder sich gegen ihre Natur zu verhalten.«
»Haben denn diese Nager Verstand?«
»Den haben sie. Ich untersuchte ihn. Am offenen Hirn.«
»Und ich meine mich zu erinnern, dass ich sie Euch zubereiten und aus den Fellen eine wärmende Mütze für den Winter machen musste«, erwiderte Quent und sah zur zerstörten Straßen, die von der Natur verschlungen worden war.
»Das war danach. Als sie bei meinen Untersuchungen gestorben waren. Schmackhafte kleine Tierchen. Vorher dienten sie einem höheren Zweck.« Calostro zeigte nach Norden. »Aus ihnen will ich die Essenz für ein Gegenmittel destillieren, das wir versprühen können. Es wird gegen den Bann helfen, der mit dem Wald einhergeht. Der die Natur unterworfen hat und ihr rätselhafte Kräfte verleiht.«
»Aus Nagern«, konstatierte Quent skeptisch. »Wie viele Tausende brauchen wir denn, Herr?«
»Aus Längsstreifenhörnchen«, korrigierte Calostro und machte eine scheuchende Bewegung. »Genug. Ich streite mich doch nicht mit meinem Diener! Hoch mit dem Joch und voran! Wenn in den Fallen Beute ist, will ich sie haben, bevor Füchse sie schnappen.«
Seufzend legte Quent die Zugvorrichtung an und packte die Deichsel, mit der er lenkte. »Der Fallensteller hat Euch gehörig übers Ohr gehauen«, verkündete er seine Meinung. »Er wagte sich nicht mehr in die verfluchten Wälder, und mit Euch fand er einen Esel, der ihm die verlorenen Fangeisen zahlte.«
»Wir werden sehen«, sagte der Zauberer. »Und falls nicht, werde ich der Retter von Nankān und Yarkin! Die Mächtigen werden mir aus Dankbarkeit Land und Reichtümer schenken.« Er tat so, als würde er Hof halten, winkte und lächelte. Die Talismane klapperten um ihn herum.