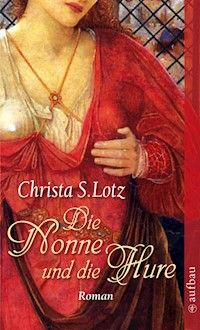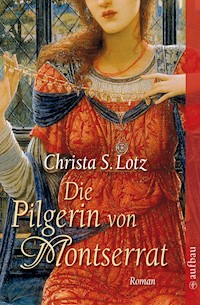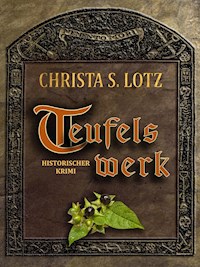12,99 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei historische Romane in einem E-Book!
Die Köchin und der Kardinal:
Man schreibt das Jahr 1634. Noch ist der Schwarzwald von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verschont geblieben. Doch im September ziehen plündernde Truppen des Kaisers durchs Land. Sie verwüsten die kleine Stadt Calw, wo die junge Elisabeth mit ihrer Familie lebt. Zusammen mit ihrer Schwester Agnes wird Elisabeth von Jakob, einem Musketier, entdeckt, der ihnen zur Flucht in die Wälder verhilft. Elisabeth verliebt sich in ihn, doch ihr Weg führt sie nach Baden-Baden. Sie wird die Leibköchin des Kardinals Thomas Weltlin. Bald schon ahnt sie, dass der Kardinal sich in sie verliebt hat. Wenig später ziehen die Truppen des Kaisers heran und belagern das Schloss. Nach einem Gemetzel entdeckt Elisabeth den schwerverwundeten Jakob und pflegt ihn heimlich in einem Gartenhaus. Ständig ist sie in Gefahr, von ihrer Schwester, dem Kardinal oder den Bediensteten entdeckt zu werden. Als Jakob wieder gesund ist, kehrt er zum kaiserlichen Tross zurück. Elisabeth tut alles dafür, einen Weg zu ihm zu finden, und gerät dabei selber in Lebensgefahr ...
Die Pilgerin von Montserrat:
Im Jahre 1546 finden Teresa und ihr Vater Froben in ihrer Bibliothek, wo sie an einer Familienchronik arbeiten, ein uraltes Pergament. Ihr Vorfahr Friedrich von Wildenberg nahm am 1. Kreuzzug im Jahre 1096 teil und brachte einen Goldkandelaber in das Kloster Agenbach im Schwarzwald. Diese Reliquie soll jedem, der sie besitzt, Macht, Reichtum und Glück bescheren. Teresa und ihr Vater beschließen, nach der Reliquie zu suchen. Noch in derselben Nacht wird Froben überfallen, der Torwächter der Burg ermordet und das Pergament gestohlen. Als Teresa und Froben nach Agenbach reiten, werden sie von zwei Reitern verfolgt. Alexius, der Bibliothekar des Klosters, eröffnet ihnen, dass der Kandelaber zwar damals ins Kloster gebracht worden, aber seitdem verschwunden sei. Wahrscheinlich sei er nach Santiago de Compostela oder nach Montserrat gebracht worden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1153
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Informationen zum Buch
Die Köchin und der Kardinal
Man schreibt das Jahr 1634. Noch ist der Schwarzwald von den Wirren des Dreißigjährigen Krieges verschont geblieben. Doch im September ziehen plündernde Truppen des Kaisers durchs Land. Sie verwüsten die kleine Stadt Calw, wo die junge Elisabeth mit ihrer Familie lebt. Zusammen mit ihrer Schwester Agnes wird Elisabeth von Jakob, einem Musketier, entdeckt, der ihnen zur Flucht in die Wälder verhilft. Elisabeth verliebt sich in ihn, doch ihr Weg führt sie nach Baden-Baden. Sie wird die Leibköchin des Kardinals Thomas Weltlin.
Bald schon ahnt sie, dass der Kardinal sich in sie verliebt hat. Wenig später ziehen die Truppen des Kaisers heran und belagern das Schloss. Nach einem Gemetzel entdeckt Elisabeth den schwerverwundeten Jakob und pflegt ihn heimlich in einem Gartenhaus. Ständig ist sie in Gefahr, von ihrer Schwester, dem Kardinal oder den Bediensteten entdeckt zu werden. Als Jakob wieder gesund ist, kehrt er zum kaiserlichen Tross zurück. Elisabeth tut alles dafür, einen Weg zu ihm zu finden, und gerät dabei selber in Lebensgefahr.
Ein opulenter historischer Roman über eine Köchin und ihre unmögliche Liebe.
Die Pilgerin von Montserrat
Im Jahre 1546 finden Teresa und ihr Vater Froben in ihrer Bibliothek, wo sie an einer Familienchronik arbeiten, ein uraltes Pergament. Ihr Vorfahr Friedrich von Wildenberg nahm am 1. Kreuzzug im Jahre 1096 teil und brachte einen Goldkandelaber in das Kloster Agenbach im Schwarzwald. Diese Reliquie soll jedem, der sie besitzt, Macht, Reichtum und Glück bescheren. Teresa und ihr Vater beschließen, nach der Reliquie zu suchen. Noch in derselben Nacht wird Froben überfallen, der Torwächter der Burg ermordet und das Pergament gestohlen. Als Teresa und Froben nach Agenbach reiten, werden sie von zwei Reitern verfolgt. Alexius, der Bibliothekar des Klosters, eröffnet ihnen, dass der Kandelaber zwar damals ins Kloster gebracht worden, aber seitdem verschwunden sei. Wahrscheinlich sei er nach Santiago de Compostela oder nach Montserrat gebracht worden.
Informationen zur Autorin
Christa S. Lotz lebt in Baden-Württemberg am Rande des Schwarzwaldes. Sie hat bereits mehrere historische Romane veröffentlicht.
Als Aufbau Taschenbuch sind bisher von ihr erschienen: »Die Nonne und die Hure«, »Die Pilgerin von Montserrat«, »Die Hure und der Mönch« sowie »Die Köchin und der Kardinal«.
ABONNIEREN SIE DENNEWSLETTER DER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
CHRISTA S. LOTZ
DIEKÖCHIN UND DERKARDINAL &DIEPILGER VONMONTSERRAT
Zwei historische Romane in einem E-Book
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Die Köchin und der Kardinal
1. BUCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2. BUCH
10
11
12
13
14
15
16
17
3. BUCH
18
19
20
21
22
23
24
25
26
4. BUCH
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Nachwort
Die Pilgerin von Montserrat
1. Buch: Die Chronik
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
2. Buch: Die Reise
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
3. Buch: Das Geheimnis
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
4. Buch: Die Rückkehr
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Impressum
CHRISTA S. LOTZ
DIEKÖCHINUND DER KARDINAL
Roman
1. BUCH
(September 1634 – November 1634) Flucht
1.
Eine Trompete wurde zum Angriff geblasen, gefolgt von einem dumpfen Trommeln. Elisabeth lief zum Fenster und schaute hinaus. Der Marktplatz lag friedlich in der Morgensonne, der Brunnen plätscherte, allerlei Volk war unterwegs.
Noch einmal ertönte das Trompetensignal, das Trommeln wurde heftiger. Und dann kamen sie von überallher, ein Wald aus Piken, von jeder Gasse und aus jedem Winkel. Nein, sagte sie sich, das kann nicht sein, das ist nur ein Alptraum. Die kaiserlichen Soldaten waren da, sie fielen über Männer, Frauen und Kinder her, stachen mit ihren Piken auf sie ein, Blut spritzte, markerschütternde Schreie ertönten. Die Söldner schleppten Geschirr, Möbel und Bettzeug aus den Häusern, legten Feuer und drohten den Bewohnern, ihnen die Därme herauszureißen, wenn sie die Verstecke ihrer Wertsachen nicht verrieten. Und dann hatten die Soldaten Elisabeth am Fenster entdeckt. Sie rannten zur Tür, stießen sie auf und polterten die Treppe herauf. Elisabeths Herz klopfte wie ein Hammer gegen die Rippen. Wo sollte sie sich verstecken? Was würden sie mit ihr anstellen? Die Tür flog mit einem Krachen auf, eine Horde von Männern drängte herein. Elisabeth stand wie fest gewurzelt, konnte sich nicht rühren. Der vorderste Mann, mit einem wilden Bartgestrüpp vor dem Mund, hob seine Pike, von der Blut herabtropfte. Vor Elisabeths Augen drehte sich alles. Und dann stach der Soldat zu. Elisabeth spürte einen brennenden Schmerz im Bauch, sie griff dorthin, Blut rann an ihren Händen herab, es roch süß und metallisch. Sie fiel, ihr Körper schlug auf den Boden. Elisabeth riss die Augen auf. Die Männer verschwanden wie in einem Nebel, es wurde still. Sie rieb sich die Augen.
Der Geruch nach Feuer und Blut stand ihr noch in der Nase. Die Schmerzen im Bauch ebbten langsam ab. Elisabeth schlug die Decke zurück, erhob sich von der Strohmatratze, lief zum Fenster und stieß den Laden auf. Kalte Luft strömte herein. Piken und Soldaten waren verschwunden. Die kleine Stadt Calw, von Mauern umschlossen und mit Türmen bewehrt, erwachte zum Leben. Die Sonne war hinter Nebelwolken versteckt, ein Hahn krähte sich die Seele aus dem Leib. Handwerker überquerten den Platz auf dem Weg zur Arbeit. Im Marktbrunnen strömte das Wasser wie eh und je, und aus den Häusern drang das Klappern von Geschirr. Elisabeth rieb sich mit den Fingern über die Stirn, um den bösen Traum zu verscheuchen. Mochte er nur niemals Wirklichkeit werden! Sie holte ein Wollkleid aus der Truhe neben dem Bett, zog es mit ein wenig zittrigen Fingern an und band ihre langen Haare zur Seite. Elisabeth verließ die Kammer und lief die knarrenden Stufen der Treppe hinunter. Aus der Küche hörte sie die Magd mit Töpfen hantieren. Elisabeths Mutter gab Anweisungen für die Tagesarbeit. Elisabeth ging durch den Flur hinaus in den Hinterhof, um sich das Gesicht in der Wassertonne zu waschen. Erfrischt kehrte sie in die Küche zurück und begrüßte Mutter und Magd. Elisabeths Vater, Mesner des protestantischen Städtchens, ihr Bruder Lukas und ihre Schwester Agnes betraten hintereinander die Küche. Zusammen mit Elisabeth und der Mutter ließen sie sich an dem blank gescheuerten Holztisch nieder. Die Magd stellte einen Topf mit Haferbrei auf den Tisch und setzte sich ebenfalls dazu. Der Vater schaute Agnes tadelnd an, als sie zu ihrem Silberlöffel griff. Mit seinem Dreiecksbart und dem Spitzenkragen über der schwarzen Soutane sah er dem Superintendenten der Stadt, Johannes Valentin Andreä, recht ähnlich.
Der Vater senkte den Kopf, faltete die Hände, die anderen taten es ihm nach. Er betete: »O Herr, öffne meine Lippen.
Und mein Mund soll sprechen mein Lob.
Beschütze uns vor allem Übel, das da kommen soll.
Lobet den Herrn.
Der Name des Herrn sei gelobt. Amen.«
»Amen«, wiederholten die anderen, bevor sie sich dem heißen Brei zuwendeten. Eine Weile herrschte Stille, derweil gedämpftes Klappern von Löffeln erklang. Der Vater hatte das Frühmahl beendet und schob seine Schüssel aus bunter Keramik von sich.
»Liebe Familie«, begann er seine tägliche Ansprache. »Wie wir alle wissen, haben die Kaiserlichen die Schlacht bei Nördlingen gewonnen. Ich bin in großer Angst und Sorge um uns alle, denn danach haben sie die Städte Göppingen und Schorndorf eingenommen und befinden sich jetzt in Stuttgart. Sie schonen die Einwohner nicht, sondern foltern und quälen sie, um die Verstecke der Reichtümer aus ihnen herauszupressen. Sie schrecken vor nichts zurück, auch nicht vor Vergewaltigung«, sein Gesicht überzog sich mit einer leichten Röte, »Brandstiftung und Mord. Sie sollen die Stuttgarter Geistlichen bis aufs Blut gequält haben. Jetzt seien sie auf dem Weg nach Tübingen und Herrenberg, hat mir der Stadtvogt gesagt.«
»Um Jesu willen«, sagte seine Frau, die aschfahl geworden war. Elisabeth war es, als röche sie wieder den Brandgeruch.
»Ich habe heute Nacht davon geträumt«, sagte sie mit gepresster Stimme. »Was sollen wir tun, Herr Vater, wie können wir uns schützen?«
»Am besten geben wir ihnen alles, was wir haben«, warf Agnes ein. Alle starrten sie entsetzt an.
»Das wäre eine große Sünde«, erwiderte der Vater. »Denn sie würden es nur versaufen, verfressen und zur Verbreitung ihrer papistischen Lehre verwenden. Wir sollten erst einmal abwarten, was geschieht.«
»Sollen wir warten, bis sie hier einfallen wie ein Schwarm Hornissen und uns alle massakrieren?«, rief die Mutter mit schriller Stimme. »Lasst uns hinauf ins Waldgebirge gehen, zu meiner Schwester in Neuweiler, da wären wir in Sicherheit!«
»Das kommt gar nicht in Frage, Weib!«, knurrte der Vater. Sein Bart zitterte.
»Die haben doch selbst nicht genug zum Leben, und außerdem wäre es feige, unsere Brüder und Schwestern hier im Stich zu lassen.«
»Sie könnten doch mit uns gehen«, warf Elisabeth ein.
»Und dem Feind die Stadt kampflos überlassen?«, fuhr ihr Vater auf. »Unser Haus hergeben, unser ganzes Leben hier?«
»Wir könnten uns doch im Keller oder auf dem Dachboden verstecken«, meinte Lukas.
»Da werden sie uns gewiss bald finden«, gab die Mutter zurück.
»Ich werde gleich zum Superintendenten gehen und mich mit ihm besprechen«, sagte der Vater und erhob sich vom Tisch. »Ihr geht eurem Tagwerk nach, das ist Gottes Wille. Betet und kommt heute Abend in die Kirche, der Superintendent wird uns einiges zu sagen haben.«
»Ach, wären wir doch in Ettlingen oder in Baden«, seufzte die Mutter. »Da würde der Markgraf seine schützende Hand über uns halten.«
»Wir bleiben«, beschied der Vater und war gleich darauf zur Tür hinaus.
»Schade, dass der Superintendent zur Zeit keinen Unterricht für euch drei abhält«, meinte die Mutter.
»Er hat andere Sorgen, hat er gesagt«, erwiderte Elisabeth. »Aber ich kann mich nützlich machen, könnte auf den Markt zum Einkaufen gehen und später kochen.«
»Was willst du denn heute kochen?«, fragte Agnes.
»Ich weiß nicht, ob ich überhaupt etwas herunterbringe«, wandte die Mutter ein.
»Ja!«, ließ sich Elisabeths Bruder Lukas vernehmen. »Ich möchte mal wieder saure Leber haben!«
»Mal schauen, was es auf dem Markt gibt«, sagte Elisabeth. Ihre Mutter händigte ihr einen Korb und einen Lederbeutel mit ein paar Gulden und Kreuzern aus.
»Treib dich aber nicht zu lange in der Stadt herum, wer weiß, was passiert!«, mahnte die Mutter.
»Ich bin groß genug mit meinen achtzehn Jahren!«, fuhr Elisabeth auf.
»Die Jahre schützen dich nicht davor, von Männern belästigt zu werden«, gab die Mutter zurück. Zu Agnes gewandt, fügte sie hinzu: »Und du kannst die Stube fegen und die Wäsche waschen.«
Agnes verzog maulend das Gesicht.
»Warum darf ich nicht auf den Markt gehen? Warum darf immer Elisabeth rausgehen und ich nicht?«
»Weil sie uns das Mittagessen kocht, darum. Außerdem ist sie zwei Jahre älter als du.«
Elisabeth warf sich eine wollene Schecke über, griff nach dem Korb und trat hinaus auf den Platz. Es war immer noch düster und kalt, die Sonne schaffte es nicht, durch den Hochnebel zu dringen. Knechte und Mägde zersägten Buchen- und Tannenholz, das aus den Wäldern gebracht worden war. Hausfrauen mit schwarzen Hauben eilten geschäftig hin und her, um einzukaufen oder Birnen und Äpfel aus ihren Gärten zu holen, die sie einmachen oder für den Winter dörren würden. Elisabeth ging die wenigen Schritte zum Rathaus hinunter. Hier hatten die Bäcker und die Metzger ihre Bänke. Sie verkauften Brot, Dinnete, Mehlfladen mit Speck, Hutzelbrot und Brezeln. Die Metzger priesen Querrippe vom Rind, Schweinefüße, Lammhals, Bries, Leber und Lunge an. In einen Steinguttopf war Schmalz gefüllt, in einen anderen Butter. Elisabeth kaufte eine große Leber vom Rind, ein Töpfchen Schmalz, ein Viertelpfund Speck und Brot. Von einem der Bauern ließ sie sich Äpfel in den Korb füllen. Mit einer Kanne Milch beladen, trat sie den Rückweg zum Elternhaus an. In diesem Augenblick wurde es laut auf dem Platz. Eine Gruppe jüngerer Leute torkelte zum Brunnen und ließ sich an dessen Rand nieder. Sie trugen Pumphosen, Stulpenstiefel, Wämser aus gewalktem Tuch und Federhüte. Mein Gott, das ist ja der Stadtvogt mit seinen Kumpanen, dachte Elisabeth, muss er sich in dieser Zeit betrunken hier herumtreiben? Die Männer stimmten einen Gesang an und drehten sich dazu im Kreis. Als Elisabeth ihren Weg fortsetzen wollte, kam ein Mann zu ihr herüber.
»Darf ich Euch geleiten, schönes Kind?«, fragte er mit schwerer Zunge. Sein Atem roch nach Wein.
»Geleite Er sich lieber selbst zurück auf den Pfad der Tugend!«, gab sie zurück.
Verdutzt blieb der Mann stehen. Er machte einen drohenden Schritt auf sie zu. Dann reckte er den Kopf.
»Potz Stern!«, rief er. »Die Frau ist aber nicht auf den Mund gefallen!«
Elisabeth lief schnell zurück ins Haus ihrer Eltern.
»Was ist? Du bist ja ganz außer Atem«, sagte ihre Mutter, die ihr den Korb und die Kanne aus der Hand nahm.
»Ich musste mich vor einem Trunkenbold retten«, entgegnete Elisabeth, »und ich verstehe nicht, warum sich unser Stadtvogt am helllichten Tag besäuft, anstatt sich um die Geschicke der Stadt zu kümmern.«
»Dem ist es völlig gleichgültig, was aus uns wird«, sagte die Mutter mit einem Seufzer. »Wir müssen uns selber helfen, dann hilft uns Gott.«
Sie stellte Korb und Kanne auf den Küchentisch.
»Nun walte deines Amtes als Köchin«, meinte sie.
Die Mutter zog sich zurück, wahrscheinlich zum Beten. Elisabeth nahm ein Messer, legte die Leber auf ein Brett und begann sie aufzuschneiden. Blut tropfte ihr über die Finger. Sie zögerte einen Augenblick, schnitt dann die Leber in fingerdicke Schnitten, streute Salz und Pfeffer darüber und legte die Scheiben auf den Rost des Ofens. Während sie langsam rösteten, schnitt Elisabeth Speck, den sie zusammen mit Schmalz in einer gusseisernen Pfanne ausließ. Darin briet sie die geschnittenen Äpfel und Grieben. Aus dunklem, in Fleischbrühe eingeweichtem Brot, Mehl, Zimt, Muskatnuss und Essig stellte sie eine dunkle Soße her, gab die Leberstücke in die Pfanne und ließ alles eine halbe Stunde kochen. In der Zwischenzeit brachte sie in einem Topf Wasser zum Sieden und schabte einen Teig aus Eiern, Mehl und Milch hinein. Die Uhr von der nahen Kirche schlug die zwölfte Stunde, der Vater würde bald heimkehren. Agnes und Lukas kamen in die Küche.
»Das riecht aber gut«, sagte Agnes. Sie steckte den Finger in die Soße und leckte ihn ab.
»Warte, bis das Essen auf dem Tisch steht!«, rief Elisabeth und drohte ihr mit dem Zeigefinger. »Mach dich lieber nützlich! Du kannst Schüsseln, Teller und Besteck aufdecken.«
Die Familie versammelte sich um den Tisch. Elisabeth trug die Leber in einer Schüssel auf und goss Äpfel, Schmalz und Grieben darüber. Sie ließ die Teigwaren in einem Seiher abtropfen und gab sie in eine weitere Schüssel. Nach dem Gebet begannen sie zu essen. Der Vater legte Gabel und Löffel beiseite, lobte Elisabeths Kochkunst und berichtete über das, was er im Pfarrhaus erfahren hatte.
»Unser Superintendent Andreä hat sich entschlossen, zusammen mit seiner Frau die Stadt zu verlassen. Er wird nach Neuweiler zum dortigen Pfarrer gehen. Sie nehmen mit, was sie tragen können.«
»Warum schließen wir uns ihnen nicht an?«, fuhr seine Gattin auf.
»Ja, lasst uns fliehen!«, pflichtete Elisabeth ihr bei. »Die Kaiserlichen können jeden Tag eintreffen.«
»Aber nicht nach Neuweiler, nach Baden will ich gehen!«, versetzte Agnes.
»Wir bleiben«, beharrte der Vater. »Uns werden sie verschonen, denn wir haben nicht viele Reichtümer.«
»Und was ist mit den Bildern von Cranach und Dürer, was mit dem Tafelsilber für hohe Feiertage?«, warf die Mutter ein. »Und mit der Truhe voller Goldgulden?«
»Das ist alles wohlverwahrt und versteckt. Auf dem Dachboden.«
»Dann befehle ich uns in Gottes Hand«, sagte die Mutter. Als wäre es ein Zeichen gewesen, ertönte in diesem Augenblick eine Glocke auf dem Marktplatz. Alle sprangen auf und liefen hinaus. Der Büttel des Stadtvogtes hatte sich am Brunnen aufgestellt. Von überall her strömten die Menschen herbei, derweil der Büttel weiter die Glocke schwang. Viele hatten ihre Fenster geöffnet und harrten gespannt der Dinge, die da kommen sollten.
»Eine Nachricht hat unsere Stadt erreicht«, verkündete der Büttel feierlich. Die Feder auf seinem Filzhut wippte bedenklich. »Ein Bote kam geritten und überbrachte die Nachricht, dass die Kaiserlichen Herrenberg geplündert hätten und nun auf dem Weg zu uns seien. Hier gäbe es etwas zu holen, so erzähle man sich im feindlichen Lager.«
Ein Stöhnen ging durch die Menge. Dann kam Bewegung in sie.
»Wo ist denn unser Stadtvogt?«, rief ein Mann. »Warum kommt er nicht selbst und steht uns bei in dieser schweren Stunde?«
»Er lässt sich entschuldigen«, antwortete der Büttel. »Und er lässt euch sagen, dass ihr Ruhe bewahren und in euren Häusern bleiben sollt.«
Vom Fluss her war ein Schuss zu hören.
»Sie kommen!«, kreischte eine Frau. Eine Welle der Angst ergriff die Calwer Bürger.
Kopflos rannten sie in alle Richtungen davon, den Stadttoren zu. Elisabeth wurde von der Menge mitgerissen, sie rannte um ihr Leben. Ob die Stadttore offen waren? Würden sie es schaffen, vor den Augen der Kaiserlichen aus der Stadt hinauszukommen? Wo waren ihre Eltern und ihre Geschwister? Elisabeth konnte sie nirgends entdecken. Gänse stoben laut schnatternd davon, Schweine quiekten und brachten sich vor den rennenden Leuten in Sicherheit. Als sie das äußere Tor erreichten, sah Elisabeth, dass es verschlossen war. Von außen wurde dagegen gehämmert. Um Gottes willen, dachte Elisabeth, lass sie nicht hereinkommen, lass diesen Kelch an uns vorübergehen! Jetzt war das Tor offen, und Männer mit blutverschmierter Kleidung strömten herein. Elisabeth erkannte den Metzger unter ihnen, der ihr am Morgen die Leber verkauft hatte. Ihr fiel ein, dass vor dem Tor der Metzgerplatz lag, wo Rinder, Schweine und Hühner geschlachtet wurden.
»Gott sei Dank habt ihr das Tor geöffnet«, rief einer der Metzger. »Wir fühlen uns nicht mehr sicher da draußen.«
»Wer hat geschossen?«, fragte eine befehlsgewohnte, leicht schwankende Stimme. Elisabeth erkannte den Stadtvogt.
»Es muss einer von Euren Lausbuben gewesen sein«, sagte der Metzger, »die sich nicht entblöden, sich am helllichten Tag auf dem Marktplatz zu besaufen.«
»Das geht Euch nichts an«, versetzte der Stadtvogt. »Geht jetzt wieder in Eure Häuser zurück. Wer gut und rechtschaffen ist, dem wird nichts geschehen.«
Murrend und nur allmählich zerstreute sich die Menge. Elisabeth ging gedankenverloren zum Marktplatz zurück. Im Haus fand sie ihre Familie versammelt.
»Es war blinder Alarm, ich habe es schon gehört«, sagte ihr Vater. »Jetzt lasst uns essen und früh ins Bett gehen.«
Am anderen Nachmittag gegen fünf Uhr wurde eine Trompete geblasen. Elisabeth hörte das Bersten der Stadttore bis in die Stube hinein. Von allen Seiten her drang das Bellen der Falkonette. Die Stadt wurde von den Kaiserlichen mit leichten Geschützen beschossen. Das Herz klopfte Elisabeth bis zum Hals, ihre Beine zitterten. Sie lief zum Fenster und sah wie in ihrem Traum einen Wald aus Piken durch alle Gassen kommen. Ihre Mutter lief wie ein Vögelchen umher, versuchte, etwas zusammenzupacken, um es im letzten Augenblick zu verstecken. Der Vater packte sie am Arm, rief nach seinen Kindern und lief mit ihnen die Stiege zum Dachboden hinauf. In der Eile stolperte Elisabeth, schlug der Länge nach auf die Stiege, rappelte sich wieder auf. Auf dem Dachboden schob der Vater Lukas und seine Frau zu einer Kiste und bedeutete ihnen, hineinzukriechen. Den beiden Mädchen wies er einen Platz in einem großen Schrank an. Drinnen roch es dumpf und modrig. Alte Kleider und Pelze hingen herab, hinter denen sich Agnes und Elisabeth versteckten. Von draußen hörte Elisabeth Schüsse und Schreie, die nichts Menschliches mehr an sich hatten. Der Schweiß brach ihr aus allen Poren. Dicht an sie gedrängt hockte Agnes, die ebenfalls nass von Schweiß war. Durch einen Spalt in der Schranktür konnte Elisabeth einen Streifen Tageslicht sehen, den staubigen Boden und eine Ecke der Truhe, in der ihre Mutter und ihr Bruder um ihr Leben bangten. Die Schreie von draußen wurden immer lauter. Jetzt mussten die Soldaten im Nachbarhaus sein. Elisabeth hörte Flüche, herzzerreißendes Wimmern eines Kindes und dann ein Klatschen, als sei ein menschlicher Körper aus dem Fenster geworfen worden. Sie war halb ohnmächtig, bekam keine Luft mehr. Ein Hustenreiz quälte sie zunehmend. Agnes hatte ihre Arme um sie geschlungen und weinte leise vor sich hin.
»Sei ruhig!«, zischte Elisabeth ihr zu. »Willst du, dass sie uns finden?«
Das Tageslicht machte allmählich der Dämmerung Platz, aber immer noch waren die Schüsse und Schreie von draußen nicht verstummt, nahmen sogar an Heftigkeit zu.
Von den unteren Räumen her hörte Elisabeth ein Poltern, das Krachen von Töpfen und das Splittern zerbrechenden Geschirrs. Das Geräusch von genagelten Stiefeln polterte die Stiege herauf.
»Vater unser, der du bist im Himmel«, betete Elisabeth lautlos in sich hinein. Ihr Hustenreiz wurde stärker. Sie räusperte sich, krampfte ihre Hände ineinander. Hoffentlich hörten es die Männer nicht. Etwas Hartes drückte an Elisabeths Schenkel. Mein Gott, was war denn das? Ihr fiel ein, dass sie vergessen hatte, ihrer Mutter nach einem morgendlichen Einkauf den Geldbeutel zurückzugeben. Sollte sie aus dem Schrank herauskommen und den Söldnern die Goldgulden und Kreuzer anbieten? Aber würden sie deswegen sie und ihre Familie verschonen? Agnes neben ihr zitterte so sehr, dass Elisabeth fürchtete, das Klappern ihrer Zähne könnte sie verraten. Das Geräusch der Stiefel kam näher, es waren viele Stiefel. Die Söldner unterhielten sich laut in einer fremden Sprache, liefen mit ihren Fackeln hin und her, schlugen mit den Schwertern auf Kisten und Truhen. Elisabeth presste sich die Faust vor den Mund, um nicht aufzuschreien. Sie drückte Agnes noch fester an sich, damit ihre Zähne aufhörten zu klappern. Flüche wurden laut, es schepperte und rasselte, dass Elisabeth fürchtete, die Besinnung zu verlieren. Jetzt schienen sie etwas entdeckt zu haben, vielleicht das Kästchen mit Goldgulden, das ihre Mutter in der hintersten Ecke, bedeckt von Tüchern und alten Töpfen, versteckt hatte. Einen Augenblick lang wurde es still im Raum. Dann brachen die Männer in ein Freudengeheul aus. Der Deckel einer anderen Truhe klappte hoch. Mit vor Entsetzen geweiteten Augen hörte Elisabeth ihre Mutter sagen: »Verschont uns, um Christi willen, wir haben nicht mehr als dieses Kästchen mit den Goldgulden!« Lukas weinte. Unverständliches Brüllen folgte.
»Wo sind eure Reichtümer?«, fragte einer mit lauter Stimme. Sie wurde übertönt von den Schreien, die vom Marktplatz und aus den Nachbarhäusern zu ihnen drangen.
»Wir haben nichts mehr, erbarmt Euch«, flehte die Mutter. Wo war nur der Vater geblieben?
»Was ist in dem Schrank?«, wollte die dröhnende Stimme wissen.
»Da sind nur alte Kleider und Pelze drin«, sagte die Mutter. Lukas war inzwischen verstummt. Ein klatschender Laut, ein Stöhnen, noch ein Hieb, ein Gurgeln, dann trat Stille ein. Tritte näherten sich dem Schrank, die Tür wurde aufgerissen. Elisabeth war vollkommen starr. Im Schein der Fackel sah sie, unter den Kleidern hindurch, Stulpenstiefel, die mit Dreck und Blut verkrustet waren. Elisabeth hielt den Atem an.
So sah also der Tod aus. Mit seiner Pike stocherte der Söldner in den Kleidern herum, riss einen Pelzrock von der Stange. Elisabeth spürte einen leichten Stich an der Schulter, von den Kleidern gedämpft. Sie nahm all ihre Kraft zusammen, um nicht aufzuschreien. Die alten Röcke, Wämser und Hosen schienen den Söldner jedoch nicht zu gefallen. Die Stiefel entfernten sich. Die Tür zum Dachboden quietschte, offensichtlich kamen weitere Söldner herein. Elisabeth befahl ihr Leben und das ihrer Familie in Gottes Hand.
»Was macht ihr denn da, seid ihr von allen guten Geistern verlassen?«, rief ein Mann.
»Ihr sollt euch holen, was ihr braucht, zu essen und zu trinken und warme Kleidung für den Winter. Wer hat gesagt, dass ihr die Bewohner quälen und töten sollt?«
Elisabeth schreckte zusammen, ihr wurde eiskalt. Dann stimmte es also, dass ihre Mutter und Lukas tot waren.
»Verschwindet und lasst euch hier nicht mehr blicken!«, rief der Mann. Das Getrappel der genagelten Stiefel entfernte sich. Auch draußen war für einen Augenblick Ruhe eingekehrt. Das Kratzen in Elisabeths Hals wurde unerträglich, sie musste husten. Mit einem Satz war der Mann beim Schrank und sagte: »Wer immer in diesem Schrank versteckt ist, komme heraus, ihm wird kein Leid geschehen.«
Elisabeth dehnte ihre steifen Glieder, drehte sich auf den Bauch und kroch aus dem Schrank. Agnes tat es ihr nach. Ihr Gesicht war kreidebleich. Der Mann leuchtete Elisabeth mit seiner Fackel ins Gesicht. Er hatte lange Haare und war mit einem roten, goldverbrämten Musketierrock und Stiefeln bekleidet. Am Gürtel steckten Degen, Pulverbeutel und Zunderbüchse.
»Ihr müsst fort aus der Stadt«, sagte der Mann. »Hier seid Ihr Eures Lebens nicht mehr sicher.«
»Was ist mit meinen Eltern, mit meinem Bruder?«, fragte Elisabeth mit versagender Stimme.
»Mir wäre es recht, wenn wir aus diesem gottverdammten Loch herauskommen«, ließ sich Agnes mit weinerlicher Stimme vernehmen. »Habe ich nicht gesagt, ich will nach Baden?«
Elisabeth starrte sie entsetzt an. Hatte sie denn kein Herz im Leib?
»Die Söldner haben Eure Eltern und Euren Bruder mitgenommen«, sagte der Musketier. »Aber ich habe ihnen bei Strafe verboten, ihnen etwas anzutun.«
»Und unser Herr Vater?«, wollte Elisabeth wissen.
»Den habe ich nicht gesehen. Jetzt schnell, bevor die Männer es sich noch anders überlegen.«
»Was sind das für Männer, die sich so grausam verhalten?«, fragte Elisabeth hastig.
»Es sind Italiener und Kroaten, die angeworben wurden«, war die Antwort. »Jan van Werth, unser Oberst, ist schon weitergezogen nach Neuenbürg.« Er griff in den Schrank und holte zwei abgegriffene Pelzmäntel heraus.
»Hier. Legt sie Euch um, die Nächte sind schon sehr kalt«, sagte er.
Elisabeth und Agnes folgten dem Söldner, der sie die Stiege hinunter und aus dem Haus führte. Auf dem Marktplatz lagen viele Leichen, einige Stellen waren rot vom Blut.
»Habt Ihr Verwandte, zu denen Ihr gehen könnt?«, fragte der Söldner. In den Gassen fing nun wieder das Schreien und Wehklagen an.
»Eine Tante in Neuweiler«, sagte Agnes.
»Kennt Ihr einen Schlupfwinkel, durch den man die Stadt verlassen kann?«, fragte der Söldner weiter.
»Wenn wir durch den Zwinger gehen, hinten, beim Salzstadel, da gibt es ein Nebentor, vielleicht kommt man da hinaus«, antwortete Elisabeth. Sie liefen durch die Gasse zum Salzstadel. Überall zerstochene Leiber, Sterbende, Verletzte, Blut und der Geruch nach Pulver, Urin und Kot. An einem Feuer saßen Soldaten und brieten ein Ferkel am Spieß.
»He, wohin mit den Dirnen?«, rief einer den Musketier an.
»Sie zeigen mir ein Versteck mit Geld«, antwortete der.
Der Sprecher wollte sich erheben, fiel aber an seinen Platz zurück, weil er zu betrunken war. Elisabeth merkte, dass auch andere den Zwinger entlangliefen, vor allem Frauen und Kinder. Wenn es einen gerechten Gott gibt, dann soll er wenigstens die Frauen und Kinder entkommen lassen, dachte Elisabeth, während sie keuchend weiterlief. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie einen Soldaten, der einer Schwangeren den Säbel an die Kehle legte, damit sie ihm die Verstecke von Gold und Silber verriete. Dreh dich nicht um, rief Elisabeth sich selber zu, doch sie hielt einen Augenblick an, um Atem zu schöpfen, und drehte sich um. Der Söldner hatte die Frau zu Boden geworfen, lag über ihr und stieß in sie hinein. Die Feder an seinem Hut wippte, als sei das Ganze ein einziges großes Vergnügen. Sie erreichten den Salzstadel und die Stadtmauer. Jemand hatte eine Strickleiter darüber geworfen. Also gab es einen Ausweg aus dieser Hölle! Agnes begann, die Leiter hinaufzusteigen. Hinter ihnen drängten sich andere, die ebenfalls fliehen wollten. Elisabeth drückte dem Musketier die Hand, die sich warm um die ihre schloss.
»Wie heißt Ihr?«, fragte sie noch.
»Jakob.«
»Ich heiße Elisabeth.«
Ein letzter Blick, und schon musste Elisabeth die Strickleiter hinaufklettern.
»Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!«, rief der Musketier ihr nach.
»Ich danke Euch für alles«, gab sie zurück. Sie war gleich auf der Mauerzinne. Im Schein der Feuer, die auf dem Platz brannten, bemerkte sie einen kleinen Farn, der aus der Mauer herauswuchs. Das war für sie wie ein Zeichen, dass es Hoffnung gab. Vom Zwinger her näherte sich eine Schar Söldner, die immer schneller wurden. Agnes wurde an einem Seil auf der anderen Seite herabgelassen, Elisabeth folgte. Jetzt hatten die kaiserlichen Söldner die Fliehenden erreicht. Du kannst ihnen nicht helfen, rief Elisabeth sich zu, schau, dass du deine Schwester und dich selber rettest! Vor ihnen lag der Weg, der in den Wald hinaufführte. Andere Gestalten liefen vor ihnen her. Das Gelände war hier so steil, dass Elisabeth tief Luft holen musste. Es ging durch Tannen und Gebüsch, Brombeersträucher und Moospolster hinauf, immer weiter hinauf, es roch faulig nach welkem Laub und Pilzen. Elisabeth schwitzte trotz der nebelfeuchten Kühle. Die Dornen verhakten sich in ihrem Mantel. Immer wieder zerriss die Wolkendecke, um einem blassen Mond Platz zu machen. Dadurch konnten sie wenigstens den Weg erkennen. Agnes folgte ihr dichtauf. Auf einem Fichtenstumpf setzten sie sich hin und hielten eine kurze Rast. Warum nur hatten sie nichts zum Essen und zum Trinken mitgenommen?
»Ich habe Hunger«, klagte Agnes. »Ich will zu meiner Mutter, ich will in mein Bett!«
»Wir kommen bald nach Neuweiler«, tröstete Elisabeth sie. »Dort wirst du zu essen bekommen und ein weiches Bett dazu.«
Mit ihren sechzehn Jahren, zwei Jahre jünger als sie, war Agnes doch noch ein Kind. Hinter ihnen knackte es im Gebüsch. Elisabeth fuhr zusammen. Wurden sie von den Kaiserlichen verfolgt? Immerhin hatten sie sie über die Mauer steigen sehen. Zwei Frauen mit einer Schar von Kindern lösten sich aus dem Dunkel. Gott sei Dank, es waren offensichtlich Flüchtlinge wie sie selbst.
»Hütet euch davor, Fackeln anzuzünden«, sagte die ältere der beiden Frauen.
»Wir haben gar keine«, erwiderte Elisabeth. »Und wenn wir welche hätten, warum sollten wir sie nicht anzünden?«
»Weil wir von den Söldnern verfolgt werden.«
Elisabeth Mut sank. So sehr hatten es die Söldner auf ihre Habseligkeiten abgesehen, dass sie selbst den beschwerlichen Weg in den Schwarzwald nicht scheuten!
»Wohin geht Ihr?«, fragte Elisabeth.
»Nach Neuweiler, zum Superintendenten, der dort bei einem Pfarrer weilt«, antwortete die Frau. Sie blickte die andere Mutter an, und sie zogen weiter. Agnes und Elisabeth standen auf und folgten ihnen, verloren sie aber bald aus den Augen. Bald kamen sie an einem Schafott vorbei, einem erhöhten Podest, dem Blutgerüst, auf dem die Delinquenten mit dem Schwert gerichtet wurden. Schaudernd wandte Elisabeth sich ab, Agnes schien es nicht näher zu berühren. Nach etwa zwei Stunden bergauf und bergab erreichten sie den Weiler Zavelstein. Wie Perlen auf einer Schnur lagen die kleinen Häuser an der einzigen Straße aufgereiht. Die Wolken hatten sich inzwischen verzogen, es war eiskalt, und der Mond beschien die alte Burg am Ende der Straße. Alles war still. Elisabeth zog ein paar gelbe Rüben aus einem Garten und wusch sie notdürftig in einem Brunnen. So hatten ihre Zähne wenigstens etwas zum Beißen. In der Burg brannten noch einige Lichter. Der Weg führte hinab ins Tal, dann wieder ganz hinauf. Manchmal, wenn sie auf einer Straße liefen, hörten sie Reiter kommen und versteckten sich angstvoll im Gebüsch. Über Schmie erreichten sie schließlich das Dorf Neuweiler. Es herrschte eine unheimliche Ruhe. Sie hielten auf die Kirche zu. Aus dem Glockenstuhl des Daches ertönten zwölf Schläge. Vom Pfarrhaus her näherte sich eine Schar dunkel gekleideter Menschen. Keiner sprach ein Wort.
2.
Im Näherkommen erkannte Elisabeth den Superintendenten Andreä, dessen Frau und einige andere Calwer Bürger. Andreä, in seinem Talar mit dem pelzbesetzten Kragen, über den er einen wollenen Umhang geworfen hatte, sprach die beiden an.
»Ihr seid doch Elisabeth und Agnes Weber, Töchter des Mesners von Calw.«
»Ja«, bestätigte Elisabeth. In diesem Augenblick wurde ihr bewusst, welcher ungeheuerlichen Lage sie gerade erst entronnen waren.
»Wir sind, zusammen mit vielen anderen, aus der Stadt geflohen«, sagte sie.
»Es werden immer mehr«, stellte Andreä fest, über ihren Kopf hinweg zum Waldrand blickend. »Was ist mit euren Eltern, eurem Bruder?«
»Sie wurden misshandelt, dann hat uns ein Söldner befreit«, sagte Elisabeth und kämpfte mühsam die Tränen nieder. »Ich weiß nicht, wo sie sich jetzt befinden.«
»Ich hoffe, sie konnten sich retten«, meinte Andreä. »Und ich werde Gott darum bitten, seine Hand über sie zu halten.«
»Haltet euch nicht so lange auf«, beschwor sie ein Mann, der neben Andreä stand.
»Ihr werdet verfolgt, ihr müsst fliehen!«
»Das ist der Maier des Dorfes«, erklärte Andreä. »Er bringt uns zu den Wäldern, durch die wir uns nach Aichelberg und zur Enz durchschlagen wollen. Pfarrer Rebstock hat uns gut mit Essen versorgt.« Er zog sein Felleisen vom Rücken, fasste hinein und gab den Mädchen jeweils ein Stück Brot und Wurst und einen Schluck Wein aus einem Lederbeutel.
»Hier, nimm das Felleisen, ich brauche es nicht mehr.« Er reichte Elisabeth den Rucksack.
»Habt Ihr selbst denn noch genug?«, fragte Elisabeth.
»Wir teilen alles miteinander, es ist ausreichend für alle da«, sagte er.
»Ich danke Euch, Herr Superintendent.«
»Nun müssen wir gehen«, meinte er. Elisabeth und Agnes schlossen sich der kleinen Schar an.
»Was ist mit unserer Tante?«, fragte Elisabeth unterwegs leise den Superintendenten.
»Sie ist heute Mittag nach Calw hinuntergegangen«, antwortete Andreä. »Sie ließ sich nicht abhalten. Vielleicht wollte sie euch beistehen in eurer Not.«
Elisabeth weinte, sie folgte blind dem Trupp durch die Nacht. Eine Eule schrie. Als Elisabeth den Kopf wandte, um ihre Schwester anzusehen, sah sie, dass deren Gesicht wie versteinert war. Sie bewegte sich wie eine Marionette. Schließlich erreichten sie den schützenden Wald. Elisabeth meinte, vom Dorf her Stimmen und das Trappeln von Hufen zu hören. Sie liefen weiter, stolperten in der Dunkelheit der Tannen. Schließlich lagerten sie in einer Mulde, die mit Blättern gefüllt war. An Schlaf war nicht zu denken. Während der Nacht stießen noch etliche Flüchtlinge, meist Frauen und Kinder, zu ihnen. In der Ferne glaubte Elisabeth einen Feuerschein zu erkennen. Ob die Söldner aus Wut das Dorf angezündet hatten, weil es nichts mehr zu holen gab? Decken wurden verteilt, es wurde leise gebetet. Elisabeth lag auf dem Rücken, dicht bei ihrer Schwester Agnes. Sie schaute zu den Baumwipfeln empor, über denen eisig die Sterne glitzerten. Elisabeth fühlte sich wie betäubt. Bilder der vergangenen Stunden und Tage gingen ihr durch den Kopf. Wo waren ihre Eltern, wo war ihr Bruder Lukas? Warum hatte der Musketier sie gerettet, sie aus der Stadt hinausgeführt? Beim Gedanken an ihn wurde es Elisabeth warm. Sie hörte die gleichmäßigen Atemzüge von Agnes, die fast lautlosen Gebete der anderen. Es raschelte im Unterholz, kleine Tiere der Nacht waren unterwegs. Fledermäuse huschten über sie hinweg. Gegen Morgen fiel Elisabeth in einen unruhigen Schlaf.
Sie wurde vom Rätschen eines Hähers geweckt. Der Geruch nach welkem Laub stieg ihr in die Nase. Golden fiel die Sonne durch die Zweige der Tannen, Mücken schwirrten in der Luft. Die Menschen begannen sich zu erheben. Brot, Speck und Wurst wurden verteilt. Den ganzen Tag über wagten sie sich kaum zu rühren. Glücklicherweise war die Witterung mild, die Sonne schien und erwärmte den Waldboden, die Steine und das Laub. Gegen Abend brachen sie wieder auf, tasteten sich durch den dämmrigen Wald, stolperten, fielen und rafften sich wieder auf. Nachts sahen sie von einer Anhöhe aus einen großen Feuerschein. War das die Stadt Calw, die brannte? Ob ihr Elternhaus ebenfalls in Flammen stand? Elisabeth faltete die Hände und betete inbrünstig für ihre Eltern und ihren Bruder. Sie fühlte sich leer und ausgehöhlt. Die kleine Schar war inzwischen auf annähernd zweihundert Personen angewachsen. Weiter, immer weiter, wenn die Söldner sie fanden, war es aus mit ihnen! Tagsüber irrten sie durch Wälder und Schluchten, kletterten über steile Felssteige und hielten sich abseits der Wege, auf denen die Söldner patrouillierten. Elisabeth spürte ein Stechen in der Seite, die Füße taten ihr weh und waren wund gescheuert in ihren leichten Stiefeln. Agnes wimmerte leise vor sich hin, ebenso wie die Kinder. Manchmal verloren Elisabeth und Agnes die anderen aus den Augen. Müde und verloren rutschten sie Abhänge hinab, wateten durch Bäche und mussten wieder einen steilen Felssturz hinauf. Als unvermittelt Menschen vor ihnen auftauchten, schreckten sie zurück und glaubten sich verloren. Aber es waren ihre eigenen Leute, Flüchtlinge wie sie. In Aichelberg fanden sie Unterschlupf in der Scheune eines Bauern. Zwei Männer hatten sie als Nachhut zurückgelassen, um sie zu warnen, falls die Söldner auftauchen sollten. Mitten in der Nacht wurde Elisabeth von einem Flüstern geweckt.
»Euer Versteck wurde verraten«, hörte sie jemanden sagen. Es war die Stimme des Bauern. »Ihr müsst weiter, hier könnt ihr nicht bleiben!«
Elisabeth fuhr hoch, griff nach der Hand ihrer Schwester. Schlaftrunken murmelte Agnes: »Was ist denn jetzt schon wieder?«, bequemte sich dann aber doch, aufzustehen. Elisabeth packte ihr ledernes Felleisen und schnallte es sich auf den Rücken.
»Komm«, flüsterte sie Agnes zu. Die anderen hatten sich mit ihnen erhoben, packten hastig ihre Sachen und drängten zum Scheunentor. Wieder liefen sie den ganzen Tag, abseits der Wege, durch das Gebirge. Ihren Durst stillten sie an klaren Bächen. Brot, Wurst und Wein gingen allmählich aus. Sie schliefen in Heuschobern und Viehställen.
Am Tag darauf meldete die Nachhut, es seien Jäger mit Hunden auf sie angesetzt worden. Konnten die denn niemals Ruhe geben? Warum verfolgten sie Frauen und Kinder durch den halben Schwarzwald? Glaubten sie, die Calwer Bürger trügen ihre wertvollsten Gegenstände noch bei sich? Was Letzteres betraf, war Elisabeth sich nicht einmal so sicher, ob es nicht den Tatsachen entsprach. Sie irrten weiter durch Wälder und über Felsen. Buchen und Birken trugen gelbes und rotes Laub, das in der Sonne glänzte. Darüber spannte sich ein seidenweicher blauer Himmel. Wie schön waren die Waldspaziergänge mit der Familie gewesen, mit den Farnen und Glockenblumen am Wegrand, wenn sie über kristallklare Bäche sprangen, in denen unbeweglich die Forellen standen! Aber jetzt schien das Leuchten der Blätter Elisabeth zu verhöhnen, denn in dieser Welt gab es keine Schönheit mehr. Ihr traten die Tränen in die Augen; sie wischte sie verstohlen weg. Abends, nach dem Aufstieg vom Enztal auf die Höhen, hörte Elisabeth in der Ferne ein Jagdhorn. Ihr Herz machte einen Satz und begann zu rasen. Sie nahm Agnes an der Hand und rannte los, alle rannten los. Wieder hatten sie bald die anderen aus den Augen verloren. Elisabeth glaubte, Hundegebell hinter sich zu hören. Zunächst blieb alles ruhig. Dann kam das Bellen näher. Sollten sie sich in einer Höhle verstecken, auf einen Baum klettern, von einem Felsen springen, nur, um ihnen nicht in die Hände zu fallen? Elisabeth dachte an den kleinen Farn und an den warmen Händedruck Jakobs. Sie raffte sich auf, befahl Agnes, die wie zur Salzsäure erstarrt war, mit leiser Stimme, weiterzugehen. Elisabeth kletterte auf einen Felsen, der rot im Mondlicht vor ihnen glänzte. Er war gezackt, sah aus wie ein riesiger Altar. Das Gebell kam immer näher, schon meinte Elisabeth zu sehen, wie die Schatten der Tiere durch den Wald auf sie zusprangen. Wieder ertönte ein Hornsignal. Mit letzter Kraft stemmte sich Elisabeth zum Gipfel des Felsens hinauf, zog Agnes an der Hand nach. Hände, Knie und Beine waren völlig verschrammt, Kleid und Mantel zerrissen. Aber das war jetzt gleichgültig. Oben war eine Mulde zwischen den Felszacken. Beide duckten sich nieder. Elisabeth hörte, wie die Hunde den Fuß des Felsens erreichten und bellend daran hinaufsprangen. Dann vernahm sie Stimmen, laute, barsche Stimmen, die in einer fremden Sprache redeten. Elisabeth drückte sich noch fester in die Mulde hinein und presste, wie schon einmal, Agnes an sich. Sie fror entsetzlich. Nur still liegen und keinen Laut von sich geben. Ihr fiel ein, dass sie ihr Felleisen mit der Nahrung und zwei Decken am Fuß des Felsens verloren hatte. Sei’s drum, wenn die Söldner sich damit zufriedengaben, wären sie wenigstens gerettet. Ein kratzendes Geräusch warnte sie. Offensichtlich begann einer der Männer, am Felsen heraufzusteigen. Der kalte Schweiß brach Elisabeth aus allen Poren. Eine herrische Stimme rief den Söldner zurück. Elisabeth hörte Getrappel, leiseres Hundebellen, das sich entfernende Geräusch von raschelndem Laub, dann war es still. Sie atmete tief aus.
»Lass uns weitergehen, Agnes, wir müssen einen Heustadel finden, um darin zu übernachten, oder ein Bauernhaus.«
»Wir haben nichts mehr zu essen und zu trinken«, klagte Agnes, als sie von dem Fels mehr herunterrutschten als -stiegen.
»So schnell verhungert man nicht«, entgegnete Elisabeth. »Und unseren Durst können wir an den Bächen und Quellen stillen.«
Am Abend erreichten sie ein Gehöft, in dem eine barmherzige Bauernfamilie wohnte. Sie gaben den Mädchen Milch und Brot und rieten ihnen, auf keinen Fall umzukehren, um nicht den Verfolgern in die Hände zu fallen. Am nächsten Morgen erklärten die Bauern ihnen den Weg nach Baden. Einen kleinen Laib Käse und ein halbes Brot gaben sie ihnen mit auf den Weg. Nach einem weiteren Tag in der Wildnis gelangten die Mädchen zum Kloster Lichtenthal, das in eine Schleife der Oos gebettet lag. Von hier aus war es nicht mehr weit in die Bäderstadt mit dem Neuen Schloss, das über den Dächern der Häuser thronte. Über eine Rundbogenbrücke und ein Tor gelangten sie in das Innere der Stadt. Hell gestrichene Häuser mit verspielten Giebeln empfingen sie, schlicht gebaute Badehäuser, in denen vornehm gekleidete Menschen aus und ein gingen. Doch waren die Anzeichen von Plünderung und Zerstörung nicht zu übersehen. Söldner aus aller Herren Länder spazierten umher, Bäcker und Metzger priesen ihre Waren an, Zimmerer sägten Holz, aus den Schmieden drang lautes Hämmern, und Schuster nagelten Lederstiefel zusammen. Da sie von niemandem beachtet wurden, ließen die Angst und die Anspannung bei Elisabeth nach. Und auch Agnes schritt nun leichtfüßiger dahin. Elisabeth bemerkte, dass ihre Schwester die Frauen ungeniert anstarrte. Sie trugen ausgeschnittene Kleider aus Seide und Barchent. Gestärkte Spitzenkragen breiteten sich über ihre Schultern, die Ärmel waren weit und elegant. In ihren Haaren hatten sie Perlenschnüre befestigt. Sie trugen die gepuderten Nasen recht hoch und stolzierten auf den Absätzen ihrer Lederstiefelchen einher.
»Solche schönen Kleider möchtest du wohl auch mal tragen!«, neckte Elisabeth die Schwester.
»Natürlich will ich das, so abgerissen, wie wir aussehen! Und ich wollte schon immer nach Baden, das weißt du doch«, gab Agnes zurück.
»Denkst du gar nicht mehr an unsere Familie?«, wollte Elisabeth wissen. »Ist es dir gleichgültig, was aus den Flüchtlingen im Schwarzwald geworden ist?«
»Wir haben Krieg, Elisabeth, da müssen wir in erster Linie an uns selber denken.«
Elisabeth war fassungslos. So hatte sie ihre kleine Schwester noch nie erlebt.
Vor der Kirche mit den hohen Fenstern und Strebepfeilern blieben sie stehen. Hier wurde ein Markt abgehalten. Elisabeth lief das Wasser im Mund zusammen, als sie die ausgestellten Waren sah: Walnüsse und Maronen in großen Säcken, grüne Bohnen, Fleisch von Hühnern, Rindern und Ziegen, Käse aller Sorten, Trauben, Fässer mit Wein, weißes und schwarzes Brot, Butter, Salz, Ingwer, Kurkuma, Pfeffer und andere Gewürze. Elisabeth zog ihren Geldbeutel heraus und kaufte für sie beide Brot und Wurst.
»Wir müssen beraten, was jetzt zu tun ist«, sagte sie zu Agnes. »Ob wir in einem Kloster um Aufnahme bitten oder …«
»Oder uns eine Arbeit suchen, die uns ernährt«, vollendete Agnes den Satz. »Ich könnte mir gut vorstellen, in dieser Stadt als Bademagd anzufangen.«
Eine ältere Frau in Wollkleidung, die vorüberging, hatte den letzten Satz von Agnes gehört.
»Das ist keine Beschäftigung für ehrbare Frauen«, sagte sie. »Fragt doch mal im ›Roten Ochsen‹ nach, die suchen gerade jemanden für die Küche und für den Garten.«
»Ich danke Euch«, sagte Elisabeth. Wie kam die Frau darauf, sie für ehrbar zu halten? Es lag wohl an den Pelzmänteln, die sie wegen der Wärme ausgezogen hatten und in den Händen trugen. Elisabeth wollte in ihren Geldbeutel greifen, aber die Frau winkte ab und setzte ihren Weg fort. Agnes verzog das Gesicht.
»Als Küchenmagd soll ich mich verdingen, ich, die Tochter eines Mesners, der in der Kirche eine gewichtige Rolle spielt? Lieber wäre ich die Mätresse eines hohen Herrn!«
»Agnes, du weißt nicht, was du sprichst. Gerade erst sind wir mit dem Leben davongekommen, und du hast schon wieder solche Flausen im Kopf. Ich gehe jetzt zum ›Roten Ochsen‹ und versuche mein Glück.«
»Also gut, ich komme mit dir. Wenn man in der Küche schafft, wird man ja wenigstens gut verpflegt werden.«
»Ich habe doch gerade etwas für uns gekauft. Ist dir das nicht gut genug?«
»Ich hätte Lust auf Schweinebraten mit Kraut!«
»Ich verstehe dich ja«, antwortete Elisabeth. »Vielleicht bekommen wir das im ›Roten Ochsen‹.« Auch sie hätte natürlich einen heißen, saftigen Braten dem Brot vorgezogen.
Die Sonne hatte die Steine des Platzes erwärmt. Ein tiefblauer Himmel spannte sich über der Stadt. Der »Rote Ochse« lag in einer Gasse unterhalb von Rathaus und Kirche. Die niedrige Tür stand einladend offen. Ein Duft nach Braten wehte Elisabeth entgegen, was ihre Magensäfte in Aufruhr brachte. Die Gaststube hatte eine rußgeschwärzte Decke und war mit rohgezimmerten Bänken, Tischen und Schemeln ausgestattet.
»Was habt Ihr heute anzubieten?«, fragte Elisabeth den Wirt, einen beleibten Mann mit gelbem Wams und Lederkniehose. Sein braunes, an den Schläfen ergrautes Haar fiel offen auf seine Schultern.
»Schweinsbraten in Biersoße, dazu Kraut und Brotknödel«, erwiderte der Wirt. Elisabeth warf einen Blick in die Küche. Da stand der gemauerte Herd in einer Ecke; auf dem Rost dampfte ein großer Topf mit Kraut, während der Braten von der Frau des Wirtes gewendet und mit Brühe begossen wurde. Die dabei entstehende Soße aus Fett und Saft wurde in einer flachen Raine aufgefangen.
»Wir nehmen zwei Portionen«, sagte Elisabeth. Wenig später standen Zinnteller mit Braten, Kraut und Klößen vor ihnen. Das Fleisch war zart, es fiel fast vom Löffel, das Kraut sämig und die Knödel herzhaft. Inzwischen hatte sich die Gaststube gefüllt, Landsknechte und Marktbesucher ließen sich an den Tischen nieder und bestellten Braten und Wein.
»Was sind wir Euch schuldig?«, fragte Elisabeth den Wirt, nachdem sie beide genüsslich ihr Mahl beendet hatten.
»Zwei Gulden«, meinte der Mann. Er musterte erst sie, dann Agnes. »Woher kommt Ihr und wohin wollt Ihr, wenn ich fragen darf?«
»Wir kommen aus Calw«, übernahm Agnes das Wort. »Da haben Jan van Werths Soldaten die Stadt verwüstet, und wir mussten fliehen.«
»Habt Ihr denn eine Bleibe?«, wollte der Mann wissen.
»Nein«, sagte Elisabeth. »Was verlangt Ihr für ein Bett?«
»Wieso ein Bett?«, fuhr Agnes auf. »Zwei Betten brauchen wir!«
»Wenn wir im Überfluss leben, ist unser Geld bald aufgebraucht«, sagte Elisabeth leise zu ihr, damit es nicht alle hören konnten.
»Drei Gulden« antwortete der Wirt.
»Wir haben gehört, dass Ihr jemanden für die Küche sucht«, fuhr Elisabeth vorsichtig fort.
»Ja, schon, aber so heruntergekommen, wie Ihr ausseht, kann ich Euch nicht in meine Dienste nehmen.«
»Wir werden uns etwas besorgen«, sagte sie. »Wartet Ihr auf uns, gebt Ihr die Stelle keinem anderen?«
»Ja, aber lasst mich nicht zu lange warten!«
Sie gingen noch einmal zum Markt zurück. Einzelne Händler räumten schon ihre Waren zusammen. Zwei alte, zahnlose Frauen saßen auf Schemeln und hatten vor sich Stoffe mit bunten Rändern ausgebreitet, an einer Stange hingen Kleider mit Spitzenkragen sowie Mäntel und Umhänge. In einem Korb ringelten sich gestrickte Strümpfe, wollene Hauben und Röcke. Elisabeth erstand ein Wollkleid für sich, dann hatte sie wenigstens eines zum Wechseln, für Agnes eines aus Leinen mit Taftkragen, dazu Rindslederstiefel als Ersatz für das zerrissene Schuhzeug. Ihr Geldbeutel war sehr viel leichter, als sie zur Herberge zurückgingen. Sie kamen wieder an den Badehäusern vorbei.
»Wir sind so schmutzig, dass wir uns eigentlich nirgends sehen lassen können«, sagte Elisabeth zu Agnes. »Wir müssen baden.«
Agnes’ Gesicht hellte sich auf.
»Mit Rosenöl? Und bekomme ich auch eine Handpflege?«
»Nein, wir baden nur«, entschied Elisabeth, »damit wir besser riechen.«
Die beiden Frauen gingen zu einem der Badehäuser hinüber, die aus rötlichem Sandstein erbaut waren und kleine Fensteröffnungen hatten. Im Inneren war das Fachwerk freigelegt worden. Eine zierliche blonde Bademagd führte sie in einen Raum, in dem zwei hölzerne Zuber standen, half ihnen beim Entkleiden und hüllte sie in Leinenhandtücher.
»Das alte Zeug gebe ich zum Waschen und Flicken«, sagte sie und verschwand. Wenig später brachte eine weitere Magd zwei Ledereimer mit heißem Thermalwasser, das sie in die Zuber schüttete. Das wiederholte sich einige Male. Sie goss jeweils etwas Rosenöl hinein.
»Nun überlasse ich Euch dem Vergnügen«, sagte sie und wandte sich zum Gehen.
Die beiden stiegen ins heiße Wasser. Da, wo der Söldner mit seiner Pike zugestochen hatte und wo Dornen und spitze Steine sie verletzt hatten, spürte Elisabeth ein Brennen. Aber bald breitete sich ein wohliges Gefühl in ihrem Körper aus. Über ihr spannte sich eine Gewölbedecke.
»Ach, ist das gut«, rief Agnes und ließ sich in den Zuber gleiten. Ihr schmaler Körper war noch nicht voll entwickelt, der Busen war klein und spitz. Mit ihren achtzehn Jahren wirkte Elisabeth schon wesentlich fraulicher, wenn sie auch in den letzten Tagen an Gewicht verloren hatte. Durch die schmalen Fenster fiel goldenes Licht. Elisabeth wusch ihr langes, dunkelblondes Haar mit Seife, rubbelte ihren Körper mit einem Schwamm und lag eine Weile sinnend in der Wanne. Auch Agnes schien das Bad zu genießen, denn immer wieder hörte Elisabeth wohlige Laute aus ihrer Richtung. Elisabeth musste, wie so oft in den letzten Tagen, an den Musketier denken, der sie unter Gefahr für sein eigenes Leben zur Stadtmauer in Calw geführt hatte. Wie war es ihm seitdem ergangen? Ob er sie schon vergessen hatte? Die Magd kam noch einmal, um heißes Wasser nachzugießen und ihnen die Nägel mit einer Sandelholzfeile zu reinigen. Nach einer weiteren halben Stunde stieg Elisabeth aus der Wanne, trocknete sich ab und schlüpfte in die frischen Kleider. Agnes machte keine Anstalten aufzustehen.
»Komm, wir müssen zurück in die Wirtschaft«, sagte Elisabeth. Endlich stieg Agnes aus dem Kübel, trocknete sich ab und legte das neue Kleid an. Die alten Kleider bekamen sie noch feucht mit auf den Weg. Elisabeth zahlte. Draußen war es inzwischen dunkel und entsprechend kalt. Im »Roten Ochsen« hatten sich einige Adlige eingefunden. Ihre scharlachroten Röcke waren mit Samt ausgeschlagen, bunte Federn schmückten die Hüte, und an den hohen Stiefeln trugen sie Sporen. Auf den Tischen vor ihnen standen Tonschüsseln mit Wildschweinbraten, Krautsalat und gekochten Pflaumen. Die Teller waren randvoll, und sie tranken Wein aus Zinnbechern. Sie waren nicht mehr ganz nüchtern und starrten ihnen entgegen.
»Holla, Ihr süßen Jungfern, habt Ihr schon ein Bett für die Nacht?«, rief einer und prostete ihnen zu.
»Ich weiß, wo ich hingehöre«, antwortete Elisabeth.
Agnes streckte die Brust heraus, stemmte die Arme in die Hüften und sagte: »Was wäre es Euch denn wert, mein Herr?«
Alle lachten dröhnend.
»Ein paar Gulden würde ich dabei schon springen lassen«, entgegnete der Sprecher. Elisabeth stieß Agnes in die Seite. »Was machst du denn da?«, zischte sie ihr zu. »Du hast wohl deine gute Erziehung vergessen!«
»Ich weiß, was ich tue«, gab Agnes schnippisch zurück.
Der Wirt tauchte aus der Küche auf. Er stellte einen Teller mit Kraut auf den Tisch und rief: »Ich habe es wohl gehört, meine Herren. Denkt nicht, dass Ihr hier derart verfahren könnt. Dies ist und bleibt ein ehrenhaftes Haus, in dem selbst die Bediensteten des Markgrafen verkehren!«
»Und denkt nicht, dass wir leichte Beute für Euch seien, nur weil wir keinen männlichen Schutz haben!«, setzte Elisabeth hinzu.
»So eine kalekutische Henne!«, schimpfte der Mann, der zuerst gesprochen hatte.
»Ich gewähre Euch Schutz, da Ihr beide ab heute bei mir arbeitet«, sagte der Wirt und strich sich eine Strähne aus dem feisten Gesicht. »Gegen Kost und Unterkunft.«
Seine Frau, ebenfalls recht beleibt, stand mit großen Augen am Eingang der Küche.
»Zeig ihnen das freie Zimmer, Melvine«, rief der Wirt seiner Frau zu und kehrte zu seinem Platz hinter dem Tresen zurück. Die Wirtin holte einen Kienspan aus der Küche und leuchtete ihnen auf einer Stiege nach oben voraus. Sie wies auf die Türen.
»Das waren früher Knechte- und Mägdekammern«, sagte sie.
»Und wer wohnt jetzt darin?«, fragte Elisabeth.
»Niemand«, gab die Wirtin zur Antwort. »Aber es dient immer wieder durchziehenden Söldnern als Quartier.«
Mit einem Blick auf Agnes sagte Elisabeth: »Dann hoffen wir mal, dass die Söldner der Stadt schon eine Bleibe gefunden haben.«
Der Raum war so ausgestattet, wie Elisabeth es erwartet hatte: zwei Betten mit strohgefüllten Matratzen, eine Truhe, ein Kreuz an der Wand. Sie richteten sich notdürftig ein und gingen dann wieder hinunter in den Gastraum. Die Adligen waren inzwischen verschwunden. Die Wirtin brachte ihnen eine dampfende Schüssel und zwei Zinnlöffel. Wie das duftete! Und es waren richtige Fleischbrocken in der Suppe, so etwas hatte es auch zu Hause nicht oft gegeben. Sie widmeten sich dem Essen.
Nach dem Spätmahl gähnte Elisabeth herzhaft.
»Es wird Zeit, ins Bett zu gehen«, meinte sie und leerte ihren Becher mit Wein.
»Ich bin aber noch nicht müde«, begehrte Agnes auf. »Lass uns noch ausgehen.«
»Wohin willst du ausgehen?«, fragte Elisabeth. »Ohne männliche Begleitung ist das sehr unschicklich, liebe Agnes!«
»Ich würde überhaupt nicht dazu raten, nachts auszugehen«, ließ sich Paul, der Wirt, vernehmen, »weder in männlicher noch ohne jede Begleitung.«
»Warum?«, fragte Elisabeth. Agnes machte ein trotziges Gesicht.
»Weil«, Paul beugte sich ein wenig näher zu ihr, »weil hier in der Stadt schwedische und französische Söldner einquartiert sind. Meine Frau Melvine hat es Euch gewiss schon erzählt. Denen kann man nicht trauen. Sie haben zwar die Stadt kaum ausgeplündert, als sie kamen, das haben schon der Markgraf und der Kardinal von Straßburg verhindert, aber sie nehmen sich, was sie kriegen können, auch Frauen und blutjunge Mädchen.«
Elisabeth erschrak. Die schrecklichen Bilder stiegen wieder vor ihren Augen auf.
»Aber warum ein Kardinal?«, fragte sie. »Der müsste doch katholisch sein und zu den Kaiserlichen, den Habsburgern, halten.«
»Kardinal Thomas Weltlin steht auf der Seite der Schweden. Nach der Niederlage in Nördlingen hat er sich dem Heer des Bernhard von Sachsen-Weimar angeschlossen und weilt nun hier in der Residenz des Markgrafen. Die Schweden und die Franzosen kämpfen gemeinsam gegen den Kaiser von Habsburg.«
»Ach, deshalb sind wir hier so gut gelitten«, sagte Elisabeth. »Als Protestanten haben sie von uns nichts zu befürchten, sozusagen.«
»So ist es«, sagte Paul, der Wirt.
Elisabeth beschloss, einen Vorstoß zu wagen.
»Wisst Ihr auch, wo sich die kaiserliche Armee gerade befindet?«, fragte sie gespannt.
»Umherziehende Söldner haben berichtet«, antwortete der Wirt, »dass sie von Herrenberg über Calw nach Neuenbürg gezogen seien und von dort nach Ettlingen ins Winterquartier gehen wollen.«
»Wo liegt Ettlingen?«, wollte Elisabeth wissen.
»Etwa eine Tagesreise von hier«, sagte der Wirt.
Das war ja gar nicht so weit entfernt. Vielleicht würde sie Jakob doch noch einmal begegnen, sie wünschte es sich so sehr. Sie versuchte, sich an den Klang seiner Stimme zu erinnern. War seine Mundart nicht von der ihren verschieden gewesen? Es hatte so wie das Bayerische geklungen, das sie schon von fahrenden Händlern gehört hatte.
»Warum wollt Ihr das wissen?«, fragte Melvine, die Wirtin, die wieder dick und rosig in der Öffnung zur Küche stand.
»Man sollte immer wissen, wo der Feind gerade steht«, antwortete Agnes anstelle ihrer Schwester.
3.
Jakob war froh, der Gegend den Rücken kehren zu können. Er fühlte sich miserabel. Bei der Zerstörung Calws waren fast alle Häuser verbrannt, dreiundachtzig Menschen waren ums Leben gekommen, und Jakob wusste, dass noch eine Vielzahl davon an Hunger und Seuchen sterben würden. Er fragte sich, warum er dem Grauen keinen Einhalt geboten hatte. Gut, er hatte die beiden Mädchen vor den Söldnern gerettet und dafür zu sorgen versucht, dass nicht noch mehr Morde und Vergewaltigungen geschahen. Die Söldner waren ausgehungert und schon seit Tagen ohne Sold gewesen, so dass sie sich wie die wilden Horden auf die Vorräte und die Menschen der Stadt gestürzt hatten. Wenn die Calwer doch nur die Tore geöffnet und ihre Habe freiwillig hergegeben hätten! So aber hatten sie mit Brandschatzung drohen und, als die Calwer das Geld angeblich nicht aufbringen konnten, tatsächlich die Stadt anzünden müssen. Mit seinem Haufen zog Jakob durch das Nagoldtal, dann über die Kämme des Schwarzwaldes, um zum Heer von Jan van Werth aufzuschließen. Die Nebel der vergangenen Tage hatten sich gelichtet, eine milde Sonne beschien Wiesen, Wälder, Dörfer und einzelne Gehöfte. Spinnweben schwebten durch die Luft. Die bewaldeten Hänge glänzten schwarz, dazwischen flammten rot und gelb die Laubbäume auf. Seine Männer und er rasteten nur wenig. In den anderen Ortschaften war nicht so viel zu holen wie im reichen Calw. Das Heer Jan van Werths lagerte oben auf dem Schloss von Neuenbürg, der Stadt an der wilden Enz. Jakob zog mit seinem Haufen zum Schloss hinauf. Im Schlossgarten, der von einer Mauer umgeben war, standen unzählige Zelte, Feuer brannten, es dampfte aus Töpfen, die über der Glut hingen, Fett von jungen Schweinen zischte in die Glut. Es war ein babylonisches Gemisch aus fremden Sprachen, aus Menschenleibern, die Schweiß ausdünsteten, Kindern, Frauen und glänzenden Pferdeleibern. Pulverdampf vernebelte die Sicht, der Geruch von Rossäpfeln stand in der Luft. Das Heer umfasste viertausend Mann, und noch einmal so viele Personen bildeten den Tross mit den Familien der Söldner, mit Händlern, Marketenderinnen und Dirnen. Sie wohnten teils hier oben, teils in Zeltlagern vor der Stadt. Jan van Werth selbst bewohnte selbstverständlich das Schloss, die Eigentümer hatten sich derweil woanders einquartieren müssen. Er empfing Jakob im Speisesaal. Jakob rechnete damit, bald zum Hauptmann befördert zu werden, weil Johann von Werth große Stücke auf ihn hielt. Und Jakob wusste, dass es dann vorbei sein würde mit dem Hungern und Beutemachen, denn je höher man im Rang stand, desto besser die Verpflegung und auch die sonstigen Lebensumstände.
»Gott zum Gruße, Bayer«, sagte van Werth. Das war sein Neckname für Jakob. Dabei kamen viele der Söldner des Heeres aus diesem Landstrich. Der General hatte ein rundes Gesicht mit Augenbrauen, die ständig wie fragend nach oben gezogen waren. Seine Haare trug er in geordneten Locken um den Kopf. Über dem Wams ragte der unausweichliche weiße Stehkragen empor, ein rotes Tuch war um seinen Hals geschlungen. Vor ihm stand eine Schüssel mit Hechtsuppe. Van Werth lud Jakob mit einer Handbewegung ein, Platz zu nehmen. Eine Magd, die ihn hatte kommen sehen, trug ein weiteres Gedeck herein.
»Du weißt ja, dass ich am liebsten alleine speise, Bayer«, sagte van Werth. »Nur dich habe ich gerne um mich. Du bist mir angenehmer als der Pöbel, der ohne Sinn und Verstand durch die Dörfer mordet und plündert.«
Die Magd schöpfte Jakob Suppe in eine Schüssel. Sie war gut mit Salz, Pfeffer und Ingwer gewürzt. Nachdem er seinen ersten Hunger gestillt hatte, begann er seinem Heerführer von den Geschehnissen der letzten Tage zu berichten.
»Wir lagen zwei Tage und Nächte in Calw«, sagte er. »Da haben wir uns nicht gerade mit Ruhm bekleckert.«
»Was meinst du damit?«, fragte van Werth und nahm ihn scharf ins Visier.
»Ich habe versucht, es zu verhindern, aber es kam zu Mord und Totschlag und zur Brandschatzung.«
»Das Töten von Menschen habe ich verboten«, sagte van Werth grimmig. »Dafür werden sie mit Stockhieben bestraft werden. Nur in der Not habe ich es ihnen gestattet.«
»Sie glaubten wohl, sie wären in Not«, versetzte Jakob. »Ein Teil von ihnen ist dann den Flüchtigen nach, auch das konnte ich nicht verhindern.«
Hoffentlich haben sie die Mädchen nicht gefunden, setzte er in Gedanken hinzu, hoffentlich haben sie niemanden erwischt.
»Sei’s drum, wir sind im Krieg«, brummte van Werth. »Auf jeden Fall hast du dich bewährt, und ich werde dich ab sofort zum Hauptmann befördern. Du weißt, was das bedeutet.«
»Ja, das weiß ich, Jan«, sagte Jakob.
Die Magd und ein Knecht erschienen mit Platten, auf denen Krebspasteten lagen, gesottene Hechte, weißes Hühnerfleisch und gekochte Erbsen mit Buttersoße. Ein weiterer Diener brachte Krüge mit Neckarwein. Jakob ließ es sich schmecken, auch wenn die Bilder der letzten Tage ihn noch verfolgten.
»Denkst du über das nach, was geschehen ist?«, fragte van Werth. »Das solltest du nicht. Wer die Schlacht bei Nördlingen überstanden hat, der sollte stolz und unbeeindruckt durch die Welt gehen. Dem Krieg entkommt keiner, Jakob, du nicht, ich nicht und nicht ein Söldner, kein Mann, keine Frau, kein Kind, kein Huhn, kein Pferd und keine Kuh. Versuch das Beste für dich dabei herauszuschlagen, für dich und für uns alle.«
Jakob dachte daran, wie es früher gewesen war, vor dem großen Krieg. Als der im Jahre 1618 begann, war er gerade einmal