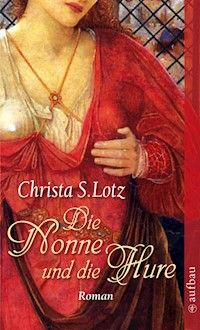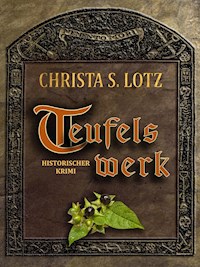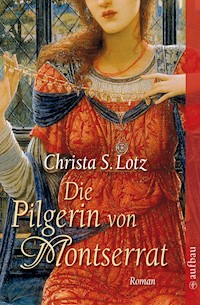
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Geheimnis des ersten Kreuzzuges.
Im Jahre 1546 finden Teresa und ihr Vater Froben in ihrer Bibliothek, wo sie an einer Familienchronik arbeiten, ein uraltes Pergament. Ihr Vorfahr Friedrich von Wildenberg nahm am 1. Kreuzzug im Jahre 1096 teil und brachte einen Goldkandelaber in das Kloster Agenbach im Schwarzwald. Diese Reliquie soll jedem, der sie besitzt, Macht, Reichtum und Glück bescheren. Teresa und ihr Vater beschließen, nach der Reliquie zu suchen. Noch in derselben Nacht wird Froben überfallen, der Torwächter der Burg ermordet und das Pergament gestohlen. Als Teresa und Froben nach Agenbach reiten, werden sie von zwei Reitern verfolgt. Alexius, der Bibliothekar des Klosters, eröffnet ihnen, dass der Kandelaber zwar damals ins Kloster gebracht worden, aber seitdem verschwunden sei. Wahrscheinlich sei er nach Santiago de Compostela oder nach Montserrat gebracht worden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 568
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Christa S. Lotz
Die Pilgerin von Montserrat
Roman
Impressum
ISBN 978-3-8412-0788-3
Aufbau Digital,
veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Februar 2014
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin
Die Originalausgabe erschien 2009 bei Aufbau Taschenbuch, einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Dagmar & Torsten Lemme, Berlin
unter Verwendung eines Ausschnitts aus dem Gemälde »Oh, Swallow, Swallow« von John Melhuish Strudwick, 1894
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig, www.le-tex.de
www.aufbau-verlag.de
Auf den Gipfel ist das Ziel
Und das Ende unseres Lebens
Auf ihn ist unsere Wallfahrt gerichtet.
Francesco Petrarca, 1304–1374
Inhaltsübersicht
Cover
Impressum
1. Buch: Die Chronik
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
2. Buch: Die Reise
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
3. Buch: Das Geheimnis
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
4. Buch: Die Rückkehr
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
Nachwort
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …
1. Buch: Die Chronik
1.
Teresa hielt einen Augenblick lang inne und schaute wie gebannt auf die Flamme der Öllampe. Der Sturm machte eine Pause, vielleicht um Atem zu holen für einen neuen Angriff. Es ächzte und stöhnte in den alten Mauern. Die Flamme zuckte, drohte zu erlöschen und brannte ruhig weiter, als wäre nichts geschehen. Der Regen klatschte gegen die gegerbte Lammhaut, die vor das kleine Fenster des Raumes gespannt war. Teresa nahm die Lampe, goss aus einem Kupferkännchen Rübsenöl nach und verließ die Kammer. Um zur Bibliothek zu gelangen, in der sie gewöhnlich mit ihrem Vater zu Abend aß, musste sie einen düsteren Gang durchqueren. Im Schein des Lichtes sah sie die feucht glänzenden Wände, roch den Modergeruch. Trotz der Mauerstärke hörte sie weit entfernt den Sturm heulen. Sie nahm direkt vor ihrem Kopf eine Bewegung wahr und hielt den Atem an.
Etwas näherte sich lautlos mit raschen Flügelschlägen und landete mitten in ihrem Gesicht. Teresa schrie auf. Schon war das Wesen wieder weg, aber sie spürte, wie ihr das Blut von den Wangen aufs Kinn tropfte. Rechts und links von ihr schossen weitere geflügelte Gestalten vorbei. Teresa drehte sich um und hob mit zitternden Händen die Lampe. Sie erkannte die großen Ohren und das seidenweiche, braunschwarze Fell der Tiere. Hatten die Fledermäuse hier schon ihr Winterquartier aufgeschlagen und waren durch sie aufgestört worden? Sie wusste, dass es harmlose Säuger waren, die in der Nacht auf die Jagd gingen, Insekten und Kleinlebewesen als Nahrung suchten. Und doch … sagte Ursula, die Köchin, nicht, dass sie Gefährten des Bösen seien?
Ihr Herzschlag hatte sich wieder beruhigt. Sie wischte sich das Blut aus dem Gesicht und lief schnell die letzten Schritte, bis sie aus dem Gang in eine kleine Halle kam. Sie öffnete die Tür zur Bibliothek. In dem großen Raum hatte der Diener Caspar ein Talglicht entzündet. Im Kamin prasselte ein Feuer aus Buchenholzscheiten. Teresas Vater, Froben von Wildenberg, saß in einem Stuhl mit hoher geschnitzter Lehne vor einem Pult, auf dem ein dickes, schon etwas vergilbtes Buch lag. Teresa liebte den Geruch der vielen Bücher, die an Regalen entlang der Wände aufgestellt waren. Sie rochen nach dem Staub von Jahrhunderten. An einer Seite der Bibliothek war die Wand mit Fresken bedeckt. Froben war in grauen Wollstoff gekleidet; grau waren sein Rock und sein langer Pelz, den er über die Lehne eines Stuhles gehängt hatte. Er blickte ihr aus seinen Augenspiegeln entgegen, die auf seiner Nase klemmten.
»Du kommst spät, Teresa, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Du hast ja Blut im Gesicht!«
»Ich wurde im Gang von Fledermäusen gestreift.«
»Ach, du Armes, zeig mal.« Er untersuchte ihre Wunden. »Ich werde gleich die Ringelblumensalbe holen. Wie kommen die Tiere bloß dahin? Sonst ziehen sie sich zum Winterschlaf in die Höhlen der Umgebung zurück. Und natürlich hast du an die Worte von Ursula gedacht, dass sie etwas Böses an sich haben, diese kleinen Biester. Haben sie aber nicht, glaube den Unfug nicht.«
»Ich glaube, dass sie ein Unheil anzeigen. Heute wird bestimmt noch etwas geschehen.«
»Und wenn schon! Das werden wir schon meistern, du und ich. Haben wir bisher nicht alles zusammen erreicht, was wir wollten?«
»Als ich von Krähenstetten zurückkam, stand Wilhelm, unser alter Hakenschütze, im Tor. Der Wind war schon so stark geworden, dass er Äste und Zweige heruntergerissen hatte.«
»Und? Was hat er gesagt?«, wollte Froben wissen.
»Er hat gesagt, dass kurz vorher eine Kröte zu ihm hereingekrochen sei, seitdem müsse er immer an sie denken.«
»Ihr beide messt den Dingen zu viel Bedeutung bei«, brummte Froben. »Sie wird Schutz vor dem Wetter gesucht haben.«
Ohne ihre Antwort abzuwarten, wandte ihr Vater sich zur Tür, ging hinaus und kehrte bald darauf mit einem Töpfchen Ringelblumensalbe zurück. Die kühlende Arznei tat Teresas Haut wohl. Auf dem kleinen, runden Tisch mit den zierlich gedrechselten Füßen war das Familienporzellan für das Abendessen aufgelegt. Auch in diesem Raum hing zum Schutz gegen die nächtliche Kälte eine Decke vor dem Fenster, die sich im stürmischen Wind hin und her bewegte. Ein Kerzenleuchter warf sein Licht auf das Gedeck; es flackerte, wenn eine kühle Böe den Raum durchstrich.
Teresa setzte sich auf einen der beiden Stühle, ihr Vater tat es ihr nach. Er wandte ihr sein breites Gesicht mit dem gezwirbelten Schnurrbart zu. Ein Lächeln lag in seinen Mundwinkeln, und seine Augen glitzerten wie schwarzer Onyx.
»Unsere Magd Kathrin, die kleine Schwatzbase, hat dir sicher schon erzählt, dass uns die Einquartierung der adligen Nachbarn bevorsteht«, sagte er.
»Das hat sie. Fürchtest du auch …?«
»Es wird zu eng hier oben. Ich kann mich kaum bewegen, wenn sie da sind. Das war schon einmal der Fall. Vor allem können wir uns dann nicht mehr mit der Familienchronik befassen.«
»Sollen wir nicht auf unsere Residenz in Peterszell ausweichen?«
»Dort herrscht ebenfalls zu viel Geschäftigkeit. Teresa, die Aufgabe, diese Chronik zu vollenden, sehe ich geradezu als heilig an, die dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen.«
»Nun gut«, sagte sie. »Noch ist ja Zeit, noch hat keiner von ihnen ans Tor geklopft. Wir werden nachher weiterarbeiten. Aber eins möchte ich dich noch fragen: Sollte Barbara nicht zu uns kommen? Im Kloster Inzigkofen ist sie nicht sicher. Vom Schmalkaldischen Bund und dem Kaiser aus wird es bestimmt auch hier zu kriegerischen Handlungen kommen.«
»Ich habe gestern einen Boten nach Inzigkofen hingeschickt. Er kehrte unverrichteter Dinge zurück; deine Schwester wollte ihrem Gelübde treu bleiben. Und vielleicht ist es besser so.«
»Du meinst, weil sie … blind ist?«
»Sie müsste hier auf engstem Raum mit Männern leben.«
Der Diener Caspar, gekleidet in ein schwarzes Wams und graugestreifte Halbhosen, kam mit einer silbernen Kasserolle herein, stellte sie mit einer angedeuteten Verbeugung auf den Tisch und hob den Deckel. In Butter geröstete Weißbrotscheiben häuften sich neben glänzenden Artischockenherzen. Caspar stellte einen Gewürzständer in Form eines Schwanes daneben. Im Rücken und in den Flügeln des Tieres befanden sich Höhlungen, die mit Salz, Muskatblumen und Pfeffer gefüllt waren. Der Diener wünschte einen gesegneten Appetit und entfernte sich. Der zweite Diener mit Namen Heinrich trat ein und setzte einen Krug mit frischem, schäumendem Bier auf dem Tisch ab, einen anderen mit Wasser. Im Gegensatz zu Caspar, der groß und hager war, empfand Teresa Heinrich als klein, dicklich und verschlagen, weil er stets in eine andere Richtung schaute, wenn ihn der Blick eines Menschen traf.
»Den Herrschaften möge es wohl bekommen«, näselte er mit einer Stimme, die Teresa schon immer unangenehm gewesen war.
»Können wir nicht einen anderen Diener einstellen?«, fragte Teresa, nachdem Heinrich sich entfernt hatte. »Er ist mir unheimlich.«
»Es ist nicht leicht, hier auf dem Land Dienerschaft zu bekommen«, antwortete ihr Vater. »Jetzt lass uns beten.«
Teresa faltete die Hände, senkte die Augen auf den Tisch, und gemeinsam sprachen sie die Worte:
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein,
sondern von jedem Wort,
das aus dem Munde Gottes geht.
Amen.
Teresa war so hungrig, dass sie am liebsten die Hälfte des Gemüses auf ihren Teller gehäuft hätte. Doch sie besann sich ihrer Erziehung, spießte eine Brotscheibe auf ihr Messer, legte ein paar Artischocken dazu und streute Gewürze darüber. Ihr Vater nahm nur ein Stück Brot.
»Du isst spartanisch wie eh und je«, neckte sie ihn. »Ich frage mich, warum du nicht noch mehr vom Fleisch gefallen bist – du ernährst dich ja von nichts anderem als von Brot und Wasser!«
»Dafür habe ich eine Tochter, die sich keinen Genuss entgehen lässt«, gab er zurück. »Doch nein, es erfreut mich immer wieder zu sehen, dass es dir schmeckt und du auch Freude am Kochen hast. Das wird dir einmal von Nutzen sein.«
»Zum Nutzen für wen?« Sie blickte ihn einen Moment lang schärfer an, als sie es beabsichtigt hatte.
»Nun ja, irgendwann werden wir die Chronik beendet haben, und irgendwann wird es auch Zeit für dich, dein Leben an der Seite eines Mannes zu verbringen.«
»Daran möchte ich nicht denken. Ich bin für etwas anderes geboren.«
»Ich weiß schon, du willst schreiben, etwas von der Welt sehen … Leider ziemt sich das nicht für ein Mädchen von Stand.«
»Ich habe Petrarca gelesen«, erwiderte Teresa. »Wie du weißt, ist er im Jahr 1336 auf den Mont Ventoux gestiegen, einzig zu dem Zweck, sich selbst und der Natur näher zu kommen.« Sie zitierte: »Und es gehen die Menschen hin, zu bestaunen die Höhen der Berge, die ungeheuren Fluten des Meeres, die breit dahinfließenden Ströme, die Weite des Ozeans und die Bahnen der Gestirne und vergessen darüber sich selbst. – Ich möchte wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen«, fuhr sie fort. »Möchte weiterkommen, ferne Länder sehen und fremde Menschen kennenlernen!«
»Du wirst das ganz sicher erleben, mein Kind, aber hüte dich davor, es allzu wichtig zu nehmen.«
Nachdem Teresa die Gartenfrüchte mit dem köstlichen Aroma verspeist, der Vater sein Brot verzehrt hatte, öffnete sich die Tür. Caspar trat nah an ihren Tisch heran, so nahe, dass Teresa sich unwillkürlich zurücklehnte. Er fragte, ob die Herrschaften weitere Wünsche hätten.
»Eine kleine Scheibe Schweinsbraten mit Soße«, sagte Teresa.
Froben winkte ab. »Bring mir noch einen Krug Wasser«, sagte er zu Caspar.
Der Diener verbeugte sich. Teresa stellte sich vor, dass seine Hakennase dabei den Tischrand berühren würde, und unterdrückte ein Kichern. Der Wind ließ jetzt nach; im Raum war es kühler geworden, da das Holz im Kamin heruntergebrannt war. Caspar legte neues nach, räumte das Geschirr zusammen und entfernte sich. Kurz darauf kehrte er mit dem Braten, einer Schüssel voll Birnenmus und dem Wasser zurück.
»Du solltest dich ein wenig besser benehmen«, sagte Froben und drohte seiner Tochter scherzhaft mit dem Finger. Sein Gesicht wurde ernst. »Es geht mir heute noch nach, dass deine Mutter so früh hat sterben müssen, sie hatte sehr viel Sinn für gutes Betragen. Und da mir ein Sohn versagt blieb, bist du meine einzige Hoffnung. Mit deinen blonden Haaren und deiner zierlichen Figur erinnerst du mich immer wieder an sie.«
Seine Augen wurden feucht. Teresa erinnerte sich gut an die Krankheit ihrer Mutter. Sie dachte an das Stöhnen, das aus dem Krankenzimmer gedrungen war, an den scharfen Geruch, an die spitze Nase und die eingefallenen Wangen. Ihre Mutter war an der Cholera gestorben. Sie wischte die Erinnerung fort. Ob ihr Vater die Chronik deswegen zu Ende bringen wollte, weil sein Geschlecht mit ihr, Teresa, aussterben würde, selbst wenn sie heiratete? Sie wandte sich wieder ihrem Braten zu und nahm einen herzhaften Zug aus dem Bierkrug. Froben aß ein wenig von dem Birnenmus und trank Wasser.
»Wir werden nachher, bevor ich dir weiter aus der Chronik diktiere, noch in die Wunderkammer gehen, die hat deine Mutter sehr geliebt, wie du weißt.«
Darauf freute sich Teresa. Froben gewährte nur selten jemandem einen Blick in diese Kammer, und wenn, dann nur Familienmitgliedern oder engen Freunden. Daher konnte sie es kaum erwarten, dass die Mahlzeit beendet und das Geschirr abgetragen wurde. Nachdem er sich vergewissert hatte, dass niemand außer ihnen in der Bibliothek war, bat Froben seine Tochter, den Leuchter zu nehmen. Er selbst trat zu einem der Regale und schob es beiseite. Dahinter befand sich eine Tür, die mit scharlachrotem Damast bespannt war. Ihr Vater nahm einen Bartschlüssel von seinem Gürtel und schloss auf. Er ließ seine Tochter vorangehen. Wie immer, wenn sie diesen Raum betrat, befielen sie Verwunderung und gleichzeitig eine Angst, die sie sich nie hatte erklären können. Die Kammer war etwas größer als ihre Kemenate. Die Kerzen beleuchteten Truhen mit Holzbrandmalereien und Kommoden, deren vergoldete Schnitzereien Teresa immer aufs Neue beeindruckten. Einige der Schubladen waren halb geöffnet; aus ihnen quollen allerlei Dinge wie silber- und goldgeschmiedete Ketten, Korallen, Perlen und Bergkristalle, bemalte Straußeneier und Tiere aus Elfenbein. In einem Regal standen vergilbte alchimistische Bücher, und auf dem Tisch in der Mitte thronte neben einem Astrolabium ein Globus. Verschieden große Zirkel lagen neben Kolben, Schröpfgläsern und scharfen Messern. Teresas Blick fiel auf einen Gegenstand, der sie erstarren ließ. Es war eine präparierte Fledermaus. Die großen Ohren standen senkrecht über dem kleinen, mausähnlichen Kopf mit den Nagezähnen. Die Augen des Tieres wirkten lebendig, sie schienen sie anzustarren. Wieder spürte sie das weiche Fell an ihrem Gesicht, den Schmerz der winzigen Krallen.
»Vater«, sagte sie mit erstickter Stimme, »was bedeutet dieses tote Tier? Warum hast du es in deine Raritätensammlung aufgenommen?«
Froben, der hinter ihr den Raum betreten hatte, meinte: »Ich habe die Fledermaus nicht zu einem bestimmten Zweck in die Sammlung gebracht. Sie ist einfach eine Kuriosität, die ich während einer Reise auf einem Markt gekauft habe.«
Teresa drehte sich zu ihm um, breitete wie hilfesuchend die Arme aus.
»Was ist mit dir?«, fragte er. »Du bist ja ganz blass.«
»Ich glaube, dass bei uns bald ein Unheil geschehen wird.«
»Warum meinst du das?«
»Weil Fledermäuse Unglück bringen. Ich habe das Gefühl, dass etwas Entsetzliches passieren wird.«
»Das sind Hirngespinste.« Ihr Vater legte ihr beruhigend die Hand auf den Arm. »Ich werde Ursula sagen, dass sie dir keine Gespenstergeschichten mehr erzählen soll.«
»Es war nicht nur Ursula, sondern auch meine Amme Maria.«
»Vergiss es doch einfach. Wir beide sind hier, um die Chronik unserer Familie fertig zu schreiben, und es wird überhaupt nichts passieren, das verspreche ich dir!«
Teresa fühlte sich halbwegs getröstet. Sie trat auf eine der Kommoden zu, bückte sich, hob den Leuchter vor die unterste Schublade.
»Schau mal, da ist ein sehr hübsches Kästchen.« Sie nahm es heraus. Es war ein kleiner Kasten aus Kirschbaumholz, einer Truhe nachgebildet, wenn auch etwas wurmstichig und schwärzlich verfärbt, als hätte er einen Brand überstanden. Teresa erkannte aber deutlich die Schnitzereien und die versilberten Sterne auf dem Deckel.
»Das ist eine Hinterlassenschaft unserer Vorfahren«, sagte Froben hinter ihrem Rücken. »Das Kästchen ist mit Schmucksteinen gefüllt. Du darfst es ruhig öffnen.«
Der Wind hinter den Mauern des Raumes begann sich wieder zu erheben. Teresa war es ganz feierlich zumute. Der Stammbaum ihrer Familie reichte bis ins 11. Jahrhundert zurück. Es war ihr eine Ehre, so alte Gegenstände zu berühren. Sie wollte den Leuchter auf die Kommode stellen. In diesem Moment – war es ein Augenblick der Schwäche? – entglitt das Kästchen ihrer Hand und schlug mit einem Klacken auf dem Boden auf.
»Wie ungeschickt, Teresa«, entfuhr es ihrem Vater. »Hoffentlich ist es nicht beschädigt worden.«
Sie gingen beide gleichzeitig in die Hocke. Eine Menge glitzernder Perlen lag über den Boden verstreut. Mittendrin bemerkte Teresa noch etwas anderes. Das Kästchen war offensichtlich in zwei Teile zersprungen, und als sie näher hinsah, entdeckte sie eine kleine Pergamentrolle.
»Na, so etwas«, bemerkte Froben. »Das Ding scheint einen doppelten Boden gehabt zu haben.« Er nahm das Pergament und richtete sich mühsam auf. Teresa schien es, als wäre dem Kästchen ein Geruch nach Weihrauch entströmt.
»Komm, gehen wir zurück in die Bibliothek«, meinte ihr Vater.
Froben schob das Regal wieder an die alte Stelle zurück, ging hinüber zu seinem Schreibpult und breitete das Pergament darauf aus. Teresa setzte sich auf einen Stuhl und hörte mit wachsendem Interesse, was ihr Vater vorlas:
»Ich, Friedrich von Wildenberg, habe im Jahr 1096 am Kreuzzug zum Heiligen Grab teilgenommen. Gottfried von Bouillon aus Lothringen führte unseren Zug an. Bei der Schlacht um Jerusalem 1099 wurde mein Bruder Albrecht tödlich verwundet, ich selbst entkam schwer verletzt dem Massaker. Aus der Heiligen Stadt brachte ich einen Goldkandelaber in die Heimat mit, den ich dem Kloster Agenbach im Schwarzwald zur Aufbewahrung übergab. Dieser Kandelaber hat einen unermesslichen Wert für denjenigen, der ihn besitzt: Er verleiht ihm Macht über andere, Reichtum, Glück und dauernde Gesundheit. Ich spüre, dass meine Zeit bald um sein wird. Deshalb gebe ich diese Niederschrift meinem Diener Abel, damit er sie nach Wildenberg bringe.
Agenbach, im Jahre des Herrn 1099, 12. Dezember«
2.
Froben schaute von dem Pergament auf, blickte Teresa aus seinen Augengläsern an, die seine Pupillen stark vergrößerten, und fragte: »Was hältst du davon?«
»Das ist ein ganz wichtiges Dokument für unsere Familienchronik. Unser letzter bekannter Vorfahr starb im Jahre 1224. Dieser Friedrich muss zumindest einen Sohn hinterlassen haben, sonst wäre unser Geschlecht ausgestorben.«
»So sehe ich das auch«, meinte Froben. »Es ist ein sehr wertvolles Dokument. Ich möchte dich bitten, es gleich abzuschreiben, falls es verlorengehen sollte.«
Er holte eine Feder aus der Schublade des Lesepults, ein Tintenhörnchen und das Gefäß mit dem Löschsand. Teresa stellte sich an das Pult und schrieb. Dabei schob sich ihre Zunge unter die Unterlippe. Von der Tür her ertönte ein Klappen. Caspar trat ein und fragte: »Darf ich den Herrschaften noch etwas bringen?«
Froben blickte zerstreut in seine Richtung. »Ja, noch eine Kanne warmen Würzwein und für mich ein Wasser. Dann kannst du die heißen Steine in unsere Betten legen.«
Caspar kniff die Lippen zusammen, verbeugte sich und ging hinaus.
Teresa streute Sand auf das Geschriebene, wartete einen Moment, blies darüber und fragte: »Was sollen wir jetzt damit machen? Und wie bringen wir unsere Forschungen weiter?«
»Sag es selbst, du weißt es, Teresa.«
»Ja, ich kenne dich und mich und den Wagemut unserer Familie. Wir werden in das Kloster Agenbach reiten und schauen, wo dieses Familienerbstück geblieben ist.«
»Genauso machen wir es. Die Abschrift versteckst du am besten in deinem Ausschnitt. Wer weiß, ob dieser Raum nicht Augen und Ohren hat.«
»Wer sollte so ein altes Pergament haben wollen?«
»Bedenke, was da geschrieben steht: Der Besitz bringt seinem Eigentümer Reichtum, Macht und Glück. Dieser Kandelaber ist wundertätig.«
Caspar kehrte mit dem Würzwein und dem Wasser zurück, setzte die Kannen auf dem Tisch ab und stellte zwei gefüllte, grün glasierte Becher auf das Pult. Mit einer weiteren Verbeugung entfernte er sich. Vater und Tochter tranken in langsamen Zügen. Teresas Lider wurden schwer.
»Wir sollten zu Bett gehen«, meinte ihr Vater. »Morgen werden wir alles Weitere besprechen.«
Heinrich leuchtete ihnen voran zu ihren Kemenaten. Er sah stets aus, als habe er etwas Anrüchiges im Sinn, fand Teresa. Sie schloss die eisenbeschlagene Tür und zog sich aus. Die Decke vor dem Fenster hielt die Kälte nur ungenügend ab. Es war so kalt, dass sie wieder hellwach wurde. Ihre Schlafstatt hatte eine hohe Lehne, die mit zierlichen Blumen bemalt war. Schnell glitt sie unter die Decke. Ihre Zähne schlugen aufeinander. Durch den heißen Stein wurde ihr bald warm, und sie sank in den Schlaf.
Teresa träumte. Sie schritt mit ihrem Vater durch einen düsteren Gang in einem Kloster. Am Ende schien ein helles Licht: Das war der Goldkandelaber. Er war besetzt mit den herrlichsten Edelsteinen; ein Funkeln und Leuchten ging von ihm aus, dass sie meinte, nie etwas Schöneres gesehen zu haben. Ein Gefühl der Ruhe und Zufriedenheit erfüllte sie. Doch es währte nicht lange. Hinter sich hörte sie ein Trappeln und Keuchen, einen dumpfen Schlag und ein knirschendes Geräusch, als wenn ein Schädel splitterte. Im nächsten Moment spürte sie einen heftigen Schmerz und wachte auf.
Sie starrte in die Dunkelheit. Ihr Herz klopfte schneller als je zuvor. Angestrengt lauschte sie, aber es war nichts zu vernehmen. Es war nur ein dummer Traum, sagte sie sich, drehte sich um und wollte weiter schlafen. Doch da hörte sie es, das Rufen von einem Menschen, gar nicht so weit entfernt. Sie sprang aus dem Bett, warf hastig ihre Kleider über und eilte zur Kemenate ihres Vaters. Die Tür war angelehnt, das Bett leer.
Mein Gott, lass ihm nichts passiert sein, betete sie stumm.
Wohin sollte sie sich wenden? Da war das Geräusch wieder: Es kam aus der Bibliothek. Sie riss die Tür auf. Im Schein des Kaminfeuers sah sie eine Gestalt, die sich auf dem Boden bewegte. Mit zitternden Fingern nahm sie eine Kerze, ging zum Kamin, und nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es ihr, sie anzuzünden.
»Vater! Was ist passiert?«, rief sie und eilte zu Froben, der auf dem Boden lag und stöhnte. Von seinem Kopf rann Blut. Er öffnete mehrmals den Mund, um zu sprechen.
»Sag jetzt nichts«, sagte Teresa. »Ich werde Verbandszeug holen.«
In fieberhafter Eile nahm sie den Kerzenhalter und lief zur Küche. Auf der Feuerstelle glomm noch ein Rest des Feuers. Sie suchte die Regale nach Leinenstreifen und Ringelblumensalbe ab. Dabei tropfte ihr Wachs auf den bloßen Arm. Sie schlug sich mit der Hand an die Stirn. Ihr Vater hatte die Salbe doch nicht aus der Küche geholt – er bewahrte sie in seinem Zimmer auf! Endlich wurde sie fündig. Sie lief zurück in die Bibliothek, wo sich inzwischen die schlaftrunkenen Diener, Ursula, die Köchin und Kathrin, die Magd, eingefunden hatten. Sie standen um Froben herum, als wüssten sie nicht, was in einem solchen Fall zu tun war. Ursula besann sich als Erste und nahm Teresa Salbe und Verbandszeug aus der Hand.
Sie langte in das Töpfchen, strich Froben mit der Salbe über den Kopf und wickelte saubere Tücher darum.
»Ich habe ein Geräusch gehört und bin hier herüber in die Bibliothek gekommen«, sagte Froben mit schwacher Stimme. »Die Kerzen brannten, und in ihrem Schein sah ich, wie sich zwei vermummte Gestalten an meinem Pult zu schaffen machten. Ich rief sie an, doch statt einer Antwort nahm einer von ihnen den Kerzenständer, rannte auf mich zu und schlug ihn mir über den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein und bin gerade erst wieder zu mir gekommen. Da«, er wies auf sein Hemd, »alles ist mit Kerzenwachs beträufelt.«
»Fehlt etwas aus der Sammlung?«, wollte Caspar wissen. »Die Diebe müssen es auf die Bücher oder auf die Wunderkammer abgesehen haben.«
»Der Herr wird jetzt erst einmal zu Bett getragen«, protestierte Ursula, die Köchin.
»Ob etwas fehlt, können wir morgen untersuchen«, bemerkte Froben. »Das ändert auch nichts mehr daran. Weg ist weg, ob wir es nun gleich bemerken oder später.«
Caspar und Heinrich fassten Froben unter den Schultern und an den Füßen und trugen ihn in seine Kemenate. Während die anderen wieder ins Bett gingen, folgte Teresa den beiden Dienern. Von draußen her erhob sich plötzlich ein Lärm. Stimmen schrien durcheinander. Einer der Hakenschützenmänner stürmte zur Tür herein. »Wilhelm, der Torwächter, er ist …« Grauen stand in seinen Augen.
Froben sank in Ohnmacht, sein Kopf fiel zur Seite. Mit einem Gefühl, als wäre ihr der Boden unter den Füßen weggerissen worden, folgte Teresa dem Mann nach draußen. Beim Überqueren des Hofes mussten sie sich Wind und Regen entgegenstemmen. Sie stiegen die Treppe zu den Unterkünften der Mannschaft hinauf. Teresa keuchte, sie spürte Stiche in der Seite. Aus der Vorburg waren die Hakenschützen gekommen, müde und nur notdürftig bekleidet, ihre Katzbalger am Gürtel. Sie standen am Ende der Zugbrücke.
Als Teresa eintraf, öffneten sie den Kreis. Da lag Wilhelm, mit dem sie am Abend noch gesprochen hatte. Seine Kehle war aufgeschlitzt, die Augen waren weit aufgerissen. Es roch metallisch und süß nach dem Blut, das sich in einer Lache um ihn herum ausgebreitet hatte. Seine Arme hielt er noch im Tod vor sich hingestreckt, als wolle er einen Angreifer abwehren. Angst kroch Teresa die Kehle herauf.
»Wie konnte das geschehen?«, rief sie.
»Wilhelm hatte sich schon in sein Quartier begeben«, antwortete einer der Schützen. »Jemand hätte ihn ablösen müssen! So ist er wieder zurück auf seinen Posten, und so hat es ihn erwischt.«
Verlegen schauten die Männer auf den Boden.
»Er wollte es so«, sagte schließlich einer von ihnen. »Er traute niemandem außer sich selbst. Heute ist so ein Wetter, da ist was im Anzug, hat er gesagt. Und wir haben ihm seinen Willen gelassen.« Zustimmung heischend schaute er seine Kameraden an.
»Ja, er wollte es so«, bestätigte ein anderer.
»Bringt ihn hinein!«, sagte Teresa. »Ich muss nach meinem Vater sehen.«
Sie eilte über die Zugbrücke und durch den Burghof zurück in den Palas. In seiner Kemenate fand sie ihren Vater aufrecht im Bett sitzend. Er hielt die Federdecke zwischen seine Finger gekrallt.
»Vater, was machst du da?«, rief sie. »Du musst ruhen, du bist schwer verletzt worden.«
»Ach was!«, meinte er. »Das bisschen Blut schert mich nicht im Geringsten. Was war los da draußen?«
»Wilhelm … er ist tot, jemand hat ihm die Kehle durchgeschnitten.«
Froben zuckte zusammen. »Um Gottes willen! Was ist das heute für ein Tag! Wir müssen ihm eine anständige Beerdigung geben, morgen auf dem Gottesacker gegenüber der Burg.«
»Ich werde in der Frühe eine Magd schicken, um die Familie Wilhelms zu benachrichtigen.«
Frobens Blicke schweiften im Raum umher. »Hast du nachgeschaut, ob etwas fehlt?«
»Dazu hatte ich noch keine Muße. Ich werde gleich in die Bibliothek gehen und nachsehen.«
Teresa ergriff den Leuchter, der auf einem kleinen Tisch in der Nähe des Bettes stand, und ging zögernd hinaus. Durfte sie ihren Vater überhaupt allein lassen, ohne Licht? Anscheinend hatte es auch auf ihn jemand abgesehen. Von draußen drangen Rufe und Flüche herein, doch hier drinnen war alles still. Teresa erreichte den Gang zur Bibliothek. Die Wände rochen feucht und glitzerten im Schein des Lichtes. Sie betrat die Bibliothek und hob die Lampe. Auf den ersten Blick schien alles unberührt zu sein. Teresa ging näher zu den Bücherregalen hin und ließ ihren Blick darüber schweifen. Es fehlte kein einziges Werk. Auch von dem, was den Raum ausschmückte, wie antike Vasen, Bilder an den Wänden, war nichts entfernt worden. Siedendheiß fiel es ihr ein. Das Pergament! Sie lief zu dem Stehpult, in dem ihr Vater die Schriftrolle verstaut hatte, und zog die Lade auf. Sie war leer. Wo hatte sie nur die Abschrift hingetan? Was hatte das zu bedeuten? Wer wusste von diesem Pergament und seinem Geheimnis? Sie lief zurück durch den Gang und kam außer Atem im Zimmer ihres Vaters an.
»Das Pergament ist fort, gestohlen!«, platzte sie heraus.
»Es scheint jemand Wind davon bekommen zu haben«, meinte ihr Vater und zwirbelte sich den Schnurrbart. »Aber wir haben ja noch die Abschrift. Ich hoffe, du hast sie gut verwahrt.«
Teresa schaute sich vorsichtig um, als könne jemand ihr Gespräch belauschen.
»Jetzt fällt es mir wieder ein.« Sie senkte die Stimme. »Ich habe sie in meinem Zimmer versteckt. Als hätte ich geahnt, was passieren würde.«
»Schon deine Mutter bewunderte deine Fähigkeit, Ereignisse vorauszusehen«, versetzte Froben. »Eine Fledermaus hat diesen schlimmen Abend eingeleitet, und wir haben gesehen, wie er endete. Aber lasst uns jetzt schlafen, wir haben alle eine Menge durchgemacht.«
»Was sollen wir tun, Vater?«, drängte Teresa.
»Sobald die Beerdigung vorüber ist, werde ich alles Nötige veranlassen, um zu dem Kloster zu reiten und Nachforschungen über diesen Kandelaber anzustellen.«
»Ich möchte dich begleiten.«
»Das ist viel zu gefährlich für ein junges Mädchen. Ich werde dich, wenn ich aufbreche, sicher in der Obhut von Ursula und den Mägden wissen.«
»Aber heute ist jemand ins Haus eingedrungen, hat dich niedergeschlagen und Wilhelm getötet! Willst du mich angesichts solcher Gefahren hier zurücklassen? Bedenke, es gibt noch die Abschrift des Briefes, die ich gemacht habe.«
»Du bist ein kluges Kind, Teresa, aber ich fühle mich heute nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung darüber zu treffen. Morgen ist auch noch ein Tag.«
In ihrem Zimmer nahm Teresa die Abschrift des Pergamentes an sich und steckte sie in die Innentasche ihres Mantels. Sie würden sie gewiss noch brauchen.
3.
Über der Wiese gegenüber Burg Wildenberg wölbte sich ein durchsichtig blauer Septemberhimmel, in dem einzelne Wolken segelten. Der Wind war abgeflaut, aber die Spuren des nächtlichen Sturmes waren nicht zu übersehen. Abgebrochene Äste und gelb verfärbte Blätter lagen auf dem Boden, und auf dem Weg hatten sich Regenpfützen gebildet. Die Familien des Burgherrn und des Torwächters, das Gesinde und ein paar Leute aus dem Dorf standen um das offene Grab versammelt. Der Geistliche in schwarzer Soutane, der auch sonst die Messen in der Burgkapelle las, sprach über das Leben Wilhelms, von seiner Treue zur Herrschaft und seiner Fürsorge für seine Familie. Frau und Kinder schluchzten laut.
Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
Die Anwesenden sangen ein Lied, dann wurden die sterblichen Überreste Wilhelms in einem grob gezimmerten Sarg in die Erde gelassen. Teresa konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. Solange sie sich erinnern konnte, war Wilhelm bei ihnen Torwächter gewesen. Sie ergriff eine Handvoll Erde und warf sie in das Grab. Das dumpfe Geräusch hallte in ihren Ohren nach.
Im Burghof war auf Tischen ein einfaches Mittagsmahl hergerichtet. Gerade noch waren die Menschen still und andächtig gewesen, jetzt schwatzten sie wie eine Herde von Elstern, während sie sich auf den Bänken niederließen. Ursula schöpfte Suppe in die Zinnteller und schnitt Brot. Teresa saß zwischen Froben und Kathrin, ihrer Magd. Die Sonne wärmte ihren Kopf, den sie mit einer schwarzen Haube bedeckt hatte. In einer Linde, die einen Teil ihres Laubes schon eingebüßt hatte, hockte ein Rabe. Teresa war es, als würde er zu ihr herüberschauen. Er krächzte misstönig und erhob sich flügelschlagend in die Lüfte, wo sich ihm andere zugesellten. Der Rabe war ein Bote aus der Unterwelt, er verkündete Unglück und Tod.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!