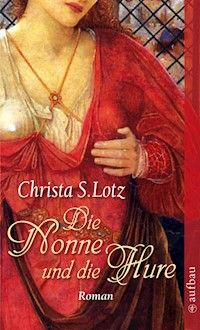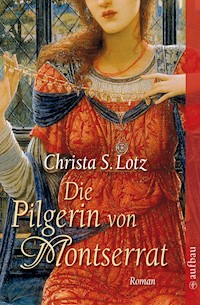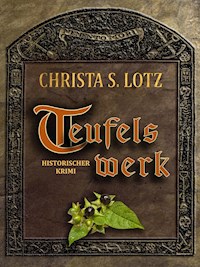
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Süddeutschland im Jahr 1527. Als die Blitze eines Unwetters die elterliche Burg zerstören, beginnt ein schweres Leben für Julia, die Tochter einer verarmten Ritterfamilie. Sie kommt bei einer Tante in der nahen Stadt unter. Um die junge Frau entspinnt sich ein Gewirr von Intrigen - sie wird als Hexe denunziert, in ein Kloster abgeschoben, und nur durch die Hilfe einer Novizin entkommt sie einem Giftmord. Was treibt die ungeliebte Tante und die Äbtissin des Klosters zu ihrem teuflischen Spiel? Zusammen mit dem Stadtschreiber Wolfram sucht Julia nach einer Lösung des Rätsels. Die beiden finden schließlich eine Spur, die sie zum Bischof in Rottenburg, zum Arzt Paracelsus und zu einem Alchimisten führt, der einen tödlichen Plan verfolgt. Der Roman spielt unter anderem am Neckar, im Schwarzwald und im Markgräfler Land. Leserstimmen: Die Autorin schafft es, den Leser mit diesem Roman zu fesseln, ihn in die Zeit mitzunehmen. (… ) Fazit: schöner historischer Roman. Empfehlenswert! (Deutsche Krimi-Autoren) ...detailliert, gut und flüssig zu lesen, interessant, lebendig, spannend. (Yopi Community)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christa S. Lotz
Teufelswerk
Roman
Süddeutschland im Jahr 1527. Als die Blitze eines Unwetters die elterliche Burg zerstören, beginnt ein schweres Leben für Julia, die Tochter einer verarmten Ritterfamilie. Um die junge Frau entspinnt sich ein Gewirr von Intrigen, die sie schließlich in eine tödliche Gefahr bringen.Inhaltsverzeichnis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Christa S. Lotz
Teufelswerk
Roman
I M P R E S S U M
Teufelswerk
von Christa S. Lotz
Breslauer Str.1
72224 Ebhausen
© 2014 Christa S. Lotz
Alle Rechte vorbehalten.
Autor: Christa S. Lotz, Ebhausen, Deutschland
Kontaktdaten: [email protected]
http://schreibteufelchen-christa.blogspot.de/
Cover:
Kommunikationsdesign
Stefanie Pappon
http://lidschlag.jimdo.com/
Korrektorat und Konvertierung:
Karl Kloiböck, Neunkirchen-A
Dieses E-Book erschien im Jahr 2011 als Printausgabe unter der ISBN 978-3886279630 im Verlag Oertel&Spörer Verlags-GmbH und Co. KG, Reutlingen. Die E-Book-Rechte liegen bei der Autorin.
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden.
1.
Am Morgen krochen kleine weiße Schnecken an den Wänden der Kemenate hinauf. Während ein Sonnenstrahl durch die Ritzen des Fensterladens drang, blieb Julia noch einen Moment unter ihrer Wolldecke liegen, schaute auf die Schleimspuren, die sie hinterließen und überlegte, was das wohl zu bedeuten hatte.
Hinter dem Brokatvorhang hörte sie die gleichmäßigen Atemzüge der Mutter und das Schnarchen des Vaters, das ab und zu von einem tiefen Grunzen in ein hohes Pfeifen überging. Vom Hof drangen die morgendlichen Burggeräusche zu ihr herauf: das Klappern der Milcheimer, Wiehern und die Stimmen der Knechte und Mägde. Gleichzeitig zog der Geruch nach Mist durch den Raum. Es klopfte. Anna, die frühere Amme von Julia, kam herein, grüßte und stellte einen Krug mit Wasser und dazu eine Schüssel auf den Fenstersims. Die rundliche, kleine Frau war mit einem beigefarbenen Überkleid und einer weißen Schürze bekleidet. Während Julia Gesicht und Arme benetzte, holte Anna aus einer geschnitzten Truhe die Kleidungsstücke für den Tag: einen gefalteten, hellen Rock und ein Mieder aus Samt. Sie half ihr, das Mieder zu schnüren und die langen Ärmel mit Bändern zu befestigen. Julias lange, hellbraune Haare flocht sie zu Zöpfen und bedeckte sie mit einem Perlennetz, einem Relikt aus besseren Zeiten. Anna erinnerte Julia immer an einen Rosinenkuchen, und so duftete sie auch heute Morgen.
„Jetzt seid Ihr gerüstet und könnt zum Frühmahl hinübergehen“, sagte Anna. Als Julia an der Küche vorbeikam, sah sie das Gesinde schon zum Essen versammelt. Alle langten mit ihren Holzlöffeln in eine Schüssel mit Haferbrei und tranken dünnes Bier aus dickwandigen Bechern.
Julia betrat den Speisesaal mit seinen hohen, gotischen Fenstern, der fein gearbeiteten Kassettendecke und den ehemals prächtigen Wandteppichen. Die Läden waren geöffnet, so dass die warmen Strahlen der Sonne in den Saal hereinfielen und Muster auf den gefliesten Boden zeichneten. Über den Tisch, ein schweres Brett aus Buchenholz auf zwei Böcken, hatte eine Magd ein Tischtuch gebreitet und darauf Gerstenbrei, Brot, geröstete Hühnerkeulen und Würzwein zum Frühmahl bereitgestellt.
Während sie auf das Erscheinen der Eltern wartete, schaute Julia zu einem der Fenster hinaus: Sie sah tief unten die rostbraunen Dächer des Städtchens Sulz, sah bewaldete Hügel und den Fluss, der sich glitzernd durch das Tal schlängelte. Am liebsten wäre sie hinausgelaufen, raus aus der Enge dieser Burg, wo die Tage vergingen, ohne dass etwas Nennenswertes passierte, wo ständig der Gestank nach Exkrementen durch die Zimmer zog. Julia dachte an den Erker mit dem Abtrittsloch, daneben Moos und trockene Blätter zum Abwischen. Im Sommer kam man fast um vor Hitze und Gestank, im Winter fror man am Boden fest, wenn man nicht aufpasste. Doch wohin sollte sie gehen? Für eine junge Frau von siebzehn Jahren, noch dazu der Tochter eines verarmten Adligen, waren die Möglichkeiten nicht eben berauschend. Außer einer Heirat, einem Leben im Kloster oder als Erzieherin der Kinder bessergestellter Leute hielt das Leben nicht viele Möglichkeiten für sie bereit. Ihre Eltern betraten den Speisesaal. Der Burgvogt Eitel trug eine dunkelbraune Schaube über einem hellen Wams, und um seine kräftigen Hüften spannten sich die Halbhosen, an deren Enden Strümpfe mit Bändern befestigt waren. Seine Füße steckten in ledernen Kuhmaulschuhen, die nur Zehen und Rist bedeckten. Sein Gesicht, in dem wie kleine Krater Narben eingegraben waren, aus dem seine Augen aber gütig hervor blickten, war von einem breiten schwarzen Barett eingerahmt. Er ließ sich mit einem wohligen Seufzer am Esstisch nieder. Die Mutter war ebenfalls mit einer Schaube bekleidet, die jedoch mit einem Brustlatz aus Samt und einem bestickten Kragen verziert war. Über das Unterkleid, das mit einem Gürtel zusammengehalten wurde, hatte sie eine graue Schürze gebunden und über ihrem rosigen, fast faltenlosen Gesicht trug sie eine gestärkte Haube.
„Ich hoffe, du hast gut geruht, mein Täubchen“, sagte Eitel und griff nach einem Hühnerschenkel. Julia füllte Brei in ihren Zinnteller und brach ein Stück Brot ab.
„Ich habe gut geruht“, antwortete sie, „aber nach dem Erwachen sah ich Schnecken an den Wänden hochkriechen. Anna sagt immer, das bedeutet Unheil.“
„Dieses schleimige Ungeziefer ist eine wahre Plage“, ließ sich Frau Eitel vernehmen. „Aber Unheil? Davon habe ich noch nichts gehört, und ich glaube es auch nicht.“
„Doch, doch“, schaltete sich der Vater ein. „Wenn es sehr heiß ist oder ein Unwetter droht, kriecht alle Kreatur nach oben, wahrscheinlich, um nachher nicht in den Wassermassen zu ersaufen.“
Frau Eitel warf einen Blick aus dem Fenster.
„So schön wie dieser Morgen war schon lange keiner mehr. Jemand muss dir Ammenmärchen erzählt haben. Seit der Stürmung Tannecks durch die Bauern gab es auf dieser Burg kein Unglück mehr.“
Julia erinnerte sich gut an diese Nacht, als sie von ihrer Mutter geweckt und, mit ein paar Habseligkeiten ausgestattet, eilig zu einer Tante gebracht worden war, die in der Stadt unweit der Burg wohnte. Die Eltern hatten sich in ein Kloster in der Nähe geflüchtet. Überall standen Bauern, disputierten mit hasserfüllten Gesichtern und reckten drohend ihre Sensen und Hungerharken gegen sie. Die Tante war eine kalte, herrschsüchtige Person, die Julia den ganzen Tag herumkommandierte. Julia war heilfroh gewesen, als die Aufstände vorüber waren und sie wieder auf den elterlichen Besitz zurückkehren konnte. Ihr Vater hatte sein Vermögen während des Krieges verloren und verwaltete nun das Anwesen mit seinen wenigen Wiesen und Äckern selbst.
„Ich muss fort, muss bei meinen Bauern nach dem Rechten sehen“, knurrte er jetzt und erhob sich schwerfällig. „Bin zur Spätmahlzeit wieder hier. Vielleicht gelingt es mir, einen Vogel zu erlegen, dann können wir ihn morgen braten.“
„Die Jagdzeit beginnt doch erst im Herbst“, wandte seine Frau ein.
„Das ist mir einerlei“, versetzte ihr Mann. „Die Zeiten sind sowieso aus den Fugen geraten. Niemand weiß mehr, was zählt, noch hat es irgendeine Ordnung auf der Welt. Dieser vermaledeite Luther hat alles von unten nach oben gekehrt!“
Er griff sich eine Armbrust, die mit einem Haken an der Wand befestigt war, und schlurfte hinaus. Wenig später hörte Julia, wie sich die Hufschläge seines Pferdes aus dem Hof entfernten.
„Auch gut, wenn wir beiden Frauenspersonen einmal unter uns sind“, sagte die Mutter. „Dann können wir besprechen, was du heute an Arbeiten verrichten könntest.“
„Was soll ich tun, Frau Mutter?“
„Du kannst die Hühner füttern und die Eier einsammeln, den Gänsestall reinigen, dann mit den Mägden Kräuter und Gemüse für die Suppe schneiden. Dafür brauchen wir Wacholderbeeren und Safran. Die Beeren wirst du von der Heide holen, den Safran besorgen wir anschließend zusammen auf dem Markt. Und noch einiges mehr.“
Mit diesen Worten biss sie kräftig in einen der Hühnerschlegel. Im nächsten Moment schrie sie auf.
„Frau Mutter, was ist?“, fragte Julia bestürzt. Frau Eitel spuckte ein Stück Zahn aus.
„Abgebrochen ...nein, das darf nicht sein. Damit kann ich nicht mehr zubeißen. Oh, und es tut so arg weh!“
Ein dünner Blutfaden lief über ihr rosiges Kinn.
„Wenn wir sowieso zum Markt hinuntergehen, können wir doch den Bader aufsuchen, der hat schon viele Zähne gezogen, sagt Anna.“
„Zu diesem Quacksalber?“
„Es gibt niemanden sonst, der so etwas kann.“
„Also gut“, meinte Frau Eitel. „Dann hol den Korb, ich werde rasch ein paar Kreuzer zusammen richten.“
Als sie den Hof betraten, schlug ihnen die Hitze wie aus einem Backofen entgegen, gemischt mit dem beißenden Geruch von Urin. Einige Knechte striegelten Pferde, andere besserten Sättel und Zaumzeug aus. Eine Magd war damit beschäftigt, einen Eimer in den Brunnen hinunterzulassen, zwei weitere Knechte trugen einen Sack mit Getreide zum Vorratslager neben dem Stall. Unter den Lagerräumen befand sich der Keller mit den Weinfässern und den Waren, die kühl gehalten werden mussten. Zwischen Ring – und Zwingermauer hatte die Mutter einen Garten angelegt. Sie passierten die Zugbrücke über den Halsgraben und schlugen den Pfad ein, der durch Gebüsch und Wald in die Stadt hinunterführte. Der besseren Sicht auf feindliche Angreifer wegen hatte Eitel den oberen Teil des Berges kahlschlagen lassen. Die Lichtung war inzwischen mit Himbeersträuchern, Farnen und Ebereschen bewachsen. Obwohl sie offensichtlich Schmerzen hatte, redete Frau Eitel fast unentwegt, über die Teuerung, die schlechten Zeiten, Männer wie Luther, die der Teufel geritten haben musste. Und dass man bald einen geeigneten Ehemann für Julia finden müsse. Julia äußerte sich nicht weiter dazu. Bald erreichten sie die ersten Häuser der Stadt, über der ein Dunst der Salzsiedereien schwebte. Auf dem Platz unterhalb der Kirche wurde der Markt abgehalten. Hier standen auch die Siedehäuser und der Salzbrunnen, ein größeres Loch im Boden, aus dem das Salzwasser floss. Einige Arbeiter waren mit dem Sieden beschäftigt. Die beiden Frauen ließen sich jedoch nicht aufhalten, sondern steuerten das Haus des Baders an, das sich in einer Seitengasse befand.
Eine Glocke ertönte, als die beiden Frauen durch die Tür traten. Der Raum war angefüllt mit den Utensilien, die ein Bader benötigte, mit Handtüchern, Rasierpinseln, Seifen, Ölen, Scheren, Verbandsmaterial aus Leinenstreifen, Arm- und Beinschienen, Schröpfgläsern, Einlaufschläuchen, chirurgischen Messern und Zangen, die auf einem Tisch und auf Holzbrettern an den Wänden bereitlagen. Auf dem Fenstersims standen Gläser, die mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt waren und Blutegel enthielten. Der Bader Gunther erschien und wischte sich die nassen Hände an seinem Kittel ab. Aus dem Nebenraum klangen plantschende Geräusche, und ein Duft nach Bergamotte-Öl lag in der Luft. Der Bader war ein großer, stämmiger Mann mit wirrem, schwarzem Haar. Sein Gesicht war bleich, und die rechte Hälfte schien in irgendeiner Art angefressen, als hätte er sich bei einem seiner Versuche mit Säure verätzt. Ein grauslicher Anblick, dachte Julia. Der Blick seiner dunklen Augen war unstet. Julia spürte ein unangenehmes Gefühl im Magen.
„Was kann ich für Euch tun?“, fragte er. Statt einer Antwort wies Frau Eitel auf ihre Backe, die inzwischen beträchtlich angeschwollen war. Der Bader führte sie zu einem Stuhl, befahl ihr, den Mund weit aufzumachen und ihn nicht etwa zu beißen. Er führte einen Mundspiegel ein und sagte:
„Aha. Einer der Quadrupelzähne.“
„Was beabsichtigt Ihr zu tun?“, wagte Julia zu fragen. Statt einer Antwort verschwand er in einem angrenzenden Zimmer und kam mit einer Kristallkugel zurück.
„Mit meinem Speculum oris habe ich festgestellt, dass der Zahn nicht mehr zu retten ist“, sagte er, nun schon etwas freundlicher. „Ich muss ihn ziehen, aber damit Eure Frau Mutter nicht gar so viele Schmerzen erleidet, werde ich sie in einen kurzen Schlaf versetzen.“
Aufmerksam schaute Julia zu, wie der Bader die Kugel vor den Augen der Mutter pendeln ließ, bis sich ihre Augen schlossen, die Gesichtszüge entspannten und gleichmäßige Atemzüge verrieten, dass sie in tiefen Schlaf gefallen war. Der Bader klemmte das Speculum in ihren Mundwinkel, wies Julia an, ein kleines Tuch bereitzuhalten, um Speichel und Blut aufzufangen, griff nach der Zange und machte sich ans Werk. Er musste mehrmals ansetzen, und Julia schauderte ein ums andere Mal bei dem Krachen und Knirschen. Der Körper der Mutter bäumte sich auf, sie erwachte jedoch nicht bei dieser Prozedur. Schließlich war der Zahn draußen, Julia wischte Blut und Speichel weg, Frau Eitel erwachte, stand auf und lächelte erleichtert.
„Es hat überhaupt nicht weh getan“, meinte sie und kramte in dem Lederbeutel, den sie am Gürtel trug, nach Geld. Der Bader warf die Münzen in eine Schale und reichte den Frauen die Hand. Julia fiel auf, dass er sehr kräftige, aber auch feingliedrige Hände hatte, an denen die Adern deutlich hervortraten.
„Was habt Ihr mit dieser Kugel gemacht?“, wollte Julia zum Abschied wissen.
„Es ist eine Möglichkeit, den Schmerz bei Operationen zu lindern“, gab Gunther Rathfelder zurück. „Der Arzt, Astrologe und Alchimist Paracelsus, der in Basel lehrt, wendet diese Methode an. Ich habe mit ihm Briefe darüber ausgetauscht.“
Julia merkte, dass sie großes Interesse an diesen Dingen hatte, wollte den Bader und ihre Mutter, die glückselig dem Ausgang zustrebte, jedoch nicht länger aufhalten.
„Geht mit Gott, liebe Frauen, und beehrt mich wieder einmal mit Eurem Besuch“, sagte Rathfelder, wobei er Julia eindringlich musterte. Sie war froh, als sie aus dem düsteren Ladengeschäft in die Hitze des Sommertages zurückkehren konnten.
Frau Eitel strebte dem Markt zu, um noch vor dem Mittagsläuten ihre Einkäufe zu erledigen. Auf dem Platz unterhalb der Kirche herrschte ein großes Gedränge. An den Seiten und an den Gängen in der Mitte waren Zeltplanen aus Leinen gespannt, um Verkäufer und Waren vor der Sonneneinstrahlung zu schützen. Dazwischen gingen die Sieder ihrer Arbeit nach, es roch intensiv nach Salz. Bäuerinnen in derber Tracht boten ihre Erzeugnisse feil, die sie auf Holztischen ausgebreitet hatten. Auf dem Boden standen Säcke mit Gerste, Dinkel, Emmer, Einkorn, Roggen und Buchweizen. Unter den Arkaden des Rathauses war der Platz der Bäcker und Metzger. Das knusprige Weizenbrot und das Gerstenbrot waren für die Herren und reichen Bürger, Haferbrot und Roggenbrot dagegen für die Bauern, die ärmeren Bürger und das Gesinde bestimmt. Von den Metzgern wurden neben Rinderhälften und Schweinepfoten, auf denen sich Fliegen breitmachten, auch Wachteln, Rebhühner, Trappen, Bärenschinken und Biberschwänze feilgeboten. Julia genoss es, die Düfte nach Gebratenem und Gewürzen wie Muskat, Nelken und Galant einzuatmen. In dem Gedränge kamen sie kaum voran. Wasserträger tauchten in der Menge auf, ein Mann schleppte einen Korb mit gackernden Hühnern, und zwischen zwei Ständen zeigte ein Gaukler seine Kunststücke. Um ihn herum hatte sich eine Traube von Menschen gebildet.
„Seht den Taschenspieler!“, rief ein Mann. „er wird uns gleich eines seiner Zauberstücke vorführen.“
„Das ist kein rechtschaffenes Handwerk“, fiel eine Hausfrau mit übergroßer Haube ein. „Der muss mit dem Teufel im Bunde sein, der solche Künste beherrscht!“ Julia und ihre Mutter blieben stehen. Der Mann, mit altmodischen Schellenschuhen, einem spitzen schwarzen Hut und Rüschenärmeln ausgestattet, zwirbelte sich die gewichsten Bartspitzen und blickte in die Runde. Seine Haut war dunkel, als hätte er die meiste Zeit seines Lebens im Freien verbracht.
„Ja, das werde ich, euch etwas vorführen nämlich, was Ihr eurer Lebtag nicht gesehen habt“, sagte er und zog seinen Hut, um erst einmal Geld einzusammeln.
„Ihr seid gleich Zeugen des Königsspiels der Zauberei. Gebt mir ein Scherflein, denn auch Zauberkünstler müssen leben. Ihr könnt auch bei mir kaufen, ehrbare, rechtschaffene Dinge, Zahnpulver, Heilsalben, Seifen und Bürsten“, er wies auf einen Ledersack, der neben ihm stand.
Der Mann stellte sich in die Mitte des kleinen Platzes und rief: „Nun werde ich beginnen!“ Auf seinen Ruf hin blieben immer mehr Menschen stehen. Der Gaukler holte drei Kupferbecher aus dem Sack und stellte sie nebeneinander auf einen Tisch. „Abrakadabra, ubi est res diaboli?“, rief er und vollführte kreisende Bewegungen mit den Armen. Seine Augen rollten hin und her und verdrehten sich zum Himmel. Dann hob er die Becher auf und das Publikum sah nacheinander drei Korken erscheinen. Julia reckte ihren Hals, um besser sehen zu können.
„Was ist unter diesen Bechern?“, rief der Gaukler.
„Drei Korken“, kam es aus dem Publikum zurück.
„Komm mal her.“ Der Gaukler deutete auf einen Jungen, der barfüßig und zerlumpt in der Menge stand. Sein blondes Haar war zerzaust, das kleine, schmale Gesicht hatte einen verschmitzten Ausdruck.
„Ich?“
„Ja, du.“ Der Junge bahnte sich seinen Weg zu dem Zauberer und blieb abwartend neben ihm stehen.
„Jetzt hebe einmal den mittleren Becher auf“, befahl der Gaukler. Der Junge tat es. Unter dem Becher war – nichts! So ging es einige Male hin und her. Mal erschienen die Korken, mal nicht. Schließlich winkte der Gaukler einen Reisigen heran.
„Hebt den rechten Becher auf“, sagte er. Alle reckten die Hälse. Der Reisige tat, wie ihm geheißen. Unter dem Becher lag ein Apfel, dick und rotbackig, zum Reinbeißen. Die Leute lachten und riefen: „Mehr davon!“ Jetzt sprach der Gaukler einen Mönch an, der anscheinend auf dem Weg zur Mittagshore war, denn er trug die deutsche Bibel unter dem Arm, war also ein Anhänger Luthers. Der Schwarzgewandete sträubte sich und wollte weitergehen, doch zwei Männer hielten ihn fest und schrien: „Euer Luther gehört doch auch zu dieser Sorte, jetzt zier‘ dich nicht und mach mit bei dem Spiel.“ Als der Mönch zaghaft den mittleren Becher hob, saß darunter ein Küken, das sich zitternd erhob, seine Notdurft verrichtete und dann davon zu flattern versuchte. Die Menschen johlten, einige bekreuzigten sich.
Julia wusste nicht, was sie von diesem Zauber halten sollte. Waren diese Menschen echte Künstler, die sich auf Jahrmärkten ihr Zubrot verdienen mussten? Wie schafften sie es, die anderen zu täuschen? Allmählich zerstreute sich die Menge, und der Gaukler zählte zufrieden sein Geld. Julia wollte keine weiteren Schaustückchen dieser Art sehen. Sie zog ihre Mutter zu einem Stand, von dem zu Kränzen gebundene Schalotten zusammen mit Zwiebeln und Knoblauch herab hingen. Junge Erbsen, Pastinak, Spinat, Lauch und Pferdebohnen waren ausgebreitet. In Körbchen bot die Marktfrau Vogelbeeren, Holunderbeeren und Berberitzen an. Frau Eitel kaufte Kirschen und späte Erdbeeren, die sie nicht selbst in ihrem Garten zog. Auch ein wenig von dem kostbaren Safran ergatterte sie. Die beiden Frauen begaben sich auf den Rückweg zur Burg Tanneck.
Ein plötzlicher Windstoß fegte über den Platz, so heftig, dass einige Zeltbahnen umfielen und ihre Besitzer unter sich begruben. Eine Bauersfrau mit einfachem, derbem Gesicht versuchte ihren Korb mit Eiern zu retten, doch sie waren auf die Erde gefallen und dort geplatzt und zerlaufen. Sie fing lauthals an zu schreien.
„Gott sei mir gnädig, das ist ein Zeichen!“
„Das ist ein Zeichen!“, echoten andere Frauen, schauten zum Himmel, an dem sich wenige Federwölkchen zeigten, und schlugen das Kreuz. Julia sah die Blicke der Bäuerinnen feindselig auf sich gerichtet. Oder bildete sie sich das bloß ein? In aller Eile wurden die Stände wieder aufgerichtet, zerbrochenes Geschirr wurde zusammengefegt und die Körbe ordentlich aufgestellt. Mit rotem Kopf folgte Julia ihrer Mutter, die von dem Markt wegdrängte und den Weg zurück nach Hause nahm. Als sie schweißgebadet am Eingang der Burg ankamen, sah Julia, dass sich über den Hängen des Flusstales große weiße Quellwolken bildeten.
2.
Auf Tanneck war alles unverändert. Die Knechte und Mägde gingen pflichtbewusst ihrer Arbeit nach, und Anna hatte offensichtlich in der Zwischenzeit die Bediensteten beaufsichtigt. Julia ruhte sich einen Augenblick in der Fensternische des Speisesaales aus, um wieder zu Atem zu kommen. Hier war es wohltuend kühl. Sie zuckte zusammen, als sie das Schimpfen ihrer Mutter aus der Küche hörte.
„Habe ich euch nicht gesagt, dass die Rüben und die Pastinaken viel kleiner geschnitten werden müssen? Und dem Eintopf fehlt jede Würze. Julia!“
Julia lief hinüber zur Küche, die Mägde Lina und Katherina knicksten, als sie ihrer ansichtig wurden. Lina, mit kess geschürzter Haube und schweißnassem Gesicht, rührte in einem Kessel, der an einem Haken über der gemauerten Feuerstelle hing. Es dampfte und duftete nach frischem Gemüse. Katherina saß auf einem dreibeinigen Schemel am Tisch und zerkleinerte Kräuter in einem Mörser. An den Wänden hingen Töpfe, Suppenkellen, Spieße und Geschirr aus Zinn.
„Julia, du könntest dich ein wenig nützlich machen“, sagte Frau Eitel. „Geh doch in die Heide hinüber und hole ein Säckchen mit Wacholderbeeren. Dann ist die Suppe gut gewürzt, wenn dein Vater von der Jagd nach Hause kommt. Aber nimm Joscha mit, man weiß nie, wer sich heutzutage in der Gegend herumtreibt. Und vergiss nicht, danach die Hühner zu füttern.“
„Ja, Frau Mutter“, sagte Julia, froh darüber, für einige Zeit hinauszukommen. Sie nahm ein Leinensäckchen und überquerte den Burghof. Am Tor saß Joscha, der Knecht und besserte einen Sattel aus. Er nickte ihr flüchtig zu. Warum sollte sie ihn bei seiner Arbeit stören? Sie konnte gut auf sich selbst acht geben. Julia passierte die Zugbrücke und gelangte zu dem Weg, der durch einen kleinen Buchenwald zur Heide führte. Es war so heiß, dass ihr bald Mieder und Überrock am Körper klebten. Der Wind hatte sich gelegt, und über den Bergen ballten sich Wolken wie riesige, grauweiße Wattebäusche zusammen. Als sie sich der Heide näherte, hörte sie ein Blöken, das sehr rasch vielstimmig wurde, dazwischen das weinerliche Meckern der Lämmer. Es roch nach Schafsmist und Thymian. Der Schäfer, Hans genannt, stützte sich auf seinen Knotenstock und schaute ihr ruhig entgegen. Sein schwarzer Hund umkreiste die Herde mit eifrigem Bellen. Hans war mit einem groben Leinenhemd, ebensolchen Hosen und Holzschuhen bekleidet, und sein faltiges, gebräuntes Gesicht verschwand fast hinter der grauen Mähne und einem langen, zerzausten Bart.
„Heda, Jungfer Julia“, sagte er. „Was tut Ihr hier draußen um diese Zeit?“
„Ich hole ein Säckchen mit Wacholderbeeren, die Mutter hat’s mir aufgetragen.“ Grüßend hob sie die Hand.
Der Schäfer blinzelte in den Himmel, dessen Wolken sich inzwischen bleigrau verfärbt hatten.
„Es liegt ein Unwetter in der Luft“, meinte er. „Wisst Ihr auch, wozu solche Beeren noch nützen, außer, der Suppe einen besseren Geschmack zu geben?“
„Nein, das weiß ich nicht“, gab sie zurück. „Aber Ihr werdet es mir gewiss gleich sagen.“
„Es ist gut zum Abhusten, als Tee getrunken, man kann sich mit ihrer Hilfe morgens besser erleichtern, sie helfen bei Gicht und Wassersucht und sind schweißtreibend.“
„Das hat gerade noch gefehlt“, antwortete Julia und unterdrückte das Bedürfnis zu kichern. „Und wogegen helfen sie noch?“
„Gegen die Pest und gegen ...“
„Gegen was noch? Nun lasst euch doch nicht alles aus der Nase ziehen.“
„Gegen Hexen.“
Julia war mit einem Schlag hellwach.
„Was sind das eigentlich für Geschöpfe?“, fragte sie. „Ein Reisiger berichtete uns, dass im vorigen Monat, im Juni, eine Hexe in Stuttgart festgesetzt worden sei.“
„Das war Margarethe Löfin, eine Witwe.“
„Was ist mit ihr passiert?“
„Sie wurde der Hexerei und der Buhlschaft mit dem Teufel angeklagt. Auf der Ofengabel sei sie über den Gartenzaun geritten.“
„Und weiter?“
„Wollt Ihr es wirklich hören? Das ist nichts für ein junges, adeliges Mädchen, wie Ihr eins seid.“
„Doch, ich möchte es hören“, beharrte sie.
„Sie wurde auf die Folter gespannt und mit Ruten geschlagen. Ihre Schienbeine wurden in Pech getaucht. Die Haare rasierte man ihr ab, zog Seile um den Kopf, steckte ihre Füße in Schweinsschuhe und röstete sie über einem Kohlebecken. Am Schluss wurde sie mit glühenden Kohlen überschüttet.“
Ein kalter Schauder erfasste Julia, trotz der schwülen Hitze.
„Hat sie gestanden?“, fragte sie.
„Nein. Man sperrte sie in einen Turm auf dem Reichenberg, wo sie immer noch sitzt. Es ist kein Geständnis aus ihr herauszukriegen.“
„Dann ist sie sicher auch keine Hexe. Könnt Ihr denn diese Vorgehensweise billigen, Hans?“
„Unsere Kirche, insbesondere der Herr Luther, haben uns immer wieder vor den Hexen und vor dem Teufel gewarnt. Besonders mit leichtsinnigen, leichtgläubigen Personen treiben sie ihr Spiel.“ Der Schäfer redete sich warm. „Da oben ist ein Wegekreuz“, er wies auf die Anhöhe über der Heide, „dort ist vor einem Jahr ein Schäfer mit seiner Herde entlanggezogen. Genau wie heute zog ein Gewitter auf. Spürt Ihr, wie die Luft wabert? Als das Donnerwetter losging, suchte er Schutz unter einer mächtigen Eiche. Und wurde vom Blitz getroffen. Das war die Strafe für sein wenig gottesfürchtiges Leben.“
„Ihr meint, wenn man nur gottesfürchtig genug ist, kann einem so etwas nicht geschehen?“
„Die Kirche sagt es, Luther sagt es.“
„Wessen hat sich der Schäfer Eurer Meinung nach schuldig gemacht?“
„Er handelte mit Stoffen, von denen ein ehrbarer Mensch lieber die Finger lassen sollte.“
Er verstummte und schien in sich hineinzuhorchen.
„Was sind das für Stoffe?“, drängte Julia.
„Bilsenkraut, Stechapfel, Spanische Fliege und allerhand andere Ingredienzien. Hat Liebestränke daraus hergestellt, und ich bin sicher, so mancher ist dabei zu Tode gekommen. Er kann von Glück sagen, dass der Blitz ihn getroffen hat, sonst wäre auch er der Hexerei angeklagt worden.“
Es war Julia, als erwache sie aus einem schweren Traum. Sie stand hier auf der Heide, sprach mit einem Schäfer über unerhörte Dinge und hatte ganz vergessen, warum sie überhaupt hergekommen war. Die Bienen summten, das trockene Gras knisterte leise, und über dem Burgberg hatte sich der Himmel schwefelgelb verfärbt.
„Ich danke Euch für Eure Auskünfte“, stammelte sie, raffte ihren Rock und verließ den Platz, auf dem die Schafe gemächlich grasten.
Das Blöken wurde leiser, während Julia einen steilen Pfad hinaufstieg. Oben erstreckte sich die eigentliche Heide mit Wacholderbüschen und trockenem Gras, in dem Karthäusernelken und Glockenblumen wuchsen. Sie hockte sich vor einen der Büsche. Bei ihrem Versuch, möglichst schnell das Säckchen mit den blauen Beeren zu füllen, riss sie sich die Hände an den Stacheln wund. Viele der Früchte waren noch grün. Als der Beutel halb gefüllt war, richtete sie sich auf und machte sich auf den Rückweg zur Burg. Sie sah, dass sich von Westen her eine dunkle Wolkenwand heranschob. Mäuse huschten in ihre Erdlöcher, die Luft war schwer und zum Schneiden dick, und wieder krochen weiße Schnecken an den Gräsern hinauf. Im Wald war es totenstill, kein Vogel war zu hören. Die Angst vor etwas Unausweichlichem schnürte Julia die Kehle zu. An der Mauer der Burg bemerkte sie im Vorübereilen eine Pflanze, deren Blüten schmutzig gelb und lila geädert waren. Das muss das Teufelskraut sein, dachte sie, vergaß es aber gleich wieder, weil sie an die Vorhaltungen der Mutter dachte. Die Hühner zu füttern und den Mägden beim Kochen zu helfen hatte sie ebenfalls vergessen. Als sie den Burghof erreichte, war alles wie immer. Oder doch nicht. Das Vieh stand in den Ställen und rührte sich nicht. Hühner, Gänse und Enten hatten sich in ihre hölzernen Verschläge zurückgezogen. Julia lief die Treppe zum Obergeschoss des Palas hinauf, in der sich Kemenate, Küche und Speisesaal befanden. Lina und Anna sangen bei ihrer Arbeit, es roch nach Fleisch- und Gemüseeintopf, und in einem Korb neben der Vorratskammer lagen zwei frisch erlegte Fasane.
Julia betrat die Kemenate, um sich für das Abendessen umzuziehen. Sie stockte, als sie Stimmen hinter dem Vorhang hörte – es waren die ihrer Eltern.
„Sie muss möglichst bald unter die Haube“, sagte ihr Vater. „Das Kind hat mir zu viele Flausen im Kopf. Junker Gerold von Sterneck hat mich kürzlich gefragt, ob unsere Tochter schon jemandem versprochen ist.“
Julia schoss das Blut ins Gesicht. Hätte man sie nicht in diese Pläne einweihen können?
„Der ist doch doppelt so alt wie sie. Und außer seiner Burg hat er keinerlei Besitz vorzuweisen“, erwiderte Frau Eitel.
„Du weißt doch, es gibt dieses ...“, die Stimme des Vaters erstarb zu einem Flüstern.
Julia war außer sich. Gab es eine Art Familiengeheimnis? Warum sollte das niemand hören? Warum wurde einfach über ihren Kopf hinweg bestimmt? Sie beschloss, die Eltern beim Abendessen danach zu fragen, zog sich aus der Kammer zurück und ging mit betont lauten Schritten noch einmal hinein. Die Mutter wird schimpfen, dachte sie, dass ich so lange ausgeblieben bin und niemanden mitgenommen habe. Herr und Frau Eitel waren im Begriff, den Raum zu verlassen, so dass Julia ihnen direkt in die Arme lief.
„Wo bist du so lange gewesen, mein Täubchen?“, fragte ihr Vater und nahm sie in dem Arm. „Deine Mutter hat sich Sorgen gemacht. „Du hast Joscha nicht mitgenommen, und die Hühner hast du auch nicht gefüttert“, sagte Frau Eitel und verzog ihre Stirn in kummervolle Falten. „Was soll ich von einer Tochter halten, die immer ihren eigenen Kopf durchsetzen will?“
„Verzeiht, Frau Mutter, aber es war sehr schwierig, reife Beeren zu finden. Meine Hände sind dabei ganz schön zerstochen worden.“
Sie hielt der Mutter ihre Hände entgegen.
„Ach, hätte ich dir doch bloß Handschuhe mitgegeben!“, sagte
Frau Eitel mit einem Kopfschütteln.
„Das ist alles halb so schlimm“, antwortete Julia. „Das Wetter macht mir viel mehr Kopfzerbrechen. Da scheint sich etwas Furchtbares zusammenzubrauen.“
„Gewitter gibt es in jedem Sommer, zumal, wenn es so heiß ist wie heute. Ich bin froh, wenn wir etwas Regen bekommen“, meinte ihr Vater.
„Jetzt lasst uns nicht mehr herumstehen und reden, sondern zum Essen gehen“, beendete Frau Eitel die Unterhaltung.
Nachdem Anna Julias Hände mit Ringelblumensalbe bestrichen und verbunden hatte, ging Julia in den Speisesaal hinüber, wo ihre Eltern schon am Tisch saßen. Der Himmel hatte sich inzwischen vollends verdüstert. Ein starker Wind kam auf, der mit seinen Böen die Fensterläden klappern ließ. In der Ferne war ein schwaches Donnern zu hören. Lina brachte den Topf mit der Suppe, eine Kanne Bier und ein Weizenbrot herein, schloss die Läden und stellte einen eisernen Kerzenhalter auf den Tisch. Nachdem sie sich entfernt hatte, nahm Herr Eitel sein Messer aus dem Gürtel, schnitt Brot und Fleisch in Scheiben und verteilte es. Das Donnern wurde lauter. Die Mutter sprach ein Gebet. Schweigend saßen die drei, aßen und tranken. Der Safran und die Wacholderbeeren gaben der Brühe eine köstliche Würze. Julia konnte die Mahlzeit jedoch nicht genießen. Ihr Magen zog sich immer wieder schmerzhaft zusammen, wenn sie an das dachte, was heute passiert war. Die Donnerschläge krachten immer lauter, und das Licht der Blitze, das durch die Ritzen der Läden drang, erfüllte den Raum mit einem gespenstischen Licht.
„Was habt Ihr Euch eigentlich hinsichtlich meiner Zukunft gedacht?“, fragte Julia in das Schweigen hinein. Sie wollte nicht gleich mit dem herausplatzen, was ihr am meisten am Herzen lag. Die Eltern tauschten einen stummen Blick. Herr Eitel räusperte sich.
„Nun, da unsere Mittel nicht weit reichen, schon lange nicht mehr, wäre es das Beste, wenn du bald heiraten würdest und einen eigenen Hausstand gründest.“ Er schaute seine Tochter erwartungsvoll an.
„Und wenn ich nicht will?“, gab Julia kurz zurück.
„Es wird dir nichts anderes übrig bleiben, liebes Kind“, sagte Frau Eitel. Ihre Stimme zitterte, und ihr Mund verzog sich kläglich, als würde sie gleich anfangen zu weinen. Wieder krachte es, als hätte jemand direkt neben ihnen einen Arkebusenschuss abgegeben.
„Was ist, Frau Mutter?“, fragte Julia und fasste nach ihrem Arm.
„Ich glaube, dass heute noch etwas Schreckliches passiert“, fuhr es aus Frau Eitel heraus. „Dieser Bader, die Eier auf dem Markt und jetzt noch ein Unwetter ...“
Nicht zu vergessen die Schnecken und der Schäfer Hans mit seinen Erzählungen von der Hexe, dachte Julia.
„Lasst uns in den Wald gehen und dort abwarten“, schniefte Frau Eitel.
„Frau, du hast wohl deine fünf Sinne nicht beisammen“, fuhr der Vater sie an. Draußen blitzte und krachte es, dass die Burg in ihren Grundfesten erbebte. Lina kam mit schreckgeweiteten Augen herein. Sie trug eine tönerne Schale mit dem Nachtisch, einer Creme aus Marzipan und Nüssen. Herr Eitel schickte sie fort und erhob sich so abrupt, dass sein Stuhl umfiel.
„Wir gehen alle miteinander in die Burgkapelle, um zu beten“, ordnete er an. Die Knechte und Mägde standen wie ein Häuflein Elend vor der Küche. Als sich der kleine Trupp in den Hof begab, begannen erste Tropfen in ihre Gesichter zu klatschen. Die Tür der Kapelle schwang im Wind hin und her. Im Inneren war die Hitze des Tages noch spürbar. Die kleine Kirche war mit einigen Bänken und einem Holzkreuz ausgestattet. Julia ließ sich mit den anderen auf die Knie nieder. Es war ihr, als würde jemand fehlen.
„Verschone uns, gütiger Herr!“, begann Herr Eitel. „Vor allem Bösen und Unglück, vor Sünde, Täuschung und Versuchungen des Teufels, vor Deinem Zorn und vor der ewigen
Verdammnis“, fuhren die anderen fort.
„Bewahre uns, gütiger Herr!“, sagte Herr Eitel.
„Vor Blitz und Ungewitter, vor Erdbeben, Feuer und Flut, vor Seuchen, Pest und Hungersnot, vor Krieg und Mord und vor einem plötzlichen Tod“, murmelten Julia und das Gesinde. Ihre Augen suchten den Raum ab. Wo ist eigentlich Anna? dachte sie und erschrak.
„Ich muss noch einmal hinaus“, sagte sie, und ohne auf die Rufe ihrer Eltern zu achten, rannte sie über den Hof zurück. Es regnete heftig, so dass sie binnen Kurzem völlig durchnässt war. Bei jedem Zucken eines Blitzes und dem nachfolgendem Einschlag blieb ihr fast das Herz stehen. Sie fand Anna im Pferdestall beim Versuch, die Tiere zu beruhigen. „Anna, warum tust du das?“, schrie sie und packte die Amme am Arm.
„Das sind auch Kreaturen, die unsere Hilfe brauchen“, gab Anna zurück und blickte sie mit einem Ausdruck an, der Julia an die Zeiten erinnerte, in denen Anna immer ein offenes Ohr für ihre Sorgen und Nöte gehabt hatte.
„Geh und sag den anderen, sie sollen anderweitig Schutz suchen“, sagte Anna eindringlich. „Die Kapelle ist besonders gefährdet, weil sie höher steht als die anderen Gebäude!“
Julia fragte sich, woher sie das wusste, lief aber wieder hinaus, um die anderen zu warnen. Ein Blitz fuhr mit gleißender Helligkeit direkt vor ihr nieder, gefolgt von einem Schlag, der den Boden unter ihren Füßen wanken ließ. Wie gelähmt stand sie da und sah, dass die Kapelle buchstäblich in Stücke gerissen war und in der nachfolgenden, entsetzlichen, kurzen Stille vermeinte sie verzweifelte Hilfeschreie zu hören. Sie wollte zu dem Ort des Unglücks eilen, wurde jedoch von zwei kräftigen Armen zurückgehalten.
„Komm mit mir, da ist nichts mehr zu retten“, schrie Anna und zog sie in Richtung des Pferdestalles. Die Tiere brüllten in Todesangst und hämmerten mit den Hufen an die Verschläge. Ein helles Licht, das die Augen blendete, ein Zischen, ein Knall, noch stärker als der vorherige, dann barst über ihnen der Palas. Steine polterten herab und verfehlten die beiden Frauen um Haaresbreite. Qualm und Gestank breiteten sich aus, es wurde immer heißer. Aus den oberen Fenstern schlugen die Flammen. Anna drängte Julia die Treppe zum Weinkeller hinab.
„Was hast du mit mir vor?“, kreischte Julia, die fürchtete, den Verstand zu verlieren.
„Frag‘ nicht, hilf mir, eins der Weinfässer zum Tor zu rollen“, sagte Anna in befehlendem Ton.
Mit letzter Kraft gelang es den beiden Frauen, ein kleineres, leeres Fass die Treppe hinauf und durch das Inferno hindurch zum Tor zu bringen. Der beißende Rauch und die Hitze nahmen Julia fast den Atem. Auf Geheiß der Amme kletterte sie in das Fass hinein. Es roch nach Weinstein und Essig, war feucht und muffig.
„Komm mit mir“, rief sie Anna zu. Die Haut an ihren Schultern und Beinen schmerzte, dort, wo glühende Bretter sie gestreift hatten.
„Es ist nur Platz für eine“, sagte Anna. Das Letzte, was Julia von ihr sah, bevor sie das Fass mit dem Boden verschloss, war ihr Gesicht, dieses Rosinenkuchengesicht, das sie immer so sehr geliebt hatte. Polternd setzte sich das Fass in Bewegung. Julia wurde gerüttelt und geschüttelt, drehte sich im Kreis, immer schneller, ihr wurde schwindelig und alles tat ihr weh. Das Fass hopste, sprang, schlug gegen Hindernisse, blieb kurz stehen, um dann weiter bergab zu rollen. Das war sicher einer dieser Baumstümpfe, dachte Julia, bevor es dunkel um sie wurde.
3.
Es war die Hölle, und sie war mittendrin, von Gluthitze und Flammen umgeben, von Teufeln umtanzt, die sich weideten an ihrer Qual. Nach einer Ewigkeit, Hunderte von Höllen weiter hörte sie ein Geräusch. Ein Licht erschien am Ende des Tunnels, die Pforten des Himmels öffneten sich für sie, die geglaubt hatte, für alle Zeit hier unten schmoren zu müssen. Ihr Körper, ihr Kopf, ihre Arme und Beine, alles schmerzte und brannte. Ihre Finger griffen in Erbrochenes, kräftige Hände zogen sie aus dem Gewölbe heraus, in dem sie sich befand. Welche Wohltat, auf weichem, feuchtem Gras zu liegen und einen blassblauen Himmel über den Baumwipfeln zu sehen!
Ein derbes Bauerngesicht beugte sich über sie.
„Es ist ein Wunder, dass Ihr gerettet wurdet“, sagte der Mann. „Da oben ist nichts mehr übrig geblieben.“ Er wies mit dem Daumen in die Höhe, auf die Reste der verkohlten Burg, von der Rauchschwaden aufstiegen.
„Das Wetter hat uns mal wieder alles gründlich verhagelt“, fuhr der Bauer fort. „Doch ich will nicht jammern, Euch hat es viel schwerer getroffen. Ich werde Euch zu meinem Wagen tragen.“
Er nahm sie auf seine Arme, was zu einem erneuten Schmerz- und Übelkeitsanfall bei Julia führte. Sie verlor abermals das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, lag sie auf einem Wagen, der einen Feldweg entlang rumpelte. Auch hier hatte der Hagel viel zerstört: Die Bäume streckten ihre teilweise entblätterten Zweige in den Himmel, und die hölzernen Räder des Gefährts blieben immer wieder im matschigen Untergrund oder einer großen Pfütze stecken. Julia spürte nichts als Schmerz, Müdigkeit und eine unendliche Trauer. Sie hatte alles verloren, was ihr Leben ausgemacht hatte. Während sie so dalag, die Zähne zusammenbiss, um nicht laut heraus zu schluchzen und auf den Rücken des Bauern starrte, der seinen Gaul durch die Felder und Wiesen lenkte, dachte sie an Anna, ihre Eltern, an Lina, Katherina, Joscha und alle anderen. Hätte sie, Julia, nicht versuchen müssen, sie zu retten? Als hätte er ihre Gedanken erraten, drehte sich der Bauer um und sagte:
„Macht Euch keine Gedanken, Ihr wäret selbst draufgegangen, wenn Ihr versucht hättet, jemanden zu retten. Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen.“
Der Name des Herrn sei gelobt, dachte Julia. Das konnte aber nicht Gottes Werk gewesen sein. Der Schäfer fiel ihr ein. Ob er auch vom Blitz erschlagen wurde wie sein Vorgänger? Irrten die Schafe jetzt führungslos umher, war der Hund noch bei ihnen? Der Bauer zog die Zügel an, machte „Brr“, und das Fuhrwerk kam zum Halten. Vor ihnen stand ein kleines, aus Lehm gebautes Haus mit einem Sockel aus rötlichem Stein. Es war mit Schindeln gedeckt, und aus dem Schornstein stieg eine schmale Rauchsäule. Eine hagere Frau stand in der Tür, stemmte die Arme in die Taille ihres Leinenkleides und rief:
„Wen bringst du mir da, Johann? Ach Gott, wie sieht die denn aus. Bring sie schnell herein.“ Hinter ihr wurden fünf Kinder mit großen Augen sichtbar, die an ihrem Kleid rissen.
„Sie hat den Brand auf Tanneck überlebt“, sagte der Bauer. Er stützte Julia auf dem Weg ins Haus.
„Jemand scheint sie in ein Weinfass gesteckt zu haben, um es den Berg herunterrollen zu lassen. Hab ich nicht gesagt, Sina, habe ich nicht gesagt, da kommt ein Feuerrad den Berg herab?“
„Es war meine Amme, die mich gerettet hat“, sagte Julia. Gleich darauf schlug sie die Hände vors Gesicht und schluchzte trocken auf.
„Nun weint mal nicht, so ist das Leben eben“, versuchte die Bäuerin sie zu trösten. „Wir haben Glück gehabt, dass der Hagel unser Feld verschonte. Andere sind jetzt arm wie Kirchenmäuse. Gott allein weiß, warum es diesen trifft und jenen nicht. Legt Euch da auf die Ofenbank in der Küche. Ich hole etwas Wasser vom Brunnen.“ Julia tat, wie ihr geheißen. Die Kinder standen stumm und scheu um sie herum. Die Bäuerin kehrte mit einem Eimer zurück, scheuchte die Kinder hinaus und begann, Julia zu reinigen. Auf ihre Wunden strich sie einen Brei aus Ringelblumen und Asche. Dann brachte sie ihr ein Stück Brot und einen Becher mit Bier, breitete eine Decke über sie, die nach Ziegen roch, und ließ sie allein. Innerhalb kurzer Zeit war Julia eingeschlafen.
Die nächsten Tage lebte Julia unter der Pflege der Bäuerin sichtbar auf. Als sie wieder herumlaufen und der Frau bei leichteren Arbeiten zur Hand gehen konnte, sprachen die Bauern sie nach dem Abendessen an.
„Habt Ihr Verwandte?“, fragte Johann. „Wir haben selber nicht genug, um noch jemanden durchfüttern zu können.“ Darüber hatte Julia sich noch keine Gedanken gemacht, so betäubt war sie von dem Geschehen gewesen, eher daran gedacht, sich bei einem reichen Bauern als Magd zu verdingen. Ihre Tante fiel ihr ein. Wie hatte sie noch geheißen? Kreszentia.
„Ich habe eine Tante in der Stadt, weiß aber nicht mehr, wo sie wohnt.“
„Das finden wir heraus“, meinte der Bauer. „Aber vorerst gibt es noch eine Beerdigung.“ Er räusperte sich. „Von dem, was dort oben gefunden wurde zwischen den Überresten. Aber haben sie nicht ein ehrliches Begräbnis verdient?“
Julia verschluckte sich an dem Bier, das sie gerade trank.
„Ich werde hingehen“, sagte sie. „Und dann nach meiner Tante suchen.“
Am Tag der Beerdigung zog Julia ein schlichtes, graues Wollkleid an, das sie von der Bäuerin bekommen hatte. Darüber trug sie eine schwarze Schaube und eine dunkle Haube mit einem Schleier. Die Bauersleute konnten sie nicht begleiten, da sie ihren Hof versorgen mussten, und so trat Julia allein den Weg zur Kirche an. Es war ein strahlender Sommermorgen. Einige vom Hagel niedergedrückte Halme hatten sich wieder aufgerichtet und trugen dicke, goldene Ähren. An den Ackerrändern blühten Rittersporn und Klatschmohn. Das Licht fiel heiter auf die Landschaft, die sich lindgrün und wellig vor ihr ausbreitete. In der Ferne sah sie die Berge bläulich aufragen, weiter vorn den Hügel mit der Burgruine und die Stadt mit ihren Toren und Türmen. Es geht weiter, es muss weitergehen, sagte sie vor sich hin, während sie den Blick zum Boden wandte. Ein Hirschkäfer kroch über den Weg. Alles Lebendige geht seinen Gang, dachte sie, der Tod ist nicht das Ende. Vielleicht ist es besser dort, wo sie jetzt sind. Julia stieg die Anhöhe zur Kirche hinauf. Sie war gedrungen, mit einem Spitzdach gekrönt und von einer Mauer umgeben. Eiserne Kreuze und verwitterte Steine zeigten die Stellen, an denen die Menschen ihre Liebsten zu Grabe getragen hatten. Ein Loch war frisch ausgeworfen. Julia fühlte sich, als wenn ein unsichtbarer Schleier sie umgebe, als ginge sie das alles nichts an. Julia warf einen Blick zum schlanken Turm der Kirche hinauf und entdeckte dämonische Skulpturen sowie zwei einander zugewandte Drachen. Ob die Böses von der Kirche abwehren sollten? Sie betrat die Kirche. Ein roh gezimmerter Sarg stand neben dem schlichten Steinaltar. Er war mit einem Strauß frisch gepflückter Nelken und Kornblumen bedeckt. Julia setzte sich in die vorderste Bankreihe, die für die Angehörigen vorgesehen war. Der Chor war von einem Netzrippengewölbe überspannt, an den Seiten standen Grabplatten. Die schwarz verschleierte, hagere Frau neben Julia wandte sich zu ihr um. Das war doch...
„Tante Kreszentia“, flüsterte sie. Die Tante schaute sie mit zusammengekniffenen Augen an.
„Du und deine Familie, ihr habt gesündigt“, zischelte sie so leise, dass nur Julia es hören konnte. „Oh, ich habe es schon immer gesagt, über diese Menschen kommt einmal ein Unglück.“
„Aber warum ...“, wollte Julia entgegnen, hielt aber inne, da nun der Klang der Orgel ertönte.
„Ein’ feste Burg ist unser Gott, Ein gute Wehr und Waffen; Er hilft uns frei aus aller Not, Die uns jetzt hat betroffen. Der alt’ böse Feind, Mit Ernst er’s jetzt meint, Gross’ Macht und viel List Sein’ grausam’ Ruestung ist, Auf Erd’ ist nicht seingleichen“,
sangen der Pfarrer und eine Handvoll Leute, die ihren Weg zu der Beerdigung gefunden hatten. Dieser Mann namens Luther hatte das Lied erst in diesem Jahr erdichtet und es mittels Druckschriften unter die Leute gebracht. An manchen Orten vermischten sich Anhänger Luthers und Katholiken, keiner wusste mehr, welcher denn nun der rechte Glauben sein sollte. Anna hatte ihr das erzählt und es oft mit ihr zusammen an den Sonn- und Feiertagen in der Burgkapelle gesungen. Die Tränen liefen Julia über die Wangen, aber die Tante sah starr geradeaus und bewegte die fleischlosen Lippen zur Melodie.
„Und wenn die Welt voll Teufel wär’ Und wollt’ uns gar verschlingen, So fürchten wir uns nicht so sehr, Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, Wie sau’r er sich stellt, Tut er uns doch nicht, Das macht, er ist gericht’t, Ein Wörtlein kann ihn fällen“,
sangen die Anwesenden.
Die Welt voller Teufel? Und ein Wort kann ihn fällen, den Fürst dieser Welt? Julia überlegte, was das für ein Wort sein könnte. Der Pfarrer, ein dicklicher, älterer Mann in einer schwarzen Soutane, stellte sich jetzt hinter den Altar und begann mit seiner kurzen Predigt. Wahrscheinlich wartete er darauf, dass alles schnell vorbeigehen möge und er heim zu seinen Fleischtöpfen und Pfründen kam. Und zu seiner Magd. Um Gottes Willen, was denkst du da, schalt sich Julia im selben Augenblick. Er tut doch nur seine Pflicht.
„Wir bitten Dich, erhöre uns gütiger Herr!“, begann der Pfarrer mit seiner Litanei.
„Gib uns ein Herz, Dich zu lieben, Dich zu fürchten und eifrig nach Deinen Geboten zu leben; Wir bitten Dich, erhöre uns, gütiger Herr! Lass Dein ganzes Volk in der Gnade wachsen, dass es dein Wort demütig höre, mit reiner Liebe aufnehme und Früchte des Geistes hervorbringe.“
„Wir bitten Dich, erhöre uns, gütiger Herr!“, murmelten die Kirchenbesucher.
Eine Fliege hatte sich auf dem Unterarm von Julia niedergelassen und putzte sich gelassen die Flügel. Julia war versucht, nach ihr zu schlagen, unterdrückte jedoch diesen Wunsch.
„Leite alle Verirrten und Verführten zurück auf den Weg der Wahrheit; Wir bitten Dich, erhöre uns, gütiger Herr! Stärke die Stehenden, tröste die Verzagten und richte auf alle Gefallenen. Schließlich trete Satan unter unsere Füße.“ Julia machte eine energische Bewegung mit dem Arm, um die Fliege zu verscheuchen, gleich darauf landete diese jedoch wieder an derselben Stelle. Satan unter unsere Füße? Julia hatte das Lutherlied oft gehört, es oft gesungen, war sich aber der Bedeutung der Worte nie bewusst gewesen. War sie auf der Erde, um Satan unter ihre Füße zu treten? Was bedeutete das? Sie beschoss, ihre Tante zu fragen, auch wenn die ihr nicht gerade gut gesinnt zu sein schien. Die Fliege kitzelte jetzt derart, dass sie nach ihr schlug, was ihr einige ärgerliche Blicke der Tante und der Kirchenbesucher eintrug.
„Wir bitten Dich, erhöre uns, gütiger Herr!“, betete der Pfarrer.
„Helfe allen in Gefahr, Not und Bedrängnis, unterstütze und tröste sie.“
„Wir bitten Dich, erhöre uns, gütiger Herr!“, gaben die Frommen zur Antwort.
Die Orgel endete mit einem brausenden Akkord, was Julia die Tränen in die Augen trieb. Wie im Nebel folgte sie, Seite an Seite mit Kreszentia, den Sargträgern zu der Grube. Mit Seilen wurde der Sarg in die Gruft hinabgelassen.
„Erde zu Erde, Asche zu Asche“, sagte der Pfarrer mit sonorer Stimme und warf einen Klumpen in die Tiefe.
„Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten auf euch und gebe euch Frieden. Amen.“ Auf einen Wink vom Pfarrer begann der Totengräber sein Werk. Die Besucher zerstreuten sich, ohne weiter Notiz von Julia und ihrer Tante zu nehmen. Sie solle gleich mit ihr kommen, sagte die Tante, schließlich sei sie das ihrem toten Bruder schuldig.
Kreszentia sprach wenig auf dem Weg zu ihrem Haus, und so hatte Julia ausgiebig Muße, die Blumen in den Gärten zu betrachten. Mit einem jähen Schmerzgefühl wurde ihr bewusst, wie schön Gott seine Schöpfung gestaltet hatte. Warum hatte er sie so geprüft, warum musste er ihr das Liebste, was sie hatte, entreißen? Sie sah Malven und Vergissmeinnicht, stattliche gelbe Königskerzen mit schwarzen Augen, aber auch Kratzdisteln und Natternköpfe am Wegesrand. Vielleicht hatte Gott es ihr zur Aufgabe gemacht, etwas von dem Geheimnis seiner Natur zu enträtseln. Es gab Schönes und Hässliches, Gutes und Böses, es gab Kriege und friedliche Zeiten, und immer kam etwas Neues hervor, wenn das Alte untergegangen war. Sie folgte der Tante durch die Gassen der Stadt, in denen sich der Kot ausbreitete und die Bewohner sich im Abendlicht zu schaffen machten, jeder mit seinem eigenen Ding. Eine Frau trat aus dem Haus und leerte einen Eimer mit übelriechender Flüssigkeit auf die Straße. Ihre runzligen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln, das die gelben Zahnstummel freigab. „Vorsicht, Ihr könntet nass werden“, scherzte sie. Kreszentia nahm ihre Nichte am Arm und zog sie weiter. Julia erkannte das Haus ihrer Tante sofort wieder. Es war klein, mit einem hübschen alemannischen Fachwerk ausgestattet, das Obergeschoss kragte über das untere hinaus, mit einer runden, niedrigen Tür, über der die Namen von Schutzheiligen eingraviert waren. Direkt neben den Wohnräumen lag der Stall, aus dem das Schnattern von Gänsen drang. Seitlich befand sich ein Garten mit Buschrosen, Birken, einem Zwetschgenbaum, Sommerfrüchten und Kräutern.
„Komm mit in den Garten“, sagte Kreszentia. Jetzt, nachdem sie den Schleier zurückgeschlagen hatte, sah Julia ihre Gesichtszüge, die ihr schon damals alt erschienen waren, obwohl die Tante da höchstens fünfunddreißig Jahre gewesen sein mochte. Das Gesicht war spitz, leicht gerötet, zwei tiefe Furchen zogen sich von der Nasenwurzel zum Mund herab. Ihre Augen waren grau, wachsam und misstrauisch, ihre Gestalt mager, aber aufrecht, als habe sie einen Spazierstock verschluckt.
„Dieser Garten wird für die nächste Zeit deine Aufgabe sein“, bestimmte Kreszentia mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. „Später, am Ende des Sommers, wird man dann weitersehen. Deine Mahlzeiten wirst du zusammen mit meiner Magd Franziska einnehmen. Sie ist ein junges, dummes Ding vom Land. Deine Mutter hat dich doch gewiss in Gartenbau und Kräuterkunde unterwiesen?“
„Ja, hat sie“ presste Julia zwischen den Zähnen hervor.
„Dann ist es ja gut“, meinte die Tante und rauschte davon. Wenig später kam ein Mädchen mit rundem Gesicht aus dem Haus gelaufen. Über einem einfachen Wollkleid trug sie eine grobe Leinenschürze. In ihrem Gesicht war alles lebendig: die dunklen Knopfaugen, ihre rosigen Bäckchen und eine kleine Stupsnase. Der lächelnde, breite Mund, der eine Reihe gesunder Zähne sehen ließ, und ihre lebhaften Bewegungen verrieten, dass Julia es mit einer aufgeweckten Altersgenossin zu tun hatte. Das Mädchen ging unbefangen auf sie zu.
„Ich heiße Franziska“, sagte sie mit einer hellen Stimme und lachte gleich darauf, als ertöne eine Glocke. „Wie schön Ihr seid mit Euren blauen Augen und dem rehfarbenen Haar. Nehmt doch einmal die Haube ab, damit Licht und Luft daran kommen.“
Julia war froh, sich der Kopfbedeckung entledigen zu können.
„Kommt, ich zeige Euch unser Wundergärtlein“, sagte Franziska.
Sie blieb vor einem Beet mit Petersilie, Koriander und Liebstöckel stehen. „„Hier seht Ihr die Gewürzkräuter. Dazwischen habe ich Sponsa solis – das ist Sonnenkraut oder auch Ringelblume - Raute und Lavendel gepflanzt.“ Julia sog den Duft der Pflanzen ein. „Daneben stehen Zitronenmelisse und Majoran. Die Blumenbeete sind von Buchs gesäumt. Vorsicht ...“, sie senkte ihre Stimme zu einem Flüstern. „Das hier ist der Spindelstrauch oder Pfaffenhütchen. Die Samen dieser Pflanze enthalten ein starkes Gift.“
„Wozu braucht meine Tante Gift in ihrem Garten?“, wollte Julia wissen.
„Es sind Heilpflanzen. Schaut hier den purpurroten Fingerhut, ein Herzgift und eine Arzneipflanze, die seit alters her in Gebrauch sind und ...“, sie strahlte Julia sichtlich vergnügt an, „hier der hochgiftige Eisen- oder Sturmhut, eines der stärksten Pflanzengifte überhaupt.“
Julia bemerkte, dass wie zur Tarnung Gänseblümchen zwischen Taglilien blühten, von Bienen umsummt, und auf einem anderen Beet Kohl, Lauch und Winterwirsing angebaut waren, gerahmt von Johannisbeer- und Himbeerbüschen. Von der Haustür her wurden Stimmen laut. Zwei Männer verabschiedeten sich von der Tante. Einer kam Julia bekannt vor. War das nicht der Bader, der ihrer Mutter am Tag des Unglücks den Zahn gezogen hatte? Ein Schauder überlief sie, nicht nur wegen des schlechten Omens, das diese Begegnung bedeutete, sondern auch wegen des Mannes, der ihr so widersprüchliche Gefühle bereitet hatte. Der Bader war in einen schwarzen Kapuzenmantel gehüllt und redete mit heftigen Bewegungen auf die Tante ein. Der andere Mann war, wie der Bader, Anfang zwanzig und hatte langes, welliges, dunkles Haar. Er trug Bruche mit Beinlingen und Stiefeln, ein Seidenhemd und ein Barett mit Flaumfedern. Jetzt schauten beide zu ihr herüber und verbeugten sich leicht. Julia spürte, wie ihr die Röte in die Wangen stieg, und wandte sich schnell wieder Franziska zu.
„Wer war das?“, fragte sie, als die beiden Männer in der Abenddämmerung davonschritten.
„Das sind die Kostgänger von Frau Kreszentia“, entgegnete das Mädchen. „Gunther Rathfelder, der Bader unserer Stadt und Wolfram von Lauterach, studierter Rechtsgelehrter und Schreiber im Rathaus. “
Soso, dachte Julia, das ist also der Bader, der meiner Mutter den Quadrupelzahn gezogen hat. Er war ein Heiler, aber irgendwie war er ihr unheimlich. Der andere gefiel ihr wesentlich besser. Hoffentlich würde sie bald Gelegenheit haben, die beiden Männer näher kennenzulernen. Sie konnte sich nicht mehr auf das konzentrieren, was Franziska ihr erzählte. Julia schaute sich die Blumen, die Gemüsepflanzen, Gartenkörbe und Werkzeuge an, die das Dienstmädchen ihr eifrig zeigte, aber sie nahm nichts mehr richtig wahr. Eine Angst hatte sie ergriffen vor dem, was ihr bevorstehen könnte. Sie war nicht in der Lage, es zu benennen. Wann immer sie an ihre Eltern, an Anna, die Knechte und Mägde dachte, spürte sie einen brennenden Schmerz. Sie konnte sich nicht damit abfinden, dass sie alles verloren hatte. Es würde nie mehr so sein wie zuvor. Doch gleichzeitig war sie ein wenig neugierig auf das, was kommen würde. Es war wie damals in der Kindheit, wenn Anna sie ein wenig zu wild geschaukelt hatte. Der Abend war noch immer so heiß, dass Julia am ganzen Körper schwitzte. Nicht einmal die Nacht würde Abkühlung bringen.
4.
Die nächsten Tage brachten neue Gluthitze. Frühmorgens verrichtete Julia ihre Arbeit im Garten, jätete Unkraut, bearbeitete die Erde mit einem Grubber, pflanzte Lauch und goss die Pflanzen mit Wasser, das sie aus dem nahegelegenen Fluss holte. Nach der Beerenernte musste sie die Sträucher schneiden, welke Blätter von den Bohnen entfernen und zum Komposthaufen tragen. Kreszentia ließ ihr keine Ruhe, immer musste sie etwas für sie erledigen, nie durfte sie einen Moment die Arbeit niederlegen. Sie machte Botengänge für die Tante, half Franziska beim Fegen oder Wäschewaschen und träumte nachts von Feuer und Zerstörung. Die beiden Kostgänger bekam sie nicht mehr zu Gesicht, auch wenn sie ihr nicht mehr aus dem Kopf gingen, besonders der Schreiber nicht. Sie aß mit Franziska in der Küche und musste auf ihr Zimmer gehen, bevor die Männer kamen. Dabei wurde das Gefühl in ihr immer stärker, dass sie Schuld trage an dem Unglück, dass über ihre Familie gekommen war. Hatte sie sich nicht gewünscht, fortzugehen von der Burg, den Eltern, dem Leben, das sie dort führte? Und jetzt? War ihr Leben nur einen Deut besser geworden? Mitnichten. Selbst der Gestank in den Gassen war hier nicht geringer, weil die Menschen ihre Nachttöpfe einfach auf die Straße leerten. Sie beschloss, sich vorerst in ihr Schicksal zu ergeben und auf eine Gelegenheit zu warten, bei der sie ihrem Leben noch einmal eine andere Wendung geben konnte. In den wenigen Mußestunden nahm sie den Stickrahmen zur Hand, las in der Bibel oder spielte auf einem verstimmten Cembalo. Kreszentia entließ Franziska, zum großen Kummer von Julia, die das Mädchen lieb gewonnen hatte. Sie könne sie nicht mehr bezahlen, jetzt, wo sie eine weitere Esserin im Hause habe, sagte die Tante. Franziska würde in einem Haus in Reutlingen als Zimmermädchen anfangen.
In den nächsten Tagen verschlechterte sich das Wetter. Es wurde empfindlich kalt. Julia trug warme Wollsachen unter ihrem Mantel, die hatte Kreszentia ihr abgetreten, Kleidung, die sie selbst nicht mehr benötigte. Ein Blick aus dem Fenster reichte, um Julias Laune auf einen Tiefpunkt zu bringen: Nebel, so dicht, dass sie kaum die Bäume im Garten erkennen konnte.
„Julia!“ Wie sie die herrische Stimme von Kreszentia hasste!
„Geh zur Fleischschranne und hol mir einen Topf Metzelsuppe“, befahl sie. „Dann brauche ich einen Laib dunkles Roggenbrot, du weißt ja, wo der Bäcker seinen Stand hat. Aber trödle nicht, sonst schicke ich dich ohne Abendessen ins Bett.“
Es war schon schlimm genug, dass Julia immer allein auf ihrem Zimmer essen musste. Sie nahm Geld und Topf von Kreszentia und verließ mit trüben Gedanken das Haus. Was, wenn das Leben immer so weiterging? Vielleicht wollte die Tante sie bald verheiraten, damit sie ihr nicht mehr auf der Tasche lag. Mit dem Metzger, diesem Schweinchengesicht, der war doch im letzten Jahr Witwer geworden. Oder mit dem Schuster, dem finsteren Gesellen, der nie ein Wort sprach. Der Nebel hing zwischen den Häusern der Stadt, kroch in ihre Kleider, machte alles klamm. Es war, als hätte sich eine riesige Wolke über den Ort gebreitet, sei dort liegen geblieben und würde nie mehr weichen. Nur wenige Menschen waren unterwegs. Julia erreichte den Salzbrunnen und die Salinenhäuser, die mit einfachem Fachwerk geschmückt waren. Hier wurde emsig gearbeitet. Sie bog in eine Nebengasse ein. An der Fleischbank hielt sie dem Metzger ihren Topf hin.
„Eine schöne Portion Metzelsuppe hätte ich gern“, sagte sie und schlug die Augen nieder, weil sie den eindringlichen Blick des Metzgers spürte. Rund und rosig sah er aus, mit seinen kleinen blauen Augen, die zwischen einer dicken Nase und wulstigen Augenbrauen kaum zu sehen waren. Er hörte auf, in dem großen Kessel zu rühren, unter dem ein kräftiges Feuer brannte. Der Geruch nach Blut, Leberwurst und Brühe drang zu Julia herüber. Der Metzger stemmte die Arme in die Hüfte, sah sie herausfordernd an.
„Die Suppe ist noch nicht fertig“, sagte er. „Kommt in einer Stunde wieder.“
Sie sah, dass in dem Topf alles schwamm und brodelte, was der Metzger nach dem Schlachten nicht verkaufen konnte: Gekröse, Pfoten, Zähne, Ohren, Schwänze von der Sau. Später kamen Bauchlappen, Blut- und Leberwürste dazu. Gegessen wurden nur die Würste und das fette Fleisch. Was sollte sie jetzt tun? Sie hatte keine Lust, noch einmal zurückzugehen, denn sie wollte Kreszentia nicht mit leeren Händen gegenübertreten. Julia seufzte. Dann musste sie eben solange spazieren gehen. Das Brot konnte sie ja schon mal kaufen. Sie erstand beim Bäcker einen großen Brotlaib und ging in Richtung Stadttor nach Norden. Das war der Weg, den sie mit ihrer Tante gegangen war.
Gedankenverloren lief Julia weiter. Schemenhaft standen Bauernhäuser im Dunst. Julia konnte kaum die Getreideähren erkennen, die auf den Feldern standen. Da vorne stand eine Kapelle, vielleicht die des Seichenfriedhofs. Doch als sie weiterging, war nichts mehr zu sehen als grauweißer Nebel, die Umrisse der Bäume und der Weg zu ihren Füßen. Ihr Herz begann schneller zu klopfen. Wo war sie eigentlich? Sie drehte sich um, ging in der entgegengesetzten Richtung weiter. Das Gleiche: Nebel, Bäume und hölzerne Zäune. Der Boden war federnd und weich. Zu ihrer Bestürzung erkannte Julia, dass sie sich nicht mehr auf dem Weg befand, sondern auf einer Wiese. Sie blieb stehen, horchte in die Welt hinein. Es war alles still, so grenzenlos still, als hätte Gott die Erde erst heute gemacht. Kein Vogel rief, keine Grille zirpte, kein Ruf eines Menschen, kein Knarren eines Wagens war zu hören. Julias Knie wurden weich. Sie wäre am liebsten zu Boden gesunken und hätte um Hilfe geschrien. Doch niemand würde sie hören, die Welt war verlassen, ausgestorben, sie war dazu verdammt, immer im Kreis zu laufen. Ihre Hände und Füße waren kalt. Um sich aufzuwärmen, lief Julia weiter in die Richtung, aus er sie gekommen war. Da war wieder die Turmspitze der Kapelle. Sie lief darauf zu. Und richtig, eine verwitterte Mauer tauchte auf, eiserne Kreuze markierten die Gräber des Siechenfriedhofs. Julia hätte fast aufgeschluchzt vor Erleichterung. Sie hastete durch die Reihen. Auf einem der Gräber lagen frische Blumen, Astern und Zweige von einem Wacholderbusch. Die Beerdigung ihrer Eltern kam ihr in den Sinn. Sie war häufig auf dem kleinen Stadtfriedhof gewesen und hatte immer Blumen mitgebracht. Sie stand lange vor dem fremden Grab, betete, dachte an die schöne Zeit, die sie mit ihren Eltern verbracht hatte. Das Blöken von Schafen näherte sich dem Friedhof. Julia schaute angestrengt in die Richtung, aus der es kam. Eine Gestalt tauchte auf. Es war der Schäfer Hans.
„Ihr seid doch Julia Eitel, der ich droben kurz vor dem Gewitter begegnet bin“, sagte er. In seinem grauen Bart hingen winzige Wassertropfen.
„Ja, ein trauriger Anlass, bei dem wir uns wiedersehen“, antwortete sie. „Aber ich freue mich, Euch gesund und munter hier anzutreffen.“
„Ich weiß, wie man sich bei solchen Unwettern verhalten muss“, meinte der Schäfer. „Und habe mich nicht unter einen Baum gestellt, wie mein Vorgänger. Stattdessen überlebte ich in einer Mulde, patschnass zwar, aber quicklebendig. Eins von den Schafen wurde vom Blitz getroffen, ein anderes verirrte sich und stürzte ab.“
„Mein Gott.“ Julia fiel etwas ein. „Da stehe ich und schwätze und vergesse meinen Auftrag.“
„Wer hat Euch denn einen Auftrag erteilt? Eure Tante?“
„Ihr wisst ...“
„Ich erfahre viel von den Leuten. Aber gebt Acht auf Euch, Julia. Kreszentia Eitel ist eine Frau, die wohl mal angesehen war, aber aus mir nicht bekannten Gründen nie geheiratet hat. Man spricht davon, dass sie sich manchmal mit einem feinen Herrn trifft, andere Male mit einer Matrone, mit der sie in den Ecken der Stadt steht und tuschelt. Die führt sicher nichts Gutes im Schilde.“
Endlich einmal jemand, der sie verstand und der ihre Meinung über Kreszentia teilte.