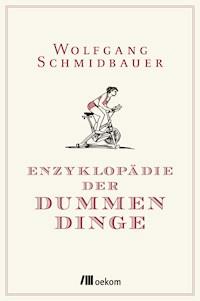Wolfgang Schmidbauer
Die Kunstder Reparatur
Ein Essay
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2020 oekom, Münchenoekom verlag, Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbHWaltherstraße 29, 80337 München
Umschlaggestaltung: www.buero-jorge-schmidt.deKorrektorat: Maike SpechtLektorat: Ute Scheub
E-Book: SEUME Publishing Services GmbH, Erfurt
Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-96238-672-6
INHALT
Einleitung
Kapitel 1
Rettet die Dinge und die Menschen!
Kapitel 2
Die Ehre der Dinge
Kapitel 3
Reparieren, therapieren?
Kapitel 4
Mit dem Mangel leben
Kapitel 5
Der Unterricht in Autonomie fällt aus
Kapitel 6
In der Schule alter Häuser
Kapitel 7
Reparatur und Risiko
Kapitel 8
Reparieren oder austauschen?
Kapitel 9
Scherben zum Schmelzen bringen
Kapitel 10
Der Mühe wert
Kapitel 11
Die Recyclinglüge
Kapitel 12
Kunstvolle Sparsamkeit
Kapitel 13
Flicken
Kapitel 14
Werkzeug am Gürtel
Kapitel 15
Plastik: Was sich nicht reparieren lässt, sollten wir vermeiden
Kapitel 16
Auf dem Weg zur Ökotherapie
Schluss
Anmerkungen
EINLEITUNG
Wer kleine Kinder beobachtet, erkennt schnell die Macht der Funktionslust – sie sind hundertmal leidenschaftlicher als Erwachsene dabei, alles, was sie können, auch zu üben. Normalerweise weckt, was anders ist als das Gewohnte, Neugier. Es setzt einen schöpferischen Prozess in Gang.
»Kluge« Dinge kommen uns bei diesem Prozess entgegen, »dumme« blockieren uns. In einem Buch über »dumme Dinge« habe ich dieses Thema nicht nur aus ökonomischer, sondern auch aus psychologischer Sicht verfolgt.1 Dumm ist ein Ding, von dessen Funktionsstörungen wir nichts lernen können. Denn der Kontrast zwischen Funktionieren und Nichtfunktionieren kann die Aufmerksamkeit fesseln. Er wird die Beziehung zu einem Gegenstand im guten Fall vertiefen, im schlechten Fall dazu führen, dass das Interesse verloren geht.
In seinem schönen Buch über Die Kultur der Reparatur beschreibt Wolfgang Heckel seinen ersten Reparaturversuch an einem defekten Radio.2 Er zerlegte es als Fünfjähriger mithilfe der Werkzeuge, die er bei seinem Vater gefunden hatte, konnte es nachher zu seinem Leidwesen nicht mehr zusammenbauen und entdeckte bei dieser Gelegenheit die faszinierende Fähigkeit des Magneten an der Rückseite des Lautsprechers, Eisen festzuhalten. Dieser Fünfjährige studierte später Physik und wurde Direktor des Deutschen Museums in München. Seine Eltern haben diese Aktion nicht getadelt, sondern sich über den Forschergeist ihres Sohnes gefreut.
Dieses Radio war also ein kluges Ding, ebenso wie der kaputte Wecker, den mir meine niederbayerischen Großeltern zu jenem wunderbaren Spiel schenkten, das sie ztrifeln nannten – auf Hochdeutsch wohl zerlegen. Auch ich konnte den Wecker zwar zerlegen, aber nicht wieder zusammenbauen. Auf dem Weg gewann ich einen Kreisel aus der ausgebauten Unruhe und ein faszinierend schnell laufendes Räderwerk, das den Weckerklöppel zucken ließ wie ein verletztes Insekt.
Jahrhundertelang war es für die Menschen völlig selbstverständlich, alles zu erforschen, was ihnen in die Hände kam. Die Jäger und Sammler der Altsteinzeit überlebten nicht, weil sie gute Waffen hatten, sondern weil sie eifrig forschten. So fand der Ornithologe Ernst Mayr heraus, als er als junger Forscher einige Monate mit einem Stamm von Jägern und Sammlern auf Neu-Guinea zusammenlebte, dass diese 136 Bezeichnungen für die Vogelarten in ihrem Gebiet kannten. Der Wissenschaftler zählte 137 Arten. Kein Zufall, erläutert Mayr – die Waldmenschen müssen zu denselben Schlüssen kommen wie die Taxonomen in den Museen, weil sie ebenso gut wie diese die Natur beobachten.3 Aber wie viele Vogelarten kennt der durchschnittliche Großstädter?
Was Homo sapiens in den frühen Phasen seiner Entwicklung auszeichnete, war sein Wissen, seine reichen Kenntnisse über Pflanzen und Tiere, das Spurenlesen, die Fähigkeit, sich von Bienen zu ihren Honigwaben führen zu lassen und aus verwelkten Blättern zu schließen, wo nahrhafte Knollen in der Erde liegen.
Die Kultur der Reparatur, von der Heckel spricht, ist viel älter als die Zivilisation. Vor der modernen Konsumgesellschaft war es selbstverständlich, Dinge neugierig auseinanderzunehmen, sie zu erforschen und sie den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Ohne diese Haltung gäbe es die technische Entwicklung nicht. Wenn etwas nicht funktionierte, wurde es zerlegt, erforscht, verändert und neu zusammengesetzt. Aus diesen ständigen Verbesserungen wuchs der technische Fortschritt, bis er eine kritische Grenze erreichte und die Handwerker-Techniker den Fabrikanten und später den Marketingexperten und Designern weichen mussten.
Einer von ihnen, Brooks Stevens, prägte den Begriff des geplanten Veraltens (planned obsolescence), freilich nicht in dem Sinn, den er später gewinnen sollte: durch Verunmöglichung von Reparaturen Kunden zu zwingen, neue Produkte zu kaufen. Brooks Stevens ging es erst einmal darum, nicht ein einzelnes Produkt zu planen, sondern eine Serie, von der jede Generation so gestaltet sein solle, dass der Kunde verführt werde, das neue Produkt etwas früher zu kaufen als nötig.
Dass dieser Prozess durch Reparaturfeindlichkeit wirkungsvoller gestaltet werden kann, liegt nahe und wird brutal umgesetzt. Deshalb werden heute möglichst viele Elektrogeräte mit Akkus betrieben. Ein Rasierapparat mit unverwüstlichem Schwingankermotor für 220 Volt erinnert den Kunden viel zu spät daran, dass er einen neuen braucht.
Wenn Konzerne wie Apple heute behaupten, Umwelt und Wiederverwertung lägen ihnen am Herzen, lügen sie schamlos. Das erfährt jeder Kunde, der die Entwicklung zu immer unzugänglicheren Gehäusen, tückischen Verlangsamungen, abgewürgter Ersatzteilproduktion und nicht mehr austauschbaren Batterien verfolgt.4
Inzwischen wächst die Gegenbewegung. Sie ist freilich noch zu schwach, um den Gesetzgeber zu zwingen, das längst Notwendige zu tun: Rücknahmepflicht für alle Geräte durch die Produzenten und eine energische CO2-Steuer, durch die Rohstoffverschwendung und Billigproduktion erschwert werden. Die Menschheit hat die Welt eng gemacht. Sie wird nicht überleben, wenn sie die Verschwendung und die Entsorgungslast beim Steuerzahler weiterhin toleriert, während der Unternehmer mit seinem Gewinn durch eine geschickte Verschachtelung des Konzerns das Weite sucht.
Im 19. Jahrhundert mag der freie Markt ein kreatives Werkzeug gewesen sein. Solange es viele freie Räume gab, den Wilden Westen, den undurchdringlichen Dschungel, die unerschöpflich fischreichen Weiten der Meere, konnten die Grenzen jedes einseitigen Wachstums verleugnet werden. Die Vergangenheit lässt sich nicht verändern, aber die Zukunft nur bewahren, wenn die Grenzen des Planeten respektiert werden, von denen die Wirtschaftsphilosophen des 19. Jahrhunderts bereits hätten wissen können, aber noch nicht wissen mussten.
Meines Wissens waren es die Holländer, schon immer gezwungen, möglichst viel aus möglichst wenig zu machen, die nach der Jahrtausendwende die Repair-Cafés erfanden. In Deutschland hat sich die (An)Stiftung von Jens Mittelsten Scheid der Reparaturbewegung angenommen.5 2014 gab es in Deutschland 40 Repair-Cafés, 2019 waren es schon mehr als 1000 (wo das nächste ist, erfährt man auf einer Internetseite: reparatur-initiativen.de).
2003 gründeten zwei Studenten in Kalifornien iFixit – einen Webführer durch das Dickicht verlorener oder niemals ausgehändigter Reparaturanleitungen. Sie hatten sich geärgert, dass sie nirgends eine Bauanleitung für einen kaputten Rechner fanden. Die Anleitungen sind kostenlos, die Firma verdient ihr Geld mit dem Verkauf von Spezialwerkzeug und Ersatzteilen. Denn viele moderne Geräte lassen sich nicht mit normalen Werkzeugen öffnen; die Schrauben haben bizarre Vertiefungen. Durch einen handelsüblichen Bit-Satz können sie nur verdorben werden.
Als das Auto auf den Markt kam, wurde es so wenigen Regulierungen unterworfen wie im 19. Jahrhundert das Opium. Sicherheitsgurte, gereinigte Abgase – alles wurde erst eingeführt, als die Schäden dokumentiert waren, gegen hinhaltenden Widerstand.
Der Clean Air Act in den USA wurde Anfang 1970 in Kalifornien wegen des heftigen Sommersmogs erlassen. Er orientierte sich in Teilen an dem gleichnamigen Gesetz in London, das schon 1956 den Smog in der britischen Hauptstadt bekämpfen sollte.
Eine spezifische Qualität dieses Gesetzes hat der VW-Konzern zu spüren bekommen. Es schreibt vor, dass Maßnahmen eines Herstellers zur Abgasreinigung so transparent gemacht werden, dass alle Werkstätten und Bastler die Katalysatoren reparieren können. Die kriminelle Software wurde daher in den USA sehr viel härter verfolgt als in Europa.
Wenn man den Umfang der Probleme mit den bisherigen Maßnahmen gerade der europäischen Gesetzgeber vergleicht, denkt man nicht mehr an David gegen Goliath, sondern an das Kind aus der Heiligenlegende, das mit seiner Muschelschale das Meer in eine Sandgrube schöpfen will.
Drei Fragen sollten heute vor jedem Kauf stehen: (1) Brauche ich das wirklich? (2) Kann ich es reparieren? und (3) Wo bleibt der Müll? Dazu ist ein Vorgehen hilfreich, das dem Psychoanalytiker bekannt vorkommt: Reverse Engineering.6 Der Begriff stammt aus dem Maschinenbau. Es geht darum, einem Gerät jene Geheimnisse zu entreißen, welche die glatte Oberfläche verbirgt. Produzenten stellen sich Nutzern in den Weg, die verstehen, erforschen, ein Ding ihren eigenen Bedürfnissen unterwerfen wollen. Reverse Engineering durchkreuzt diesen Versuch. Das Gerät wird zerlegt, analysiert, seine Geheimnisse werden der Öffentlichkeit verfügbar gemacht, die Nutzer können es jetzt verändern, neu justieren und reparieren.
Die Parallele zur Psychoanalyse liegt nahe: Ein zunächst rätselhaftes Symptom, dessen Betriebsgeheimnis dem Betroffenen unzugänglich ist, wird in seinem Kontext analysiert und dadurch die innere Freiheit des Klienten wiederhergestellt. Der geistige Nutzen der Reparatur liegt darin, dass sie es uns ermöglicht, die Geschichte einer Störung zu lesen und daraus Schlüsse zu ziehen, wie wir sie beheben oder ihr vorbeugen können.
In diesem Buch möchte ich die vielfältigen Anregungen zur Entwicklung einer Reparaturgesellschaft um den psychologischen Aspekt ergänzen.7 Es geht um die Freude am Reparieren, aber auch um den Zusammenhang zwischen der Konsumgesellschaft und den Neurosen, unter denen Einzelne und Paare leiden. Das Modell von Ex-und-hopp lädiert nicht nur die Umwelt, sondern auch die Innenwelt. Es richtet sich gegen das Wesen der Humanität: die Verlässlichkeit von Bindungen.
Die Kunst der Reparatur beruht auf der Haltung, nicht schnell aufzugeben und angesichts einer Störung in zwei Richtungen zu denken, die beide dem primitiven Affekt entgegenarbeiten: dem »weg damit!« Diese beiden Richtungen folgen den Zeitpfeilen »zurück« und »vorwärts«: Was ist geschehen, dass etwas nicht mehr funktioniert, was bisher funktionierte? Und: Was kann ich tun, um die frühere Funktion wiederherzustellen?
Wenn ein Freund sich nicht mehr für mich zu interessieren scheint, kann ich mich ebenfalls von ihm abwenden. Oder aber ich versuche zu verstehen, was geschehen ist, spreche mit ihm über meinen Eindruck und mögliche Schritte, um das frühere Verhältnis wiederherzustellen.
Leider merken wir oft zu spät, was wir verloren haben, wenn wir angesichts eines verlockenden Angebotes aufgeben, was uns lange begleitet hat und uns durch einige Reparaturen vertraut geworden ist. Ich habe den Fehler gemacht, ein neues Rad mit einer Schaltung zu kaufen, die so kompliziert angebracht war, dass ich erst nach langer Pfriemelei und ausführlicher Lektüre einer in Halbdeutsch geschriebenen Anleitung das Hinterrad demontieren konnte. So wurde ich dafür bestraft, dass ich das vertraute Modell aufgegeben hatte, das mit einem vertrauten Handgriff ausgebaut werden kann.
Und wenn die lieb gewonnene Technik dem wind of change einfach nicht standhält, will ich sie wenigstens anständig betrauern! Das gilt vor allem für die mechanische Schreibmaschine: Ihr lieben Hingeschiedenen, Monika Olympia und Dora Olivetti! Wie oft habe ich euch wieder flott gemacht, ein Farbband eingezogen, etwas Öl in den Wagenlauf getropft, verbogene Typenhebel gerade gerückt und mit einer Nadel vertrocknete Farbe aus den e’s und o’s gekratzt.
Und dann kamen Bildschirm und Rechner; statt Papier konnte ich eine Diskette an den Verlag schicken, wenig später eine Mail. Nie wieder werde ich die Zuversicht und das Kompetenzgefühl erleben, die mich trösteten, wenn etwas an euch nicht funktionierte, wie es sollte. Mein Notebook hier funktioniert entweder perfekt – oder gar nicht mehr. Das ist sehr bequem – und im Krisenfall zum Verzweifeln.
Kapitel 1
RETTET DIE DINGE UND DIE MENSCHEN!
Mit der Massenproduktion im Industriezeitalter hat auch eine seelische Deformation begonnen. Arbeit verliert an Wert und Würde, wenn sie allein dem schnellen Nutzen dienen muss und Menschen ebenso wie Waren austauschbare Glieder einer Produktionskette werden. Der persönliche Bezug zu den Dingen geht verloren. Es ist ein Teufelskreis: Je weniger Bindung sich zu den der Mode unterworfenen Massenprodukten entwickelt, desto schneller werden sie ersetzt; das strahlt aus in die emotionalen Beziehungen.
Der Handwerker, der auf die Qualität seines Produktes stolz ist und sich mit seinem Kunden darüber einigt, ob es durch eine Reparatur gerettet werden soll, weicht dem anonymen Geschehen von Produktion und Vertrieb, in dem kalt kalkuliert wird, wie weit man gehen kann, um dem Kunden neue Waren aufzuzwingen.
Marx hat diese Entwicklung treffend beschrieben; seine Kritik hat sich in vielen Punkten bestätigt und bestätigt sich noch. Die von ihm vorgeschlagenen Lösungen haben sich bisher nicht umsetzen lassen; die Versuche in dieser Richtung haben wenig gebessert und liefern eher Argumente gegen die kritischen Gedanken.
Die Konsumgesellschaft schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch der Psyche. Mein erstes Plädoyer für Konsumverzicht war durch das erste Vogelsterben, Rachel Carsons Stummen Frühling, angestoßen worden.8 Das Pestizid Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) ist in Europa und Nordamerika seit über vierzig Jahren verboten. Aber die Umwelt hat ein langes Gedächtnis. Bis heute lassen sich als gesundheitsschädlich beurteilte Werte des Insektenbekämpfungsmittels in kanadischen Seen nachweisen.9
Ich erklärte im Homo consumens gedankenlosen Konsum durch orale Fixierungen und plädierte für den Abschied von der Verschwendungswirtschaft. Nie wieder habe ich so heftige Polemik gegen ein Buch erlebt wie 1972 gegen die These vom nötigen Konsumverzicht. Rezensenten entpuppten sich als Priester des heiligen Luxus; in der Zeit schrieb Haug von Kuenheim, auch Jesus wäre mit dem Auto nach Genezareth gefahren, wenn er eines gehabt hätte.
Heute wird es allmählich konsensfähig, dass es so nicht weitergehen kann. »Der Vermüllung der Meere und den ökologischen und sozialen Verheerungen der Textilindustrie kann nur dann Einhalt geboten werden, wenn weniger Kleider und weniger Plastik hergestellt, konsumiert und weggeworfen werden. Sehr viel weniger«, stellt 2018 Kathrin Hartmann in ihrem Buch Die grüne Lüge fest. Ökobewegung und Kapitalismuskritik haben heute die Chance, ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, in dem Verzicht kein Tabu ist, bemerkt im Juni 2019 Sebastian Schoepp in einem Leitartikel der Süddeutschen Zeitung: »Der Internetknoten in Frankfurt frisst mehr Strom als der ganze Flughafen. Wer nachhaltig etwas ändern will, kommt um ein Nachdenken über das Dogma des Immer-mehr nicht herum. Und vielleicht bedeutet ein Immer-weniger am Ende ja sogar mehr Lebensqualität?«
In der Welt von Homo consumens wachsen mit den Bequemlichkeiten auch die Ansprüche. Es ist ein Teufelskreis, denn je mehr Bequemlichkeit und Komfort wir kaufen können, desto weniger heilsame Übung im Ertragen von Angst und Schmerz nehmen wir in Kauf, um persönlich weiterzukommen. Es ist eine Binsenweisheit, dass Konsumartikel nur kurze Zeit die Stimmung heben. Wer sie nicht kritisch prüft, wird abhängig. Er genießt den Konsum nicht frei und entspannt, im Gegenteil. Er muss konsumieren, weil ihn sonst Unlust plagt. Was soll ich nur mit mir anfangen? Ganz einfach, ich gehe shoppen!
Wir haben uns in eine Paradoxie hineinentwickelt und unsere ökonomische Kreativität, unseren Erfindergeist an der Fiktion orientiert, dass der Planet über grenzenlose Ressourcen verfügt. Ähnlich gehen wir auch mit unserer Psyche um: Wir überfordern sie, packen immer mehr Forderungen in eine konstant bleibende Lebenszeit, weil es eben noch geht – bis sie kollabiert.
Unsere Urgroßeltern trugen ihre Hemden, bis Kragen und Manschetten zerschlissen waren. Dann nutzten sie die noch guten Stücke als Taschentücher, Putzlappen und Flicken. Wir geben in die Altkleidersammlung, was außer Mode ist, und in den Müll, was auch nur ein wenig zerschlissen ist. Dann kaufen wir die meist mit Petrochemie getränkten Wisch- und Putzlappen, die bald in den Müll wandern.
Wir handeln, als seien die Ressourcen unendlich, obwohl wir wissen, wie begrenzt sie sind, während unsere Vorfahren über solche Grenzen nichts wussten, aber handelten, als seien die Ressourcen begrenzt.
Die Ansprüche wachsen rasant, seit Maximierung und nicht Stabilisierung zum ökonomischen Prinzip erhoben wurde. Ein Auto, das dem Fahranfänger vor dreißig Jahren ein Wunder an Dynamik schien, wirkt heute unerträglich lahm. Nach vier Jahren ist der neue Computer »zu langsam«, obwohl er vor acht Jahren noch superschnell war. Der von Drogenberatern zitierte Spruch, dass ein Dealer nicht einen Stoff an Menschen verkauft, sondern Menschen an einen Stoff, lässt sich verallgemeinern und ist das Grundprinzip moderner Vermarktung.
Die Konsumgesellschaft ist, psychologisch gesehen, ein manischer Prozess. Manische Zustände sind durch Selbstüberschätzung, Verleugnung von Grenzen und blinden Optimismus charakterisiert. Sie kämpfen wütend gegen alle Zweifel und Einschränkungen ihrer Größenphantasie. Bricht diese zusammen, endet die Manie nicht in einem Normalzustand, sondern in einer Depression. Es wird deutlich, dass die Überschätzung bereits die ganze Zeit dazu gedient hat, die Gefahr der Depression abzuwehren.
Als nach dem Zweiten Weltkrieg die Freiheit verteidigt war und es darum gegangen wäre, das Verteidigte zu genießen, wurde die Lage in den Ländern der Sieger ungemütlicher als erhofft. Wie meist nach einem Krieg überfiel die Kämpfer der Eindruck, dass andere weniger gelitten und mehr Gründe hatten, sich am Sieg zu erfreuen. Kriege nützen nun einmal nicht den Soldaten, sondern den Fabrikanten, die ihnen Stiefel und Munition geliefert haben.
Um die aus dem Boden gestampfte und nach Aufträgen hungrige Industrie im Frieden weiter zu beschäftigen, entstand die Konsumgesellschaft. Die alten Sinnstifter waren nicht mehr glaubwürdig, die neuen verloren zunehmend an Kredit, je deutlicher die Kluft zwischen überzeugender Lehre und kläglicher Praxis wurde.
Dazu kamen Probleme, die weder Jesus noch Mohammed, Marx oder Freud bedrängten: Es wurde deutlich, dass diese Kultur mehr verbrauchte, als sich regenerieren kann.
Wir leben in einem Zwischenreich, in dem sich die Grenzen des Wachstums schlechter, aber immer noch von Mehrheiten verleugnen lassen. Gegenwärtig diskutieren Erwachsene, ob sie ihre Kinder in die Schule zwingen oder an ihrer Seite für eine Zukunft kämpfen sollen, in der auch die nächste Generation noch einen lebensfreundlichen Platz auf dem Planeten findet.
In diesem Kontext, als kleine Anleitung zum Genuss am Widerstand, zur Freude am Schwimmen gegen den Strom, siedle ich das Reparieren an. Es geht um die Verbindungen zwischen den Dingen und den Menschen, um die Energie, die wir sparen können, wenn wir das Vorhandene pflegen und nicht gierig nach besserem Ersatz Ausschau halten, um den Trost des Handwerks und die Freude daran, nicht alles komfortabler zu machen, sondern in der Bewältigung selbstgewählter Aufgaben Körper und Geist zu üben.
ZUM BEISPIEL REGENSCHIRME
»Heute kennt man von allem den Preis, von nichts den Wert.« So Oscar Wilde in Lady Windermeres Fächer. Die ausgepreiste Welt ermüdet uns, gibt uns ein Gefühl der Bedeutungslosigkeit – ein ökonomisches Rädchen in einer Riesenmaschine zwischen Produktion, Konsumption, Müll. Es gibt einige Auswege aus dieser öden Routine von Kosten und Nutzen: suchen und sammeln, selber machen, reparieren.
Es macht einen Unterschied, ob ich mir den Kräutertee in der Apotheke kaufe oder die Pflanzen in der Natur erkennen lerne, sie zur rechten Zeit pflücke, trockne und verwahre. Pilze kann ich im Laden kaufen oder im Wald finden – das erste ist Routine wie so vieles, das zweite ein kleines Abenteuer mit unsicherem Ausgang.
Den Tisch, an dem ich arbeite, kann ich fertig im Laden kaufen oder selber machen. Ob ich das mit gehobeltem Holz aus dem Baumarkt tue oder während des Projekts lerne, selbst zu hobeln – in jedem Fall wird es mein Tisch, ein Ding außerhalb der Langeweile, der Routine, der Entfremdung. Ein weiterer Ausweg ist das Reparieren. Im typischen Fall gibt es einem Ding, das andere für wertlos erklären, beiseitelegen oder wegwerfen, seine Funktion und oft auch etwas wie eine besondere Würde zurück.
Wer einem Ding begegnet, das eine Schwäche oder Störung zeigt, steht an einem Scheideweg. Er kann die bequeme Route wählen, die ihm hundertfach vorgelebt wird; weg damit, das ist nichts, das wird nichts. In den Müll damit! Oder er sieht hin und denkt nach.
Ich habe in den letzten dreißig Jahren keinen Regenschirm mehr gekauft. Dennoch stehen in dem Schirmständer mehrere funktionierende Exemplare, die ich alle aus öffentlichen Papierkörben geborgen habe, in denen sie nun wirklich nichts zu suchen hatten. Bei einem war der Griff abgebrochen; Gestänge und Bespannung funktionierten tadellos. Ich schnitzte also einen Griff aus Eschenholz in einer simplen, aber angenehm in der Hand liegenden Form, die sich an afrikanische Figuren der Lobi anlehnt, ganz ohne den wenig aussichtsreichen Ehrgeiz, deren Vollkommenheit gleichzukommen.
Ein abgebrochener Griff ist ersetzt.
Die Lobi leben im Süden Burkina Fasos und im Norden Ghanas und der Elfenbeinküste. Sie haben keine Häuptlinge, ihre Lehmburgen sind traditionsgemäß so weit voneinander entfernt, wie ein Pfeil geschossen werden kann. Holzfiguren (bateba) schützen ihre Eigentümer vor Zauberei und anderen Gefahren.
Bewundernswert sind neben den Kunstwerken der Lobi auch Gebrauchsgegenstände, die aus natürlich gewachsenem Holz herausgearbeitet werden. Man nennt das opportunistische Schnitzkunst. In meinem Fall ergab eine Astgabel den Ersatz für die verlorene Krücke des Schirms. Ich verband die kleine Schnitzfigur durch einen Dübel mit dem Schirmstock. Damit war der Schirm nicht nur gerettet, sondern schöner als zuvor.
Ein zweiter Schirm war nicht am Griff gebrochen; der Stock war aus einem Blechrohr, das einen Knick hatte. Dadurch war es so verformt, dass man den Schirm nicht mehr auf- und zuschieben konnte. Die Reparatur war simpel, obwohl sie die frühere Belastbarkeit des Schirms nicht ganz wiederherstellen konnte: Ich legte das gequetschte Rohr auf einen Amboss, der aus einem Stück Eisenbahnschiene improvisiert war, und klopfte es mit dem Schlosserhammer vorsichtig von beiden Seiten wieder in seine runde Form. Das gelang ausreichend, um den Schirm wieder auf- und zuzumachen. Ich würde ihn nicht nehmen, um bei Sturm spazieren zu gehen, aber dann nützt ein Schirm ohnehin wenig.
Jüngst musste ich diese erste Reparatur noch ergänzen. Als ich in den Regen hinausging, klappte der Schirm plötzlich über meinem Kopf zusammen. Die Fehlfunktion beruhte darauf, dass jetzt der Kunststoffring gebrochen war, der in der oberen Stellung an einer durch eine Feder herausgedrückten Zunge Halt gefunden hatte. Der Draht, der das Gestänge zusammenhielt, konnte die Zunge nicht halten. Ich ging in die Werkstatt und suchte. Ich hatte an eine Schelle gedacht, mit der man über ein Rohr gesteckte Schläuche fixiert, fand aber keine. So schnitt ich von einem Rest Kupferrohr mit der Metallsäge einen Streifen ab und drückte ihn mit der Kombizange fest um den brüchigen Kunststoffring. Die Metallzunge fand wieder festen Halt, Gestänge und Bespannung blieben an ihrem Platz, der Schirm war durch ein Stück Kupferblech hübscher geworden, dessen sägerauer Rand mit kleinen Kanten und Zähnen in das elende Plastik griff.
Der dritte Schirm war weggeworfen worden, obwohl Gestänge und Griff funktionierten. Nur die Bespannung hatte sich vom Vollmond in einen schlappen Halbmond verwandelt. Der Nylonstoff wurde von kleinen Plastikhütchen auf den Streben festgehalten. Von diesen Hütchen war eines verloren, einige andere hatten ihren Platz am Ende der Streben eingebüßt und hingen herum. Der Schirmträger hatte es nicht der Mühe wert befunden, den Schaden genauer zu untersuchen, denn das meiste daran war leicht zu beheben: Ich musste nur die Hütchen, die an die Bespannung genäht waren, wieder an Ort und Stelle stecken und ein wenig festdrücken.
Jetzt war der Halbmond schon drei Viertel voll, der Schirm wieder einigermaßen zu gebrauchen. Es war aber klar, dass die Gesamtspannung nur dann wiederhergestellt werden konnte, wenn auch das fehlende Hütchen ersetzt war. Es war aus Plastik und zerbrochen, an dieser Stelle sah man noch deutlich den Faden, mit dem früher die Bespannung mit dem Hütchen und der zuständigen Strebe verbunden war.
Ich kramte und fand die Messinghülse einer Platzpatrone, die ich vor Jahren vom Gehsteig aufgesammelt hatte. Ein Nachbar hatte mit einer Schreckschusspistole das neue Jahr eingeschossen.