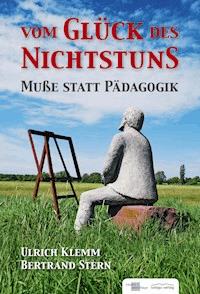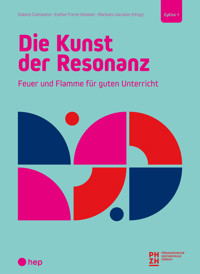
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: hep verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Feuer und Flamme fürs Lehren – das sind die Zyklus-I-Lehrpersonen, die in diesem Buch aus ihrem Unterricht berichten. Zusammen mit PH-Dozierenden denken sie über gelingendes Lehren und Lernen nach. Sie messen Unterrichtsqualität über die üblichen Parameter hinaus an der Resonanz, die sich zwischen den Lehrpersonen, den Schüler:innen und den Lerninhalten ergibt. Die festgehaltenen Momente von wechselseitiger, sinnstiftender Beziehung zeigen, was den Schulalltag lebendig macht. Sie sind Inspiration für die Weiterentwicklung von Unterricht und Schule. Dieses E-Book enthält Bildbeschreibungen zu allen Grafiken. Es wird empfohlen, einen E-Reader zu verwenden, auf dem die Bilder vergrössert werden können.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 204
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Herausgeberinnen gehören zum Hochschulpersonal der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die Urheberrechte am vorliegenden Sammelwerk liegen bei der Hochschule. Die Nutzungsrechte liegen beim hep Verlag.
Sabine Campana, Esther Forrer Kasteel, Barbara Jacober (Hrsg.)
Die Kunst der Resonanz
Feuer und Flamme für guten Unterricht
Zyklus I, Band 1
ISBN Print: 978-3-0355-2871-8
ISBN E-Book: 978-3-0355-2870-1
Die Illustrationen wurden von den Künstlerinnen und Dozentinnen der PHZH, Annina Nora Burkhalter und Allina Amayi Wittmer, eigens für dieses Buch angefertigt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© 2025 hep Verlag AG, Bern
hep Verlag AG
Gutenbergstrasse 31 | Postfach | CH-3001 Bern
[email protected] | hep-verlag.com
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Resonanz: Kern der Unterrichtsqualität
Unterrichtsqualität
Resonanz
Zusammenführung – resonante Unterrichtsqualität
Ein Fazit
Haben Tiere Gefühle?
Philosophieren mit Kindergartenkindern
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Schläft ein Lied in allen Dingen …
Forschen mit Klängen, Bewegungen, Farben und Formen
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Abenteuerliche Begegnungen
Ein spielerisch-sportlicher Waldtag mit Kindergartenkindern
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Ich weiß, was IT heißt
Frühe Medienbildung durch Gespräche und Ausprobieren
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Raspelzungen und Tierdetektivinnen
Unterricht in Natur, Mensch, Gesellschaft, der unter die Haut geht
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Das habe ich gar nicht gewusst!
Kindergartenkinder untersuchen mathematische Spuren
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Du denkst, sie könnte im Schloss ein bisschen einsam sein?
Resonanzräume in der Kunstrezeption
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Wege in die Welt der Bücher
Lesen als soziale Praxis im Kindergarten
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Feuer und Flamme im Spiel
Playfulness im Zyklus 1 stärken
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Die Friedenstaube
Wenn der Klassengeist zaubert
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Connected
Gemeinsam ins Portfolio vertieft
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Teamwork mit Resonanz
Wie multiprofessionelle Zusammenarbeit im Kontext der integrativen Förderung Resonanzmomente ermöglichen kann
Resonanz erleben
Resonanz diskutieren
Resonanz reflektieren
Resonanz weiterdenken und anwenden
Die Kunst der Resonanz im Unterricht: Anregungen zum Weiterdenken
Resonanz erleben: Carpe momentum
Resonanz diskutieren: Berührende Momente besprechen und feiern
Resonanz reflektieren: Unterrichtsqualität ganzheitlicher denken
Resonanz anwenden und weiterdenken: Von Gelungenem lernen und die Unverfügbarkeit schätzen
Autorinnen
Gestalterinnen
Einleitung
Unterricht begeistert und berührt, ist lebendig und geht unter die Haut. Schule, die in diesem Sinne gelingt und Resonanz ermöglicht, erleben wir Dozierende der Abteilung Eingangsstufe der Pädagogischen Hochschule Zürich täglich bei unseren Besuchen in den Klassenzimmern und Schulhäusern. Trotz oder gerade wegen der hohen Anforderungen an den Lehrberuf und der aktuellen Herausforderungen der Schule treffen wir auf Lehrpersonen, die Großartiges leisten und sich mit außerordentlichem Engagement für eine hohe Qualität des Lehrens und Lernens einsetzen. Unsere Erfahrungen stehen in starkem Kontrast zu den oft negativen Schlagzeilen über Schule in der aktuellen Medienberichterstattung. Deshalb ist es uns ein Anliegen, mit diesem Buch den Blick einmal auf die vielen berührenden und die Kinder stärkenden und fördernden Alltagsmomente zu lenken und unsere konkreten Erlebnisse aus dem Schulalltag im Zyklus 1 zu teilen. Wir möchten diese zum Teil wenig sichtbaren und kaum wahrgenommenen Momente in den Vordergrund rücken, weil wir überzeugt sind, dass sich aus ihnen viel über Unterrichtsqualität und ihre Gelingensbedingungen lernen lässt.
Unter dem Titel «Die Kunst der Resonanz» gibt dieser Band Einblicke in inspirierende Unterrichtsmomente, die uns in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen des Zyklus 1 berührt haben. Das Konzept der Resonanz nach Hartmut Rosa (2019a, 2019b) leitete uns beim Aufspüren solcher Momente. Rosa beschreibt Resonanz als eine Form der Beziehung, in der sich beide Seiten gegenseitig anregen. Sie kann zwischen Menschen entstehen, aber auch zwischen Menschen und Objekten oder Tätigkeiten. In resonanten Beziehungen sind berührende Erfahrungen möglich. Im Gegensatz dazu stehen stumme oder instrumentelle Weltbeziehungen, in denen es vorrangig um das Erreichen eines zweckmäßigen Zieles geht. Wir beziehen die von Rosa als allgemeine Gesellschaftskritik formulierte Theorie auf den pädagogischen Kontext. In welchen Momenten knistert es im Klassenzimmer? Wo springt der Funke zwischen Kindern, Lehrpersonen und Lerninhalten?
Diese Fragen haben zu einer Sammlung von zwölf Unterrichtsmomenten geführt, die einen Einblick in den Unterricht und die Schulkultur im Zyklus 1 geben. Auf ein einleitendes Grundlagenkapitel, in dem Resonanz und Unterrichtsqualität erläutert werden und über den Zusammenhang zwischen den beiden Konzepten nachgedacht wird, folgen sieben Beispiele von Resonanzmomenten aus dem Unterricht in den Fächern «Religionen, Kulturen, Ethik», «Musik und Performance», Sport, Medienbildung, «Natur, Mensch, Gesellschaft», Mathematik und «Kunst und Design». Weitere vier Lernmomente stehen für den Aufbau überfachlicher Kompetenzen im Zusammenhang mit Lesen als sozialer Praxis, mit dem spontanen Spiel, mit der Suche nach dem Klassengeist sowie mit dem Austausch unter Kindern über den eigenen Lernfortschritt. In einem weiteren Beitrag geht es um die gelingende Zusammenarbeit im multiprofessionellen Klassenteam.
Die verschiedenen Beiträge folgen einem gemeinsamen Aufbau. Im Abschnitt «Resonanz erleben» erhalten wir Einblick in eine Unterrichtssituation. Anschließend werden die beschriebenen Momente unter die Lupe genommen. Unter dem Titel «Resonanz diskutieren» suchen Lehrpersonen gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus angrenzenden Wissenschaftsbereichen und Fachdidaktiken nach dem kleinen Unterschied, dem springenden Punkt. Wie entsteht das Knistern im Klassenzimmer? Was braucht es, damit Kinder von Lerninhalten in Bann gezogen werden? Wann gelingt Beziehung zu allen Schülerinnen und Schülern? Unter dem Titel «Resonanz reflektieren» folgt eine theoretische Einordnung der Unterrichtssituation und des Gesprächs. Dabei orientieren wir uns an der Forschung zu Unterrichtsqualität, die sich mit der Frage beschäftigt, was eigentlich guter Unterricht ist. Auf der abschließenden Doppelseite mit dem Titel «Resonanz anwenden und weiterdenken» teilen die Autorinnen Erfahrungen und Tipps, die für ihre Gestaltung von Unterricht nützlich sind.
Beim Sammeln von resonanten Momenten in Schulen und Klassen und beim Nachdenken darüber hat uns die Frage nach dem guten Unterricht begleitet. In der Unterrichtsforschung dominiert seit den 1970er-Jahren das Prozess-Produkt-Paradigma. Dabei wird analysiert, welche Unterrichtsmerkmale sich positiv auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler auswirken. Das Modell guten Unterrichts von Lipowsky und Bleck (2019) erweist sich als hilfreiches und empirisch belastbares Instrument zur Beobachtung und Beschreibung von Merkmalen guten Unterrichts. Das Modell bildet Unterrichtsqualität durch drei beobachtbare Merkmale ab: Klassenführung, eine gute Lernatmosphäre beziehungsweise Lernbegleitung und die kognitive Aktivierung der Lernenden (siehe Campana & Forrer Kasteel, einführendes Kapitel in diesem Band). Diese Forschung hat viel zum Verständnis von effektivem Unterricht beigetragen, und das Prozess-Produkt-Paradigma ist bis heute in der empirischen Unterrichtsforschung vorherrschend (Seidel & Shavelson, 2007). Der Ansatz ist allerdings nicht unproblematisch. Es besteht die Gefahr, dass Unterricht über Situationen, Personen und Inhalte hinweg standardisiert wird.
Wie komplex es ist, Unterrichtsqualität zu definieren, erleben wir, wenn wir an der Pädagogischen Hochschule Zürich mit Studierenden, Praxislehrpersonen und Praxisleiterinnen und -leitern die Frage nach gutem Unterricht diskutieren. Wenn wir die Studierenden in ihren Praktika besuchen, denken wir gemeinsam über Qualitätskriterien nach. Wir sprechen über Klassenführung, kognitive Aktivierung und über das Unterrichtsklima, darüber, wie der Morgen rhythmisiert war oder ob die Lernbegleitung dem Leistungsstand des Kindes entsprach. Aber ob uns bei der Unterrichtsbeobachtung das Herz aufgeht, entscheidet sich oft auch an anderen Dingen: beispielsweise daran, ob die Studentin mit den Kindern herzlich lacht, ob sich der Student über die Antwort eines Schülers freut oder ob die Augen aller Beteiligten leuchten.
Ob Unterricht auf fruchtbaren Boden fällt, sich die Schülerinnen und Schüler also darauf einlassen, hat mit den Kindern selbst zu tun, mit ihrer Beziehung zur Lehrperson und mit ihrem Bezug zum Unterrichtsgegenstand. Unterricht ist ein interaktionales, kommunikatives Geschehen, das weder eindimensional noch unidirektional wirkt. An dieser Stelle verlangen die Ergebnisse aus den großen, standardisierten Studien nach ergänzenden Theorien, die differenzierter beleuchten, wie Lernen und Entwicklung im Unterricht gelingt und was dazu beiträgt, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Unterrichtsgegenstand, aber auch mit sich selbst, mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern und mit der Lehrperson in Beziehung treten können.
Im Hinblick auf ein Verständnis von Unterrichtsqualität, das die Qualitätsentwicklung und damit die Prozesse selbst in den Mittelpunkt stellt, sind wir überzeugt, dass das Konzept der Resonanz das bestehende Modell der Unterrichtsqualität nach Lipowsky und Bleck (2019) bereichert und umgekehrt. Im vorliegenden Buch bringen wir daher das Konzept der Resonanz mit empirischen Modellen von Unterrichtsqualität zusammen. Dies geschieht im Wissen, dass Rosa der Quantifizierbarkeit von Qualität kritisch gegenübersteht. Wir gehen der Frage nach, wie resonante Unterrichtsmomente und erfolgreiches Lernen zusammenhängen. Dabei eruieren wir, wie Lernen und Entwicklung mit einer gelingenden Beziehungsgestaltung zusammengedacht werden können oder sogar müssen.
Die beschriebenen Unterrichtsmomente erzählen von alltäglichen Situationen, von Lernbegleitung, Feedback, von der Auswahl von Unterrichtsthemen oder vom Umgang mit Fehlern. Diese Alltagsmomente werden sowohl durch den Filter der Unterrichtsforschung als auch der Resonanz betrachtet. Wir interessieren uns für ausgewählte Einzelfälle und schaffen keine harten Fakten oder verallgemeinerbare Erkenntnisse. Wir erfinden den Unterricht nicht neu, sondern beleuchten den pädagogischen Alltag. Wir zeigen gelungene Beispiele und suchen nach Erklärungen, liefern aber keine Rezepte. Wir wollen inspirieren, nicht belehren. Wir wollen sichtbar machen, wann und warum Unterricht gelingt, und nicht den Bildungsnotstand beklagen. Die Ergänzung der empirisch erhobenen Erkenntnisse aus der Unterrichtsforschung durch die Resonanztheorie macht den pädagogischen Blick differenzierter und breiter. Es wird sichtbar, welche Expertise und welche Virtuosität vonseiten der Lehrpersonen hinter berührenden Momenten stehen und welche Kunst es ist, Schule Tag für Tag gelingen zu lassen. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir mit dem gewählten Fokus auf den Unterricht nur einen Aspekt von gelingender Schule abbilden und dass immer auch die Einbettung der beschriebenen Momente in das System Schule mitgedacht werden muss.
Illustriert werden die Beiträge von Annina Burkhalter und Allina Amayi Wittmer. In einem künstlerischen Prozess haben sie die geschilderten Unterrichtseinblicke auf sich wirken lassen, sind im Sinne einer Resonanz spielerisch kreativ in Beziehung dazu getreten und haben 13 Textildrucke geschaffen – je einen für jeden Unterrichtsmoment sowie ein Übersichtsbild, das auch als Spielplan verwendet werden kann. Auf diesem Spielplan finden sich neben den in diesem Buch beschriebenen Unterrichtsmomenten auch Leerstellen. Diese Leerstellen stehen stellvertretend für die vielen resonanten Unterrichtsmomente, die in diesem Band nicht beschrieben werden können. Es sind all die Unterrichtsmomente, die im Alltag der Leserinnen und Leser auftauchen und die es noch zu sammeln, zu dokumentieren und zu analysieren gilt. In diesem Sinne hoffen wir, dass der Funke überspringt. Wir laden Lehrpersonen, Schulleitungen, Medienschaffende, Eltern, Studierende, Politikerinnen und Politiker und weitere am Schulfeld interessierte Personen ein, sich in Schulhäusern und Klassenzimmern auf die Suche nach resonanten Momenten zu machen und genauer hinzuschauen, was da an Wertvollem passiert und warum Unterricht immer und immer wieder gelingt. Denn wir sind überzeugt, dass es gerade angesichts großer Herausforderungen wichtig ist, sich auf die eigenen Stärken zu besinnen, auf die Momente, die uns beflügeln und aufblühen lassen. Nicht zuletzt die Arbeit an diesem Buch hat uns gezeigt, dass wir von den Momenten, die gelingen, viel lernen können.
Wir bedanken uns bei allen Autorinnen, die sich mit uns auf die Suche nach Resonanz im Klassenzimmer gemacht haben, für die unkomplizierte Zusammenarbeit, das große Engagement und die Offenheit, sich gemeinsam auf das Thema einzulassen. Den Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern danken wir dafür, dass sie ihre Schulhaus- und Klassenzimmertüren geöffnet und mit uns über knisternde Lernmomente nachgedacht haben. Ein herzlicher Dank geht an Annina Burkhalter und Allina Amayi Wittmer, die uns mit ihrer künstlerischen Resonanz auf die Texte begeisterten. Ein großer Dank geht an Susanne Gentsch vom hep Verlag für die kompetente Begleitung. Herzlichen Dank auch an Corinne Mäder, die uns mit Sorgfalt und Umsicht beim Zusammentragen der Kapitel und der Organisation unterstützt hat. Und schließlich danken wir unseren Kolleginnen und Kollegen für ihre wertvolle Unterstützung und Inspiration in unterschiedlichster Form. Bei der Arbeit an diesem Buch durften wir zahlreiche bereichernde Kooperationen erleben. Wir freuen uns, das daraus Gelernte nun mit den Leserinnen und den Leserinnen teilen zu dürfen, und sind gespannt auf die Weiterführung der Diskussion über Unterrichtsqualität und Resonanz im Zyklus 1.
Wir wünschen Ihnen viel Inspiration und Freude bei der Lektüre.
Sabine Campana, Esther Forrer Kasteel und Barbara Jacober
Zürich im Frühling 2025
Literatur
Lipowsky, F. & Bleck, V. (2019). Was wissen wir über guten Unterricht? – Ein Update. In U. Steffens & R. Messner (Hrsg.), Unterrichtsqualität: Konzepte und Bilanzen gelingenden Lehrens und Lernens (S. 219–249). Waxmann.
Rosa, H. (2019a). Resonanz: Eine Soziologie der Weltbeziehung. Suhrkamp.
Rosa, H. (2019b). Unverfügbarkeit (4. Aufl.). Residenz.
Seidel, T. & Shavelson, R. J. (2007). Teaching effectiveness research in the past decade: The role of theory and research design in disentangling meta-analysis results. Review of Educational Research, 77(4), 454–499.
Resonanz:Kern der Unterrichtsqualität
Sabine Campana und Esther Forrer Kasteel
Unterrichtsqualität kann durch unterschiedliche Methoden und an verschiedenen Aspekten festgemacht werden. Man kann sich zum Beispiel anschauen, was beim Unterricht als Ergebnis herauskommt. Das wird als Outputorientierung bezeichnet. In diesem Fall bezieht man sich in der Regel auf die Leistung der Schülerinnen und Schüler. Glücklicherweise lässt sich Leistung (wenn die zu messenden Leistungsbereiche definiert sind) relativ einfach messen. In Studien versuchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herauszufinden, wie der Unterricht gestaltet werden muss, damit die Schülerinnen und Schüler möglichst hohe Leistungen erbringen. Guter Unterricht ist nach der outputorientierten Unterrichtsforschung also Unterricht, in dem die Lehrperson so unterrichtet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst effizient und effektiv lernen und ihren Lernerfolg durch Leistungstests sichtbar machen können.
Viele Erziehungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler kritisieren diese Sichtweise (z. B. Brügelmann, 2015; Herzog, 2013; Herzog & Rahm, 2014). Sie argumentieren, dass sie der Schulrealität nicht gerecht wird und viele Gefahren birgt. Eine davon sei, dass die schulische Leistung ein sehr hohes Gewicht erhält und andere schulische Ziele wie Persönlichkeitsbildung, Verantwortlichkeit, Kooperativität oder Kreativität mangels Messbarkeit in den Hintergrund treten. Eine weitere Gefahr bestehe darin, dass das Modell ein technokratisches Verständnis von Unterricht impliziere. Es suggeriere, dass ein optimierter Input der Lehrperson direkt zu besseren Leistungen führt. Wir alle wissen, dass dies nicht der Fall ist. Unterrichten, Lehren und Lernen sind viel komplexer, und Unterricht ist ein wechselseitiger Prozess. Auch wenn die Lehrperson ihren Unterricht sehr gut plant und durchführt, resultieren daraus nicht immer gute Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Unter der Formel «Ökonomisierung der Bildung» (Buck, 2024; Höhne, 2015) wird kritisiert, dass Bildung heute nach einer ökonomischen Logik funktioniert und die Kinder als Investitionsgut betrachtet werden, deren Bildung Kapital abwerfen soll. Lehrpersonen haben dieses Humankapital nach festgesetzten Standards zu produzieren.
Es besteht die Tendenz, alles steuerbar, messbar und verfügbar zu machen, und außerdem die Gefahr einer Zweckrationalität. Darauf weist ein Soziologe hin: Hartmut Rosa. Er sagt, eine solche Haltung führe dazu, dass man sich von Erlebnissen, Menschen oder Gegenständen gar nicht mehr berühren lasse, sondern eher aggressiv werde, wenn diese eben nicht einträten oder sich nicht so verhielten, wie man es sich wünsche. Er plädiert für einen Unterricht, in dem die Kinder in ihrer Ganzheit berührt werden. Das kann in einem unterstützenden Gespräch der Lehrperson mit einer Schülerin geschehen oder auch zwischen mehreren Kindern, die sich in einer Gruppenarbeit voranbringen. Oder es passiert, wenn die Kinder von einem Unterrichtsgegenstand so gefesselt sind, dass sie alles um sich herum vergessen. Rosa (2019a) nennt solche Formen der Beziehung resonant. Er wehrt sich dezidiert dagegen, dass resonante Beziehungen nur zur Effizienzsteigerung angestrebt werden sollen. Er sagt, Resonanz könne weder willentlich herbeigeführt noch gemessen werden.
Als Lehrpersonen des Zyklus 1 finden wir uns in beiden Sichtweisen wieder. Natürlich möchten wir, dass die Kinder möglichst gut lernen. Wir sind dem Lehrplan verpflichtet und müssen die Kinder unter anderem nach ihren Leistungen in bestimmten Fächern beurteilen. Gleichzeitig erleben wir täglich, dass es im Unterricht mit jungen Kindern um viel mehr geht als nur um den leistungsbezogenen Output. Es geht auch darum, wie wir miteinander umgehen, wie sich die Kinder auf das Lernen einlassen können, wie wir miteinander sprechen oder uns gegenseitig helfen. Es geht um Leistungen und um resonante Beziehungen. Wir machen uns also auf die Suche nach einer resonanten Unterrichtsqualität – ungeachtet dessen, ob sich diese vermessen lässt. Wir glauben, dass Bildung mehr ist als ein hoher Leistungsoutput. Wir glauben aber auch, dass man in resonanten Beziehungen lieber und damit auch besser lernt. Wir glauben, dass resonante Unterrichtsqualität nicht immer willentlich herbeigeführt werden kann. Wir glauben aber auch, dass sie nicht einfach zufällig entsteht, sondern dass Lehrpersonen ihr einen fruchtbaren Boden bereiten können.
Im Folgenden werden die beiden Sichtweisen zunächst einzeln dargestellt und anschließend gemeinsam gedacht.
Unterrichtsqualität
Die Frage nach gutem Unterricht beschäftigt Forschende und Lehrpersonen schon seit geraumer Zeit. In der outputorientierten Unterrichtsforschung hat sich seit den 2010er-Jahren das Modell der drei Basisdimensionen etabliert. Es fasst alle bisherigen Erkenntnisse empirischer Studien übersichtlich in drei zentralen und fächerübergreifenden Dimensionen zusammen. Demnach sind effiziente Klassenführung, ein unterstützendes Unterrichtsklima und kognitive Aktivierung die ausschlaggebenden Unterrichtselemente, wenn Schülerinnen und Schüler gut lernen sollen (Klieme, 2019; Lipowsky et al. 2019).
Effektive Klassenführung ermöglicht es, die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit optimal für das Lernen zu nutzen und möglichst wenig Lernzeit für Unnötiges zu verschwenden. Das bedeutet, dass die Lehrperson eine lernförderliche Umgebung schafft, indem sie Störungen minimiert, klare Regeln und Routinen etabliert, flüssige Übergänge zwischen den Unterrichtsphasen gestaltet und die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf die Lerninhalte lenkt.
Konstruktive Unterstützung bezieht sich auf zwei Ebenen: die pädagogisch didaktische Unterstützung mit dem Ziel des Erwerbs von Fachkompetenzen und die emotional-motivationale Unterstützung mit dem Ziel der sozioemotionalen Entwicklung. Angemessenes Feedback, Hilfestellungen, Anregungen zum selbstständigen Lernen, die Schaffung einer positiven Lernatmosphäre, die Wertschätzung der individuellen Bedürfnisse und Interessen der Schülerinnen und Schüler fördern ihre Motivation, ihr Selbstvertrauen und damit auch ihre Leistung.
Kognitive Aktivierung basiert auf einem konstruktivistischen Lernverständnis. Die Lehrperson regt die Schülerinnen und Schüler durch herausfordernde Aufgaben dazu an, zu analysieren, zu vergleichen, zu begründen, Probleme zu lösen oder ihr Wissen auf andere Kontexte zu transferieren. Wichtig ist auch, dass sich die Kinder über ihre Erkenntnisse und ihre Lösungswege austauschen. Kognitive Aktivierung fördert Lernen, das auf aktiver Wissenskonstruktion basiert, statt auf passiver Wissensreproduktion.
Das Modell der Basisdimensionen zeigt, dass die Tiefenstrukturen des Unterrichts für den Lernerfolg besonders wichtig sind. Sie sind, im Gegensatz zu den Oberflächenstrukturen wie Klassengröße, eingesetzte Methoden oder Sozialformen, nicht auf den ersten Blick erkennbar, haben aber den deutlich stärkeren Einfluss (Decristan et al., 2020; Lotz & Lipowsky, 2015).
Auch wenn das Modell in erster Linie auf outputorientierten Forschungsergebnissen aufbaut, liegen ihm lerntheoretische und psychologische Denkmodelle zugrunde. Es orientiert sich unter anderem an der Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (2017). Diese geht davon aus, dass Menschen durch drei Grundbedürfnisse motiviert werden: Sie wollen Kompetenz erfahren, sozial eingebunden sein und selbst bestimmen können. Erst wenn diese Grundbedürfnisse erfüllt sind, können sich Schülerinnen und Schüler auf das Lernen einlassen. Es geht also darum, ein Lernen zu fördern, das Schülerinnen und Schüler als autonome Persönlichkeiten wahrnimmt, auf Selbststeuerungsprozesse angelegt ist und sich durch wertschätzende Sozialbeziehungen auszeichnet.
Unbestritten sind die drei Basisdimensionen dem Lernen zuträglich. Das Modell besticht durch seine Einfachheit und Klarheit. Es erlaubt uns, das Unterrichten nach theoretisch und empirisch fundierten Kriterien zu beobachten und zu beurteilen. Es hat aber auch seine Schwächen. Versucht man beispielsweise in Studien die Leistung oder die Motivation der Schülerinnen und Schüler anhand der drei Basisdimensionen vorherzusagen, sind die Ergebnisse eher ernüchternd: Nur etwa der Hälfte der Studien gelingt dies und manchmal sind die Effekte sogar umgekehrt (Praetorius et al., 2018). So gibt es Studien, die zeigen, dass eine hocheffiziente Klassenführung das Selbstkonzept von Schulanfängerinnen und Schulanfängern sogar negativ beeinflussen kann oder dass offene Aufgabenstellungen zwar leistungsstarke Schülerinnen und Schüler anregen, leistungsschwache Kinder aber häufig überfordern (Gabriel, 2013; Grünke, 2007). Offensichtlich spielen noch weitere Faktoren eine wichtige Rolle – beispielsweise wie die Schülerinnen und Schüler das Unterrichtsangebot nutzen. Diese Einflüsse stellt Helmke (2017) in seinem Angebots-Nutzungs-Modell vor. Neben der Qualität des Unterrichtsangebots bestimmen auch andere Größen mit, wie gut die Schülerinnen und Schüler lernen. Dazu gehört zum Beispiel ihr Lernpotenzial, das wiederum von familiären Bedingungen oder von gesellschaftlichen und schulischen Kontextfaktoren beeinflusst wird. Helmkes Modell erweitert also den Blick und macht nicht die Lehrperson und deren Unterricht allein verantwortlich für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Aber auch Helmkes Modell kann durchaus kritisiert werden. Es ist problematisch, Unterricht als Angebot der Lehrperson zu betrachten, das von den Kindern mehr oder weniger genutzt werden kann. Angebot und Nutzung beeinflussen sich im Unterricht wechselseitig. Die Kinder ermöglichen den Unterricht durch ihre Beteiligung und fordern die Lehrperson durch ihr Verhalten dazu auf, das Angebot immer wieder anzupassen (Reusser & Pauli, 2010). Zudem ist das ganze System in ständiger Bewegung. Nicht nur das Kind lernt und entwickelt sich, auch die Expertise der Lehrperson verändert sich über Erfahrungen, die sie mit ihren Unterrichtsangeboten macht (Gruschka, 2007). Um Unterricht zu verstehen, muss der Blick also auf die dynamischen Interaktionen und die daraus resultierenden Veränderungen fallen. Ob sich Kinder für den Unterricht begeistern lassen und wie Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler gemeinsam Unterricht gestalten, ist (auch) eine Frage von Beziehungen. Und hier kommt die Resonanz ins Spiel.
Resonanz
Was verstehen Sie, liebe Leserinnen und Leser unter Resonanz? Haben Sie es im Klassenzimmer oder an Ihrer (Tages-)Schule schon einmal knistern gehört? Hat Sie eine Begegnung schon einmal so berührt, dass Sie es sogar körperlich gespürt haben?
Resonanz lässt sich sehr gut mit den Metaphern berührt werden, sich mit eigener Stimme einbringen und es knistern hören beschreiben. Es geht um Beziehungen und Begegnungen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Inhalten sowie zwischen Menschen und der Welt insgesamt (Rosa 2019a, 2019b). Resonanz ist grundsätzlich ein Beziehungsmodus und kein Gefühlszustand. Dabei nimmt das Subjekt die Welt oder Segmente daraus als responsiv wahr. Resonanz versteht sich als eine intrinsisch motivierte und durch Selbstwirksamkeitserwartungen erzeugte Form der Weltbeziehung, in der Subjekt und Welt(-ausschnitte) miteinander in Dialog treten und sich gegenseitig berühren. Subjekte und Welt(-ausschnitte) treten dabei jeweils mit je eigener Stimme in eine wechselseitige Resonanzbeziehung und nicht in eine Echobeziehung (Rosa, 2019a). Dementsprechend ist Resonanz ein wechselseitiges und eigenständiges Antworten der beiden Gegenüber und nicht eine Wiedergabe wie beim Echo. Grundsätzlich sind Resonanz und Resonanzerfahrungen körperlich, emotional und kognitiv wahrnehmbar.
Das Konzept der Resonanz zielt darauf ab, dem Leben wieder Sinn und Lebensqualität zu geben (Rosa, 2019a, 2019b). Demnach ist ein gutes Leben reich an Resonanzerfahrungen, es verfügt über stabile Resonanzachsen (Rosa, 2019a). Resonanz ist ein soziologisches Konzept der Weltbeziehungen. Es kritisiert die zunehmende Beschleunigung, Entfremdung und Komplexitätssteigerung der heutigen Welt und fordert stattdessen einen kulturellen Paradigmenwechsel (Rosa, 2019a), der auf Entschleunigung und Resonanz fokussiert.
Kernelemente des Resonanzkonzepts sind die folgenden drei Resonanzachsen (Rosa, 2019a):
Die
horizontale Resonanzachse
bildet die sozialen Beziehungen zwischen Menschen ab. Im Falle der Schule ist die Beziehung zwischen den Lehrpersonen und ihren Schülerinnen und Schülern zentral und absolut tragend. Selbstverständlich sind in der Schule auch andere Beziehungen relevant, zum Beispiel zwischen den Schülerinnen und Schülern, zwischen den Lehrpersonen und ihren Kolleginnen und Kollegen sowie zum Beispiel zwischen den Lehrpersonen und den Eltern.
Die
diagonale Resonanzachse
umfasst die Beziehung zur Dingwelt. Im schulischen Kontext sind damit der Lernstoff, die Unterrichtsthemen oder die Ziele gemeint. Es geht nicht darum, einen Stoff oder Inhalt zu beherrschen. Vielmehr geht es darum, den Stoff zum Sprechen zu bringen, damit man sich diesen anverwandeln kann. Der Stoff beziehungsweise Inhalt berührt und kann das Gegenüber tendenziell verändern (Rosa & Endres, 2016).
Die
vertikale Resonanzachse
verkörpert die Beziehung zur Welt insgesamt. Damit ist die Verbundenheit mit dem großen Ganzen gemeint. Die Idee dahinter ist, dass eine Weltbeziehung, die durch stabile Resonanzachsen geprägt ist, es den Menschen ermöglicht, sich «in einer antwortenden, entgegenkommenden Welt
getragen
oder sogar
geborgen
zu fühlen» (Rosa 2019a, S. 59).
Alle drei genannten Resonanzachsen sollten bewusst gepflegt werden. Bei einer Fokussierung auf eine einzelne Achse besteht die Gefahr, dass andere verstummen und letztlich Resonanzquellen verloren gehen. Generell sollte der Stellenwert der einzelnen Achsen auch im Verhältnis zu den anderen Achsen regelmäßig reflektiert werden. Es stellt sich beispielsweise die Frage, welchen Stellenwert die eigene Arbeit im Verhältnis zum Stellenwert der sozialen Beziehungen hat (Rosa, 2019a).
Damit Resonanz entstehen kann, müssen neben den Resonanzachsen auch die vier Momente Berührung, Selbstwirksamkeit, Anverwandlung und Unverfügbarkeit gegeben sein. Dabei spielen vor allem die ersten drei eng zusammen. Die Kunst besteht darin, dass die Beteiligten offen sind für Berührung und Veränderung und gleichzeitig geschloßen, um selbstwirksam mit eigener Stimme zu antworten (Rosa, 2019b).
Die vier Momente lassen sich wie folgt charakterisieren (Rosa 2019b):
Das
Moment der Berührung
drückt aus, dass sich die an der Beziehung Beteiligten berührt und bewegt fühlen. Im Falle einer Resonanz zwischen zwei Personen bedeutet dies etwa, dass die beiden Gegenüber die Berührung emotional, körperlich oder auch kognitiv erleben können. Bezogen auf den Unterricht kann dies zum Beispiel bedeuten, dass eine Lehrperson durch ihre eigene Begeisterung für die Kinder und für die zu besprechenden Inhalte sowohl die horizontale als auch die diagonale Resonanzachse öffnet und die Kinder durch ihre Begeisterung geradezu ansteckt.
Mit dem
Moment der Selbstwirksamkeit