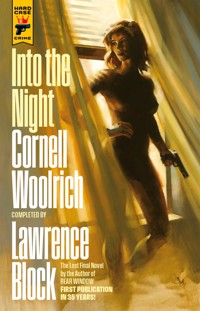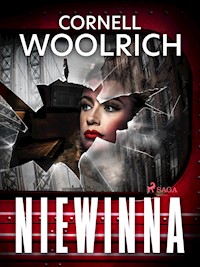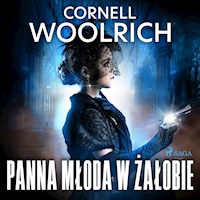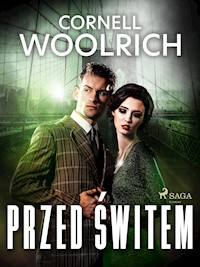4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Da hat Pilot Penny O'Shaughnessy noch einmal Glück gehabt. Glaubt er – immerhin hat er den Absturz in der Wildnis im Norden der USA nicht nur überlebt, sondern findet sogar ein bewohntes Anwesen in der Nähe der Unglücksstelle. Hilfe ist nah! Dort trifft er auf Dr. Denholt und seine Pflegetochter Nova. Mit ihr stimmt etwas nicht … Und was ist mit dem seltsamen Labor, das der Hausherr immer hinter sich abschließt? O'Shaughnessy lässt sich nicht einschüchtern. Im Gegenteil: Jetzt ist die Neugier des Abenteurers erst geweckt. Doch diese Neugier führt ihn in einen Albtraum … Ein finsteres Meisterwerk über die Ungerechtigkeit dieser Existenz, die wir Leben nennen und die immer vom Tod heimgesucht wird. Francis Nevins Jr.: »Woolrich ist der Edgar Allan Poe des 20. Jahrhunderts.« Ellery Queen: »Woolrich kann selbst den banalsten Ereignissen mehr Schrecken, mehr Nervenkitzel und mehr Spannung entlocken als irgendeiner seiner Konkurrenten.« Robert Bloch: »Niemand hat Cornell Woolrich je in punkto schiere Spannung übertroffen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Susanne Picard
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Jane Brown’s Body
erschien erstmals 1938 in der März-April-Ausgabe
des Magazins All-American Fiction.
Copyright © 1938, 1951 by Cornell Woolrich
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Titelbild: Rodolfo Valcarenghi
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-965-7
www.Festa-Verlag.de
Kapitel 1
Drei Uhr morgens. Ein leerer Highway zieht sich durch die Landschaft. Die Ölflecken auf dem Asphalt lassen die Straße unter einem bösartig schimmernden Mond wie ein blaues Satinband glänzen. Die Nacht ist still, abgesehen von einem Brummen hinter einer Bodenwelle.
Zwei andere Monde, greller, weißer und dicht beisammen, erscheinen plötzlich auf dieser Bodenwelle und schießen einen Strahl blendendes Platin weit vor sich her. Es sind Scheinwerfer. Das Brummen verstärkt sich, wird zu einem Dröhnen. Das hochtourige Fahrzeug rast so schnell dahin, dass es ein wenig die Bodenhaftung verloren hat. Aber die Straße ist gerade, der Weg noch lang. Und die Nacht kurz.
Der Mann, der sich über das Lenkrad beugt, ist angespannt, seine Augen sind ohne zu blinzeln fest auf den Saum des schwarzen Vorhangs gerichtet, den seine Scheinwerfer ihm nach und nach enthüllen. Seine Augen glühen wie zwei Kohlenstücke. Sein Gesicht ist gebräunt, sein Haar weiß. Die Gestalt ist hager, aber den knochigen Händen, die das Lenkrad fest im Griff haben, ist, ebenso wie seinen fest zusammengepressten Kiefern, seine Kraft anzusehen. Die Haut über den Gelenken ist weiß vor Anspannung.
Die Nadel auf dem Tacho zuckt kurz über die 150-Stundenkilometer-Marke.
Im Rückspiegel ist eine sehr müde Frau zu sehen, die auf dem Rücksitz eingeschlafen ist. Sie hat die Beine unter sich gezogen, sie stecken bis zur Hüfte unter einer Reisedecke. Ihre schwarz behandschuhte Hand hängt in einer der Halteschlingen über der Fahrzeugtür. Sie hängt da, obwohl sie schläft, allein wegen ihres eigenen Gewichts. Sie schwankt, ist ganz schlaff. Ein Fehlen der Reflexe, sich festzuhalten, macht beinahe glauben, da sei kein Leben mehr vorhanden.
Sie trägt ein winziges Pillbox-Hütchen, unter dem ein feinmaschiger Schleier hervorlugt und ihr Gesicht umflattert. Der Fahrtwind schiebt ihn wie einen dünnen Film immer wieder zur Seite, auf der Nase bildet er aufgrund des Kontakts einen seltsamen kleinen Knubbel. Eigentlich sollte der Schleier sich wegen des engen Kontakts in Höhe ihres Atems ausbeulen. Doch das tut er nicht, nur dort, wo ihre Lippen sich teilen, ist in dem Schleier eine winzige Delle zu sehen, als saugte sie ihn in sich hinein. Sie schläft mit leicht offenem Mund.
Der Mond ist das Einzige, das mit dem dahinrasenden Wagen Schritt hält. Er grinst höhnisch auf die Strecke herab, Meile um Meile, als wollte er sagen: »Ich bin dir auf den Fersen!«
Vor ihm tauchen aus der Finsternis ein paar hingestreute Lichter auf. Ein Dorf oder eine kleine Stadt, die am Rand des Highways liegt. Die Nadel auf dem Tachometer wird zittriger. Der Mann wirft einen Blick in den Rückspiegel auf das Mädchen, ein wenig furchtsam, so als stellte das Städtchen eine Art Probe dar, die er bestehen muss.
Ein beleuchtetes Schild blitzt auf und ist schon wieder vorüber.
VORSICHT!
BEWOHNTE ORTSCHAFT
LANGSAM FAHREN
Der Mann nickt grimmig, so als wollte er zumindest das erste Wort bestätigen. Doch offenbar versteht er es anders, als es gemeint ist.
Die Lichter werden größer und tauchen nun beiderseits der Straße auf. Straßenlampen schälen sich aus dem Dunkel der Bäume rechts und links. Plötzlich hat der Highway rechts und links Bürgersteige. Dunkle Schaufenster gleiten vorbei.
Mit einer instinktiven Geste blendet der Mann die Scheinwerfer von grellem Platinweiß zu blass verwaschen ab. Das Fenster eines kleinen Restaurants huscht vorbei.
Vor ihm blinken jetzt die Rücklichter eines großen Busses auf. Er dreht am Lenkrad, um ihm auszuweichen und ihn zu überholen. Doch dann taucht eine unerwartete Komplikation auf. Ein abgelegenes Bahngleis überquert an dieser Stelle die Hauptstraße. Vielleicht ist die ganze Nacht bisher kein Zug hier durchgekommen und wird es auch bis zum Morgen nicht tun. Fünf Minuten später, fünf Minuten früher, und es hätte keinen Aufenthalt gegeben. Aber genau als Wagen und Bus gleichauf fahren, klingelt es, gestreifte Holme, an denen rote Signalleuchten angebracht sind, senken sich und die Straße ist blockiert. Die beiden Fahrzeuge sind gezwungen anzuhalten, gleichzeitig, während eine langsame, endlose Prozession von Frachtcontainern an ihnen vorüberzieht. Beinahe zur selben Zeit ist hinter ihm ein großer Milchwagen von einer Seitenstraße eingebogen, hat sich hinter ihn gesetzt und schneidet ihm so den Rückweg ab.
Die Lichter des Busses erhellen das Innere des Wagens und fallen auch auf die schlafende Frau. Im Bus befindet sich nur ein Passagier, aber er sitzt auf der dem Auto zugewandten Seite. Er starrt aus dem Fenster in das neben ihm stehende Fahrzeug. Sein Blick fällt auf die Schlafende und bleibt dort liegen. Das würde wohl jeder Mann tun.
Der Mann am Steuer ist nun vollends verkrampft. Seine Knöchel treten weiß hervor, sein Blick ist in den Rückspiegel gerichtet, an der Stelle geradezu festgeklebt, wo er den Buspassagier sehen kann, der beiläufig in den Fond des Wagens herabblickt. Ein glänzender Streifen bildet sich und läuft auf seinem Gesicht entlang, bis er sich in einer der tiefen Falten darauf fängt. Schweiß. Dann bildet sich ein weiterer Streifen. Seine Brust hebt und senkt sich unter seinem Mantel und er atmet schwer, als wäre er eine Strecke gerannt.
Der Mann am Busfenster schaut die Frau weiter an. Nur sie. Wahrscheinlich denkt er sich nichts dabei. Und warum sollte er auch nicht eine Frau ansehen, wenn auch eine Schlafende? Sie muss unter diesem Schleier wunderschön sein. Ohnehin sind einige Männer geborene Frauen-Anstarrer.
Aber noch während die endlosen Frachtcontainer rumpelnd vorbeiziehen, diese Tortur weitergeht, bewegt sich eine der weißknöcheligen Hände auf dem Steuer. Sie gleitet von dem polierten Holz hinab in den Schoß ihres Besitzers. Farbe kehrt in sie zurück. Langsam kriecht sie in den Mantel, verschwindet zwischen den Knopfleisten und wird wieder herausgezogen. Jetzt sind die Knöchel wieder weiß, denn sie umklammern eine Automatikpistole.
Sein Blick wendet sich derweil nicht vom Rückspiegel ab, auch nicht vom Buspassagier. Er reagiert wie einer, der darauf wartet, dass sich der Gesichtsausdruck des Buspassagiers ändert. Ein ganz bestimmter Ausdruck, der genau einzuordnen ist. Es sieht aus, als wäre er durchaus imstande, die Waffe auf seinem Schoß dann auch zu benutzen.
Aber jetzt ist endlich der Triebwagen dieses endlosen Frachtzugs vorbeigefahren. Die Glocke klingelt nicht mehr, die Holme heben sich langsam. Der Busfahrer legt den Gang ein, die Reihe der schwach beleuchteten Busfenster setzt sich langsam in Bewegung. Die Waffe verschwindet, die Hand, die sie hielt, legt sich wieder auf das Lenkrad. Einen Augenblick später ist der Bus mitsamt dem Passagier und seinem Gesicht am Wagen vorübergezogen. Einen Augenblick bleibt der hochtourige Wagen noch zurück, um ihm einen Vorsprung zu geben. Der Milchwagen blinkt ungeduldig, überholt dann das Hindernis und schießt davon.
Der Mann am Lenkrad mit dem ledrigen Gesicht hat die Unterlippe vorgeschoben und pustet sich selbst einen heißen Atemzug der Erleichterung ins Gesicht. Er tastet nach den Spuren, die der Schweiß auf seinen Wangen hinterlassen hat, und wischt sie fort.
Dann fährt er weiter in die Nacht, den pfeilgeraden Highway unter dem lauernden Mond entlang. Die Dame taumelt ein wenig, irgendwie träumerisch, und atmet leicht ihren Schleier ein.
Dann beginnt eine lange, sanfte Steigung, jetzt bockt der Wagen ein wenig, wenn er beschleunigt. Er sieht auf das Armaturenbrett hinab: Das Benzin wird rasch weniger. Für einen Augenblick verlässt jede Farbe sein Gesicht. Nun, immerhin befindet er sich hier auf einer Hauptstraße. Wenn er kein Benzin mehr hat, muss er doch nur rechts ranfahren und auf einen Wagen warten, der ihn abschleppt. Warum ist da nur diese Panik in seiner Miene?
Er fährt weiter, doch der Wagen läuft schon auf Reserve, und so schlängelt er von einer Seite auf die andere in der Hoffnung, auch noch das letzte Tröpfchen aus dem Tank zu locken. Der Wagen stottert und startet wieder neu, wird aber immer langsamer, doch die Spitze der Bodenwelle ist fast erreicht. Wenn er sie nur erreichen kann, dann kann er auf der anderen Seite noch ein Stück ohne Motor rollen.
Das Auto kriecht förmlich über den Hügel, zögert und will schon stehen bleiben. Vor ihm fällt die Straße unter dem Mond auf Meilen hin ab. In der Ferne deutet ein heller Schimmer eine Tankstelle an. Er dreht und wendet verzweifelt das Lenkrad, bis der Abwärtsschwung den Wagen erfasst. Einen Augenblick später fährt er wieder. Die Geschwindigkeit erhöht sich stetig.
Die Tankstelle rückt näher, ein Polarlicht mitten in der dunklen Landschaft. Er wagt nicht, daran vorbeizufahren, aber er ist sehr angespannt, als der Wagen in die entlarvende Beleuchtung der Tankstelle rollt. Erneut wirft er einen raschen Blick in den Rückspiegel. Er fragt sich, ob er den Lichtschutz der Fenster herunterziehen soll, doch dann lässt er alles, wie es ist. Nichts macht Menschen neugieriger als eine verdächtig herabgezogene Jalousie.
Er lenkt ein, fährt sorgfältig dicht an die Rampe der Zapfsäule und zieht die Handbremse. Ein Tankwart springt eilfertig herbei.
»Volltanken«, sagt er und bleibt sitzen, während der Junge den Zapfhahn einlegt. Er beobachtet ihn mit voller Aufmerksamkeit. Die Pistole liegt wieder in seinem Schoß, ist aber verdeckt vom Mantelsaum.
Der Tankwart erscheint direkt vor der Windschutzscheibe. »Auch Fenster putzen, der Herr?«
Der Fahrer grinst dünn. »Nein, lassen Sie die, wie sie sind.«
Der Tankwart grinst zurück und lässt den Blick zu der jungen Frau auf dem Rücksitz wandern. Er verharrt einen Augenblick dort.
»Sie ist zu Tode erschöpft«, erklärt der Mann am Steuer. »Hier ist das Geld. Behalten Sie den Rest.«
Der Wagen rollt aus dem gelben Lichtfeld der Tankstelle wieder in die schützende Dunkelheit der Straße. Das Wageninnere versinkt durch die wie Tinte hereinquellende Finsternis wieder in der Düsternis.
Der Tankwart ist baff. »Hey, Mister, das ist eine 20-Dollar-Note, die Sie mir …«, ruft er dem Fahrer hinterher.
Doch der Wagen ist schon wieder unterwegs. Der Mann am Steuer schreckt auf. Was ist das für ein Knattern da hinter ihm? Ein kleiner einzelner und schwankender Lichtstrahl folgt ihm. Schon der Bus und die Tankstelle machten den Mann nervös. Jetzt fehlt ein passendes Wort, mit dem man seinen Gesichtsausdruck beschreiben könnte, als der Rückspiegel ihm anzeigt, dass eine Streife ihm folgt. Mit gebleckten Zähnen kämpft er den Impuls nieder, Gas zu geben, der Streife davonzufahren. Er fährt rechts ran, wird langsamer, bleibt stehen. Wieder wird die Waffe hervorgeholt, wieder liegt sie unter seinem Schenkel, der Lauf so, dass seine dem Fenster abgewandte rechte Hand sie jederzeit hervorziehen kann. Dann gräbt er seine Faust in die hohle Linke.
Das Motorrad saust vorbei, macht eine etwas wacklige Kurve und kommt zurück. Der Fahrer steigt ab, kommt zu ihm herüber und stellt ein Bein schwerfällig auf dem Trittbrett ab. Er beugt sich herab und späht unter buschigen Brauen in den Wagen.
»Was haben Sie’s denn so eilig, guter Mann? Ich hab Sie mit über 150 Stundenkilometern erwischt.«
»159«, korrigiert der Ledergesichtige mit einer gefährlichen Ruhe, die man nicht mit Zerknirschung verwechseln kann.
»Na, mehr als 90 dürfen Sie hier nicht fahren. Zeigen Sie mir einmal Ihren Führerschein.«
Der Fahrer zieht den Führerschein mit der Linken hervor, die Rechte hängt immer noch an seiner Seite hinab und liegt direkt neben dem rechten Oberschenkel, auf kaltem, schwarzem Metall.
Der Polizist studiert den Führerschein im schwachen Licht des Armaturenbretts und beugt sich dafür sogar noch ein Stück weiter ins Wageninnere. Seine Waffe hängt an seiner Hüfte, außerhalb seiner Reichweite, der Fensterrahmen wäre dem Ellbogen im Weg, wenn er versuchte, der Waffe habhaft zu werden. »Anton Denholt. Sie sind Arzt, ja? Ich bin überrascht, da sollten Sie doch wirklich vernünftiger sein! Sie sind in den Nachbarstaat unterwegs? Nun, ihr Leute von dort macht uns doch wirklich den größten Ärger! Nun, hier sind Sie auf meinem Grund und Boden, ich hoffe, da haben wir uns verstanden. Die Grenze ist erst dort hinten!«
Denholt wirft einen Blick auf die Straße, als hätte er die Grenzmarkierung vorher nicht bemerkt. »Das war nicht meine Absicht«, entschuldigt er sich mit ausdrucksloser Stimme.
Der Polizist nickt nachdenklich. »Na, haben Sie wohl übersehen«, stellt er fest. »Aber warum sind Sie eigentlich so schnell gefah…?«
Vielleicht kann Denholt nicht abwarten, bis der Kerl die Schlafende auf der Rückbank entdeckt, vielleicht ist sein Nervenkostüm schon so dünn, dass er es hinter sich bringen will und deshalb die Aufmerksamkeit auf sie lenkt. »Es ist wegen ihr«, erklärt er. »Jede Minute zählt.«
Der Cop wirft einen Blick auf die Rückbank. »Ist sie krank, Doc?«, will er wissen, nun schon etwas besorgter als zuvor.
»Eine Sache auf Leben und Tod!«, sagt Denholt. Und wieder sagt er nichts als die Wahrheit. Und zwar deutlicher, als der Polizist wohl ahnt.
Jetzt sieht der Cop schon etwas schuldbewusster aus. »Warum sagen Sie das denn nicht gleich? In Rawling haben wir ein gutes Krankenhaus. Vor etwa einer Stunde müssen Sie dran vorbeigekommen sein. Warum haben Sie sie denn nicht dorthin gebracht?«
»Nein, es würde dort reichen, wo ich hinwill, wenn Sie mich nur weiterfahren lassen. Ich will sie einfach nach Hause bringen, bevor sie das Baby …«
Der Cop stößt einen kleinen Pfiff zwischen den Zähnen hervor. »Kein Wunder, dass Sie so rasen!«
Er klappt sein Notizbuch zu und reicht Denholt seinen Führerschein. »Wollen Sie eine Eskorte? Dann sind Sie noch schneller. Mein Revier endet an der Grenzmarkierung dahinten, aber ich könnte jemanden für Sie anrufen …«
»Nein danke«, sagt Denholt kurz angebunden. »So weit ist es nicht mehr.«
Der Wagen fährt an und gleitet davon. In Denholt hat sich Fatalismus breitgemacht, als er den Wagen wieder auf Hochtouren bringt. Nach allem, was er bisher getan hat, was kann ihm da schon passieren? Wovor sollte er noch Angst haben … jetzt?
Keine 40 Meilen hinter der Staatsgrenze verlässt er den Transcontinental Highway und biegt in eine Seitenstraße ab. Einen Zubringer. Sofort steigt diese Straße an, sie führt in die Hügel am Fuß einer Bergkette. Die Landschaft ändert sich, wird wilder und einsamer. Vereinzelte Bäume werden zu dichtem Wald. Alles Menschengemachte, abgesehen von der Straße selbst, bleibt langsam, aber sicher zurück.
Ein zweites Mal ändert er die Fahrtrichtung und verlässt den Zubringer für einen Weg, der kaum mehr ist als ein ungeteerter Waldweg voller Schlaglöcher, der wohl nur selten benutzt wird. Stetig steigt die Straße an. Durch gelegentliche Lücken im dichten Wald, die den gewundenen Pfad säumen, kann er das Flachland sehen, das er zurückgelassen hat, das Band des Highways, auf dem er fuhr, ein blinkendes Licht hier und da, wie ein Glühwürmchen, das ihn langsam entlangkrabbelt. Die Straße macht einige Haarnadelkurven, überhängende Zweige knacken und rauschen, als sie wieder an Ort und Stelle schwingen, nachdem er sie mit dem Wagen verdrängt hat. Er muss hier sehr viel langsamer fahren, aber er scheint zu wissen, wohin er will.
Plötzlich erscheint ein Stacheldrahtzaun aus dem Nichts, der neben dem Waldweg herläuft. Vier Reihen hoch, jede Reihe bestehend aus drei ineinandergeflochtenen Drähten. Bedrohlich trotzen sie jedem Eindringling, der größer ist als ein kleines Nagetier. In so einer abgelegenen Gegend wirkt dieser Wunsch nach Privatsphäre seltsam. Ein doppelflügliges Tor im Zaun taucht auf, das mit zwei Vorhängeschlössern gesichert ist, und der Wagen bleibt direkt davor stehen. Eine Plakette daneben besagt im wie Diamanten funkelnden Scheinwerferlicht: PRIVATBESITZ. ZUTRITT VERBOTEN. Die Warnung ist geläufig, aber sie hier in der einsamen Bergwelt vorzufinden, ist es nicht. Es ist sogar etwas verdächtig.
Er steigt aus, öffnet beide Schlösser und stößt die beiden Torflügel mit dem Fuß nach innen. Sofort ertönt in den Bäumen direkt neben dem Tor ein durchdringendes Klingen und Rattern. Eine Alarmglocke, die mit dem Tor verdrahtet ist. Der Lärm in der dunklen Stille ist beängstigend. Auch das ist alles andere als alltäglich und weist eher auf die Vorsicht eines Fanatikers hin.
Der Wagen durchfährt die Öffnung und hält wieder, während der Mann das Stacheldrahttor schließt und die Vorhängeschlösser wieder anbringt. Die Glocke ist wieder still, die Stille ist jetzt im Kontrast dazu geradezu ohrenbetäubend. Wieder fährt der Wagen ein Stück, bis die Silhouette eines Hauses plötzlich in den aufgeblendeten, suchenden Scheinwerferkegeln des Wagens auftaucht. Ein Blockhaus, dicht an den Boden gedrückt. Es sieht aus wie ein Jagdhaus. Aber es hat keine Freundlichkeit an sich. Das Haus wirkt unheimlich, abweisend, so dunkel, so verlassen, so geheimnisvoll. Es ist ein Haus, das ein Maul hat, mit dem es Dinge verschlucken kann. Ein Haus, in das es nur ein Hinein gibt und bei dem man das Gefühl hat, dass es alles verschlingt, was hineingeht. Im Mondlicht, das auf dem Dach ruht, sieht es geradezu leprös aus. Die beiden Lichtkegel, die aus dem Autoscheinwerfer auf die Seitenwände fallen, wirken wie die perlenförmigen Augen eines Schädels.
Wieder verlässt der Mann das Auto und eilt hastig zu einer Art Veranda vor dem Eingang. Metall klirrt, eine schwarze Öffnung gähnt. Er verschwindet darin, während das scheinwerferbewehrte Auto und die schlafende junge Dame gehorsam draußen warten.
Drinnen leuchtet jetzt ein Licht auf, grünlichgelb und blass wie das einer Petroleumlampe. Es scheint aus der Tür und lässt die kohlschwarzen Baumstämme nur noch schwärzer erscheinen. Das Haus sieht unheimlicher aus als zuvor.
Sieht so ein Nach-Hause-Kommen aus?
Der Schatten des Mannes wird länger, seine Silhouette erscheint schwarz im Türrahmen, und dann ist er bereit, die geduldige Dame in Empfang zu nehmen. Er stellt den Motor ab, öffnet die Hintertür des Wagens und streckt die Arme nach ihr aus. Er löst ihre schlaffe Hand aus dem Haltegriff, zieht die Decke fort und nimmt ihren Körper auf die Arme. Dann geht er langsam mit ihr im Arm ins Haus, als wäre sie etwas sehr Kostbares. Hinter ihm fällt die Tür ins Schloss, er hat mit der Ferse dagegengetreten.
Die Welt draußen versinkt wieder in Dunkelheit.
Kapitel 2
Denholt trägt die junge Frau durch das Haus hindurch in einen Anbau, den man von der Auffahrt her nicht sieht. Zwischen ihm und dem Rest des verwinkelten Gebäudes besteht ein signifikanter Unterschied. Der Anbau ist nicht in Blockhausweise gebaut, sondern hat Wände aus verputzter Ziegelmauer. Beides muss mit großem Aufwand und hohen Kosten hier an diesen unzugänglichen Ort transportiert worden sein. Hier besteht Stromanschluss, der von einem Generator Marke Eigenbau gespeist wird. Blendendes, klinisch weißes Licht strömt von der Decke in die Räumlichkeiten hinab. Es gibt keine Stühle, keine grob gezimmerten Tische oder sonst etwas in der Art. Stattdessen Petrischalen und Bunsenbrenner. Einen Operationstisch aus Zink. Wannen, in denen Chemikalien schwimmen, eine gläserne Vitrine voller Instrumente. Und an einer Seite des Raums stehen zwei Käfige aus Maschendraht, in denen je ein Kaninchen hockt.
Er durchquert rasch mit seiner Last den Raum und legt sie auf dem Zinktisch ab. Sie rührt sich kein einziges Mal. Dann dreht er sich um, schließt die Tür und verriegelt sie oben und unten, zieht seinen Mantel, Hemd und Unterhemd aus und schlüpft in einen weißen Chirurgenkittel. Er nimmt eine Spritze aus der Vitrine für die Instrumente, lässt sie in eine Schale mit antiseptischer Flüssigkeit fallen und zündet eine Flamme darunter an.
Dann geht er zurück zum OP-Tisch.
Die Gestalt der jungen Frau hat die zusammengekauerte Position angenommen, die sie während der langen Reise die ganze Zeit eingenommen hatte: Sie liegt auf der Seite und hat die Beine unter sich gezogen, als läge sie noch auf dem Rücksitz des Wagens, einen Arm ausgestreckt, mit schlaffem Handgelenk, als hinge es noch im Haltegriff. Denholt scheint das erwartet zu haben, dennoch runzelt er leicht die Stirn. Er versucht ihre steifen Glieder etwas zu strecken, doch sie widerstehen ihm. Auch seine ganze Kraft schafft es nicht, sie und den Torso in eine Linie zu bringen. Also tut er, was er tut, nun mit größerer Hast, als wäre jeder Augenblick sowohl ein Hindernis als auch eine Herausforderung.
So ist es eben. Denn die Leichenstarre hat eingesetzt, die Schlafende ist ja auch schon den größeren Teil der Nacht tot.
Denholt reißt ihr die Sachen mit weit ausholenden Armen ab, mit Bewegungen wie ein Schwimmer beim Kraulen. Hut, Schleier, das schwarze Kleid, die Schuhe, Unterwäsche, alles fällt zu Boden.