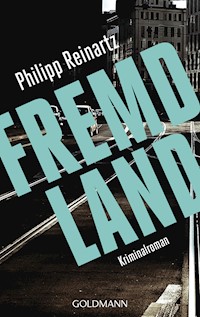8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Aus dem Berliner Westhafen wird die Leiche eines Hotelchefs geborgen. Der Tote ist merkwürdig kostümiert, sein Nacken wurde mit einem lilafarbenen Punkt markiert. Ein Fall für die neu gegründete Neunte Berliner Mordkommission, eine Sondereinheit für außergewöhnliche Fälle. Ihr Leiter: Jerusalem „Jay“ Schmitt, Polizei-Elite, international ausgebildet. Doch bald wird die nächste Leiche gefunden, wieder mit einem farbigen Punkt im Nacken. Und schon lange Vergangenes wird plötzlich aktuell. Jay vermutet einen Masterplan, sucht nach der Gemeinsamkeit hinter den in Szene gesetzten Morden. Langsam kommt er seinem Gegenspieler immer näher. Oder ist es am Ende umgekehrt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Aus dem Berliner Westhafen wird die Leiche des Hotelchefs Hans Pohl geborgen. Der Tote ist merkwürdig kostümiert, sein Nacken wurde mit einem lilafarbenen Punkt markiert. Ein Fall für die neu gegründete Neunte Berliner Mordkommission, eine Sondereinheit für außergewöhnliche Fälle. Ihr Leiter: Jerusalem »Jay« Schmitt, Polizei-Elite, international ausgebildet. Doch bald wird die nächste Leiche gefunden, wieder mit einem farbigen Punkt im Nacken. Und schon lange Vergangenes wird plötzlich aktuell. Jay vermutet einen Masterplan, sucht nach der Gemeinsamkeit hinter den in Szene gesetzten Morden. Langsam kommt er seinem Gegenspieler immer näher. Oder ist es am Ende umgekehrt?
Informationen zu Philipp Reinartz
finden Sie am Ende des Buches.
PHILIPP REINARTZ
Die letzte Farbe
des Todes
Jerusalem Schmitt ermittelt
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Originalausgabe April 2017
Copyright © 2017 by Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München
Umschlagfoto: Plainpicture/Andreas Süss; FinePic®, München
Redaktion: Lisa Wagner
BH · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-19886-2V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1
Westhafen
Ziemlich alt für einen Matrosen, dachte Jay. Er verstand nicht viel von Seefahrt, aber der vor ihm war sicher über sechzig. Da war man als Matrose im Ruhestand, rauchte Pfeife im Schaukelstuhl und sah hin und wieder sehnsüchtig auf den viktorianischen Taschenkompass auf der Anrichte. Und wer sich doch nicht von den Schiffen trennen konnte, war zumindest tätowiert, zerknautscht, furchiges Gesicht, glasige Alkoholaugen. Nicht so wie der hier. Jay hatte recht klare Vorstellungen von einem Matrosenleben, war sich seiner eigentlichen Unkenntnis jedoch bewusst.
Vielleicht war der Mann sogar betrunken, man konnte es ihm nicht ansehen. Vielleicht hatte sich irgendwer gestern Abend gefragt, was sich früher die Seefahrer der Royal Navy fragten und inzwischen jede Coverband auf dem Dorffest. What shall we do with the drunken sailor? Und dann einfach … Jay musterte den Mann. Weiße Mütze mit dunkelblauem Band, eckiger Matrosenkragen mit drei Streifen, Latztrikot. Das Halstuch auf der Brust verknotet. Sein Gesicht war blass, natürlich. Darüber kurze schwarze Haare mit vielen weißen Strähnen. Aus der Ferne würden sie wohl gräulich wirken, jetzt stand Jay nur einen Meter von ihm entfernt. Alles war nass. Das Wasser strömte aus der Kleidung auf den Asphalt, eine große Pfütze, mit Ausläufern fast bis zu den Rangierschienen.
Der Matrose hatte die Augen halb geöffnet und starrte nach oben. Jay folgte seinem leeren Blick. Über die bunten Container, die immer wirkten wie Bauklötze, wie sie aufeinandergestapelt im Hafen standen oder auf Schiffe verladen wurden, blau, gelb, grün, keine Logos, keine Einheitlichkeit, einfach bunte Kisten wie im Kindergarten. Über das rotbraune Gebäude, das einem Kreuzfahrtschiff ähnelte, über die großen gelben Buchstaben auf dem Dach, die das Wort Behala formten, bis in die Sonne. Der Verladekran sah regungslos zu, nur das Wasser bewegte sich leise im Becken des Berliner Westhafens. Was der wohl angestellt hat, dachte Jay. Fragen konnte er den Matrosen nicht. Denn der Matrose war tot.
Jay überlegte, was der Matrosenanzug aussagen konnte. Er hatte keine Ahnung davon, er war in Berlin aufgewachsen, wurde hier Polizist, dann College in Coventry, eine Zeit in Lyon. Immer ziemlich weit weg von Seeleuten. Ein Experte könnte vielleicht schon mit einem Blick auf die Wasserleiche Aussagen treffen. Knotenart, Anzahl der Streifen, Farbe des Latzes. Bestimmt sagte das etwas aus über Herkunft und Rang, Untermatrosen hatten nur einen Streifen auf dem Matrosenkragen, Obermatrosen durften ihr Mützenband mit einem längeren Schweif enden lassen, so was in der Art.
»Dr. Hans Pohl, Hotelier, 67 Jahre alt. Wurde gestern Abend als vermisst gemeldet.« Jay hatte Marcel nicht kommen hören.
»Der hier?«
»Der hier.«
Ungläubig sah Jay zurück auf den stummen Matrosen am Boden, der nun kein Matrose mehr war. Hotelier. Er hatte sich schon gewundert, ein toter Matrose fiel nicht unbedingt in ihren Aufgabenbereich.
»Hobby? Fetisch?«
Marcel schien Jays Frage nicht verstanden zu haben. Manchmal dachte Jay, sein Kollege wäre in einem Job mit weniger kombinatorischen Anforderungen und mehr Stück-für-Stück besser aufgehoben. Lagerist vielleicht. Oder Fahrkartenkontrolleur oder Notar. »Na, der Kerl liegt hier in einem Matrosenanzug.«
Jay ging noch näher an den Toten. Er hatte etwas bemerkt, einen Fetzen, der hinter dem Ohr aus den Haaren ragte. Er zog sich die Plastikhandschuhe über, die Marcel ihm in die Hand gedrückt hatte, komplettierte den Partnerlook: weißer Einwegoverall, weiße Kapuze, weiße Handschuhe. Als er das Stück Papier herausziehen wollte, zog er dem Matrosen die Mütze vom Kopf. Ein Preisschild. An der Mütze war noch das Preisschild. Man konnte nicht mehr viel lesen, das Wasser hatte den Aufdruck fast völlig abgewaschen. Jays Kopf ratterte. Er tastete den Toten ab, besah Kragenunterseite, tastete nach Innentaschen, dann in den Ärmel. Da. Noch ein Preisschild. Jay zog einen weiteren Papierfetzen hervor. Er war an der Innenseite des Hemdärmels befestigt worden. Hier ließ sich genauso wenig lesen, 29 Euro oder 49 Euro, vielleicht war es auch eine Sieben am Anfang oder die Neun eine Eins.
»In einem nagelneuen Matrosenanzug«, ergänzte Jay.
»Und wir haben noch etwas gefunden. Schauen Sie mal in seinen Nacken.«
Alle duzten Jay in der Kommission, bis auf einen. Jay drehte den Kopf des Toten leicht zur Seite. Noch bevor er etwas sagen konnte, reagierte Marcel.
»Ein lilafarbener Punkt, ein Zentimeter Durchmesser, in wasserfester Farbe.«
Tatsache. Der Mann hatte einen lila Punkt im Nacken. Jay drehte den Kopf zurück. Was der wohl angestellt hat, dachte sich Jay erneut.
2
Grunewald
Der Waldboden war angenehm gedämpft, die Luft feucht und unbelastet. Wie immer im Grunewald. Es gab für ihn nach langen Arbeitstagen nichts Angenehmeres, als hier zu spazieren. Vögel stiegen am Himmel auf und andere ab, wie Flugzeuge, dachte er, und im selben Moment hielt er es für bezeichnend, dass er bei Vögeln an Flugzeuge denken musste und nicht etwa bei Flugzeugen an Vögel. Lange Zeit waren verglaste Senator Lounges seine Vogelwarten gewesen, er konnte die Dinger an ihrem bunten Gefieder bestimmen, wusste, wer nach Süden und wer nach Norden flog und wie lange sie brauchten. Seit er den Jungen mehr Verantwortung gegeben hatte, sah er endlich wieder mehr Vögel und weniger Flugzeuge.
Manchmal hielt er die Jungen für Spinner. Sie stellten beschreibbare Wände auf, gaben jedem Filzstift und Klebezettel in die Hand und kritzelten gedankenlos drauflos, hefteten jede Schnapsidee an die Wand, und wenn man sie hier und da auf die Lächerlichkeit ihrer Vorschläge hinwies, riefen sie »Defer Judgement!« und erzählten etwas von einer Bewertungsphase, in der man noch nicht sei. Und es gab nicht mal Kekse.
Andererseits waren ihm die Jungen auch recht, denn sie arbeiteten wenigstens viel. Er konnte sich endlich ein bisschen zurückziehen, musste manchmal ein Brainstorming über sich ergehen lassen, ansonsten vor allem entscheiden. Entscheiden mochte er. Er kannte andere, für die es schon schwierig war, eine Krawatte zu kaufen. Nicht für ihn. Sich eine überschaubare Anzahl von Optionen zurechtlegen, die Konsequenzen jeder Option durchdenken, die beste Option wählen. Er hatte schon sehr viele Entscheidungen treffen müssen in seinem Leben, in seiner Karriere, wichtige, mit Tragweite, es war ihm unverständlich, wie andere an Krawatten scheitern konnten oder an einem Einkauf im Supermarkt. Es gab natürlich die ganz schwierigen Entscheidungen, diejenigen, bei denen man nicht in wenigen Minuten alle Optionen zu Ende denken konnte. Da brauchte auch er länger, klar, er wollte nicht undurchdacht entscheiden, nur eben effizient.
Richtig entschieden hatte er fast immer. Er hatte etwas aufgebaut, er hatte den Laden groß gemacht, sehr groß, niemand bezweifelte die Erfolgsgeschichte. Er war stets fasziniert, wenn er seinen Namen auf Briefpapier las oder in der Zeitung. Man sprach über ihn, er war ein Thema, er war das, was man eine Respektsperson nannte. Ja, für einige war er bestimmt Vorbild, und es würde ihn nicht wundern, wenn manch Brainstormer seinem Beispiel folgte und sein Team beim nächsten Mal auch auf Schnapsideen hinwiese, trotz irgendwelcher Regeln irgendwelcher Klebezettelgurus. Er hatte eine bedingungslos loyale Frau, die komplementär alles abdeckte, was ihm nicht lag, die mit jedem reden konnte und sich um alles kümmerte und die er über dies hinaus liebte, nicht im leidenschaftlichen Sinne, aber im Sinne eines tiefen Zugehörigkeitsgefühls, das in seinem Alter die normale Form der Liebe war. Er hatte einen Sohn und eine Tochter durchgebracht, zugegebenermaßen mit unterschiedlichem Erfolg, und er konnte an einem Sonntagabend um sechs im ruhigsten Wald der Gegend spazieren, und zurück in der Casa würde es Rehrücken geben. Ja, richtig entschieden hatte er fast immer. Fast immer, murmelte es ihm leise durch den Kopf.
Hätte man ihm zu diesem Zeitpunkt ein bevorstehendes Unheil orakelt und vier absurd erscheinende Szenarien zur Sortierung nach Wahrscheinlichkeit vorgelegt, den Börsencrash hätte er oben positioniert, man weiß ja nie, danach den Terroranschlag auf eines der Häuser der Firma, sogar eine Affäre seiner Frau mit dem Gärtner hätte er sich mit ganz, ganz viel Fantasie vorstellen können. Nicht hingegen, in fünfzehn Stunden in einem Matrosenkostüm aus dem Becken des Berliner Westhafens gezogen und für einen betrunkenen Seemann gehalten zu werden.
3
Casa
Jay dachte über den falschen Matrosen nach und über Sonya. Eigentlich sollte er besser nur über den falschen Matrosen nachdenken, es war Arbeitszeit, er saß mit Marcel in einem Polizeiwagen Richtung Grunewald, und der falsche Matrose verlangte Antworten. Aber er konnte sich nicht davon abbringen, an Sonya zu denken, denn der Kopf, das hatte er die letzten Monate gemerkt, machte in solchen Situationen immer, was er wollte, so verlässlich er auch sonst schien.
Sonya war die Höchststrafe, Sonya war das Schlimmste, was einem Mann passieren konnte. Sie war wie Kastration, sie hatte ihm die Eier herausgerissen, so fühlte es sich an. Es tat nicht weh wie bei einer normalen Trennung, es war einfach nur peinlich, das war das Fiese, es war peinlich für ihn, peinlicher als alles, eine jahrelange Affäre mit seinem besten Freund wäre noch okay gewesen, halb so peinlich wie das. Sonya war lesbisch.
Sie waren vier Jahre zusammen gewesen, lange genug, um die Schwächen des anderen identifiziert zu haben, aber auch lange genug, um die Stärken des anderen wertzuschätzen. Beide über dreißig, sie wohnten zusammen, Hochzeit mochte nun kommen oder Kind. Bei Sonya folgte eine gründliche Selbstfindung mit dem überraschenden Ergebnis einer sexuellen Neuorientierung namens Sasha. Sasha war Tänzerin oder Sängerin und schokobraun, falls man das sagen durfte. Sie war wahrscheinlich zur Hälfte irgendetwas Ausgefallenes, Réunion, Kap Verde, Französisch Guyana, Surinam, keine Ahnung. Und attraktiv war sie natürlich, aber das war schon fast egal. Sie war vor allem eine Frau und Sonya auch, und so musste Jay nicht nur über eine Trennung hinwegkommen, sondern über die Demütigung, dass seine Freundin sich nach ihm für eine Abkehr vom männlichen Geschlecht entschieden hatte.
»Hier müsste das jetzt irgendwo sein«, meinte Marcel und versuchte an den Toren und Hecken und glatten Fassaden einen Hinweis auf die Casa Lollo zu finden. Klingelschilder gab es hier nicht mehr, manchmal sah man noch ein T. G. auf dem Briefkasten oder ein S., je größer die Häuser, desto kürzer die Namen.
»Das weiße da vorne vielleicht.«
Sie stiegen aus und besahen das silberne Klingelschild. Casa Lollo.
Die Frau des toten Hoteliers, Luitgard Pohl, hatte nicht nur einen seltsamen Vornamen, sondern auch ein seltsames Wohnzimmer. Jay war noch nicht lange bei der Mordkommission, und im Gegensatz zu Derrick wurde er selten in Unterkünfte mit Dreifachcarport gerufen. Dennoch hatte er schon Reichenwohnzimmer gesehen, und die waren meistens puristisch. Dort schienen sich die Bewohner bei jedem Accessoire zu fragen, ob es wirklich notwendig war, die Beweislast lag somit beim Einrichtungsgegenstand. Pohls hingegen schienen den umgekehrten Ansatz zu verfolgen, hatten offenbar vielmehr Schwierigkeiten damit, einem Accessoire keine Wohnzimmertauglichkeit auszustellen. So gab es unzählige Vasen, Bilder, Figuren und Dinge, die man gemeinhin als Nippes bezeichnen könnte, auch wenn ihr Ankaufspreis das vermutlich verbot.
»Franziska habe ich rufen lassen.« Frau Pohl tupfte sich mit einem Taschentuch die Wangenknochen ab und ging dabei mit der notwendigen Feinfühligkeit vor, um Tränen, nicht jedoch die darunterliegende Schminke wegzuwischen.
Die ersten Minuten solcher Gespräche waren aus polizeilicher Sicht selten ergiebig. Die wichtigen Fragen brannten auf der Zunge, doch zuerst musste man durch Beileid und Formalitäten. Der Tod ihres Mannes schockierte Frau Pohl, die Matrosengeschichte entsetzte sie. Sie könne sich keinen Reim darauf machen, er war spazieren gegangen wie so oft am Wochenende, um acht wollten sie essen, dann wurde es neun, dann zehn, und dann rief sie die Polizei. Matrosenkostüm, schluchzte Frau Pohl noch einmal und zog verständnislos das Gesicht zusammen, was sie faltiger aussehen ließ, als sie war.
»Guten Tag.«
Marcel und Jay drehten sich zur Tür. Eine junge Frau in übergroßem Pullover stand unter dem weißen Bogen, der den Durchgang ins Wohnzimmer markierte. Dunkle Haare, groß, mit der rechten Hand rieb sie den Oberarm des linken Arms. Gemeinhin eine Verlegenheitsgeste, für Jay jedoch immer mit besoffenen Pubquatschern und missliebigen Flirts verbunden. Sie hatten es auf dem College in Coventry als geheime Geste eingeführt, um umherstehenden Freunden in solchen Situationen ein Holt mich hier raus zu signalisieren.
»Das ist Franziska, Hendrik ist leider noch in den USA, er wird heute Abend …«
»Hallo, Jerusalem Schmitt, Neunte Berliner Mordkommission, das ist mein Kollege Marcel Bräutigam.«
Franziska Pohl wirkte kontrolliert, gefasst, traurig, aber nicht hysterisch. Sie strahlte in Anbetracht der Situation eine überraschende Ruhe aus.
»Können wir uns irgendwo unterhalten? Dann würde mein Kollege hier mit Ihrer Mutter weitermachen.«
Frau Pohl junior ging durch den langen Flur vorweg und bog in ein Zimmer ab, das man vielleicht Salon nennen konnte oder Bibliothek, Aufenthaltsraum, es gab einen Kamin, ein schmales Sofa, Bücher, ein Alkoholika-Wägelchen. Jay dachte an lange Winterabende, dabei bot die vollkommen verglaste Front einen ungefilterten Blick auf den Frühling, die bodentiefen Fenster zeigten den Garten des Hauses. Franziska Pohl hatte Probleme, die Terrassentür zu öffnen, unsanft riss sie an einem Hebel, unter dem ein kleiner Knopf dazu einlud, gedrückt zu werden.
»Ich bin hier ewig nicht mehr gewesen«, entschuldigte sie sich, und Jay kam ihr zu Hilfe, mit einer einfachen Bewegung verifizierte er seine Knopf-Hypothese.
»Sie wohnen nicht hier?«
»Ich bin 35.« Eigentlich hatte sie recht. Einer Mittdreißigerin zu unterstellen, bei ihren Eltern zu wohnen, war ungewöhnlich. Es musste an der Casa liegen, reiche Familien hatten immer etwas von fest zusammenhaltenden Clans.
»Ich habe hier nur sehr kurz gewohnt, drei Tage nach meinem achtzehnten Geburtstag bin ich ausgezogen.«
Sie gingen ein paar Meter, bis sie in der Sonne standen, dann blieben sie gleichzeitig stehen. Jay holte einen Notizblock hervor. Viele verwendeten ihre Smartphones, zum Tippen oder direkt zum Aufnehmen, er nutzte lieber noch den Klassiker. Nicht aus Nostalgie, dafür war er zu jung, er merkte nur, dass es die Gesprächssituation zu beruhigen schien, Smartphones verunsicherten die Vernommenen, als könne er mit einem falschen Wisch einen Haftbefehl beantragen.
Franziska Pohl hatte von ihrer Mutter vom Tod des Vaters erfahren, auf den Hafen und den Matrosenanzug reagierte sie mit demselben Unverständnis, wenngleich weniger emotional. Man merkte, wie sie nachdachte, sie nahm die Nachricht nicht bloß hin, sondern überlegte, was die absurde Szenerie bedeuten könnte. Es gefiel Jay, einen rationalen Menschen vor sich zu haben, jemanden, der mitdachte, keinen Marcel, der zu diesem Zeitpunkt noch mit der Verarbeitung der Ausgangsinformation beschäftigt wäre.
»Arbeiten Sie in der Branche Ihres Vaters?«
»Hotel?« Sie lachte bitter. »Niemals. Ich habe mich nicht gut mit meinem Vater verstanden, also wir haben uns nicht gestritten, wir hatten nur wenig«, sie machte eine kurze Pause, »wir hatten nur sehr wenig Kontakt.«
»Seit wann?«
»Schon seit meiner Schulzeit, so mit sechzehn, siebzehn. Wir hatten nicht viel gemeinsam, seine ganze Welt … ich kam damit nicht klar, das war nichts für mich.«
»Die Hotelbranche?«
»Ja, die Branche und seine Häuser und …« Sie blickte leer in den Garten. »Ich bin nur gekommen, weil meine Mutter meinte, die Polizei will mich sehen.«
»Wie ist denn Ihr Verhältnis zu Ihrer Mutter? Haben Sie da mehr …?«
»Meine Mutter war mein Vater. Sie hätte sich nie von seiner Seite bewegt. Ich konnte kein normales Verhältnis zu meiner Mutter haben ohne ein halbwegs normales zu meinem Vater.«
Jay wusste, was er noch fragen musste, doch es war ihm unangenehm, und so zögerte er es hinaus und erkundigte sich nach dem eigenwilligen Namen des Hauses. Es sei nach Gina Lollobrigida benannt, meinte Franziska Pohl und erzählte von 1986, als die italienische Diva Jurypräsidentin der Berlinale gewesen war und während ihres Aufenthaltes in ebendiesem Haus bei ihrem Liebhaber, einem deutschen Fotografen und Erben, gewohnt hatte. Der benannte die Villa nach ihr, und beim Kauf des Hauses Mitte der Neunziger hätten ihre Eltern den Namen einfach übernommen. Casa Lollo.
»Wo waren Sie gestern Abend? Und wo haben Sie sich bis heute Morgen aufgehalten?« Jay entschied sich für den abrupten Themenwechsel, entschuldigte sich dann aber gleich. Er müsse das fragen.
Sie habe sich direkt nach der Arbeit mit einer Freundin zum Essen getroffen – Wo? Friedrichshain –, da müsse es Zeugen geben, sie seien im Maître Corbeau gewesen. Jay notierte. Und als ihre Mutter sie gegen halb elf anrief, sei sie hergekommen und die Nacht über geblieben, mit ihrer Mutter und der Angestellten.
Er war doppelt froh. Erstens klang es nach einem soliden Alibi, dessen Details Marcel freilich noch überprüfen musste, und zweitens spielte ein etwaiger Partner bei der Gestaltung des vorigen Abends keine Rolle. Und auch keine Partnerin.
4
Überfall
Die Erinnerung an ihn war über all die Jahre gleich geblieben. Es gab keinen Abschluss, keine Linie, die man unter alles setzen konnte. Sie war immer da, seine traurige Geschichte.
Der Mann mit den drei Muttermalen auf der rechten Wange, die auf einer wie mit dem Lineal gezogenen Geraden lagen, holte einen Sekt vom Spätkauf. Keinen Champagner, aber ein Sekt musste es sein. Es gab etwas zu feiern, einen Neuanfang, einen neuen Abschnitt, darauf musste man anstoßen. Er freute sich immer, nach Hause zu kommen, freute sich auf Netti, wie ihre Freundinnen sie nannten, und auf die Kinder. Doch noch nie hatte er sich so sehr gefreut wie heute. An diesem Tag brauchte er nur sieben Minuten mit dem Rad nach Hause, sonst waren es elf, bald würde er den Weg gar nicht mehr fahren.
Netti hatte ihn kommen sehen oder hören, die Tür stand einen Spalt offen.
»Hallo?«, rief er in die Wohnung. In seiner rechten Hand hielt er den Sekt, links die alte Ledertasche. Mit dem Fuß stupste er die Tür auf. »Hal-lo-oh?«
Niemand antwortete. Der Mann mit den drei Muttermalen stellte ab und ging durch die Wohnung. In der Küche war niemand, im Schlafzimmer auch nicht, das Kinderzimmer leer. Um diese Zeit waren sie doch zu Hause, kurz vor sieben, Kindergarten, Schule, Spielplatz, Turnen, alles vorbei. Für einen Moment erinnerte er sich zurück an die Zeit vor zehn Jahren, als er jeden Abend empfangen wurde wie heute, nämlich gar nicht. Das ganze Glück einer Familie konzentrierte sich in der einen Minute des Heimkommens, dachte er, wenn die Kleine Papa rief und der Große mit dem kaputten Raumkreuzer in der Hand aus dem Kinderzimmer kam. Immer derselbe Raumkreuzer, der im Lauf des Tages wieder am Regal oder der Tischplatte zerschellt und in seine grauen und blauen Noppensteine zerfallen war. Und der dann noch vor der Suppe wieder zusammengebaut werden wollte.
»Wo habt ihr euch verste-heckt?« Seine Stimme war immer noch in freudigem Singsang. Auch im Wohnzimmer konnte er niemanden sehen. Die grauen Gardinen waren vorgezogen, der Tisch für das Abendessen gedeckt. Plötzlich stieß seine gute Laune auf eine dünne Faser Angst. Nicht konkret, er rechnete damit, dass die drei gleich irgendwo auftauchen würden. Es war nur eine Vorstellung, die ihn fürchten ließ, die Vorstellung, das alles könnte eines Tages nicht mehr sein. Die Vorstellung, seiner Familie stieße etwas zu, und er käme wieder wie vor zehn Jahren alleine nach Hause, ohne Empfang, ohne Lärm, ohne Kuss, ohne Suppe und ohne Raumkreuzer. Konnte er sich sicher sein?
Er hörte ein Geräusch hinter dem Sofa, ganz leise nur, aber irgendetwas war da. Langsam schlich er durch sein eigenes Wohnzimmer, vorbei am Plattenspieler, in dem noch das neue Arena-Livealbum von Duran Duran aufgelegt war, die blaue Hülle mit dem verzerrten Bandfoto auf dem Couchtisch. Er blickte hinter das Sofa und erschrak.
Mit einem spitzen Schrei und einer plötzlichen und für ihn überraschenden Bewegung sprangen drei Gestalten hervor, direkt auf ihn zu, hatten ihn sogleich umzingelt und attackierten ihn von allen Seiten.
»Papa«, rief die eine der drei Gestalten, und der Mann mit den drei Muttermalen war sich sicher, der glücklichste Mensch der Welt zu sein.
5
Wasserdicht
Jay saß auf seinem Stuhl und starrte auf die Beschriftung an der Tür. Er erinnerte sich an den furchtbaren Nachmittag. Ein Jahr mochte es her sein, damals war er noch unten in der Dritten Mordkommission. Die Dezernatsleitung hatte um Vorschläge – von Rundmails über den Verteiler war keine Rede – für die einheitliche Benennung der Besprechungsräume im Haus gebeten. Minuten später ging es los. Orte aus der Umgebung, Wittenau, Spandau, wurde in einer ersten Mail angeregt. Zu langweilig, antwortete jemand, so hießen alle Konferenzräume, vielleicht James-Bond-Titel? Die vorherige Mail ignorierend schlug die nächste Kollegin Seen im Berliner Umland vor, Liepnitzsee oder Griebnitzsee klänge doch schön. Neue Mail: Meetingräume nach Berliner Seen zu benennen sei erschreckend nah an der Wannseekonferenz. Vielleicht etwas mehr mit Polizei, wurde weiterdiskutiert, berühmte Kriminalisten, bis sie merkten, dass sie eigentlich keine berühmten Kriminalisten kannten und es auf Ernst Gennat 1, Ernst Gennat 2 und so weiter hinauslaufen würde. Danach hatte Jay aufgehört mitzulesen. Nun stand Konf09 an der Tür, an den anderen Besprechungsräumen Konf01, Konf02, Konf03, Konf04, Konf05, Konf06, Konf07 und Konf08. Herzlichen Glückwunsch.
»Denken Sie nach?«
»Ja, Marcel.«
Sie waren nur zu viert im für Besprechungen dieser Größenordnung überdimensioniert wirkenden Konf09. In den anderen Kommissionen arbeiteten sie zu acht, neunt, zehnt, die Neunte Mordkommission war ein Experiment. Kleines Rumpfteam, flexibel erweiterbar. K-Leiter, Stellvertreter, zwei Ermittler, Tippse.
»Und?«
»Danke dir so weit für die Zusammenfassung.« Jay machte es nervös, wie Marcel mit dem Edding ohne Deckel vor der Wand stand und irgendetwas notieren wollte. Marcel verstand den Kommentar und setzte sich hin.
Dr. Hans Pohl hatte Wirtschaftswissenschaften studiert, war danach Assistent der Geschäftsführung eines Restaurantbetriebs, eines Brathähnchenschuppens, dann bekam er Lust auf den Tourismussektor, promovierte und übernahm 1985 das bis dahin familiär geführte Hotel Templiner Hof, baute um, aus, drehte, wendete und war dreißig Jahre später Vorstandsvorsitzender einer Hotelkette mit über dreißig Häusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neider mochte er haben, die üblichen Kapitalismuskritiker natürlich, die gegen Vorstandsgehälter wetterten oder Arbeitsplatzabbau, doch die sah man überall, und Pohl gab immerhin noch zweitausend Menschen quer durch Deutschland einen Job. Von echten Feinden fehlte bisher jede Spur.
Er hatte als Kind das Seepferdchenabzeichen gemacht und war als junger Familienvater vereinzelt im Freibad. Er mochte Urlaubsorte an der Küste, wie er aber genauso Berghütten mochte oder Afrika, alles blieb ein seltener Luxus, Zeit war sein kostbarstes Gut. Er war weder ein leidenschaftlicher Schwimmer, geschweige denn hatte er irgendetwas mit anderem Wassersport zu tun. Kontakt zu Seefahrern, Seglern, Schiffen hatte er nicht im Geringsten. Ein-, zweimal war er auf Jachten befreundeter Geschäftspartner, für nicht mehr als einige Stunden, ansonsten sah er zwar viele Flughäfen, aber keine Häfen. Mode interessierte ihn nicht, und auch zu Zeiten, als Matrosenlooks im Trend lagen – und hier hatte Frau Pohl gefragt, wann das denn bitte gewesen sein soll –, zeigte er keinerlei Affinität. Weder seine Buchauswahl noch die Reihe seiner Lieblingsfilme oder andere Hobbys standen in Bezug zur Seefahrt, er war kein ausgewiesener Moby-Dick-Fan oder sammelte Navy-Briefmarken, nicht einmal das passive Verfolgen des Segelsports im Fernsehen interessierte ihn. Wieso Dr. Hans Pohl heute Morgen bleich aus der Matrosenwäsche geguckt hatte, war bis hierhin gänzlich unverständlich.
Sosehr sich Jay damit quälte, irgendeinen Ansatzpunkt für den Matrosenmord zu finden, so sehr freute ihn die Konsequenz aus dem vorläufigen Untersuchungsbericht der Gerichtsmedizin und Marcels zweiter Recherche.
Als Todeszeitpunkt stand eine Zeit zwischen zwei und drei Uhr nachts fest, das Opfer war ertrunken, zuvor aber mit Chloroform betäubt worden, vielleicht mehrfach. Angenommen wurde eine Betäubung kurz vor Exitus (es gab keine Anzeichen von Gewalteinwirkung oder Todeskampf während des Ertrinkens), eventuell eine weitere, frühere bei der Entführung aus dem Grunewald. Mutmaßlich war das Opfer zwischendurch noch einmal bei Bewusstsein gewesen, was in Anbetracht der Tatsache, dass Dr. Hans Pohl das Haus nicht im Matrosenanzug verlassen hatte, Sinn ergab. Betrunken war der Seemann nicht.
So weit der Bericht, der in Kombination mit Marcels Telefonrecherche zumindest einen ersten Schluss zuließ. Franziska Pohl hatte tatsächlich im Maître Corbeau zu Abend gegessen und war danach laut übereinstimmenden Angaben ihrer Mutter und der Haushälterin ab 23 Uhr im Grunewald gewesen, im Verlauf des Abends sogar selbst noch im Gespräch mit der Polizeistelle, die sich geweigert hatte, nach so kurzer Zeit eine Vermisstenanzeige zu erstellen. Wo man denn da hinkomme, meinte der Diensthabende, nach vier Stunden am besten gleich eine Hubschrauberfahndung, und erst nach Marcels Ausführungen über den Matrosenmord wurde er angeblich kleinlauter. Zum festgestellten Todeszeitpunkt befand sich Franziska Pohl dann gemeinsam mit ihrer Mutter in einem Internettelefonat mit ihrem Bruder in den USA, was dieser bestätigte.
Entweder die gesamte Familie des Hoteliers vertuschte den Mord, oder sie hatten alle ein wasserdichtes Alibi für die Nacht, die für Dr. Hans Pohl im Hafenbecken geendet hatte.
6
Zukunft
Der Mann mit den drei Muttermalen saß an jenem Abend noch lange mit Netti am Wohnzimmertisch, hörte Musik und trank Sekt. Sie würden es wirklich machen, seine Eltern hatten ohnehin schon zugestimmt, heute hatte er sich mit ihnen und den beiden getroffen und die Verträge unterzeichnet.
»Wir sind stolz auf dich«, sagte Netti, dabei saß sie ihm ganz alleine gegenüber.
»Ich bin gespannt.«
Wochen hatte er mit sich gerungen, früher wäre es für ihn nie infrage gekommen. Er war Zeichner und nicht einmal ganz brotlos, kein freischaffender Karikaturist oder was die anderen aus dem Studium jetzt machten, er war in einem Werbebüro, verdiente je nach Auftragslage ordentlich, aber eben je nach Auftragslage. Die Kleine war drei geworden, der Große sechs, Netti arbeitete nicht. Um der Familie eine finanziell sichere Zukunft bieten zu können, war es die beste Lösung. Die anderen verstanden was vom Geschäft, er wurde Verantwortlicher für Verkauf und Absatzwirtschaft. Da konnte er seine Werbeerfahrung einbringen, vor allem kannte er den Laden, die Leute.
»Sie haben große Pläne«, sagte er.
»Das ist doch toll.«
»Ja, klar.« Einen Moment schwiegen sie.
»Nicht?«
»Doch, klar. Es ist nur … Kann ich das? Ich wollte das nie machen.«
Sie stellte das Sektglas ab und griff seine Hand. Dann drückte sie fest und lächelte.
»Wir schaffen das schon.«
Vor dem Schlafengehen ging der Mann mit den drei Muttermalen noch ins Kinderzimmer. Er sah die beiden Süßen ruhig atmen in ihrem Stockbett, der Große oben mit dem roten Schlafanzug, die Kleine unten. Sie sollten haben, was sie brauchten, zur Schule gehen, zum achtzehnten Geburtstag ein schönes Geschenk bekommen, während des Studiums ein paar Mark extra haben, sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen. Er trat in etwas Spitzes und zuckte mit seinem Fuß zurück. Der Raumkreuzer war mal wieder zerschellt, vermutlich an der Bettkante, die Steine lagen verteilt am Boden.
»Wir schaffen das schon«, dachte er und ging rüber zu Netti.
7
Boulevard
Jay kam schon um halb sieben zur Arbeit. Er hatte einen Umweg über den Wittenbergplatz gemacht, da gab es ab sechs Uhr das Büfett mit dem Rührei, traf die Kollegen vom Nachtdienst, die jetzt erst ins Bett gingen. Er hatte nicht schlafen können, war wieder abwechselnd beschäftigt gewesen mit Sonya und dem Matrosen und hatte dann geträumt, dass Franziska Pohl ihm einen lilafarbenen Punkt auf die Nase malte, und Sasha schwamm tot im Meer. Dann wachte er auf und fuhr ins Kommissariat.
Vor seiner Bürotür stehend sah er, dass er nichts sah. Noch immer kein Namensschild. Es ging nicht um Eitelkeit, er brauchte kein Leiter-der-Neunten-Mordkommission-Abzeichen. Es spazierten ihm nur momentan noch zu häufig Kollegen der anderen Kommissionen herein, die sich den Spiegelsaal ansehen wollten und denen er jedes Mal erklären musste, dass es hier bis auf Weiteres keinen Spiegelsaal gäbe, sondern nur sein Büro. Bis jetzt hatte Jay noch nicht ermitteln können, welcher Laie auf diese unsinnige Idee gekommen war: Neue Mordkommission, besondere Fälle, da brauchen wir einen Verhörraum mit verspiegelter Scheibe, wie im Fernsehen. Und dafür sparen wir dann das Büro des Kommissionsleiters, Stichwort flexibel, agil, Open Space, und setzen ihn mit seinem Stellvertreter ins Zweierbüro. Danke für nichts.
Es war Jays erste Amtshandlung vor zwei Wochen gewesen: Auszug aus dem Gemeinschaftsbüro mit Marcel, Anschaffung eines nicht günstigen, zwei Meter breiten Schreibtischs (Walnussplatte, Stahleinfassung), über dessen Finanzierung noch nicht final entschieden war, Umzug in den Spiegelsaal. Vernehmungen weiterhin in den dafür vorgesehenen Räumen, mit Schreibkraft, ohne Scheibe.
Jay schloss die Tür hinter sich, setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die Styroporklappschale mit dem Rührei. Es war ein Berg, man zahlte beim Rührei anders als mittags beim Salat nicht nach Gewicht, sondern pauschal, daher keine falsche Zurückhaltung. Die anthrazitfarbenen Wände, ohne Schmuck, ohne Fenster, das Kunstlicht, andere würden durchdrehen, Jay konnte sich keine bessere Arbeitsatmosphäre vorstellen. Sein Blick fiel auf die große weiße Magnetwand, völlig leer. Hier würde keiner randürfen, Marcels Kritzeleien konnte er nicht gebrauchen. Es war unstrukturiert, einfach mal was aufschreiben, Marcel konnte sich nicht hinsetzen und nachdenken, sondern musste ständig etwas tun, um nicht von einem Gefühl der Tatenlosigkeit erdrückt zu werden. Dabei waren Nichtstun und Nachdenken die ergiebigste Tätigkeit überhaupt, Eddinghysterie führte nicht zu Heurekamomenten. Es gab diese Menschen, und es konnten nette Leute sein, nur arbeiten konnte Jay mit ihnen nicht.
Das Foto von Pohl hängte er in die Mitte, daneben die der anderen Familienmitglieder. Informationen zu jedem Einzelnen fasste er auf einem kleinen Zettel zusammen und klebte ihn darunter. So sah es schon besser aus.
Auf seinem Schreibtisch lag der Prospekt der Hotelkette. Ascandy nannte sie sich, Jay blätterte sich durch die Seiten. Mehr als achttausend Betten, moderne Raumkonzepte, immer citynah, Kreatives Berlin, Ehrliches Hamburg, Gemütliches München, alle Städte wurden auf ihre Hauptaussage komprimiert, und natürlich preisgekrönte Qualität, flexible Stornierung*, aber: *gilt nicht zu Messe- und Eventzeiten.
Es war ein beliebiger Hotelkatalog, nur war das Vorwort von einem toten Matrosen geschrieben. Ihr Dr. Hans Pohl stand da, darüber eine deutlich zu leserliche Fake-Unterschrift, die bestimmt aus der Marketingabteilung stammte. Er möchte Sie einladen, die lieben Leser, und zwar zum Eintauchen und Abtauchen, denn ob Städtetrip oder Geschäftsreise, in einem Haus der Ascandy-Kette verbinde sich zentrale Lage mit komfortablem Interieur. Jay schmunzelte bitter. Die Formulierung des Ein- und Abtauchens barg rückblickend eine gewisse Ironie.
»Jerusalem.« Es hatte kurz zweimal an der Tür geklopft, auf eine Antwort wartete die Eintretende nicht. Dafür klatschte sie Jay eine Zeitung auf den Tisch.
»Martha.«
»Was ist da denn los?«, fragte Martha und nickte auf die Titelseite. Irrer Matrosenmord stand dort in fetten Buchstaben, auch hier mit Sternchen, wie bei der flexiblen Stornierung, darunter dann: *… dabei ist der Mann gar kein Matrose!
»Wir haben so wenig Details wie möglich rausgegeben, verschweigen können wir das nicht.«
»Das ist mir klar, Jerusalem. Aber was ist das für eine verrückte Geschichte? Wie weit seid ihr?«
Jay erzählte vom Hotelier mit Villa im Grunewald, der abends spazieren gegangen und wenige Stunden später im Matrosenkostüm ertrunken war. Der keine Feinde hatte, kein Geld dabei, dessen Familienmitglieder alle Alibis hatten.
Martha seufzte. Sie hatte sich wohl mehr erhofft, oft waren die spektakulären Fälle diejenigen, die auch schnell gelöst wurden, eben weil sie durch ihre Sonderbarkeit Aufmerksamkeit erregten, der tote Obdachlose im Hinterhof dauerte meistens länger.
»Wir brauchen da bald was.«
Jay verstand, was sie meinte. Wenn die Presse sich erst einmal auf einen Fall gestürzt hatte, fuhr das Karussell los. Fortan war es ein Live-Krimi, und während Ermittlungen normalerweise im Tagesrhythmus voranschritten und man sich auch nur jeden zweiten Tag zum Case Team Meeting zusammensetzte, wurde fortan in Stunden gezählt und mehrmals täglich konferiert. Bis der Fall entweder gelöst wurde oder nach einer gewissen Zeit die Aufmerksamkeit der Masse verlor, jedoch zum Ausklang begleitet von Überschriften, in denen die Polizei wahlweise noch immer im Dunkeln tappte oder weiterhin keine Spur fand.
Es waren solche Wendungen, die Jays Vorgesetzte vermeiden, solche Artikel, in denen sie ungerne zitiert werden wollte. Und nach einer gewissen Zeit war das Ermittlungsergebnis auch egal, waren diese Artikel erst einmal erschienen und der Fall anschließend von den Titelseiten verschwunden, wurde das erfolgreiche Lösen des Falles später zur Randnotiz. Martha wollte, dass die Sache vom Tisch war, und zwar möglichst bald, das verstand Jay.
»Ihr von der Neunten seid natürlich im Fokus.«
Klar, das waren sie. Viele waren gegen die Neunte Mordkommission gewesen, acht reichten doch. Aber Martha Klewicz als Dezernatsleiterin wollte eine neunte, für besondere Fälle, ein Vorzeigeprojekt, mit einem international ausgebildeten Chefermittler. Und der sollte Jay sein. Seine Teilnahme am International Leadership Programme Crime and Investigation erwähnte sie viermal in ihrem Antrag. Dass es an der International Faculty des College of Policing in Coventry stattgefunden hatte, stand immerhin an zwei Stellen dabei. Jay meinte, man könne das auch weniger spektakulär beschreiben, woraufhin Martha fragte, ob er noch nie eine Bewerbung geschrieben hätte. Dann ging sie mit ihrem Antrag zum Abteilungsleiter, der zum Direktor des LKA, der zum Polizeipräsidenten, der zur Politik. Bewilligt. Jay wurde in ein mehrwöchiges EU-gefördertes Trainingsprogramm nach Lyon geschickt, das sie Boot Camp nannten, während in Berlin ein Spiegelsaal gebaut und ein vielversprechender Kommissar aus der Siebten zu seinem Stellvertreter auserkoren wurde. Inzwischen fragte sich Jay, ob mit vielversprechend wirklich vielversprechend gemeint war, oder ob Marcel einfach viel versprochen hatte.
»Ich war um halb sieben im Büro.« Jay zeigte auf die Rühreireste.
»Gut, Jerusalem, halt mich auf dem Laufenden.«
»Jerusalem«, sagte sie. Es war das alte Chefding, Mitarbeiter nicht bei dem Namen zu nennen, bei dem sie eigentlich von allen genannt wurden und genannt werden wollten.
Jay riss den Artikel aus der Zeitung und heftete ihn an die Wand. Es war das gleiche Boulevardblatt, dem er damals zum Antritt des neuen Jobs ein Interview geben sollte. Martha wollte das, positive Außenwirkung, Polizei mal ohne direkten Bezug zu einem Unglück in der Zeitung. Er kramte den Artikel aus einem der Papierstapel auf dem Schreibtisch hervor. Unsere Lieblinge hieß die Reihe, Berliner Größen aus Sport, Medien, Show und öffentlichem Leben sollten wiederum ihre Vorlieben preisgeben. Dass es auch nur einen Menschen in dieser Stadt gab, der ihn als Liebling bezeichnen würde, bezweifelte Jay, zumindest seit Sonyas Trennung. Seine angebliche Sympathie lag allein in seinem Job als Verbrechensbekämpfer in spe. Schmitt – übernehmen Sie! war die Überschrift, wie wohl bei jeder Neubesetzung eines Postens im Polizeiwesen, da waren sie nicht sehr kreativ, die Lokaljournalisten. Sein Interview war immerhin ganz gut versteckt und nicht prominent platziert. Dieser Mann bringt die Berliner Ganoven ins Kittchen: Jerusalem Schmitt (36) wird Leiter der neuen Super-Mordkommission. Darunter dann ein Fragenkatalog aus dem Poesiealbum. Lieblingsfarbe? Blau. Lieblingsland? Schweiz. Lieblingsberliner? Kurt Tucholsky. Lieblingsberlinerin? Anna Seghers. Dafür war er die Liste der Ehrenbürger durchgegangen und hatte nicht viele Frauen gefunden. Marlene Dietrich zu nennen war ihm zu einfach, Anna Seghers kannte er nicht, aber sie hatte einen langen Wikipedia-Eintrag. Lieblingsort in Berlin? Bürgerpark Pankow. Lieblingsessen? Buletten. Hier wollte Jay eigentlich Austern sagen, denn er liebte Austern, Martha wollte bei der Durchsicht des Interviews jedoch etwas Bodenständigeres. Die Polizei, dein Freund und Helfer, kurz mal ein Bulettchen, dann wieder an die Arbeit, unvereinbar mit Austernschlürfen beim Franzosen. Vorsorglich antwortete er daher auf die folgende Frage, Lieblingshobby?, mit Monopoly spielen, was glatt gelogen war, aber solide klang und Konflikte vermied. Lieblingsbösewicht? John Doe. Lieblingsermittler: C. Auguste Dupin.
»Morgen«, sagte Marcel, fegte in den Raum, legte seine Tasche auf den Schreibtisch und nahm sich den Edding.
»Nein«, rief Jay, »nicht an die Wand, ich kann nicht denken, wenn du an die Wand schreibst!«
»Ich habe eine Theorie.«
8
Herbstliebe
Wo die Liebe hinfällt war eine reichlich abgenutzte Redewendung, die auch deswegen aus der Mode geriet, da unerwartete Verbindungen heute in der Welt keine Ausnahmen mehr darstellten. Überall schwirrten Flugzeuge durch die Luft, preschten Schnellzüge über das Land, und wenn man seine Liebe dann von sich warf, konnte sie wenige Meter neben einem niederfallen, konnte aber ebenso die Maschine nach Peking treffen oder über eine Glasfaserleitung bis nach Amerika gezogen werden. Wo die Liebe hinfällt, sagte man heute kaum noch.
Wo die Liebe hinfällt, sagten die Leute noch oft, als Jeanne und Gunther jung gewesen waren. Und sie meinten die beiden.
Gunther hatte den Ausdruck immer gehasst. Sie verwendeten ihn pseudotolerant, die Tanten, Kollegen, stellten sich über die offenen Zweifler, doch markierten sie die Liebe mit ihrem Sprüchlein nicht weniger als unnormal. Alle waren sich einig, dass Gunther seine Liebe schon sehr weit hatte werfen müssen, damit sie Jeanne vor die Füße fiel.
Und Jeannes Freunde und Gefährten, die vermeintlich so viel toleranteren, sahen das nicht anders, nur andersherum, und fragten sich, wie Jeannes Liebe ausgerechnet Gunther vor die Füße fallen konnte und wieso er sie nicht pflichtbewusst aus dem Weg gekehrt hatte. Ja, die sagten sogar ebenfalls Wo die Liebe hinfällt, und so wurde die Beziehung der beiden von Gunthers Tante Edith und Jeannes Kommunarden nicht nur gleich bewertet, sondern mit derselben Redewendung belächelt. Eine Übereinstimmung, deren Kenntnis beide Seiten zu sofortiger Neuausrichtung ihrer Position veranlasst hätte. Denn zu jener Zeit galten Inhalte und Meinungen nicht viel. Wichtiger war die radikale Abgrenzung von den anderen. Tante Edith wollte mit den Krawallbrüdern ebenso wenig gemein haben wie die Kommunarden mit dem Establishment.
In der Folge verbrachten Jeanne und Gunther mehr Zeit miteinander als mit den Ihren. Gerade Jeanne dankte dem Schicksal wenige Jahre später für diese Fügung, da sie jenen blutig berühmt gewordenen Herbst vor allem mit Spaziergängen verbrachte. Sie sammelte Blätter, gelbe, dunkelgrüne, braune und manchmal rote. Nicht dass Gunther sie von einer radikalen Haltung abgebracht hätte, sie war mehr Libertin als Aktivistin. Nur waren das auch einige andere, die sie zumindest flüchtig gekannt hatte und deren Fotos sie jetzt an Laternen hängen sah. Und ja, hätte man ihr – sagen wir nach Ohnesorg – vorausgesagt, sie würde eines Tages einem Polizisten zögernd die Hand entgegenstrecken, wäre ihr Gedanke eher der einer Festnahme gewesen als der Austausch von Zärtlichkeit unter kahler werdenden Herbstbäumen.
Gunther hingegen hatte daran nie gedacht. Für ihn war Jeanne eine liebevolle Chaotin. Er fragte sich eher, ob er sich von ihrer Andersartigkeit so angezogen fühlte, weil diese ihm fehlte, oder ob Jeanne etwas auslebte, das er selbst ebenfalls in sich trug, aber nie herausgelassen hatte. Auf jeden Fall verspürte er seit Jeanne nie mehr den Druck, sich die Jeans abzuschneiden oder eine Nacht durchzumachen, Dinge, die er vorher auch nicht tat, die jedoch ganz leise anklopften. Er musste niemandem mehr etwas beweisen, Jeanne war sein Persilschein, sie entlastete ihn in allen Anklagepunkten: Durchschnittlichkeit, Spießigkeit, Konformismus. Antrag abgelehnt.
Sie zweifelten nie an ihrer Liebe. Rückblickend war es schwer zu sagen, ob es an den vielen Warnern gelegen hatte oder der allgemein aufwühlenden Zeit oder Jeannes Wunsch, noch einmal länger im Ausland zu leben. Jedenfalls dauerte es vier Jahre, bis 1979 ihr gemeinsamer Sohn das Licht der Welt erblickte. Seine Geburtskarte, die sie stolz allen Freunden und Verwandten schickten, überschrieben sie in schönster Schreibschrift fast ein wenig trotzig: Wo die Liebe hinfällt.
9
Verwunderung
Vielleicht war Pohl schwul.«
Der Stift in Marcels Hand machte Jay immer noch Angst. Wenn du jetzt schwul an meine Wand schreibst, versuchte er mit seinen Augen zu drohen.
Um den Grunewald kümmerten sich die Kollegen dort, am Westhafen werde auch noch gesucht. Da habe er schon mal weitergedacht, bezüglich Matrose und dem lila Punkt. Das sei ja doch sehr ungewöhnlich, so ein Kostüm, Sonntagabend.
Jay griff zu der Styroporschale mit den Rühreiresten. Er hatte nicht vorgehabt, da noch mal ranzugehen, jetzt schien es die angenehmste Möglichkeit, einen Dialog zu vermeiden. Man hatte ihn damals gewarnt. Die Alten, die länger dabei waren. Es war die Kehrseite der Eliteausbildungen. Wenn du dich zu sehr daran gewöhnst, mit den Schnelldenkern zu arbeiten, nur in Teams mit Superschlauen, wird es schwer zurückzukommen. Dann musst du in die Thinktanks oder zu den Profilern. Im normalen Polizeidienst war das Umfeld marceliger.
»Es gibt doch diese Schwulenpartys, wo die sich verkleiden«, fing Marcel an. Sie seien da schon ein paarmal wegen Ruhestörung gewesen, er meine sogar, sich an einen Sonntag zu erinnern, alle halb nackt, viel Lack und Leder, einige mit Masken, ganz oft Kostüme. Polizei, Uniformen, er habe auch Matrosenoutfits gesehen.
Betont genüsslich spießte Jay die letzten Rühreibrocken auf, die sich von gelb zu gelblich verblasst nicht mehr wesentlich von der cremefarbenen Schale unterschieden. Er musste sich selbst ermahnen. Schließlich forderte er von Marcel Mitdenken, Weiterdenken, the extra mile, wie sie in Coventry sagten. Und genau das versuchte Marcel gerade.
»Und da würde auch der Punkt im Nacken dazupassen, das kam doch damals bei dem Versicherungsskandal raus oder bei VW in Brasilien, dass bei so Sexpartys eine Art Farbcode verwendet wird. Mit den Prostituierten. Gibt es ja auch bei Singlepartys, Rot vergeben, Grün für alles offen. Oder so.«
Mit letztem Schaben kratzte Jay das Styropor sauber.
»Wann war die Party zu Ende?«, fragte Jay ruhig.
»Wann die Party zu Ende war?«
»Ja, wie lange wäre Pohl bei der Party geblieben?«
»Wenn er nicht getötet worden wäre?«
»Wenn er nicht getötet worden wäre.«
»Ja, weiß ich nicht, vielleicht bis Mitternacht?«
»Und dann?«
»Wie und dann?«