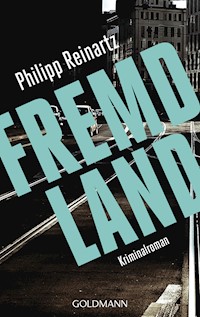
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Peng Peng. Zwei nächtliche Schüsse ins Nichts. Zwei Schüsse, die trotzdem alles verändern. Eine junge Familie aus dem Senegal glaubt nicht mehr an das neue Leben in der Fremde. Reuelose Polizisten schlagen nie wieder über die Stränge. Und die uralte Frau in der Seniorenresidenz singt keine Lieder mehr. Berlin, Du kannst so grausam sein.
Jerusalem „Jay“ Schmitt, Leiter der Neunten Mordkommission für besondere Fälle, vermutet ein düsteres Kapitel seiner eigenen Dienststelle. Für ihn beginnt alles mit einer rätselhaften Botschaft neben einer Leiche. Und endet dort, wo die Schüsse fielen. Und wieder fallen werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Peng, peng. Zwei nächtliche Schüsse ins Nichts. Zwei Schüsse, die trotzdem alles verändern. Eine junge Familie aus dem Senegal glaubt nicht mehr an das neue Leben in der Fremde. Reuelose Polizisten schlagen nie wieder über die Stränge. Und die uralte Frau in der Seniorenresidenz singt keine Lieder mehr. Berlin, du kannst so grausam sein.
Jerusalem »Jay« Schmitt, Leiter der Neunten Mordkommission für besondere Fälle, vermutet ein düsteres Kapitel seiner eigenen Dienststelle. Für ihn beginnt alles mit einer rätselhaften Botschaft neben einer Leiche. Und endet dort, wo die Schüsse fielen. Und wieder fallen werden?
Informationen zu Philipp Reinartz sowie zu lieferbaren Titeln des Autors finden Sie am Ende des Buches.
PHILIPP REINARTZ
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Januar 2019 Copyright © 2019 by Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur München Umschlagfoto: Felix Kayser / EyeEm / getty images Redaktion: Gerhard Seidl BH • Herstellung: kw Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-19872-5V002 www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
1 – Plastikbaken
Und das war dann also Deutschland. Eine Leierkastenfrau mit Handpuppe, ein Stand mit russischen Offiziersmützen und ineinander schachtelbaren Holzfiguren, dazwischen alte, dickbäuchige Männer, die mit großen Kameras das Brandenburger Tor filmten. Und alle wirkten sie unzufrieden. Den Holzfigurenmann nervte die Leierkastenfrau, die Leierkastenfrau nervte der Holzfigurenmann, die Rentner nervte die Sonne, und noch viel mehr nervten alle die Baustellen. Ganz Berlin war eine Baustelle. Kräne ragten aus unfertigen Betonskeletten, Bauwagen standen vor riesigen Gerüsten. Presslufthämmer, Bagger – die Leute hielten sich die Ohren zu oder gingen hustend durch Staubwolken.
Nur Mouhamadou Diallo lief durch die Straßen, durch Lärm und Staub, und lächelte.
Er hatte sich Deutschland in den letzten Monaten immer wieder vorgestellt, auf dem Schiff nach Dakar, im Auto nach Nouakchott, später in Marokko, in Spanien. So hatte er sich sein eigenes Deutschlandbild gemalt. Das echte Deutschland stand ihm dafür nur kurz Modell, in einem Fernsehbericht über den Berliner Reichstag, und nicht einmal da sah man viel, das Gebäude war für irgendeine Kunstaktion vollständig verhüllt worden. Mos Deutschland entstand in seinem Kopf. Und war vor allem eines: fertig. Ein fertiggestelltes Land, ausgebaut, komplett, alles an seinem Platz. Er dachte an blitzblanke Bürgersteige, Glasfassaden, Menschen in Anzügen, weiße Mauern und Werbeplakate. Das war es, worauf Mo sich freute. Das war es, wovor Mo Angst hatte. Es war wie früher, als sie, noch Kinder, in jeder freien Minute Hütten bauten. Ein Abenteuer, ein herrlicher Spaß, der für ihn genau dann endete, wenn es nichts mehr zu tun gab, wenn die Hütte fertig war. Er wurde Fertigmacher, er wurde Maurer. Und so hatte Mo auf seiner langen Reise gefürchtet, dass Deutschland ihn nicht brauche, weil Deutschland ja schon fertig war.
Jetzt lief er durch die Straßen Berlins und genoss seinen Irrtum. Das Deutschland, das ihn empfing, hatte gar keine Zeit, ihn zu empfangen. Das Deutschland baute und baggerte und zeigte auf großen Schildern vor den Baustellen durchaus präzise, wie blitzblank-glasfassadig-fertig es einmal sein werde. Nur eben noch nicht jetzt. Wenn Mo kurz die Augen schloss und an Deutschland dachte, sah er keine sauberen Bürgersteige mehr. Er sah rot-weiß gestreifte Plastikbaken, in dunklen Fußplatten verankert, mit kreisrunden gelben Lampen, die absperrten und umleiteten und dem Maurer aus der Casamance Hoffnung machten. Während alte, dickbäuchige Männer mit großen Kameras sie möglichst nicht im Bild haben wollten.
Als Erstes, sagte sich Mo, als Erstes brauchte man eine Arbeit. Das würde so schwer nicht werden. Er konnte Französisch, ein bisschen Englisch, er würde an jeden Bauwagen klopfen, Nächte durcharbeiten, in Vorleistung gehen, alles. Als Zweites brauchte man ein Auto. Er hatte noch nie ein Auto besessen, und er hatte schon lange das Foto im Kopf, das er in die Heimat schicken würde, mit ihm und den Frauen. Er am Steuer, Aissa auf dem Beifahrersitz, die kleine Marième auf dem Schoß.
Als Zweites brauche man natürlich kein Auto, als Zweites brauche man ein richtiges Zuhause, entgegnete Aissa, wenn sie darüber sprachen. Nicht nur ein Dach über dem Kopf, ein richtiges Zuhause.
Mo lachte, als er daran dachte. Er liebte sie. Er liebte ihre Stärke. Aissa hatte ihren eigenen Kopf, und ohne den wären sie hier niemals angekommen. Während sie in Dakar auf den mauretanischen Transporter Richtung Rosso warteten, hatten sie einen Film gesehen. Living in Bondage, ein Kultfilm der jungen nigerianischen Filmindustrie. Ein Mann opfert seine Frau und wird anschließend von ihrem Geist verfolgt, bis er unter der Brücke landet. Dazwischen noch irgendwas mit Satan, sexueller Belästigung und am Ende evangelikalen Christen, aber das hatten sie beide nicht verstanden und spielte Aissas Meinung nach für die Hauptaussage des Films keine Rolle. Ein Mann opfert seine Frau und wird anschließend von ihrem Geist verfolgt, bis er unter der Brücke landet. So sehe es nämlich aus, hatte Aissa gesagt, das solle er nicht vergessen.
Nein, das würde Mo nicht vergessen, dachte er, während er die Friedrichstraße nach Norden ging, während er nur Chancen sah, rechts und links, rot-weiß gestreift. Sie würden zusammen sein, noch viele Jahre, sie würden sich hier etwas aufbauen und ein Auto kaufen und ein Foto der Familie im Auto in die Heimat schicken.
Mouhamadou Diallo lag falsch.
2 – Heimkehr
Jay, mein Junge! Endlich, mein kleiner Sturkopf.« Jeanne umarmte ihren Sohn und schwenkte ihn wie ein Pendel hin und her. Sie rief nach Jays Vater, aber niemand kam zur Tür. »Meine beiden kleinen Sturköpfe. Widder und Stier.« Sie ballte ihre Hände zu Fäusten und rieb sie mit verbissenem Gesicht aneinander. Erleichtert lachte sie.
Jerusalem Schmitt war seit damals nicht wieder hier gewesen, seit dem Fall im Frühsommer. Es war merkwürdig, er war hier groß geworden, kannte jeden Zentimeter des Hauses, des Gartens, und doch saß er jetzt am großen Esstisch und fühlte sich fremd zwischen den Schälchen, den duftenden Dämpfen, saß entfremdet dem Mann gegenüber, der ihn das ganze Essen über nicht ansah. Aus Wut? Aus Scham?
»Lorbeer erstaunt mich immer wieder. So ein kleines, hartes Blatt, staubtrocken, und gibt doch so viel Geschmack ab.«
Jays Mutter war die Einzige, die sich um das Tischgespräch bemühte. Die Normalität wollte. Sie hatte noch mehr gekocht als sonst und noch besser, der Fischeintopf war hervorragend.
»Mhm«, meinte Jay.
Sein Vater nickte.
»Bist du denn die letzten Wochen ein bisschen zur Ruhe gekommen? Das war ja … eigentlich müssten die dir einen Urlaub bezahlen, der ganze Stress, die Anspannung, das ist ja auch nervlich …«
»Ich war gerade zwei Wochen raus.« Jay legte die Gabel ab und griff zu seinem Weinglas. Das Gesicht seiner Mutter machte ihm deutlich, dass ihr diese Antwort nicht genügte. »Engadin, zum Runterkommen.« Noch immer nicht. »Alleine.«
Sie seufzte. Sie wünschte sich Sonya zurück oder irgendjemanden. Mitte dreißig, da musste man doch langsam … Muttersorgen, Jay kannte das. Aber es gab niemanden. Und nie war Jay weiter davon entfernt als jetzt. Er hatte sich eine Ohrfeige gefangen, sich aufgerafft, die nächste hinterherbekommen. Er hatte auf die Falschen gesetzt, aus ganz unterschiedlichen Gründen waren beide die Falschen gewesen. Die eine stand plötzlich nicht mehr auf Männer. Die andere stand mit einem Bein im Gefängnis, bevor Jay sie richtig kennenlernen konnte. Und es kam ihm fast ironisch vor, dass in der Zeitung und beim Sommerfest des Dezernats, dass überall sein guter Riecher gelobt wurde, mit dem er Berlins grausamste Mordserie beendet habe, mit dem er vor ein paar Monaten dem irren Serienkiller auf die Schlichegekommen sei. Sein guter Riecher – bei der Damenwahl hatte er sich mehrfach vertan.
Als seine Mutter irgendwann aufstand, halb leere Schalen stapelte, stand Jay auch auf, wollte ihr helfen, sie drückte ihn wieder auf seinen Stuhl zurück.
»Nein, die Küche mache ich, ihr sprecht euch jetzt endlich mal aus.« Ohne eine Reaktion abzuwarten, verließ sie das Wohnzimmer.
Ob sie überhaupt wusste, was zwischen ihm und seinem Vater los war? Oder hatte er gar nichts gesagt, schon wieder, der verschwiegene Gunther?
Wie damals, in den Neunzigern, als Polizeiobermeister Gunther Schmitt seinen Namen heimlich aus einer Ermittlungsakte entfernen ließ. Eine Akte, die Jahre später, kürzlich erst, für Jay aktuell wurde. Und deren Manipulation beinahe Menschenleben gekostet hätte.
»Ich habe nachgedacht …« Jays Worte blieben einige Sekunden stumm im Raum stehen. »Ich glaube dir.«
Gunther saß inzwischen leicht seitlich vor dem Tisch, den einen Ellenbogen auf der Platte, die Beine übereinandergeschlagen, führte das Bierglas zum Mund und nahm einen langen Schluck.
»Was glaubst du mir?«
»Die Geschichte vor zwanzig Jahren.«
Die Sache mit der Akte. Gunther hatte damals zu Protokoll gegeben, als Streifenpolizist Zeuge einer Vergewaltigung geworden zu sein. Der Täter wurde angeklagt, verlor Job und Familie, beschwor seine Unschuld. Vergeblich. Dann drehte der Mann durch und tötete. Gunthers Aussage hatte eine Tragödie ausgelöst.
»Ich glaube dir«, sagte Jay, »dass du nichts davon wusstest. Dass du dich getäuscht hast, wie sich jeder Polizist einmal täuschen kann.«
Denn die Vergewaltigung war keine Vergewaltigung gewesen. Das Opfer hatte gespielt, es war eine Inszenierung, eine Intrige mit dem Ziel, einen Menschen zu brechen. Und das hatte geklappt. Bis vor wenigen Monaten, Jahre nach der Tat, jemand dahintergekommen war. Jemand, der Rache wollte. Jemand, der nicht wie Jay glaubte, dass Gunther sich getäuscht hatte. Dass er erst im Nachhinein Selbstzweifel bekam, Angst, etwas falsch gemacht zu haben, und seinen Namen nur aus der Akte verschwinden ließ, um nichts mehr mit dem Fall zu tun zu haben. Jemand, der Jays Vater stattdessen für einen Mitwisser, für Teil des Komplotts hielt. Der Jays Vater beinahe umgebracht hatte.
»Ja, man kann sich täuschen in den Leuten.« Gunthers selbstsicherer Ton überraschte Jay. »Manche sind viel harmloser, als man denkt. Andere hält man für harmlos, und dann …«
Jay wurde klar, auf wen Gunther anspielte. Die Frau, der Jay vertraut und der er die Geschichte von der Vergewaltigung erzählt hatte. Er hatte sie bedenkenlos an seinen Vater herangelassen, nicht wissend, wie wenig auch sie an Gunthers Unschuld glaubte. Am Ende war Gunther mit einer Waffe bedroht worden.
»Sie hatte allen Grund, dir nicht zu glauben.«
»Sie hat mich fast umgebracht, deine Freundin!«, schrie Gunther und ließ das Bierglas dumpf auf dem Holz des Tischs aufschlagen. In der Küche verstummte der Wasserhahn. »Lass uns draußen … ich will nicht, dass Jeanne …«
Gunther stand auf und ging zur Terrassentür. Natürlich hatte er Jays Mutter nichts erzählt. Wie Gunther seiner Familie damals auch nichts von dem Vergewaltigungsfall erzählt hatte. Der ihn auffraß, der ihm Schuldgefühle machte. Den er einfach nur vergessen wollte, auslöschen, so sehr, dass er tat, was nicht in Ordnung war.
»Ein Polizist zeigt eine Vergewaltigung an, lässt dann aber heimlich seinen Namen aus der Strafakte verschwinden. Hält die Klappe, als der Fall Jahre später wieder heiß wird und sogar der eigene Sohn die Mordkommission leitet. Was hätte sie denn denken sollen?«
Die beiden liefen über die symmetrisch verlegten Steinplatten der Terrasse Richtung Garten. Gunther vorn, ohne sich umzudrehen.
»Wer? Deine Freundin?«
»Das war nicht meine Freundin.«
Sie waren am Gartenhaus angekommen, Gunther zog hinter Jay die Tür zu. Die Werkbank, die beschrifteten Fächer und Halterungen. Hier war es gewesen. Hier hatten sie zu dritt gestanden, Jay, Gunther und die Frau mit der Waffe.
»Dann hast du sie ja hoffentlich festgenommen«, sagte Gunther.
Jay schwieg.
»Versuchter Mord. Ganz zu schweigen von Mitwisserschaft einer Straftat.«
Jay war noch immer ruhig.
»Du deckst sie? Du deckst die Frau, die deinen Vater umbringen wollte?«
Jays Schweigsamkeit schien Gunther nicht zu irritieren. Er musste damit gerechnet haben, dass Jay sie laufen gelassen hatte.
»Du machst da etwas hochgradig Illegales, Strafvereitelung im Amt.«
Darum ging es. Jays Vater hatte nicht nur damit gerechnet, sondern es sich eigentlich gewünscht. Damit er Jay genau das vorwerfen konnte. Sich nicht korrekt verhalten, rechtswidrig gehandelt zu haben. Damit Gunther nicht der Einzige war.
»Genauso illegal, wie seinen eigenen Namen aus einer Strafakte verschwinden zu lassen«, flüsterte Jay.
»Dann sind wir ja quitt.« Gunther stützte sich mit beiden Händen an der Werkbank ab.
Natürlich waren sie nicht quitt. Jay hatte einem traumatisierten Mädchen das Gefängnis erspart. Sein Vater hatte die Ermittlung in einem Mordfall behindert und mehrere Menschen durch sein Schweigen in Lebensgefahr gebracht. Und ja, er, Jay, glaubte Gunther zwar, dass er das damals wirklich für eine Vergewaltigung gehalten hatte. Dass er den Namen nur aus der Akte löschen wollte, um mit der Sache abzuschließen. Andere würden das nicht so sehen. Würden Gunther verdächtigen, da mit dringehangen zu haben.
»Nein, sind wir nicht«, sagte Jay. »Du kannst viel tiefer fallen.«
Gunther lachte auf.
»Bist du sicher? Du sitzt viel höher als ich.«
Da mochte sein Vater recht haben. Jay stand als Leiter der neu gegründeten Neunten Berliner Mordkommission für besondere Fälle im Fokus der Aufmerksamkeit. Gerade nach dem erfolgreich aufgeklärten ersten Fall. Gunther war Polizeiobermeister im Ruhestand.
»Wir sollten es nicht darauf ankommen lassen. Ich versuche, dich da rauszuhalten, aber du musst mir die Wahrheit sagen.«
»Was für eine Wahrheit?«, fragte Gunther. Er stand noch immer unbeweglich vor der Werkbank. In seinen Brillengläsern spiegelte sich die lose von der Decke hängende Glühbirne.
»Wer hat das mit der Akte gemacht?«
»Was meinst du?«
Gunther hätte einfach einen Namen nennen können. Keine ausweichende Gegenfrage. Dann hätte Jay nicht sagen müssen, was er lieber nicht sagen wollte.
»Du warst ein einfacher Polizist. Du hattest keinen Zugang zum Archiv unseres Dezernats. Wer hat das für dich gemacht?«
Gunther wirkte auf einmal wieder nervös.
»Jay, das ist … ich kann das nicht.«
»Ich helfe dir nur, wenn ich weiß, was damals passiert ist.«
Gunther sah auf den Boden. Das Licht war von seiner Brille gewichen, warf nun einen hellen Kreis auf seine Stirn.
»Das war ja gar nicht meine Idee. Da kam dieser Kollege, den ich kontrolliert hatte, Alkoholfahrt. Der hat das vorgeschlagen, angeboten. Gefallen gegen Gefallen. Aber das waren an dem Tag auch besondere Umstände …«
»Wie hieß der Kollege?«, unterbrach Jay seinen Vater schroff. Gunther blickte unsicher auf.
3 – Platzangst
Wenn es Abend wurde, wenn Marième in ihrem Zimmer zum Einschlafen Kassetten hörte, und Mo, der endlich eine Arbeit gefunden hatte, noch nicht heimgekommen war, dann durfte Aissatou Diallo weinen.
Weil sie unsicher war, ob sie hier glücklich werden konnte, in einem fremden, kalten Land. Weil sie Mo nicht mehr fröhlich sah, seit er sich weiter und weiter in sich zurückzog. Weil sie die Casamance vermisste, die satte grüne Landschaft, die so anders war als das Bild, das sich die Welt von Afrika machte. Und weil sie mit ihren siebenundzwanzig Jahren nicht wusste, ob sie jemals wieder ihre Mutter umarmen würde. Die Lösung schien auf den ersten Blick einfach. Raus aus dem kalten Land, in die grüne Landschaft, zu Maman. Doch obwohl es im Widerspruch zu all ihren anderen Sorgen stand, war genau das ihre größte Angst: zurückkehren zu müssen. Denn das hieße auch: zurück zwischen die Fronten einer Armee und einer Rebellengruppe, denen beiden der Tod der anderen egal war und die den eigenen Tod bedenkenlos riskierten.
Ihre Angst, zurückkehren zu müssen, war nicht unbegründet. Die ersten Wochen hatte sie es gar nicht wahrgenommen, war überwältigt vom großen Berlin. Sie hatten eine unendliche Reise überstanden und einfacher als gedacht einen Schlafplatz gefunden. Eine kleine verwinkelte Wohnung in einem besetzten Haus, in Berlin kam jeder irgendwo unter. Erst als sie zufällig auf eine Demonstration stieß, die Schilder sah, auf denen Whites only? und Against Police stand, erschrak sie. Sie sprach einen der jungen Demonstranten an, er trug eine Lederjacke, sah sympathisch aus. Er konnte Französisch und erzählte ihr von einem Gesetz, nach dem Schwarze und Migranten an bestimmten Orten in der Stadt keine Rechte hätten. Gefährliche Orte nannten sie es. Eine große Partei, die des dicken Kanzlers, Aissa erinnerte sich nicht mehr an die Buchstabenkombination, wolle sogar die ganze Stadt als gefährlichen Ort deklarieren. Woher sie denn komme, fragte der Mann. Oh, Senegal, schwierig. Die Regierung habe den Staat zwar gerade von der Liste der sicheren Herkunftsländer gestrichen. Aber nur vorübergehend, in ein paar Monaten solle das wieder rückgängig gemacht werden.
Aissa schüttelte den Kopf. Diese Deutschen. Während deren größte Sorge – eine Nachbarin übersetzte ihr manchmal die Titelblätter der Boulevardzeitungen – die Lautstärke irgendeiner Musikparade in der Hauptstadt war, machten sie Listen von Ländern, die sie sicher fanden. Und setzten da ein Land darauf, in dem wenige Tage vor ihrer Ausreise ihr Grundschullehrer mit Plastik verbrannt in einer Baracke gefunden worden war, in einer offenen Wunde am Hals drei ausgedrückte Zigaretten.
Die Demonstration verstörte sie. Sie wollte dem jungen Mann nicht glauben. Am nächsten Tag, als Mo wieder losgezogen war, nahm sie Marième an die Hand und ging mit ihr los. Lief entschlossen und ohne Angst zum Alexanderplatz, einem der Plätze, von denen der Demonstrant ihr erzählt hatte, überquerte ihn, lachte, blieb vor einem Elektronikgeschäft stehen und blickte auf den Platz. Sie hatte sich aus der afrikanischen Provinz bis in die deutsche Hauptstadt gekämpft, so leicht würde man sie nicht mehr los. Sie ging mit Marième zu der Säule mit den Uhrzeiten der Welt, niemand hinderte sie daran. Dann in Richtung der S-Bahn-Station. Dort sah sie die Polizei schon aus der Ferne, ließ sich nicht irritieren, lief stolz über die Pflastersteine – und hörte die Stimme. Stopp, so viel Deutsch verstand sie, dann folgten unfreundlich fremde Laute. Der Alexanderplatz war voll. Alte, Junge, Frauen, Männer. Aber sie wurde angehalten, wurde auf Englisch gefragt, was sie mache. Jemand griff nach ihrer Tasche, sah hinein, ohne zu fragen, drückte sie ihr unsanft zurück in die Hand. Aissa blieb stark, sagte nichts, zitterte nicht, packte die Hand ihrer Tochter noch fester als vorher und ging nach Hause.
Und auch da bewahrte sie Haltung, malte mit der Kleinen, hörte eine der deutschen Kinderkassetten, von denen sie kein Wort verstand, machte ihr das Abendessen. Sie dachte an den Spruch, den ihre Mutter immer gesagt hatte. Aissa wusste nicht, ob es eine Volksweisheit war, ein Dichterzitat oder einfach dem Geist Mamans entstammte: Der Starke ist nicht stärker als der Schwache. Er weiß nur, wann er stark sein muss.
Als Marième im Bett war, ging Aissa ins Badezimmer, stellte sich vor den Spiegel, knotete das gelbbraune Kopftuch auf, legte die Ohrringe ab, machte den Wasserhahn an, sah in ihr Gesicht, ihr stolzes, unverwüstliches Gesicht. Und begann zu weinen. Heulte, schluchzte, ließ für ein paar Minuten alles raus. Sah sich dabei immer wieder an, wollte sich weinen sehen im Spiegel. Sie hasste den Anblick, und es gab ihr Stärke, half ihr, in anderen Situationen die Haltung zu bewahren. So verletzlich durfte nur sie sich sehen, so sollte niemand anderes sie sehen können.
Es dauerte nie lange, fünf Minuten, manchmal zehn. Dann reichte es ihr. Dann drehte sie den Hahn zu, tupfte sich das Gesicht trocken, griff nach ihren Ohrringen, wickelte das Tuch um die Stirn und verließ das Badezimmer. Wenn Mo nachher nach Hause kommen würde, traurig oder schlecht gelaunt wie die ganzen letzten Wochen, schweigend über seine Arbeit auf dem Bau, würde sie wie immer seine Aissa sein, seine Stütze und sein Sonnenschein, die ihn aufbaute und von besseren Zeiten erzählte und ihm das von Marième gemalte Bild neben die Suppe legte. Alles hatte seine Zeit.
4 – Fragezeichen
Jay hatte die Keithstraße in den letzten beiden Wochen nicht vermisst. Er ging entlang der groben Steinfassade bis zum Eingang, nickte dem Pförtner zu, nahm routinemäßig den linken Treppenaufgang mit der Gedenktafel der im Ersten Weltkrieg verstorbenen Polizisten, verzichtete auf den Aufzug, fragte sich wie jedes Mal, wie lange sie eine Renovierung der Flure und Treppen noch vor sich herschieben wollten, wurde von zwei flüchtig bekannten Kollegen wissend gegrüßt, lief endlich auf die Tür zu dem Flügel zu, den sie für die Neunte Mordkommission freigeräumt hatten. Es war einfacher geworden, das Grüßen. Das wissend Gegrüßtwerden. Es war schon länger so, dass viele, die Jay kaum kannte, ihm ahnungsvoll zunickten. Aber inzwischen aus anderem Grund. Bis vor ein paar Monaten war er der Kommissar, der etwas mit einer Kollegin gehabt hatte, bis diese ihn für eine Frau verließ. Jetzt war er der Kommissar, der mit einer neu gegründeten Spezialeinheit eine Mordserie aufgeklärt hatte. Zumindest hoffte Jay bei jedem Nicken auf diesen Imagewandel.
»Tock, tock«, sagte er und klopfte an den Rahmen der offen stehenden Tür des Konferenzraums.
»Jay!«
Das Team saß um einen großen Tisch. Handschriftliche Notizblätter, ausgedruckte Mails und sechs Kaffeetassen deuteten auf eine Mischung aus Case Team Meeting und langem Frühstück hin. Es war ruhiger geworden. Seit dem Fall im Frühsommer kamen nicht viele ungewöhnliche Morde rein. Fast alles Bekanntsachen, wie sie hier sagten, Fälle, bei denen der Täter quasi auf der Leiche saß, zumindest aber leicht zu ermitteln war. Und selbst die Unbekanntsachen waren eigentlich zu gewöhnlich für Jays Abteilung. Raubmorde, Unfälle mit Fahrerflucht, nichts Ungewöhnliches.
»Ich habe euch was mitgebracht«, sagte Jay und stellte einen bunten Karton auf den Tisch. »Engadiner Nusstorte, passend zu eurem Kaffeekränzchen hier.«
»Kaffeekränzchen? Wir sind noch mal die letzten …«
»War Spaß, Marcel.«
Jays Vertreter sah auf die Uhr und kündigte der Runde eine viertelstündige Pause an. Dann mache man mit der Neunzehn-Zwo weiter. Und ob er Jay einmal kurz sprechen könne?
Sie gingen gemeinsam in den Spiegelsaal. Den extra für die neue Mordkommission eingerichteten Verhörraum, fensterlos, mit verspiegelter Scheibe. Den Raum, den die Dezernatsleitung wohl als Vorzeigeprojekt für die neu geschaffene Mordkommission angedacht hatte. Der aber im Bürgeramtsflair seiner Umgebung merkwürdig lächerlich wirkte. Und der Jays Einheit noch mehr von den anderen abhob, was ihm eher unangenehm war, trug er als international ausgebildeter Ermittler doch ohnehin den oft lästigen Elitestempel auf der Stirn. Vor allem aber hatte der neue Raum das für Jay vorgesehene Einzelbüro verdrängt. Er sollte mit seinem Stellvertreter Marcel zusammensitzen und dafür war er, jenseits allen Elitegehabes, einfach nicht gemacht. Er brauchte Ruhe, er brauchte das Gefühl eines ihm zugedachten Raums, zum Nachdenken, zum Vordenken. In einem Zweierbüro bewegte sich zu viel, auch wenn es nur die Augen des Kollegen waren. Und deswegen wurden die Verhöre weiterhin in den Befragungszimmern mit Schreibkraft durchgeführt, im Spiegelsaal stand Jays Schreibtisch, und dort war seine Hinweiswand.
»Schweiz war gut?«, wollte Marcel wissen.
Jay erwähnte kurz die Sonne, das Essen, bisschen abgeschaltet. Schön, schön. Innerhalb weniger Sekunden war der Informationsgehalt einer Urlaubspostkarte übermittelt.
»Und hier?«
»Ich … ich bin endlich mal dazu gekommen, alles für den Abschlussbericht zusammenzustellen.«
Als Jays Vertreter war Marcel Schriftführer.
»Und, alles fertig?« Jay merkte, wie zögerlich Marcel wurde.
»Es gibt immer noch keine Erklärung, warum der Vordruck 95 in der Akte fehlt. Die Anzeige, die dein Vater nach der Vergewaltigung erstellt hat.«
Ausgerechnet jetzt wurde Marcel zum Fleißarbeiter. Der Fall schien ihn beflügelt zu haben, auch Jays Kritik damals. Die ganzen letzten Wochen machte er mehr als früher, zeigte sich, war den anderen gegenüber präsenter. Alles gut, nur bei diesem einen Punkt wünschte sich Jay den alten, einfachen Marcel zurück.
»Schlamperei. Schau dir das Archiv da unten doch an. So chaotisch sah es früher bei uns nur bei der Schulbuchausgabe aus. Die Anzeige wurde da nie abgeheftet.«
»Ich dachte nur … kannst du nicht vielleicht noch mal mit deinem Vater reden?«
»Marcel …«
»Ob er irgendeine Idee hat?«
»Ich habe mit ihm gesprochen, gestern erst.« Jay ließ sich keine Nervosität anmerken. »Er kann es sich selbst nicht erklären.«
»Und auch das mit der Waffe …«
Die Scheißwaffe. »Was?«
»Die Spurensicherung sucht den ganzen Tatort ab, findet die Waffe des Täters nicht. Und am nächsten Tag liegt sie doch dort?«
Ja, Marcel, weil die Frau, der ich vertraut habe, die Waffe vom Tatort verschwinden ließ und damit meinen Vater bedrohte. Und weil ich sie danach trotzdem nach Hause gefahren und diese Scheißpistole wieder zum Tatort gebracht habe. In Gedanken formulierte Jay die Antwort, die er nicht geben durfte.
»Die SpuSi ist halt nicht perfekt. Wir haben in dem Fall am Anfang auch Fehler gemacht.«
Zufrieden schien Marcel mit Jays Erklärungsversuchen nicht zu sein. Einen Moment redete keiner. Sie brauchten bald einen neuen Fall, dachte Jay, dann wäre Marcel beschäftigt. Dann könnte er sich da beweisen und die alte Geschichte ruhen lassen. Um die würde sich Jay schon allein kümmern.
»Na ja, vielleicht können wir den Abschlussbericht ja heute Nachmittag noch mal zusammen …«
»Heute Nachmittag ist schwierig, da treffe ich einen Kollegen.« Es war nicht gelogen. Jay dachte an den Zettel in seiner Hosentasche. Gunther hatte ihm den Namen buchstabiert.
5 – Tempelhof
Dezernat 42, Sonya Mainitz. Jay starrte auf das Türschild. Sie könnte ihm bestimmt weiterhelfen, wüsste, ob es den hier noch gab.
LKA 4, am Tempelhofer Damm, zwanzig Minuten hatte er vom Morddezernat mit dem Auto gebraucht. Hier arbeitete sie seit der Trennung. Seit sie plötzlich nicht mehr das Paar der Dritten Mordkommission waren. Sie, die junge Analystin, er, der junge Ermittler. Seit Sonya nur noch die Lesbischgewordene war und Jay der dafür Verlassene. Sie hatte vorher schon an einem Querschnittsprojekt mit mehreren LKA-Abteilungen gearbeitet, einer Software zum Predictive Policing, mit der sie Straftaten durch gesammelte Daten vorausahnen und verhindern wollten. Hatte dadurch viel mit dem LKA 4 zu tun, wo sie Organisierte Kriminalität, Banden, Eigentum und Rauschgift machten. Nach der Trennung ließ sie sich hierherversetzen. Inzwischen war ihr Verhältnis okay. Für den Fall im Frühsommer hatten sie Sonya sogar wieder ins Team geholt. Die Dezernatsleiterin hatte es Jay anschließend freigestellt, ihr eine Stelle bei der Neunten zu schaffen. Aber Sonya und er waren übereingekommen, dass es so besser sei. Sie hier, er da. Man könne ja trotzdem im Einzelfall … temporär … na klar, kein Problem, jederzeit gerne.
Jay drehte sich weg von der Tür und ging den Flur entlang. Sie hätte ihm auf jeden Fall geholfen. Aber er hatte gar nicht vorgehabt, zu ihr zu gehen. Er wollte sie nicht noch weiter reinziehen. Es war schon genug verlangt, dass Sonya sich ruhig verhielt. Sie war die Einzige, die von Gunthers Fehltritt wusste. Sie hatte es sogar herausgefunden, die Sabotage der Akte.
Jay stand inzwischen vor einer anderen Tür im LKA 4. Dezernatsleitung. Er sah noch einmal auf den Zettel mit dem Namen, übte flüsternd den ersten Laut, Grze, Grze. Dann klopfte er an die Tür.
»Ja«, hörte Jay und trat ein. Ein vielleicht fünfzigjähriger Mann mit hellblauem Hemd, himmelblauer Krawatte und schwarzem Sakko saß hinter einem Eckschreibtisch.
»Sie sind Steffen Bäumert?«
»Ich bin Steffen Bäumert«, sagte der Mann und sah Jay durch seine rahmenlose Brille an. »Und Sie sind …?«
»Jerusalem Schmitt, Kollege von der Neunten …«
»Ahhh, Herr Schmitt, ja, den Namen hat man jetzt mal gehört …« Bäumert lachte freundlich und reichte Jay die Hand. »Das war ja ein richtiger …«, Bäumert zögerte, weil er den Satz zu schnell begonnen hatte, jetzt fehlte ihm ein passendes Wort, »Schuss«, sagte er dann und schien seine etwas schiefe Wendung selbst zu bemerken.
»Jaja«, antwortete Jay, »ein ruhiger Start in den Job war es auf jeden Fall nicht.«
Er sah Bäumert in kakifarbener Cargohose, Weste und Kurzarmhemd und mit knallrotem Gesicht vor einer Tempelruine stehen. Nicht in Gedanken, sondern auf dem Bild im Rahmen neben dem Computer. Vater, Mutter, Kind, Kind, Kind.
»Was führt Sie zu mir?« Bäumert deutete auf den Stuhl vor dem Schreibtisch.
Jay setzte sich. »Nichts Großes, es ist eher eine private Sache. Die letzten Wochen sind ruhiger, da ist auch mal wieder Zeit für persönliche Angelegenheiten. Dieter Grzesinski arbeitet nicht mehr hier, oder?«
»Grzesinski?«, stieß Bäumert mit heller Stimme freudig aus. »Lange nicht mehr, der müsste über siebzig sein.«
»Aber der saß mal hinter Ihrem Schreibtisch?«
»Ja, jahrelang. Ich bin sein Nachfolger.« Bäumert lehnte sich nicht in seinen Stuhl zurück, saß aufrecht vor dem aufgeräumten Schreibtisch. »Kennen Sie ihn?«
»Indirekt. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten.«
»Ach so.« Bäumert nickte.
»Ich müsste mit ihm sprechen und finde keine Kontaktdaten. Wissen Sie, wie ich ihn erreichen kann?«
»Ähhh …« Bäumert überlegte. »Schwierig auf jeden Fall. Der sitzt glaube ich seit Jahren in seiner Hütte am See.«
»Mail? Telefon?«
»Damals meinte er, dass er das alles lassen will.«
»Und wo ist die Hütte?«
Auf dem Rückweg durch das große Gebäude lief Jay so, dass er noch einmal an Sonyas Büro vorbeikam. Am liebsten hätte er doch geklopft, hätte ihr davon erzählt, von dem kleinen Deal zwischen seinem Vater und dem LKA-Mann. Dem Deal, den er versuchte nachzuvollziehen. Sie war emotional inzwischen ganz weit weg von ihm, kein Objekt von Sehnsucht oder Nostalgie, nur eine nicht verheilte Wunde. Aber er spürte ein Vertrauen, oder besser, eine Vertrautheit, die er so mit keinem anderen Menschen je gehabt hatte. Das war nicht weggegangen, das ließ sich nicht beenden durch eine Trennung. Man konnte sich hassen oder nichts mehr miteinander zu tun haben wollen oder wie in seinem Fall tief gekränkt sein. Ein blindes Verständnis, ein Nur-ein-Blick-von-dir-und-ich-wusste-genau-Gefühl würde immer weiter bestehen. Und in dieser Hinsicht, und nur in dieser, vermisste er Sonya sogar.
Einige Stunden später, während Jay beim Polizeisport mit zwei Hanteln auf den Schultern immer wieder in die Knie ging und aufstand, kam ihm der Gedanke noch einmal. Dass er Sonya vermisste. Bisher hatte er sich das nie eingestehen können. Und es stimmte ja auch nur halb. Der Verlust von Sonya als Partnerin war das eine, das Unumstößliche, der dicke, fette Filzstiftschlussstrich. So schlimm und überraschend es für ihn gewesen war, damit konnte Jay umgehen. Es war aus und vorbei. Über den Verlust von Sonya als Freundin, als Seelenverwandte kam er hingegen viel schwieriger hinweg. Die ganzen Jahre hatte es nur sie beide gegeben. Nicht, dass Jay keine Interessen gehabt hätte. Er sah gerne gute BBC-Dokumentationen, mochte karge Landschaften mit wenig Trubel, las Bücher über Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung, mochte es, sich mit anderen zu messen. Aber alles war immer mit Sonya. Mit ihr saß er vor dem Fernseher, mit ihr plante er die Fahrradtour durch die Sierra Nevada, mit ihr unterhielt er sich stundenlang über Grundformen der Angst, Fritz Riemanns tiefenpsychologisches Meisterwerk. Je mehr er sich Sonya öffnete, desto mehr verschloss er sich anderen. Neue Freundschaften, die über gerade im Großstadtleben überall anzutreffende Bekanntschaften hinausgingen, hatte Jay in der Zeit ihrer Beziehung praktisch keine geknüpft.
Auch hier nicht, wo er mindestens dreimal die Woche hinging, um sich für seinen Job fit zu halten. Wie er seinen Blick schweifen ließ, sah er fast nur Gruppen, zumindest Grüppchen, zumindest nebeneinander trainierende, die sich zwischen ihren Sätzen unterhielten. Ständig wurde irgendwo gelacht. Er selbst hatte Kopfhörer im Ohr, meistens sogar ohne Musik, mehr als Mittel zum Zweck, um eben nicht angesprochen zu werden. Und gleich würde er noch beim Thailänder vorbeigehen, die Rindfleischstreifen in Austernsauce mitnehmen und allein auf der Couch die Arktis-Dokumentation fertig schauen. Ohne mit irgendjemandem über die Rückkehr ins Büro, den Besuch bei Bäumert, die Kniebeugen, das Fleisch oder die Unterwasseraufnahmen zu sprechen. Alles machte er mit sich allein aus. Mit zitternden Oberschenkeln kämpfte sich Jay ein letztes Mal aus der Hocke nach oben und warf die Hanteln tief ausatmend von den Schultern.
6 – Fleißhände
Mo hatte bereits den Blinker, die Hupe und das Nebellicht betätigt, bis er endlich den Scheibenwischer fand. Dann konnte es ja losgehen. Es war passend, dass die Jungfernfahrt nicht wie in seiner Vorstellung mit Frau und Tochter bei Sonnenschein stattfand, sondern er sich allein durch dichten Regen kämpfte. Und auch nicht in einem richtigen deutschen Auto, sondern einem beinahe auseinanderfallenden Japaner. Aber egal, er hatte das Auto, für einen Moment vergaß er alles andere und freute sich. Punkt zwei war abgehakt.
Dann dachte er wieder an Punkt eins, die Sache mit dem Job. Durfte er das abhaken? Er erinnerte sich an die rot-weißen Plastikbaken, in denen er sich so getäuscht hatte. Sie waren keine Chancen, sie waren Schranken, sie sperrten ab und ließen niemanden durch, zumindest nicht ihn. Er war umhergezogen, von Baustelle zu Baustelle, hatte immer gefragt, wer hier in charge sei, bekam meistens keine Antwort, manchmal deutete jemand mit dem Zeigefinger in eine unbestimmte Richtung. Mo hatte an die Fenster der Bauwagen geklopft, war wütend beschimpft worden, in der hässlichsten Sprache der Welt, andernorts ergaben sich nette Gespräche, die mit freundlichem Achselzucken endeten. This is not Africa here, sagte ein bärtiger Mann mit Helm und wedelte mit einem Blatt Papier. Dann wiederholte er mehrmals den Namen des Schriftstücks, immer langsamer und lauter werdend, aber es sagte Mo nichts, eine Erlaubnis oder ein Vertrag oder so was, irgendetwas, was man brauchte, um hier zu arbeiten, und was er eben nicht hatte. Thank you, goodbye.
Mo kurbelte das Fenster runter. Er wollte kurz seinen Kopf in den Regen halten, kurz die kalten Tropfen auf seinem beinahe kahl geschorenen Schädel spüren. Er wollte aufwachen. Das konnte es noch nicht gewesen sein, dafür war er nicht nach Deutschland gekommen, hatte alles aufgegeben, hatte seiner Frau und seiner Tochter ein besseres Leben versprochen. Alles musste sich ändern.
Aber was hätte er machen sollen? Er war Tage umhergezogen, Wochen, er hätte jede verdammte Arbeit gemacht. Am Anfang stellte er sich als Maurer vor, dann als Handwerker für alles Mögliche. Hausmeister wäre auch gegangen, Sicherheitsdienst, Müllmann, Möbelpacker, Supermarktregaleinräumer, Reparateur. Es gab doch unendlich viel zu tun in diesem Land, in dieser Stadt. Es gab hier nicht nur Bauern und Erdnüsse. Es gab endlose Ketten von Jobs, die gemacht werden mussten, nur ließ ihn niemand. Bis ihm eines Tages ein Polier eine Nummer aufschrieb. Hier auf der Baustelle gebe es nichts, aber er habe einen Bruder, der immer wieder Leute suche, für verschiedene Sachen. Mo hatte Hoffnung. Er rief direkt an, wurde in eine Hochhaussiedlung bestellt und stand am selben Abend in einem sauberen Hemd vor der Tür. Es öffnete ein verschlafener Mann im Trainingsanzug, der angab, gerade aufgestanden zu sein. Mo lächelte unsicher. Sie setzten sich an, einen Couchtisch, der Mann steckte sich eine Zigarette an und mit einem mit dem Rauch ausgestoßenen Tell me a bit about you bat er Mo, von sich zu erzählen. Und Mo erzählte. Ohne zu wissen, wofür er sich gerade bewarb. Von der Casamance, seiner Arbeit dort auf dem Bau, von der Überfahrt nach Deutschland, von der Unmöglichkeit, in Berlin einen Job zu finden. Der Trainingsanzugmann lachte. There are always things to do. Dann kratzte er sich am Hinterkopf und trank Wasser aus einer halb vollen Plastikflasche.
Ein paar Monate war das inzwischen her. Mo hatte erst abgelehnt, glaubte noch daran, einen normalen Job zu finden. War wie ein Irrer umhergerannt in diesen Tagen. Dann hatte er es begriffen. Als Asylbewerber durfte er offiziell nicht arbeiten, durfte offiziell keine Wohnung mieten und auch kein Auto besitzen. Der offizielle Weg, den er eigentlich einschlagen wollte, war ihm versperrt. Es ging nur noch um die Frage: Illegale Arbeit oder keine Arbeit? Und keine Arbeit war: keine Wohnung, kein Essen, keine Zukunft, kein Auto. Nach zwei Wochen war er wieder vor dem Hochhaus aufgekreuzt, im gleichen Anzug hatte der gleiche Mann vor ihm gestanden, sich zwar nur vage an Mo erinnert, aber ja, das Jobangebot stehe natürlich noch.
Als Mo zu Hause ankam, war der Regen schwächer. Er stellte den Scheibenwischer aus, blieb noch kurz im Auto sitzen, dann ging er hoch zu Aissa und Marième. Er schämte sich inzwischen, nach Hause zu kommen. Er schämte sich, wenn er Aissa zur Begrüßung einen Kuss gab, wenn er Marième umarmte. Wenn er beim Abendessen Aissas kämpferische Worte von einer besseren Zukunft hörte. Noch viel mehr, wenn sie wie heute nach seinem Tag fragte. Er erzählte von einem Bauprojekt in Mitte, von ordentlicher Bezahlung. Sie lächelte und gab ihm einen Kuss. Sie stelle sich das vor, meinte sie dann, Mo mit gelbem Helm und Weste zwischen den ganzen deutschen Arbeitern. Sie lachte. Nichts verstand sie, als Asylbewerber durfte man nicht arbeiten, keine Wohnung haben, kein Auto, Mo hatte begriffen.
Er nahm sie bei der Hand und schob die Gardinen beiseite, zeigte auf das rote Klappergestell vor der Tür. Aissa nahm beide Hände vor den Mund. Wirklich? Er nickte. Sie umarmte ihn und flüsterte ihm ins Ohr, wie stolz sie sei. Mit seiner Hände fleißiger Arbeit habe er das erreicht.
Da musste Mo fast weinen, so sehr schämte er sich. Ja, ganz falsch lag sie nicht. Mit seiner Hände fleißiger Arbeit. Ab mittags stand er jeden Tag im Park, suchte Blicke und Gesten, deutete mit Daumen und Zeigefinger am Mund einen imaginären Zug an, sagte Smoke? Smoke? und nahm, wenn er erfolgreich war, mit der einen Hand den Geldschein entgegen, während die andere das kleine Tütchen mit dem in Alufolie verpackten Brocken aus der Hosentasche holte. Mit seiner Hände fleißiger Arbeit.
7 – Wartenweg
Das Wetter war sonniger als angekündigt, auch mit der Temperatur hatten sie sich um ein paar Grad vertan. Viele solcher Wochenenden würden nicht mehr kommen, bald packte sich die Stadt wieder ein. Jay entschied sich, die letzten Kilometer zu laufen. Er interpretierte das Gekritzel auf seinem Zettel. Er hatte sich die Umrisse des Sees aufgemalt, vertraute nicht auf den mobilen Empfang jenseits der Großstadt. Bei dem rechten unteren Zipfel käme er an, dann noch eine Viertelstunde am See entlang. Bis irgendwo der Wartenweg sein musste. Eine Hausnummer hatte Bäumert nicht für ihn gehabt, Wartenweg sei alles, was Grzesinski ihm damals aufgeschrieben habe. Jay ging los.
Keine Mails, kein Telefon. Er konnte das gut nachvollziehen. Vor allem, wenn man ein Lebensalter erreicht hatte, in dem man nichts mehr gefragt werden wollte. Mails und Telefonate waren ja meist Mittel zum Zweck, aber irgendwann gab es keinen Zweck mehr. So was hier, ein Sommertag, ein, zwei Grad wärmer als gedacht, war Zweck genug. Mit dem See schien Grzesinski alles richtig gemacht zu haben. Es war nicht einer der überlaufenen und überplanschten, wo jedes Ufer mit Badehandtüchern und Kühlboxen belegt war, Kioske standen oder Segelklubs und Villen. Das Wasser des Sees hier war trüber, und vermutlich war das seine Rettung.
Der Wartenweg schien wirklich zu einer Vogelwarte zu führen, zumindest laut einem an einen Baum genagelten Wegweiser. Die Sache mit der Hausnummer stellte kein großes Problem dar. Häuser gab es hier keine. Eine Forsthütte, eine Laube mit verriegelten Fensterläden und unabgeschlossenen Fahrrädern, dann schlängelte sich der weiche Waldweg weiter Richtung See. Ganz am Ende stand sie, die Hütte. Ein kleines Häuschen mit großem Dach, am Steg ein Ruderboot. Vom Weg aus sah Jay nur die schattige Rückseite, und als er auf den Steg zulief, die zum See ausgerichtete, sonnenbestrahlte Front. Und die holzbeplankte Terrasse davor, auf der ein dicker Mann mit geschlossenen Augen und schlaff herunterhängenden Armen in einem Campingstuhl döste. Eine Klingel gab es nicht, nicht einmal ein Zauntor, an das man klopfen konnte. Jay ging näher heran, sah die aufgeschlagene Zeitung auf dem Bauch des Mannes, mit einem beschwerenden Brillenetui vorm Wegfliegen gehindert.
»Hallo?«
Jay vernahm ein schwaches Röcheln aus dem offen stehenden Mund. Braun gebrannt war er, kurze graue Haare säumten nur an den Seiten den wuchtigen Schädel.
»Hallo? Herr Grzesinski?«
Dann öffneten sich zwei kleine Augen.
»Jerusalem Schmitt, Neunte Berliner Mordkommission.«
Ein paar Minuten später saßen sie am kleinen Terrassentisch, vor ihnen zwei Flaschen Bier, die Grzesinski aus einem im Wasser versteckten Korb am Ufer gezogen hatte.
»Kippe?«
Jay lehnte ab.
Grzesinski zündete sich die Zigarette an, atmete lange ein, dann lange aus.





























