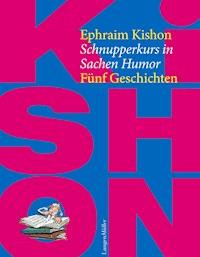8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unangemeldete Besuche des Erbonkels, Tanten, die alles besser wissen, Festtage mit der Großfamilie, Urlaub mit Kind und Kegel … Ephraim Kishon, gesegnet mit der besten Ehefrau von allen und einer großen Familie, wusste, wovon er schrieb: Der Verwandtschaft kann man meistens nicht entkommen. Doch der Weltmeister des Humors findet in jeder noch so absurden Situation den Moment, in dem ein befreiendes Lachen alles wieder ins Lot bringt. Eine wunderbare Sammlung von Satiren, mit der man feststellen wird, dass es ganz ohne die liebe Verwandtschaft auch nicht geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ephraim Kishon
Die liebe Verwandtschaft
LangenMüller
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: © 2010, 2020 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart Alle Rechte vorbehalten Schutzumschlag: STUDIO LZ, Stuttgart Illustration: Saul Steinberg, Untitled, 1955 © The Saul Steinberg Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York eBook-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-7844-8365-8
Inhalt
Verwandtschaft bereichert das Leben ungemeinOnkel Morris und das KolossalgemäldePlatonische LiebeBrautkauf im KibbuzHerkules und die sieben KätzchenNehmen Sie PlatzJa, MamaBesuchszeiten: Montag und DonnerstagKostenlose ReklameRingelspielAbgesichertMitbringselKleine Geschenke erhalten Vater und SohnReisen bildetCompukortschnoiRenanas Weg zur finanziellen UnabhängigkeitPakaEin Ei, das keinem andern gleichtGenerationskonflikt auf literarischer EbeneDer archaische Großvater oder Schonzeit für RegenschirmeYigal und die InquisitionDer SchaukelhengstMit Mazzes versehenKontakt mit dem JenseitsEntspannungEin Schnuller namens ZeziIch mache KarriereApollo-11-MissionVerwandtschaft bereichert das Leben ungemein
Nehmen wir den Vater meines Nachbarn Felix Selig, den alten Selig aus Riga. Eines Tages entdeckte er plötzlich auf einer Bank im Ben-Gurion-Flughafen seinen Bruder, den er seit 53 Jahren nicht gesehen hatte. Das muss man sich vorstellen: seit 53 Jahren! »Grischa!« rief er und die beiden Brüder lagen einander schluchzend in den Armen. Dann begannen sie in alten Erinnerungen zu kramen und Väterchen Selig kramte so lange, bis ihm einfiel, dass er ein Einzelkind war. Daraufhin rückte sein Bruder, immer noch unter Tränen, mit einem Geständnis heraus: Er sei in Australien geboren, gestand er und heisse Harry Nathansohn. Es war eine herzergreifende Szene. Dass zwei völlig Fremde, die einander 53 Jahre lang nicht gesehen hatten, auf solche Weise zusammentreffen würden, hätte niemand geglaubt.
Im Grunde ist die Suche nach verlorenen Verwandten eine Suche nach den eigenen Wurzeln, wenn möglich nach wohlhabenden. Der unwiderstehliche Drang, Verwandte zu entdecken, entsteht besonders in Zeiten drohender Kriegsgefahr oder wenn die Bank einen Bürgen verlangt.
Ich erinnere mich an die rührende Geschichte eines Neueinwanderers namens Ginsberg, der sich in der Diaspora den Ruf erworben hatte, ein Fachmann für die Reparatur schadhaft gewordener Eishockeystöcke zu sein. Als er zu uns ins Land kam und ein wenig Ruhe fand, fiel ihm auf, dass im Nahen und Mittleren Osten nur sehr geringe Nachfrage nach reparierten Eishockeystöcken herrscht. Daraufhin überkam ihn das brennende Verlangen, einen angeheirateten Cousin zweiten Grades aufzustöbern, gleichgültig, wo dieser sich befände. Ginsberg ging umher und fragte und forschte und grub nach Wurzeln und nach einiger Zeit stieß er tatsächlich auf die richtige Spur. Sie führte ihn nach Paris, wo er den lang entbehrten und weit entfernten Vetter sofort aufsuchte. Als er ihm, von Rührung übermannt, um den Hals fallen wollte, warf ihn der Baron Rothschild eigenhändig hinaus. Moral: Arme Verwandte haben ein besseres Gedächtnis als reiche.
Ich für meine Person finde entfernte Verwandte sehr anregend. Es ist von unvergleichlichem Reiz, wenn plötzlich jemand vor deiner Tür steht und dir ohne Übergang mitteilt: »Ich bin Sándor, der jüngste Sohn von Ottilie, die einen Neffen des seligen Emanuel Schmulewitz geheiratet hat.« Dein Herz beginnt wild zu schlagen, dein Hirn beginnt fieberhaft zu arbeiten: Wo hat dieser Sándor die ganze Zeit gesteckt? Wer hat ihn geschickt? Und vor allem: Wer ist Emanuel Schmuelwitz?
Einen andern, weniger rätselhaften Typ von Verwandtschaft repräsentiert meine Tante Ilka, die irgendwann in unsre Familie eingeheiratet hat, aber es ist nicht ganz klar, ob das auf der väterlichen oder auf der mütterlichen Seite geschah. Jedenfalls fragt mich meine Mutter zweimal im Jahr, ob ich Ilka besucht hätte, und ich antworte zweimal im Jahr: »Nein, noch nicht, aber demnächst besuche ich sie ganz bestimmt.«
Dabei habe ich gegen Tante Ilka als solche nichts einzuwenden, außer dass sie in einer schwer erreichbaren Vorstadt von Jaffa wohnt und eine alte Hexe von 89 Jahren ist. Überdies nörgelt sie ständig an mir herum. Immer, wenn ich sie besuche, und das ist wirklich selten genug, empfängt sie mich mit den Worten: »Höchste Zeit, dass du dich einmal an deine alte Tante erinnerst!«
»Ich habe schrecklich viel zu tun«, pflege ich zu erwidern. »Aber jetzt bin ich hier, Tante Ilka. Wie geht es dir?«
Statt einer Auskunft bekomme ich den Auftrag, wieder hinauszugehen und mir draußen gründlich die Schuhe zu reinigen. Wegen der Fliesen. Tante Ilka leidet an einer seltenen, wenn auch keineswegs lebensgefährlichen Krankheit, der sogenannten Fliesomanie. Ein sauberer Fussboden geht ihr über alles. Die Fliesen in ihrer Wohnung sehen aus, als wären sie mit der Zahnbürste geputzt worden. Man hat Angst, sie mit den Füßen zu berühren. Am liebsten würde man über sie hinwegschweben. Tante Ilka kennt jede einzelne ihrer Fliesen persönlich und benennt sie nach dem Schachbrett-System. »Auf E 4 ist ein Schmutzfleck«, sagt sie.
Nach einer Weile verlassen wir das Thema »Fliesen« und wenden uns dem Thema »Katzen« zu. Sofort beginnen Tantchens Augen feucht zu schimmern und ihre Stimme senkt sich zu melancholischem Flüstern. »Bianca … meine süße Bianca …« Bianca war ihre Lieblingskatze, sie starb in sagenhaft hohem Alter um 1950. Ich habe sie nicht gekannt, weil ich damals noch auswärts lebte und mir das Schicksal jüdischer Katzen unerheblich erschien. Dafür lässt mich Tante Ilka büßen, indem sie jedesmal aus ihrem antiken oder zumindest antiquarischen Schmuckkästchen, das auf den Fliesen G 6 und H 8 steht, ein altes Foto von Bianca hervorholt.
»Dort, wo du jetzt sitzt«, lautet der unabwendbare Begleittext, »in diesem selben Fauteuil … dort hat sie sich immer zusammengerollt.« Der Text bleibt mir auch dann nicht erspart, wenn ich stehe. »Sie war ein wunderbares Tier. Komm, schau sie dir an.« Gehorsam komme ich näher, um mir das Foto anzuschauen. Ich sehe eine Katze mit Schnurrbarthaaren, Ohren und Schwanz. Eine Katze. Mir sind Hunde lieber.
»Sie hat dich sehr geliebt, Robert«, sagt Tante Ilka. »Mehr als sonst jemanden auf der Welt.«
Habe ich schon erwähnt, dass Tante Ilka 89 Jahre alt ist? Wenn dieses Buch erscheint, wird sie vielleicht schon 90 sein. Wirklich zu dumm, dass ich Bianca nicht gekannt habe. Und dass ich nicht Robert heiße.
Tante Ilka gehört zur Kategorie der Besuchs-Tanten. Onkel Kalman hingegen ist ein Telefon-Onkel. Er ruft mich in regelmäßigen Intervallen an und fragt, warum ich ihn nicht anrufe. Außerdem leidet er an chronischem Rheuma. Welches sich bekanntlich ganz hervorragend für lange, ausführliche Bulletins eignet. Das ist der Grund, warum ich mir ein speziell konstruiertes Telefon angeschafft habe, das ich nicht ans Ohr halten muss und beide Hände frei habe. Während Onkel Kalman sich in detaillierten Schilderungen seines Leidens ergeht, schreibe ich ein oder zwei Theaterstücke, erledige die Post, halte zwischendurch ein kleines Nickerchen und muss nur achtgeben, dass ich alle Viertelstunden eine passende Bemerkung in Richtung Hörer einwerfe, etwa: »Was du nicht sagst, Onkel Kalman!« oder: »Nein, wirklich?« Es geht ganz gut, aber es ist, alles in allem, ein wenig anstrengend.
Die Wende kam, als ich eines Tages, während Onkel Kalman am Telefon eine besonders lange Langspielplatte durchgab, für ein paar Minuten vors Haus ging, um Luft zu schöpfen und meinen Nachbar Felix Selig dabei antraf, wie er sich gerade von einem düster dreinblickenden alten Herrn verabschiedete. Sie umarmten einander wortlos, aber herzlich und gingen wortlos auseinander.
»Das war der alte Wertheimer«, erklärte mir Felix. »Ein Onkel von mir, glaube ich.«
»Stumm oder taub?«, fragte ich.
»Weder noch. Nur schweigsam. Der schweigsamste Onkel, den es jemals gab. Ich bekomme kein Wort aus ihm heraus. Er langweilt mich tödlich.«
Da überkam mich die Erleuchtung. »Hören Sie, Felix. Ich habe einen ungefähr gleichaltrigen, gut erhaltenen Onkel, der das Gegenteil von schweigsam ist. Er redet pausenlos, ohne besonderen Wert darauf zu legen, dass man ihm zuhört. Wenn man ihn nur reden lässt. Wie wär’s …?«
Felix verstand mich sofort. Wir wechselten die Onkel. Seither kommt Onkel Wertheimer einmal wöchentlich zu mir, setzt sich stumm in eine Ecke meines Arbeistzimmers und starrt eine Stunde lang zur Decke, ehe er sichtlich zufrieden geht. Dafür ruft Onkel Kalman jeden Montag meinen Freund Felix an. Das Arrangement erfreut sich der Zustimmung aller Beteiligten, einschließlich meiner Mutter. »Hauptsache, dass Kalman jemanden hat, mit dem er plaudern kann«, entschied sie.
Kein Zweifel: Die Zukunft gehört dem Verwandtentausch. Ich werde demnächst eine Anzeige aufgeben: »Tausche gepflegte alte Tante mit toter Katze gegen lebensfrohe Cousine, 20 bis 25.«
Onkel Morris und das Kolossalgemälde
Der Tag begann wie jeder andere Tag. Im Wetterbericht hieß es »wechselnd wolkig bis heiter«, die See war ruhig, alles sah ganz normal aus. Aber zu Mittag hielt plötzlich ein Lastwagen vor unserem Haus. Ihm entstieg Morris, ein angeheirateter Onkel meiner Gattin mütterlicherseits.
»Ihr seid übersiedelt, höre ich«, sagte Onkel Morris. »Ich habe euch ein Ölgemälde für die neue Wohnung mitgebracht.«
Und auf einen Wink seiner freigebigen Hand brachten zwei stämmige Träger das Geschenk angeschleppt.
Wir waren tief bewegt. Onkel Morris ist der Stolz der Familie meiner Frau, ein sagenhaft vermögender Mann von großem Einfluss in einflussreichen Kreisen. Gewiss, sein Geschenk kam ein wenig spät, aber schon die bloße Tatsache seines Besuchs war eine Ehre, die man richtig einschätzen musste.
Das Gemälde bedeckte ein Areal von vier Quadratmetern, einschließlich des gotisch-barocken Goldrahmens und stellte das jüdische Gesamterbe dar. Rechts vorne erhob sich ein kleines »Städel«. Es lag teils in der Diaspora, teils in einem Alptraum und war von vielem Wasser und vielem sehr blauem Himmel umgeben. Zuoberst prangte die Sonne in natürlicher Größe, zuunterst weideten Kühe und Ziegen. Auf einem schmalen Fußpfad wandelte ein Rabbi mit zwei Torarollen, ihm folge eine Anzahl von Talmudschülern, darunter einige Wunderkinder sowie ein Knabe kurz vor Erreichung des dreizehnten Lebensjahrs, der sich für seine Bar-Mizwa vorbereitete. Im Hintergrund sah man eine Windmühle, eine Gruppe von Geigern, den Mond, eine Hochzeit und einige arbeitende Mütter, die im Fluss ihre Wäsche wuschen. Auf der linken Seite öffnete sich die hohe See, komplett mit Segelbooten und Fischernetzen. Aus der Ferne grüßten Vögel und die Küste Amerikas.
Noch nie in unserem ganzen Leben hatten wir ein derartiges Konzentrat von Scheußlichkeit erblickt, obendrein in quadratischem Format, in neoprimitivem Stil und in Technicolor.
»Wahrhaft atembeklemmend, Onkel Morris«, sagten wir. »Aber das ist ein viel zu nobles Geschenk für uns. Das können wir nicht behalten!«
»Macht keine Geschichten«, begütigte Onkel Morris. »Ich bin ein alter Mann und kann meine Sammlung nicht mit ins Grab nehmen.«
Als Onkel Morris, der Stolz der Familie meiner Frau, gegangen war, saßen wir lange vor dem in Öl geronnenen Schrecknis und schwiegen. Die ganze Tragik des jüdischen Volkes begann uns zu dämmern. Es war, als füllte sich unsere bescheidene Wohnung bis zum Rande mit Ziegen, Wolken, Wasser und Talmudschülern. Wir forschten nach der Signatur des Täters, aber er hatte sie feig verborgen. Ich schlug vor, die quadratische Ungeheuerlichkeit zu verbrennen. Meine Gattin schüttelte traurig den Kopf und wies auf die eigentümliche Empfindlichkeit hin, durch die sich ältere Verwandte auszeichnen. Onkel Morris würde uns eine solche Kränkung niemals verzeihen, meinte sie.
Wir beschlossen, dass wenigstens niemand anderer das Grauen je zu Gesicht bekommen sollte, schleppten es auf den Balkon, drehten es mit der öligen Seite zur Mauer und ließen es stehen.
Eine der dankenswertesten Eigenschaften des menschlichen Geistes ist die Fähigkeit zu vergessen. Wir vergaßen das Schreckensgemälde, das von hinten nicht einmal so schlecht aussah und gewöhnten uns allmählich an die riesige Leinwand auf unserem Balkon. Eine Schlingpflanze begann sie instinktiv zu überwuchern.
Manchmal des Nachts konnte es freilich geschehen, dass meine Frau jäh aus ihrem Schlaf emporfuhr, kalten Schweiß auf der Stirn.
»Und wenn Onkel Morris zu Besuch kommt?«
»Er kommt nicht«, murmelte ich verschlafen. »Warum sollte er kommen?«
Er kam.
Bis ans Ende meiner Tage wird mir dieser Besuch im Gedächtnis haften. Wir saßen gerade beim Essen, als die Türglocke erklang. Ich öffnete. Onkel Morris stand draußen und kam herein. Das Ölgemälde schlummerte auf dem Balkon, mit dem Gesicht zur Wand.
»Wie geht es euch?«, fragte der Onkel meiner Gattin mütterlicherseits.
Im ersten Schreck – denn auch ich bin nur ein Mensch – erwog ich, mich durch die offengebliebene Tür davonzuschleichen und draußen im dichten Nebel zu verschwinden. Gerade da erschien meine Frau, die beste Ehefrau von allen. Bleich, aber gefasst stand sie im Türrahmen und zwitscherte: »Bitte nur noch ein paar Sekunden, bis ich Ordnung gemacht habe! Ephraim, unterhalte dich so lange mit Onkel Morris. Das kann nur gut für dich sein.«
Ich versperrte Onkel Morris unauffällig den Weg ins Nebenzimmer und verwickelte ihn in ein angeregtes Gespräch. Von nebenan klangen verdächtige Geräusche, schwere Schritte und ein sonderbares Pumpern, als schleppte jemand eine Leiter hinter sich her. Dann machte ein fürchterlicher Krach die Wände erzittern und dann klang die schwache Stimme der besten Ehefrau von allen: »Ihr könnt hereinkommen.«
Wir betraten das Nebenzimmer. Meine Frau lag erschöpft auf der Couch und atmete schwer. An der Wand hing, noch leise schaukelnd, Onkelchens Ölgeschenk, verdunkelte das halbe Fenster und sah merkwürdig dreidimensional aus, denn es bedeckte noch zwei kleinere Gemälde nebst der Kuckucksuhr, und zwar dort, wo die Berge waren, die sich infolgedessen deutlich hervorwölbten.
Auf Onkel Morris machte die bevorzugte Behandlung, die wir seinem Geschenk angedeihen ließen, den denkbar günstigsten Eindruck. Nur den Platz, an dem wir es aufgehängt hatten, fand er ein wenig dunkel. Wir baten ihn, nächstens nicht unangemeldet zu kommen, damit wir uns auf seinen Besuch vorbereiten könnten.
»Papperlapapp«, brummte Onkel Morris leutselig. »Für einen alten Mann wie mich braucht man keine Vorbereitungen. Ein Glas Tee, ein paar belegte Brote, etwas Gebäck – das ist alles …«
Seit diesem Zwischenfall lebten wir in ständiger Bereitschaft. Von Zeit zu Zeit hielten wir Alarmübungen ab: Wir stellen uns schlafend – meine Frau ruft plötzlich: »Morris!« – ich springe mit einem Panthersatz auf den Balkon – unterdessen fegt meine Frau alles von den Wänden des Zimmers herunter – eine Notleiter liegt griffbereit unterm Bett – und im Handumdrehen ist alles hergerichtet. Wir nannten diese Übung »Unternehmen Haman« (weil es etwas mit Aufhängen zu tun hat).
Nach einer Woche intensiven Trainings bewältigten wir die ganze Prozedur – vom Ausruf »Morris« über das aufgehängte Bild bis zur Verwischung sämtlicher Spuren – in knappen zweieinhalb Minuten. Ein bemerkenswerter sportlich-artistischer Rekord.
Eines schicksalsschweren Sabbats kündigte uns Morris seinen Besuch an. Da er erst am Nachmittag kommen wollte, hatten wir genügend Zeit zur Vorbereitung und beschlossen, das Äußerste aus der Sache herauszuholen. Ich stellte rechts und links in schrägem Winkel zum Gemälde zwei Scheinwerfer auf, die ich mit rotem, grünem und gelbem Zellophanpapier verkleidete. Meine Frau besteckte den Goldrahmen mit erlesenen Blumen und Blüten. Und als wir dann noch das Scheinwerferlicht einschalteten, durften wir uns sagen, dass kein Grauen jemals diesem hier gleichkäme.
Pünktlich um fünf Uhr nachmittags ging die Türglocke. Während meine Frau sich anschickte, Onkel Morris liebevoll zu empfangen, richtete ich zur Steigerung des Effekts den einen Scheinwerfer auf die weidenden Ziegen und den andern auf die waschenden Mütter. Dann öffnete sich die Tür. Dr. Perlmutter, einer der wichtigsten Männer im Ministerium für Kultur und Erziehungswesen, trat mit seiner Gattin ein.
Dr. Perlmutter gehört zur geistigen Elite unseres Landes. Sein Geschmack ist in intellektuellen Kreisen geradezu sprichwörtlich. Seine Gattin leitet eine repräsentative Galerie. Und diese beiden kamen jetzt herein.
Einige Sekunden lang schien die Zeit stillzustehen. Dann sah es aus, als wollte Dr. Perlmutter in Ohnmacht fallen. Dann unternahm ich, mit dem Rücken zum Öl, eine lahme Rettungsaktion und verdeckte wenigstens die weidenden Ziegen. Dann sagte jemand in meiner Kehle: »Was für eine freudige Überraschung. Bitte nehmen Sie Platz.«
Dr. Perlmutter, immer noch leise schwankend, hatte seine Brille abgenommen und rieb hartnäckig die Gläser.
Die verdammten Blumen. Wenn wenigstens diese verdammten Blumen auf dem gotisch-barocken Goldrahmen nicht wären.
»Eine sehr hübsche Wohnung haben Sie«, murmelte Frau Dr. Perlmutter. »Und so hübsche … hm … Gemälde …«
Ich fühlte ganz deutlich, wie die Talmudschüler in meinem Rücken chassidische Tänze aufführten. Im Übrigen vergingen die nächsten Minuten in angespannter Reglosigkeit. Die Augen unserer Gäste waren starr auf das Ding gerichtet. Schließlich gelang es meiner tapferen Frau, den einen der beiden Scheinwerfer abzuschalten, aber von den Schultern des Rabbiners abwärts blieb die Szenerie in gleißendes Licht getaucht. Dr. Perlmutter klagte über Kopfschmerzen und verlangte ein Glas Wasser. Als meine tapfere Frau mit dem Glas Wasser aus der Küche zurückkam, schmuggelte sie mir einen kleinen Zettel mit einer Nachricht zu. Der Text lautete: »Ephraim, mach was!«
»Entschuldigen Sie, dass wir so plötzlich bei Ihnen eindringen«, sagte Frau Dr. Perlmutter mit belegter Stimme. »Aber mein Mann wollte mit Ihnen über eine Vortragsreise nach Amerika sprechen.«
»Ja!«, jauchzte ich. »Wann?«
»Keine Eile«, sagte Dr. Perlmutter und erhob sich. »Die Angelegenheit ist nicht mehr so dringend.«
Es war klar, dass ich jetzt endlich mit einer Erklärung herausrücken musste, sonst wären wir aus dem Kreis der zivilisierten Menschheit für immer ausgestoßen. Meine kleine tapfere Frau kam mir zur Hilfe.
»Sie wundern sich wahrscheinlich, wie dieses Bild hierhergekommen ist?«, wisperte sie.
Beide Perlmutters, schon an der Tür, wandten sich um.
»Ja«, sagten sie beide.
In diesem Augenblick kam, mit genauer Berechnung, Onkel Morris. Wir stellten ihn unseren Gästen vor und merkten mit Freude, dass sie Gefallen an ihm fanden.
»Sie wollten uns etwas über dieses … hm … über dieses Ding erzählen«, mahnte Frau Dr. Perlmutter meine kleine tapfere Frau.
»Ephraim«, sagte meine kleine tapfere Frau. » Bitte.«
Ich ließ meinen Blick in die Runde wandern – vom verzweifelten Antlitz meiner Gattin und den versteinerten Perlmutter-Gesichtern – über die Wunderkinder im Schatten der Windmühle – bis zum stolzgeschwellt strahlenden Onkel Morris.
»Es ist ein sehr schönes Bild«, brachte ich krächzend hervor. »Es hat Atmosphäre … einen meisterhaften Pinselstrich … und Sonne … sehr viel Sonne … Wir haben es von unserem Onkel hier geschenkt bekommen.«
»Sie sind Sammler?«, fragte Frau Dr. Perlmutter. »Sie sammeln –«