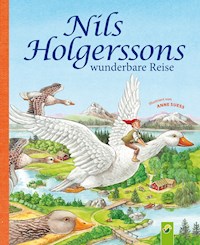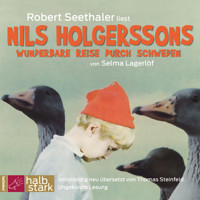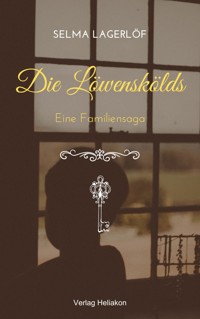
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wohl weiß ich, dass es früher einmal Leute genug gab, die nicht wussten, was das Gruseln heißen will. Ich habe von einer ganzen Menge Menschen gehört, die es liebten, über hauchdünnes Eis zu wandern, und die sich kein größeres Vergnügen denken konnten, als mit tollen Pferden zu kutschieren. Ja, es gab auch den einen oder den anderen, der nicht davor zurückscheute, mit dem Fahnenjunker Ahlegard Karten zu spielen, obgleich man wusste, er machte solche Kunststücke mit den Karten, dass er immer gewinnen musste. Ich kenne auch einige unerschrockene Gesellen, die sich nicht fürchteten, eine Reise an einem Freitag anzutreten, oder sich an einen Mittagstisch zu setzen, der für dreizehn Personen gedeckt war. Aber ich möchte gerne wissen, ob einer von all jenen den Mut gehabt hätte, sich den schrecklichen Ring an den Finger zu stecken, der dem alten General Löwensköld auf Hedeby gehört hatte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1076
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Löwenskölds
Eine Familiensaga
Der Ring des Generals
Charlotte Löwensköld
Anna, das Mädchen aus Dalarne
Verlag Heliakon
Übersetzer: Marie Franzos und Pauline Klaiber-Gottschau
Vertrieb: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
2023 © Verlag Heliakon
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Titelbild:
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Der Ring des Generals
Charlotte Löwensköld
Die Frau Oberst
Die Werbung
Wünsche
Das Mädchen aus Dalarne
Der Morgenkaffee
Der Brief
Schagerström
Die Strafpredigt
Die abgeschnittenen Locken
Der Günstling des Glücks
Das Erbe
Die Postkutsche
Das Aufgebot
Die Armenversteigerung
Der Triumph
Die Strafpredigt an den Gott der Liebe
Das Begräbnis der Frau Dompropst
Samstag: Morgen und Vormittag
Samstag: Nachmittag und Abend
Der Hochzeitstag
Anna, das Mädchen aus Dalarne
Die Reise nach Karlstadt
Pferd und Kuh, Magd und Knecht
Die Frau Schultheiß
Die Hochzeit
Das neue Heim
In der Morgenstunde
Die Erscheinung in der Kirche
Der Sonntagshut
Das Paradies
Der Sündenfall
Der Schrank
Das Kartenspiel
Die Begegnung
Der Unglücksfall
Mamsell Jaquette
Annstu-Lisa
Der Zigeunerbaron
Die Baronin
Der Jahrmarktspfarrer
Die Fahrt
Die Heimfahrt
Der Ehering
Der Ring des Generals
1
Wohl weiß ich, dass es früher einmal Leute genug gab, die nicht wussten, was das Gruseln heißen will. Ich habe von einer ganzen Menge Menschen gehört, die es liebten, über hauchdünnes Eis zu wandern, und die sich kein größeres Vergnügen denken konnten, als mit tollen Pferden zu kutschieren. Ja, es gab auch den einen oder den anderen, der nicht davor zurückscheute, mit dem Fahnenjunker Ahlegard Karten zu spielen, obgleich man wusste, er machte solche Kunststücke mit den Karten, dass er immer gewinnen musste. Ich kenne auch einige unerschrockene Gesellen, die sich nicht fürchteten, eine Reise an einem Freitag anzutreten, oder sich an einen Mittagstisch zu setzen, der für dreizehn Personen gedeckt war. Aber ich möchte gerne wissen, ob einer von all jenen den Mut gehabt hätte, sich den schrecklichen Ring an den Finger zu stecken, der dem alten General Löwensköld auf Hedeby gehört hatte.
Es war dies derselbe General, der den Löwenskölds Haus und Hof, Namen und Adel verschafft hatte; und solange einer von ihnen in Hedeby wohnte, hing sein Bildnis in dem großen Salon im oberen Stockwerk mitten zwischen den Fenstern. Es war ein großes Gemälde, das vom Boden bis zur Decke reichte; und auf den ersten Blick glaubte man, es sei Karl XII. selbst, in höchsteigener Person, der da stand, im blauen Rock, großen Sämischlederhandschuhen und ungeheueren Stulpenstiefeln, fest auf den schachbrettgemusterten Boden aufgesetzt; aber wenn man näherkam, sah man ja, dass es ein Mann von ganz anderem Schlag war.
Es war ein großes, grobes Bauerngesicht, das über den Rockkragen hervorblickte. Der Mann auf dem Bilde schien dazu geboren zu sein, all sein Lebtag hinter dem Pfluge einherzugehen. Aber bei all seiner Hässlichkeit sah er wie ein kluger, zuverlässiger und prächtiger Kerl aus. Wenn er zu unserer Zeit auf die Welt gekommen wäre, er wäre mindestens Schöffe und Gemeindevorsteher geworden, ja wer weiß, ob er nicht in den Reichsrat gekommen wäre. Aber da er in den Tagen des großen Heldenkönigs lebte, so zog er als armer Soldat in den Krieg, kehrte als der berühmte General Löwensköld heim und bekam von der Krone das Rittergut Hedeby im Kirchspiel Bro zum Lohn für seine Dienste.
Übrigens, je länger man das Bildnis betrachtete, desto mehr versöhnte man sich mit seinem Aussehen. Man glaubte zu verstehen, dass die Männer, die unter König Karls Befehl gestanden waren und ihm eine Furche durch Polen und Russland gepflügt hatten, so gewesen sein mussten. Nicht nur Abenteurer und Hofkavaliere hatten sich ihm angeschlossen, sondern gerade solche schlichte und ernste Männer wie der hier auf dem Bild waren ihm zugetan gewesen und hatten gefunden, dass er ein König war, für den man leben und sterben konnte.
Wenn man das Konterfei des alten Generals betrachtete, pflegte immer einer der Löwenskölds bei der Hand zu sein, um zu bemerken, es sei durchaus kein Zeichen der Eitelkeit bei dem General, dass er den Handschuh an der linken Hand so weit abgestreift hatte, dass der große Siegelring, den er am Zeigefinger trug, auf dem Bild zum Vorschein kam. Er hatte den Ring vom König empfangen — für ihn gab es nur einen König —, und der Ring war mit auf das Bild gekommen, um zu zeigen, dass Bengt Löwensköld ihm treu war. Er hatte ja vielen bitteren Tadel gegen seinen Herrscher hören müssen, man erkühnte sich zu behaupten, dass er durch Unverstand und Übermut das Reich an den Rand des Abgrunds gebracht hatte, aber der General hielt unbedingt an ihm fest. Denn König Karl war ein Mann, wie die Welt nie seinesgleichen gesehen, und wer in seiner Nähe gelebt hatte, der hatte erfahren, dass es schönere und höhere Dinge gibt, für die man kämpfen kann, als Ehre und Erfolg in dieser Welt.
Ganz so, wie Bengt Löwensköld den Königsring mit auf dem Konterfei haben wollte, so wollte er ihn auch mit ins Grab haben. Auch hierbei war keine Eitelkeit im Spiel. Es lag ihm nicht im Sinn, damit zu prahlen, dass er eines großen Königs Ring am Finger trug, wenn er vor den lieben Gott und die Erzengel hintrat, aber er hoffte vielleicht, dass, wenn er in den Saal kam, wo Karl XII. von all seinen Haudegen umgeben saß, der Ring als ein Wiedererkennungszeichen dienen würde, so dass er auch nach dem Tod in der Nähe des Mannes weilen durfte, dem er sein ganzes Leben lang gedient und gehuldigt hatte.
Als der Sarg des Generals in die gemauerte Grabkammer gestellt wurde, die er sich auf dem Broer Kirchhof hatte bereiten lassen, steckte der Königsring also noch am Zeigefinger der linken Hand. Viele unter den Anwesenden klagten darüber, dass ein solches Kleinod einem toten Manne ins Grab folgen sollte, denn der Ring des Generals war beinahe ebenso bekannt und berühmt wie er selbst. Man erzählte, es sei so viel Gold darin, dass es hingereicht hätte, Haus und Hof zu kaufen, und der rote Karneol, in den der Namenszug des Königs eingraviert war, sollte nicht weniger Wert haben. Man fand allgemein, dass es aller Ehren wert von den Söhnen war, sich dem Wunsche des Vaters nicht zu widersetzen und ihm das kostbare Stück zu lassen.
Wenn nun der Ring des Generals in Wirklichkeit so aussah, wie er auf dem Gemälde abgebildet war, so war er ein hässliches, plumpes Ding, das heutzutage wohl kaum ein Mensch an seinem Finger tragen möchte; aber das hindert nicht, dass er vor ein paar hundert Jahren ungeheuer wertgeschätzt wurde. Seht, man muss bedenken, alle Schmucksachen und Gefäße aus edlem Metall mit ganz wenigen Ausnahmen, hatten der Krone abgeliefert werden müssen, man hatte gegen Goertzens Taler und den Staatsbankrott zu kämpfen, und für viele Menschen war Gold etwas, das sie vom Hörensagen kannten, aber das sie nie gesehen hatten. So kam es, dass die Leute den goldenen Ring nicht vergessen konnten, der zu niemandes Nutz und Frommen unter einen Sargdeckel gelegt worden war. Man meinte beinahe, es sei unrecht, dass er da lag. Man hätte ihn ja in fremden Ländern um teures Geld verkaufen und so manchem Brot verschaffen können, der nichts anderes zu brechen und zu beißen hatte als Häcksel und Rinde.
Aber obgleich es Viele gab, die gewünscht hätten, dass die große Kostbarkeit in ihrem Besitz wäre, gab es keinen, der im Ernst daran dachte, sie sich anzueignen. Der Ring lag in einem zugeschraubten Sarg, in einem vermauerten Grabkeller, unter schweren Steinplatten, unerreichbar selbst für den kühnsten Dieb, und so, meinte man, müsse es verbleiben bis ans Ende aller Tage.
2
Im Jahre 1741 im Monat März war der Generalmajor Bengt Löwensköld im Herrn entschlafen, und im selben Jahr einige Monate später begab es sich, dass ein kleines Töchterchen des Rittmeisters Göran Löwensköld, des ältesten Sohnes des Generals, der jetzt in Hedeby wohnte, an der roten Ruhr starb. Es wurde an einem Sonntag gleich nach dem Gottesdienst begraben, und alle Kirchenbesucher folgten dem Leichenzug zu dem Löwensköldschen Grab, wo die zwei gewaltigen Grabplatten schräg aufgestellt waren. Die Wölbung darunter war von einem Maurer aufgerissen worden, so dass man den Sarg des toten Kindleins neben den des Großvaters stellen konnte.
Während die Menschen um das Grab versammelt waren und den Grabreden lauschten, mag es wohl möglich sein, dass der eine oder andere an den Königsring dachte und bedauerte, dass er in einem Grab verborgen liegen sollte, zu niemandes Nutzen und Frommen. Es gab auch vielleicht den einen oder anderen, der seinem Nachbar zuflüsterte, jetzt wäre es nicht so unmöglich, zu dem Ring zu kommen, da das Grab wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Tage zugemauert werden würde.
Unter den vielen, die da standen und diese Gedanken im Kopfe hin- und herwälzten, war auch ein Bauer aus dem Mellomhof in Olsby, der Bard Bardsson hieß. Er gehörte keineswegs zu denen, die sich des Ringes wegen hatten graue Haare wachsen lassen. Im Gegenteil! Wenn jemand von dem Ring gesprochen hatte, war seine Antwort gewesen, er hätte einen so guten Hof, dass er den General nicht zu beneiden brauchte, und wenn er gleich einen Scheffel Gold mit in den Sarg genommen hätte.
Wie er nun so auf dem Friedhof stand, kam es ihm wie so vielen anderen in den Sinn, wie merkwürdig es doch war, dass man das Grab geöffnet hatte. Aber er war nicht froh darüber. Er war unruhig. »Der Rittmeister muss es doch schon heute Nachmittag wieder instand setzen lassen«, dachte er. »Es gibt viele, die es auf diesen Ring abgesehen haben.«
Dies war ja eine Sache, die ihn gar nichts anging, aber wie es nun kam, so lebte er sich immer mehr und mehr in den Gedanken ein, dass es gefährlich sein konnte, das Grab über Nacht offen zu lassen. Man war nun im August, die Nächte waren dunkel, und wenn das Grab nicht noch an diesem Tage geschlossen wurde, konnte sich ein Dieb hinunterschleichen und sich den Schatz aneignen.
Er wurde von einer so großen Angst gepackt, dass er schon erwog, ob er nicht auf den Rittmeister zugehen und ihn warnen sollte; aber er wusste ja ganz gut, dass die Leute ihn für einfältig hielten, und er wollte sich nicht zum Gespött machen. »Freilich hast du in dieser Sache ganz recht«, dachte er, »aber wenn du dich gar zu eifrig zeigst, wirst du nur ausgelacht. Der Rittmeister, der ein so kluger Mann ist, hat sicherlich schon dafür gesorgt, dass das Loch wieder zugemauert wird.«
Er war so in diese Gedanken versunken, dass er gar nicht merkte, dass die Beerdigung zu Ende war, sondern er blieb an dem Grab stehen und wäre noch lange da gestanden, wenn nicht seine Frau gekommen wäre und ihn am Rockärmel gezupft hätte.
»Was hast du denn?« sagte sie. »Du stehst ja da und starrst immerzu auf einen einzigen Fleck wie die Katze vor dem Mauseloch.«
Der Bauer zuckte zusammen, schlug die Augen auf und fand, dass er und die Frau allein auf dem Friedhof waren.
»Es ist nichts«, sagte er. »Ich stand nur da, und es ging mir durch den Kopf …«
Er hätte der Frau gerne gesagt, was ihm durch den Kopf ging, aber er wusste ja, dass sie viel klüger war als er. Sie hätte nur gefunden, dass er sich überflüssige Sorgen machte. Sie hätte gesagt, ob das Grab verschlossen würde oder nicht, das sei eine Sache, die den Rittmeister anging und keinen anderen.
Sie machten sich auf den Heimweg, und als Bard Bardsson dem Friedhof den Rücken gekehrt hatte, hätte er ja den Gedanken an das Grab los sein müssen, aber so ging es nicht. Die Frau sprach vom Begräbnis: vom Sarg und den Trägern, von dem Leichenzug und den Grabreden, und er warf hie und da ein Wort ein, um nicht merken zu lassen, dass er nichts wusste und nichts gehört hatte, aber bald klang die Stimme der Frau wie aus weiter Ferne. Das Gehirn begann die früheren Gedanken zu mahlen. »Heute ist Sonntag«, dachte er, »und vielleicht will der Maurer die Wölbung an einem Ruhetag nicht zumauern. Aber in diesem Fall könnte ja der Rittmeister dem Totengräber einen Taler geben, damit er über Nacht bei dem Grabe wacht. Wenn er doch nur auf diesen Gedanken käme!«
Auf einmal begann er laut mit sich selbst zu sprechen. »Ich hätte doch zu dem Rittmeister hingehen sollen. Ich hätte mir nichts daraus machen sollen, wenn mich die Leute ausgelacht hätten.«
Er hatte ganz vergessen, dass die Frau neben ihm einherging, aber er kam wieder zu sich, als sie plötzlich stehen blieb und ihn anstarrte.
»Es ist nichts«, sagte er, »nur diese selbe Sache, die mir schon immer im Kopf herumgeht.«
Damit setzten sie ihre Wanderung fort, und bald waren sie in ihren eigenen vier Wänden. Er hoffte, dass die unruhigen Gedanken ihn hier verlassen würden, und das hätten sie wohl auch, wenn er zu einer Arbeit hätte greifen können. Aber nun war ja Sonntag. Als die Leute im Mellomhof ihr Mittagsbrot gegessen hatten, ging ein jeder seiner Weg. Er blieb allein in der Hütte sitzen, und gleich kam dieses Grübeln wieder über ihn.
Nach einer Weile stand er von der Bank auf und ging hinaus und striegelte das Pferd, in der Absicht, nach Hedeby zu reiten und mit dem Rittmeister zu sprechen. »Sonst wird der Ring am Ende noch diese Nacht gestohlen«, dachte er.
Es kam doch nicht dazu, dass er Ernst mit der Sache machte. Er war zu schüchtern. Er ging anstatt dessen in einen Nachbarhof, um mit dem Bauer dort von seiner Unruhe zu sprechen, aber er traf ihn nicht allein, und wieder war er zu schüchtern, zu sprechen. Er kam unverrichteter Dinge nach Hause zurück.
Sobald die Sonne untergegangen war, legte er sich zu Bett und nahm sich vor, bis zum Morgen zu schlafen. Aber er fand keinen Schlaf. Die Unruhe kehrte zurück. Er drehte und wälzte sich nur im Bett hin und her.
Die Frau konnte natürlich auch nicht schlafen, und nach einiger Zeit wollte sie wissen, warum er so unruhig war.
»Es ist nichts«, antwortete er in der gewohnten Weise. Es ist nur so eine Sache, die mir im Kopf herumgeht.
»Ja, das hast du heute schon mehrmals gesagt«, sagte die Frau, »aber nun, meine ich, solltest du mir doch sagen, was dich beunruhigt. Du hast doch nicht so gefährliche Dinge im Kopf, dass du sie mir nicht anvertrauen kannst.«
Als Bard die Frau so sprechen hörte, bildete er sich ein, er würde schlafen können, wenn er ihr gehorchte.
»Ich liege nur da und möchte gerne wissen, ob das Grab des Generals wieder zugemauert worden ist«, sagte er, »oder ob es die ganze Nacht offenstehen soll.«
Die Frau lachte. »Daran habe ich auch gedacht«, sagte sie, »und ich glaube, daran wird jeder Mensch, der heute in der Kirche war, gedacht haben. Aber von so etwas wirst du dich doch nicht um den Schlaf bringen lassen.«
Bard war froh, dass die Frau die Sache so leicht nahm. Er fühlte sich ruhiger und glaubte, jetzt würde er schlafen können.
Aber kaum hatte er sich wieder zurechtgelegt, als die Unruhe zurückkehrte. Von allen Seiten, aus allen Hütten sah er Schatten geschlichen kommen, alle zogen in derselben Absicht aus, alle lenkten ihre Schritte nach dem Friedhof mit dem offenen Grabe.
Er versuchte stillzuliegen, damit die Frau schlafen konnte, aber sein Kopf schmerzte, und sein Körper schwitzte. Er musste sich unaufhörlich hin und her drehen.
Die Frau verlor die Geduld, und sie warf halb im Scherz hin:
»Lieber Mann, ich glaube wirklich, es wäre gescheiter, wenn du zum Friedhof hinuntergingest und nachsehen würdest, wie es mit dem Grab steht, als dass du hier liegst und dich von einer Seite auf die andere wälzest, und kein Auge zutun kannst.«
Kaum hatte sie zu Ende gesprochen, als der Mann aus dem Bett sprang und sich anzuziehen begann. Er fand, dass die Frau ganz recht hatte. Es war von Olsby nicht weiter als eine halbe Stunde zur Broer Kirche. In einer Stunde konnte er wieder da sein, und dann würde er die ganze Nacht schlafen können.
Aber kaum war er zur Türe hinaus, als die Frau sich sagte, dass es für den Mann doch unheimlich war, mutterseelenallein auf den Friedhof zu gehen, und sie sprang auch hastig auf und zog die Kleider an.
Sie holte den Mann auf dem Hügel unter Olsby ein. Bard lachte, als er sie kommen hörte.
»Kommst du, um nachzusehen, ob ich nicht den Ring des Generals stehle?« sagte er.
»O du meine Güte«, sagte die Frau. »Das weiß ich wohl, dass du an so etwas nicht denkst, ich bin nur gekommen, um dir beizustehen, wenn du einem Friedhofsgespenst begegnen solltest.«
Sie schritten rüstig aus. Die Nacht war eingebrochen, und alles war schwarze Dunkelheit bis auf einen kleinen schmalen Lichtstreif am westlichen Himmel, aber sie kannten ja den Weg. Sie sprachen miteinander und waren guter Dinge. Sie gingen ja nur zum Friedhof hinunter, um zu sehen, ob das Grab offen stand, damit Bard nicht schlaflos dazuliegen und über diese Sache nachzugrübeln brauchte.
»Mir scheint es ganz unglaublich, dass die drüben in Hedeby so tollkühn sein sollten, den Ring nicht wieder einzumauern«, sagte Bard.
»Ja, darüber werden wir bald Klarheit haben«, sagte die Frau. »Wenn mich nicht alles trügt, ist das die Friedhofsmauer, die wir da neben uns haben.«
Der Mann blieb stehen. Er wunderte sich, dass die Stimme der Frau so fröhlich klang. Es konnte doch nicht möglich sein, dass sie bei dieser Wanderung eine andere Absicht hatte als er.
»Bevor wir in den Friedhof hineingehen«, sagte Bard, »sollten wir doch übereinkommen, was wir tun wollen, falls das Grab offen steht.«
»Ob es nun verschlossen oder offen ist, ich wüsste nicht, dass wir etwas anderes zu tun haben, als heimzugehen und uns niederzulegen.«
»Nein, natürlich. Da hast du ganz recht«, sagte Bard und setzte sich wieder in Gang.
»Es ist nicht zu erwarten, dass das Friedhofstor um diese Zeit offen steht«, sagte er gleich darauf.
»Das wohl nicht«, sagte die Frau. »Wir müssen schon über die Mauer klettern, wenn wir bei dem General vorsprechen und sehen wollen, wie es ihm geht.«
Wieder war der Mann erstaunt. Er hörte ein leichtes Rascheln von niederfallenden Steinchen und sah gleich darauf, wie sich die Gestalt der Frau von dem lichten Streif im Westen abzeichnete. Sie war schon auf der Mauer oben, und das war ja kein Kunststück, da sie nicht mehr als ein paar Fuß hoch war; aber es war doch seltsam, dass sie sich so eifrig zeigte und vor ihm hinaufgestiegen war. »Sieh her! Nimm meine Hand, dann will ich dir hinaufhelfen«, sagte sie.
Gleich darauf hatten sie die Mauer hinter sich und gingen still und vorsichtig zwischen all den kleinen Grabhügelchen weiter.
Einmal strauchelte Bard über ein Hügelchen und wäre fast gefallen. Es war ihm so, als hätte ihm jemand ein Bein gestellt. Er erschrak dermaßen, dass er zitterte, und er sagte ganz laut, damit all die Toten es hörten, wie gutgesinnt er war:
»Hier möchte ich nicht gehen, wenn ich in unrechter Absicht gekommen wäre.«
»Nein, nicht wahr!« sagte die Frau, »da hast du freilich recht. Aber weißt du, dort drüben haben wir schon das Grab.«
Er sah undeutlich die schräg gestellten Grabplatten gegen den dunklen Nachthimmel. Gleich darauf waren sie an dem Grab angelangt, und sie fanden es offen. Das Grabgewölbe war nicht zugemauert.
»Das ist aber doch wirklich sehr fahrlässig«, sagte der Mann. »Das ist ja wie eigens gemacht, um all jene, die wissen, was für ein Schatz hier unten verborgen liegt, der schlimmsten Versuchung auszusetzen.«
»Sie verlassen sich wohl darauf, dass niemand einem Toten zu nahe treten will«, sagte die Frau.
»Es ist ja auch kein Spaß, sich in eine solche Grabkammer hinunterzuwagen«, sagte der Mann. »Hinunterzuspringen wäre ja nicht so schwer, aber dann bliebe man drunten sitzen wie der Fuchs in der Fuchsfalle.«
»Ich sah heute Vormittag, dass sie eine kleine Leiter in das Grab gestellt hatten«, sagte die Frau, »aber die müssen sie doch wenigstens weggenommen haben.«
»Ich muss wahrhaftig nachsehen«, sagte der Mann und tastete zu dem offenen Grab hin. »Nein, denk dir nur!« rief er aus. »Das übersteigt doch alle Grenzen. Die Leiter steht noch da.«
»Das ist wirklich sehr nachlässig«, stimmte die Frau bei. »Aber weißt du, ich finde, es macht nicht so sehr viel, dass die Leiter da steht. Denn er, der hier drunten in der Tiefe wohnt, kann das Seinige schon verteidigen.«
»Wenn ich das nur sicher wüsste«, sagte der Mann. »Vielleicht sollte ich doch wenigstens die Leiter wegstellen.«
»Ich glaube nicht, dass wir irgendetwas beim Grab berühren sollen«, sagte die Frau. »Es ist am besten, wenn der Totengräber morgen das Grab genau so findet, wie er es verlassen hat.«
Sie standen da und starrten in das schwarze Loch hinunter, unentschlossen und ratlos. Sie hätten ja jetzt nach Hause gehen sollen, aber irgendetwas Geheimes, etwas, was keines von ihnen auszusprechen wagte, hielt sie zurück.
»Ja, freilich könnte ich die Leiter stehen lassen«, sagte Bard schließlich, »wenn ich nur sicher wüsste, dass der General die Macht hat, die Diebe fernzuhalten.
»Du kannst ja ins Grab hinuntersteigen, dann wirst du schon sehen, welche Macht er hat«, sagte die Frau.
Es war, als hätte Bard nur auf diese Worte seiner Frau gewartet. Im Nu war er bei der Leiter und unten im Grabgewölbe. Aber kaum stand er auf dem Steinboden der Grabkammer, als er ein Knacken der Leiter hörte und merkte, dass die Frau ihm nachkam.
»So so, du kommst mir auch hierher nach«, sagte er.
»Ich traue mich nicht, dich hier unten mit dem Toten allein zu lassen.«
»Ach, ich glaube gar nicht, dass er so gefährlich ist«, sagte der Mann. »Ich spüre keine kalte Hand, die mir das Leben auspressen will.«
»Ja, sieh, er will uns wohl nichts zuleide tun«, sagte die Frau. »Er weiß ja, dass wir nicht daran denken, den Ring zu stehlen, aber eine andere Sache wäre es natürlich, wenn wir nur so zum Spaß versuchen wollten, den Sargdeckel abzuschrauben.«
Sofort tappte der Mann zum Sarg des Generals hin und begann den Deckel abzutasten. Er fand eine Schraube, die ein kleines Kreuzchen an der Spitze hatte.
»Alles hier ist förmlich für einen Dieb zurechtgelegt«, sagte er, indem er die Sargschrauben vorsichtig und dabei behänd aufzudrehen begann.
»Spürst du nichts?« fragte die Frau. »Merkst du nicht, dass sich unter dem Sargdeckel etwas regt?«
»Hier ist es so still wie im Grab«, sagte der Mann.
»Er glaubt wohl nicht, dass wir ihm das nehmen wollen, woran er am meisten hängt«, sagte die Frau. »Eine andere Sache wäre es, wenn wir den Sargdeckel abheben würden.«
»Ja, aber dabei musst du mir helfen«, sagte der Mann.
Sie hoben den Deckel in die Höhe, und nun gab es keine Möglichkeit mehr, der Sehnsucht nach dem Schatz Einhalt zu tun. Sie lösten den Ring von der welken Hand, legten den Deckel zurück und schlichen sich ohne ein weiteres Wort aus dem Grab hinauf. Sie nahmen sich bei der Hand, als sie über den Friedhof gingen, und erst nachdem sie über die niedere Steinmauer geklettert waren und unten auf dem Weg standen, wagten sie etwas zu sprechen.
»Jetzt fange ich an zu glauben«, sagte die Frau, »dass er es so haben wollte. Er hat eingesehen, dass es nicht recht von einem toten Mann ist, ein solches Kleinod zu behalten, und darum hat er es uns gutwillig gegeben.«
Da lachte der Mann hell aus. »Ja, das machst du gut, du«, sagte er. »Nein, das wirst du mir nicht weismachen, dass er ihn uns gutwillig gelassen hat. Aber er hatte eben nicht die Macht, uns zu hindern.«
»Weißt du«, sagte die Frau, »heute Nacht bist du wirklich tapfer gewesen. Es gibt nicht viele, die sich in das Grab zum General hinuntergewagt hätten.«
»Ich habe nicht das Gefühl, als ob ich etwas Unrechtes getan hätte«, sagte der Mann. »Einem Lebenden habe ich nie auch nur einen Taler genommen, aber was sollte es schaden, einem Toten etwas zu nehmen, was er gar nicht braucht?«
Sie fühlten sich stolz und frohgemut, wie sie so einhergingen. Sie wunderten sich, dass niemand außer ihnen auf diesen Gedanken gekommen war. Bard sagte, er wolle nach Norwegen fahren und den Ring verkaufen, sobald sich nur eine Gelegenheit bot. Sie glaubten, sie würden so viel Geld dafür bekommen, dass sie sich nie mehr um diese Ware Sorgen zu machen brauchten.
»Aber«, sagte die Frau, und blieb plötzlich stehen, »was sehe ich denn da? Fängt es schon an zu tagen? Es sieht so hell im Osten aus.«
»Nein, das kann noch nicht die Sonne sein, die kommt«, sagte der Mann. »Das muss ein Feuer sein. Es sieht so aus, als wäre es in der Olsbyer Gegend. Wenn es nur nicht …«
Ein lauter Schrei der Frau unterbrach ihn. »Bei uns brennt es!« schrie sie. »Der Mellomhof brennt. Der General hat ihn angezündet … … …«
Am Montagmorgen kam der Totengräber in großer Eile nach Hedeby gestürzt, das ja in der unmittelbaren Nähe der Kirche liegt, um zu vermelden, dass sowohl er wie der Maurer, der das Grab wieder zumauern wollte, bemerkt hatten, dass der Deckel auf dem Sarg des Generals schief lag und die Schilder und Sterne, die ihn schmückten, verschoben waren.
Augenblicklich wurde eine Untersuchung vorgenommen. Man bemerkte sofort, dass große Unordnung in der Grabkammer herrschte und die Schrauben des Sarges gelockert waren. Als man den Deckel abhob, sah man auf den ersten Blick, dass der Königsring nicht mehr an seinem Platz am linken Zeigefinger des Generals war.
3
Ich denke an König Karl XII., und ich suche mir zu vergegenwärtigen, wie man ihn liebte und fürchtete. Denn ich weiß, dass es sich einmal in einein der letzten Jahre seines Lebens begab, dass er mitten während eines Gottesdienstes in die Karlstadter Kirche kam. Er war in die Stadt eingeritten, allein und unerwartet, und da er wusste, dass Gottesdienst war, ließ er das Pferd vor der Kirchentür stehen und ging den allgemeinen Weg durch das Wappenhaus hinein wie jeder andere.
Als er zur Tür hineingekommen war, sah er jedoch, dass der Prediger schon auf der Kanzel stand. Und um ihn nicht zu stören, blieb er da, wo er war. Er suchte sich nicht einmal einen Platz in einer Bank, sondern lehnte sich mit dem Rücken an den Türpfosten und hörte zu.
Aber obwohl er so unbemerkt hineingekommen war, und obwohl er sich unter dem Dunkel der Empore ganz still verhielt, war doch jemand in der hintersten Bank, der ihn erkannte. Es war vielleicht ein alter Soldat, der in den Feldzügen Arm oder Bein verloren hatte und vor Poltawa heimgeschickt worden war; der sagte sich, dass der Mann mit dem hinauf gekämmten Haar und der Hakennase der König sein müsse. Und in demselben Augenblick, in dem er ihn erkannte, erhob er sich.
Die Nachbarn in der Bank werden sich wohl gewundert haben, warum er aufstand, und da flüsterte er ihnen zu, dass der König in der Kirche wäre. Und unwillkürlich erhob sich da die ganze Bank, wie man es zu tun pflegte, wenn Gottes eigenes Wort vom Altar oder der Kanzel verkündigt wurde.
Hierauf verbreitete sich die Neuigkeit von Bank zu Bank durch die ganze Kirche und jeder Mensch, jung und alt, reich und arm, der Schwache wie der Gesunde, allesamt standen sie auf.
Dies war, wie gesagt, in einem der letzten Jahre von König Karls Leben, als Sorgen und Misserfolge bereits begonnen hatten, und es vielleicht in der ganzen Kirche nicht einen Menschen gab, der nicht durch das Verschulden des Königs lieber Anverwandter beraubt war oder sein Vermögen eingebüßt hatte. Und wenn einer zufällig für sein eigen Teil nichts zu beklagen hatte, so brauchte er ja nur daran zu denken, wie verarmt das Land dalag, wie viele Provinzen verloren waren und wie das ganze Reich von Feinden umzingelt war.
Aber doch, aber doch! Man brauchte nur ein Flüstern zu hören, dass der Mann, den man oft und oft verflucht hatte, hier drinnen im Gotteshause stand, und schon erhob man sich. Und stehen blieb man. Da war keiner, der daran dachte, sich niederzusetzen. Das konnte man nicht. Der König stand dort unten an der Kirchentür, und solange er stand, mussten sie alle stehen. Wenn einer sich gesetzt hätte, würde er ja dem König Missachtung bewiesen haben. Die Predigt würde vielleicht lange dauern, aber das musste man hinnehmen. Man wollte ihn dort an der Kirchentür nicht im Stich lassen.
Er war ja eigentlich ein Soldatenkönig, und er war es gewohnt, dass seine Krieger gerne für ihn in den Tod gingen. Aber hier in der Kirche war er von schlichten Bürgern und Handwerkern umgeben, von gewöhnlichen schwedischen Männern und Frauen, die nie auf ein »Stillgestanden!« gehört hatten. Aber er brauchte sich nur unter ihnen zu zeigen, und sie waren in seiner Gewalt. Sie wären mit ihm gegangen, wohin er wollte, sie hätten ihm gegeben, was er wünschte, sie glaubten an ihn, sie beteten ihn an. In der ganzen Kirche dankten sie Gott für den Wundermann, der Schwedens König war.
Wie gesagt, ich versuche mich in dies hineinzudenken, um zu verstehen, wie die Liebe zu König Karl die ganze Seele eines Menschen ausfüllen, wie sie sich in einem spröden, strengen, alten Herzen so einnisten konnte, dass alle Menschen erwarteten, dass sie auch noch nach dem Tode andauerte. —
Wahrlich, nachdem es entdeckt worden war, dass man den Ring des Generals gestohlen hatte, wunderte man sich im Kirchspiel Bro am meisten darüber, dass jemand den Mut gehabt hatte, die Tat zu vollbringen. Man meinte, liebende Frauen, die mit dem Verlobungsring am Finger begraben worden waren, die hätten die Diebe ungestraft ausplündern können. Oder, wenn eine Mutter mit einer Locke vom Haar ihres Kindes zwischen den Händen im Todesschlummer gelegen hätte, so hätte man sie ihr ohne Furcht entreißen können; oder wenn ein Priester mit der Bibel als Kopfkissen in den Sarg gebettet worden wäre, so hätte man sie ihm vermutlich ohne böse Folgen für den Schuldigen rauben können. Aber Karls XII. Ring vom Finger des toten Generals auf Hedeby zu rauben, das war ein Unterfangen, von dem man nicht begreifen konnte, dass ein vom Weib Geborener sich daran gewagt hatte.
Natürlich wurden Nachforschungen angestellt, aber sie führten nicht zur Entdeckung des Schuldigen. Der Dieb war im Nachtdunkel gekommen und gegangen, ohne irgendeine Spur zu hinterlassen, die dem Suchenden einen Fingerzeig geben konnte.
Darüber verwunderte man sich wiederum. Man hatte ja von Verstorbenen gehört, die Nacht für Nacht umgegangen waren, um den Verüber eines weit geringeren Verbrechens zu bezeichnen.
Aber als man endlich erfuhr, dass der General den Ring keineswegs seinem Schicksal überließ, sondern, um ihn wiederzugewinnen, mit derselben grimmigen Unbarmherzigkeit kämpfte, die er gezeigt hätte, wenn der Ring ihm bei Lebzeiten gestohlen worden wäre, da nahm dies keinen Menschen im geringsten wunder. Niemand zeigte Unglauben, denn das war es ja gerade, was man erwartet hatte.
4
Als der Ring des Generals schon mehrere Jahre verschwunden war, begab es sich eines schönen Tages, dass der Propst von Bro zu einem armen Bauer, Bard Bardsson auf die Olsbyalm gerufen wurde, der in den letzten Zügen lag und durchaus mit dem Propst selbst sprechen wollte, bevor er starb.
Der Propst war ein älterer Mann, und als er hörte, dass es sich darum handelte, einen Kranken aufzusuchen, der meilenweit weg im pfadlosen Wald wohnte, schlug er vor, der Vikar möge sich an seiner Statt hinbegeben. Aber die Tochter des Sterbenden, die mit der Botschaft gekommen war, sagte ganz bestimmt, der Propst müsse es sein oder keiner. Der Vater ließe sagen, er habe etwas zu erzählen, was nur der Propst, aber sonst niemand auf Erden erfahren dürfe.
Als der Propst dies hörte, begann er seine Erinnerungen zu durchforschen. Bard Bardsson war ein braver Mann gewesen. Allerdings ein bisschen einfältig, aber deswegen brauchte er sich doch nicht auf seinem Totenbette zu ängstigen. Ja, nach Menschenweise gesehen, würde der Propst sagen, dass er einer von jenen war, die eine Forderung an unseren Herrgott hatten. In den letzten sieben Jahren war er von allen erdenklichen Leiden und Unglücksfällen heimgesucht worden. Der Hof war ihm abgebrannt, das Vieh war an Krankheit eingegangen oder von wilden Tieren zerrissen worden, der Frost hatte die Felder verheert, so dass er arm geworden war wie Hiob. Schließlich war die Frau über all dies Unglück so verzweifelt, dass sie ins Wasser gegangen war, und Bard selbst war auf eine Alm hinaufgezogen, die das einzige war, was er noch sein eigen nannte. Seit jener Zeit hatte weder er selbst, noch seine Kinder sich in der Kirche blicken lassen. Man hatte oftmals im Pfarrhof darüber gesprochen und gezweifelt, ob sie wohl noch im Kirchspiel waren.
»Wenn ich deinen Vater recht kenne, so hat er kein so arges Verbrechen begangen, dass er es nicht dem Vikar anvertrauen könnte«, sagte der Propst und sah Bard Bardssons Tochter mit einem wohlwollenden Lächeln an.
Sie war ein vierzehnjähriges Ding, aber groß und stark für ihr Alter. Das Gesicht war breit, und die Züge waren grob. Sie sah ein bisschen einfältig aus wie der Vater, aber kindliche Unschuld und Treuherzigkeit erhellten das Gesicht.
»Der hochwürdige Herr Propst fürchtet sich doch nicht vor dem Starken Bengt, dass er sich deshalb nicht traut, zu uns zu kommen?« fragte sie.
»Was sagst du da, Kind?« gab der Propst zurück. »Was ist das für ein Starker Bengt, von dem du sprichst?«
»Ach, das ist doch der, der macht, dass uns alles schief geht.«
»So so«, sagte der Propst, »so so, das tut einer, der der Starke Bengt heißt?«
»Weiß der hochwürdige Propst nicht, dass er es ist, der den Mellomhof angezündet hat?«
»Nein, davon habe ich noch nie etwas gehört«, sagte der Propst.
Aber zugleich erhob er sich von seinem Sitz und begann das Brevier und einen hölzernen Abendmahlskelch hervorzusuchen, den er bei seinen Versehgängen mitzunehmen pflegte. —
»Er hat meine Mutter ins Wasser gejagt«, fuhr die Kleine fort.
»Ei der Tausend«, sagte der Propst, »lebt er noch, dieser Starke Bengt? Hast du ihn gesehen?«
»Nein, gesehen habe ich ihn nicht«, sagte das Kind, »aber freilich lebt er. Seinetwegen mussten wir ja in den wilden Wald, in die Einöde hinaufziehen. Da haben wir Ruhe vor ihm gehabt, bis vorige Woche, da hat sich der Vater in den Fuß gehackt.«
»Und daran, meinst du, ist der Starke Bengt schuld?« fragte der Propst mit seiner allergleichmütigsten Stimme,aber er öffnete dabei die Türe und rief seinem Knecht zu, er möge das Pferd satteln.
»Der Vater hat gesagt, dass der Starke Bengt die Axt verzaubert hat, sonst hätte er sich nie damit geschnitten. Es war ja auch keine gefährliche Wunde. Aber heute hat der Vater gesehen, dass der kalte Brand in den Fuß gekommen ist. Er hat gesagt, dass er jetzt sterben muss, weil der Starke Bengt ihm den Garaus gemacht hat; und er hat mich hierher in den Pfarrhof geschickt und sagen lassen, der Herr Propst möchte selbst kommen, so bald er nur kann.«
»Ich werde auch kommen«, sagte der Propst. Er hatte, während das Mädchen sprach, den Reitmantel umgeworfen und den Hut ausgesetzt. »Aber weißt du, eins kann ich nicht verstehen«, sagte er, »warum dieser Starke Bengt es so scharf auf deinen Vater hat. Bard wird ihm doch nicht einmal zu nahe getreten sein?«
»Ja, das leugnet der Vater gar nicht«, sagte das Kind. »Aber er hat nie gesagt, was es ist, weder mir, noch meinem Bruder. Aber ich glaube, darüber will er jetzt mit dem hochwürdigen Herrn Propst sprechen.«
»Ja, wenn es so ist«, sagte der Propst, »dann können wir nicht rasch genug zu ihm kommen.«
Er hatte nun die Reithandschuhe angezogen und ging mit dem Mädchen aus dem Zimmer, um sich auf das Pferd zu setzen.
Auf dem ganzen Ritt zur Alm hinauf sprach der Propst kaum ein Wort. Er saß da und grübelte über dieses Merkwürdige nach, das das Kind erzählt hatte. Er für seine Person hatte nur einen Mann getroffen, den die Leute den Starken Bengt zu nennen pflegten. Aber es konnte ja auch sein, dass das Mädchen gar nicht von diesem, sondern von einem ganz anderen Menschen gesprochen hatte.
Als er auf die Alm kam, lief ihm ein junger Bursch entgegen. Das war Bard Bardssons Sohn, Ingilbert. Er war einige Jahre älter als die Schwester, groß gewachsen wie sie und ihr auch in den Gesichtszügen ähnlich, aber er hatte tiefer liegende Augen und sah nicht so treuherzig und gutmütig aus wie sie.
»Das war ein langer Ritt für den Herrn Propst«, sagte er, während er ihm vom Pferde half.
»Ach ja«, sagte der alte Mann, »aber es ist rascher gegangen, als ich geglaubt hätte.«
»Eigentlich hätte ich den Herrn Propst abholen sollen«, sagte Ingilbert. »Aber ich war seit gestern Abend draußen auf dem Fischfang. Eben erst, als ich nach Hause kam, erfuhr ich, dass der Vater den Brand im Fuß hat und dass man den Herrn Propst geholt hat.«
»Martha ist so gut wie ein Mann gewesen«, sagte der Propst. »Alles ist gut abgelaufen. Aber wie steht es jetzt mit Bard?«
»Recht schlecht. Aber er ist bei klarem Bewusstsein. Er hat sich gefreut, als ich ihm sagte, dass man den Herrn Propst schon am Waldesrand sieht.«
Der Propst ging nun zu Bard hinein, und die Geschwister setzten sich auf ein paar breite Steinplatten vor der Hütte und warteten. Sie fühlten sich feierlich gestimmt, und sie sprachen von dem Vater, der nun sterben sollte. Sie sagten, dass er immer gut zu ihnen gewesen war. Aber glücklich war er nicht gewesen, seit dem Tag, an dem der Mellomhof abgebrannt war; und so war es wohl am besten, wenn er aus diesem Leben scheiden konnte.
Wie sie so miteinander sprachen, sagte die Schwester, der Vater müsse doch etwas gehabt haben, was sein Gewissen belastete.
»Vater!« sagte der Bruder. »Was sollte ihn bedrückt haben? Ich habe nie gesehen, dass er die Hand gegen Mensch oder Tier erhoben hat.«
»Aber er wollte doch mit dem Propst über etwas sprechen und nur mit ihm.«
»Hat er das gesagt?« fragte Ingilbert. »Hat er gesagt, dass er dem Propst etwas sagen will, bevor er stirbt? Ich dachte, er wollte ihn nur haben, um das heilige Abendmahl zu empfangen.«
»Als er mich heute wegschickte, sagte er, ich sollte den Propst bitten, zu kommen. Der Propst sei der einzige Mensch auf der Welt, dem er seine große, schwere Sünde anvertrauen könne.«
Ingilbert saß da und grübelte einen Augenblick nach. »Das klingt sehr sonderbar«, sagte er. »Ob das nicht etwas sein kann, was er sich nur eingebildet hat, wie er so hier in der Einsamkeit herumgegangen ist? Es wird damit wohl so sein wie mit all dem, was er vom Starken Bengt zu erzählen pflegt. Ich glaube, das ist auch nichts anderes als Einbildung.«
»Eben vom Starken Bengt wollte er mit dem Propst sprechen«, sagte das Mädchen.
»Da kannst du Gift drauf nehmen, dass das lauter Grillen sind«, sagte Ingilbert.
Damit stand er auf und ging zu einer kleinen Luke in der Wand der Almhütte, die offen stand, damit ein bisschen Luft und Licht in die fensterlose Wohnstätte dringen konnte. Das Bett des Kranken stand so nahe, dass alles, was er sagte, draußen von Ingilbert gehört werden konnte. Und der Sohn lauschte den Worten des Vaters, ohne sich im geringsten ein Gewissen daraus zu machen. Vielleicht hatte er überhaupt nicht gehört, dass es unrecht ist, einer Beichte zu lauschen. Auf jeden Fall war er überzeugt, dass der Vater keine gefährlichen Geheimnisse zu enthüllen hatte.
Nachdem er ein Weilchen neben der Luke gestanden hatte, kam er wieder zur Schwester zurück.
»Was habe ich gesagt?« begann er. »Der Vater erzählt gerade dem Propst, dass er und die Mutter dem alten General Löwensköld den Königsring gestohlen haben.«
»Ah, Gott erbarme sich!« rief die Schwester. »Sollen wir dem Propst nicht sagen, dass das Lüge ist, nur so etwas, das er sich andichtet?«
»Jetzt können wir nichts tun«, sagte Ingilbert. »Jetzt muss man ihn wohl reden lassen, was er will. Wir können nachher mit dem Propst sprechen.«
Er schlich wieder zur Luke hin, um zu horchen. Es dauerte nicht lange, so kam er abermals zur Schwester.
»Jetzt sagt er, in derselben Nacht, in der er und die Mutter unten im Grab gewesen sind und den Ring genommen haben, ist der Mellomhof abgebrannt. Er sagt, er glaubt, dass es der General war, der ihm den Hof angezündet hat.«
»Man merkt ja, dass das nur so eine Grille ist«, sagte die Schwester. »Uns hat er doch wenigstens hundertmal gesagt, dass es der Starke Bengt war, der den Mellomhof angezündet hat.«
Ingilbert war, bevor sie noch zu Ende gesprochen hatte, schon wieder auf seinem Posten unter der Luke. Da stand er lange und horchte, und als er wieder zur Schwester hinkam, war er beinahe aschgrau im Gesicht.
»Er sagt, es war der General, der ihm all das Unglück geschickt hat, um ihn zu zwingen, den Ring zurückzugeben. Er sagt, die Mutter hätte Angst bekommen und wollte, dass sie zum Rittmeister nach Hedeby gingen und ihm den Ring zurückgäben. Und der Vater hätte ihr nur zu gerne gehorcht, aber er traute sich nicht, weil er meinte, sie würden alle beide gehängt werden, wenn sie eingestünden, dass sie einen Toten bestohlen hatten. Aber da konnte die Mutter es nicht länger aushalten, sondern ging hin und ertränkte sich.«
Jetzt wurde auch die Schwester vor Entsetzen aschfahl im Gesicht. »Aber«, sagte sie, »der Vater hat doch immer gesagt, dass es …«
»Ja, gewiss. Eben erst hat er dem Propst erklärt, dass er es nicht gewagt hat, mit irgendeinem Menschen darüber zu sprechen, wer all das Unglück über ihn verhängt hat. Nur uns Kindern, weil wir nichts davon verstehen, hat er gesagt, da wäre einer, der der Starke Bengt heißt, der verfolge ihn. Er sagte, dass die Bauersleute den General immer den Starken Bengt zu nennen pflegten.«
Martha Bardstochter sank ganz in sich zusammen, wie sie da saß.
»Aber dann ist es ja wahr«, flüsterte sie so leise, als sollte dies ihr letzter Atemzug sein.
Sie sah sich nach allen Seiten um. Die Sennhütte stand am Ufer eines Waldweihers, und ringsherum erhoben sich dunkelbewaldete Bergrücken. Es gab weit und breit keine menschliche Behausung, es gab niemand, zu dem sie sich flüchten konnte. Hier herrschte die große unentrinnbare Einsamkeit.
Und es war ihr, als stünde in dem Dunkel unter den Bäumen der Tote auf der Lauer, um ihnen Unglück zu senden.
Sie war noch ein solches Kind, dass sie die Schuld und Unehre, die die Eltern auf sich geladen hatten, nicht recht erfassen konnte; aber was sie begriff, war, dass ein Gespenst, ein unversöhnliches, allmächtiges Wesen aus dem Land der Toten sie alle verfolgte. Sie war gewärtig, es jederzeit zu erblicken, und sie bekam solche Angst, dass ihre Zähne aufeinanderschlugen.
Sie dachte daran, dass der Vater nun sieben Jahre mit derselben Angst in der Seele herumgegangen war. Sie war jetzt vierzehn Jahre, und sie wusste, dass sie erst sieben gewesen, als der Mellomhof abgebrannt war. Der Vater hatte die ganze Zeit gewusst, dass der Tote auf der Jagd nach ihm war. Es war gut für ihn, dass er sterben durfte.
Ingilbert war wieder drüben gewesen und hatte gehorcht, jetzt kam er zu ihr zurück.
»Du glaubst es doch nicht, Ingilbert?« sagte sie mit einem letzten Versuch, die Angst zu verscheuchen.
Aber da sah sie, dass Ingilberts Hände zitterten und die Augen entsetzt starrten. Er hatte ebensolche Angst wie sie.
»Was soll ich glauben?" flüsterte Ingilbert. »Der Vater sagt, er hätte mehrmals versucht, nach Norwegen hinüberzugelangen, um den Ring zu verkaufen. Aber er konnte nie fortkommen. Das eine Mal wurde er krank, das andere Mal brach das Pferd das Bein, gerade als er vom Hof wegreiten wollte.«
»Was sagt der Propst?« fragte das Mädchen.
»Er hat den Vater gefragt, warum er all diese Jahre den Ring behalten hat, wenn es doch mit so großer Gefahr verknüpft war, ihn zu besitzen. Aber der Vater gab zur Antwort, er hätte geglaubt, der Rittmeister würde ihn hängen lassen, wenn er seine Tat eingestand. Er hatte keine Wahl, er war gezwungen, ihn zu behalten. Aber nun wusste er, dass er sterben müsse, und nun wollte er den Ring dem Propst geben, damit man ihn dem General ins Grab lege und wir Kinder von dem Fluch befreit werden und wieder hinunter ins Dorf ziehen können.«
»Ich bin froh, dass der Propst da ist«, sagte das Mädchen. »Ich weiß nicht, was ich anfangen soll, wenn er fort ist. Ich fürchte mich so. Es kommt mir so vor, als ob der General dort drüben unter den Tannen steht. Denke nur, dass er alle Tage hier herumgegangen ist und uns bewacht hat! Und der Vater hat ihn vielleicht gesehen.«
»Ich glaube schon, dass der Vater ihn gesehen hat«, sagte Ingilbert.
Er ging wieder zur Hütte hin, um zu lauschen. Als er zurückkam, hatte er einen anderen Ausdruck in den Augen.
»Ich habe den Ring gesehen«, sagte er. »Der Vater hat ihn dem Propst gegeben. Er schimmert wie eine Feuerflamme. Er ist rot und gelb. Er leuchtet. Der Propst hat ihn angeschaut und gesagt, er sähe, dies wäre der Ring des Generals. Geh nur zur Luke hin, dann kannst du ihn auch sehen!«
»Eher möchte ich eine Natter in die Hand nehmen, als diesen Ring ansehen«, sagte das Mädchen, »Du meinst doch nicht wirklich, dass er schön anzusehen ist?«
Ingilbert sah weg. »Ich weiß ja, dass er uns zugrunde gerichtet hat«, sagte er, »aber gefallen hat er mir doch.«
Gerade als er dies sagte, drang die Stimme des Propstes stark und laut zu den beiden Geschwistern hinaus. Bis dahin hatte er den Kranken reden lassen. Nun war die Reihe an ihm.
Es war klar, dass er auf all diese wilden Reden von der Verfolgung eines Toten nicht eingehen konnte. Er versuchte dem Bauer zu zeigen, dass es Gottes Strafe war, die ihn ereilt hatte, weil er ein so grässliches Verbrechen begangen, einen Leichnam zu bestehlen. Der Propst wollte durchaus nicht einräumen, dass der General die Macht gehabt hatte, eine Feuersbrunst anzustiften, oder Krankheiten über Mensch und Vieh zu verhängen. Nein, die Unglücksfälle, die Bard getroffen hatten, waren Gottes Fingerzeige, ihn zu zwingen, seine Tat zu bereuen und das Gestohlene, noch bei Lebzeiten, zurückzuerstatten, auf dass seine Sünde vergeben werde und er eines seligen Todes sterben könne.
Der alte Bard Bardsson lag still da und hörte die Worte des Propstes, ohne einen Einwand zu erheben. Aber zu überzeugen vermochten sie ihn wohl nicht. Er hatte zu viel Schreckliches erlebt, um glauben zu können, dass all dies von Gott kam.
Aber die Geschwister, die dasaßen und vor Gespensterfurcht und Geisterangst zitterten, lebten förmlich auf.
»Hörst du ?« sagte Ingilbert und packte die Schwester heftig am Arm. »Hörst du? Der Propst sagt, dass es nicht der General war?«
»Ja«, sagte die Schwester. Sie saß mit gefalteten Händen da und sog jedes Wort, das der Propst sagte, tief in die Seele ein.
Ingilbert stand auf. Er schöpfte heftig Atem und richtete den Körper in die Höhe. Er war von seiner Furcht befreit. Er sah aus wie ein anderer Mensch. Hastig ging er zur Hüttentür und trat ein.
»Was ist denn ?« fragte der Propst.
»Ich will ein paar Worte mit dem Vater sprechen.«
»Geh fort! Jetzt spreche ich mit deinem Vater«, sagte der Propst streng.
Wieder wendete er sich Bard Bardsson zu und sprach bald nachdrücklich, bald milde und erbarmungsvoll zu ihm. Ingilbert hatte sich auf die Steinplatte gesetzt und die Hände vors Gesicht geschlagen. Aber eine große Unruhe hatte sich seiner bemächtigt. Er ging wieder in die Hütte hinein und wurde wieder fortgewiesen.
• • •
Als alles vorüber war, sollte Ingilbert dem Propst den Weg durch den Wald zurück zeigen. Anfangs ging alles gut, aber nach einiger Zeit sollten sie über ein überbrücktes Moor. Der Propst konnte sich nicht entsinnen, dass er auf dem Hinweg über ein solches gekommen war, und er fragte, ob Ingilbert ihn nicht irreführe, aber dieser gab zur Antwort, es wäre eine große Abkürzung, wenn sie den Weg über das Moor nehmen konnten.
Der Propst sah Ingilbert scharf an. Er hatte zu bemerken geglaubt, dass er wie der Vater vom Gelddurst besessen war. Ingilbert war ja ein Mal ums andere in die Hütte gekommen, wie um zu verhindern, dass der Vater den Ring hergebe.
»Das ist aber ein schmaler, gefährlicher Weg, du, Ingilbert«, sagte er. »Ich fürchte, dass das Pferd auf den glatten Stämmen ausgleitet.«
»Ich werde das Pferd schon führen, der hochwürdige Herr Propst braucht keine Angst zu haben«, sagte Ingilbert, und damit griff er auch schon nach den Zügeln des Pferdes.
Als sie mitten draußen auf dem Moor waren, nichts anderes als lockeren Morast auf allen Seiten, begann er jedoch das Pferd zurückzutreiben. Es sah aus, als wollte er es von dem schmalen Steg herabdrängen.
Das Pferd bäumte sich, und der Propst, der sich nur schwer im Sattel erhalten konnte, rief dem Begleiter zu, doch um Gottes willen den Zügel loszulassen.
Aber Ingilbert schien nichts zu hören, und der Propst sah, wie er mit düsterem Gesicht und zusammengebissenen Zähnen mit dem Pferd kämpfte, um es in den Sumpf hinunterzutreiben. Es war der sichere Tod, der Roß und Reiter erwartete.
Da steckte der Propst die Hand in die Tasche und zog ein kleines Beutelchen aus Ziegenleder hervor. Das schleuderte er Ingilbert gerade ins Gesicht.
Dieser ließ den Zügel los, um den Beutel aufzufangen, und das Pferd war frei. Erschreckt raste es weiter über den Pfad. Ingilbert blieb stehen und machte keinen Versuch zu folgen.
5
Man kann sich nicht wundern, dass der Propst nach einem solchen Erlebnis ein bisschen wirr im Kopfe war und es Abend wurde, bis er den Weg ins Dorf hinunter fand. Auch war es nicht merkwürdig, dass er nicht auf der Olsbyer Straße, die der beste und kürzeste Weg war, aus dem Wald herauskam, sondern zu weit nach Süden abgebogen war, so dass er unmittelbar über Hedeby herauskam.
Während er drinnen im Waldesdickicht herumritt, sagte er sich, dass das erste, was er zu tun hatte, nachdem er glücklich heimgekommen war, sein musste, einen Boten zum Amtmann zu schicken, um ihn zu veranlassen, sich in den Wald zu begeben und Ingilbert den Ring wieder abzunehmen. Aber als er nun an Hedeby vorbei ritt, erwog er bei sich selbst, ob er nicht dort einsprechen und den Rittmeister Löwensköld wissen lassen sollte, wer es war, der sich erdreistet hatte, in das Grab hinabzusteigen und den Königsring zu stehlen.
Man könnte ja meinen, dass er über eine so natürliche Sache gar nicht erst lange nachzugrübeln brauchte, aber der Propst zögerte, weil er wusste, dass zwischen dem Rittmeister und seinem Vater nicht das beste Einvernehmen geherrscht hatte. Der Rittmeister war in ebenso hohem Grad ein Mann des Friedens, wie der Vater ein Mann des Kriegs gewesen war. Er hatte sich beeilt, seinen Abschied aus dem Kriegsdienst zu nehmen, sobald wir nur Frieden mit dem Russen hatten; und seither hatte er all seine Kräfte dafür eingesetzt, dem Wohlstand im Land aufzuhelfen, der in den Kriegsjahren ganz niedergebrochen war. Er war ein Gegner von Alleinherrschaft und Kriegsruhm, ja er pflegte über Karl den XII. in höchst eigener Person Übles zu sprechen, wie auch über so manches andere, was der Alte hochstellte. Um das Maß vollzumachen, war der Sohn ein eifriger Teilnehmer im Reichstagskrieg gewesen, aber stets als Anhänger der Friedenspartei. Ja, zwischen ihm und dem Vater hatte es so manchen Zankapfel gegeben.
Als nun vor sieben Jahren der Ring des Generals gestohlen worden war, hatte der Propst und viele mit ihm gemeint, dass der Rittmeister es sich nicht sonderlich angelegen sein ließ, ihn wiederzuerlangen. Und all dies bewirkte, dass er jetzt bei sich dachte: es hat keinen Zweck, wenn ich mir die Mühe mache, hier in Hedeby vom Pferd zu steigen. Der Rittmeister fragt nicht danach, ob der Vater oder Ingilbert den Königsring am Finger trägt.
Es ist besser, wenn ich gleich den Amtmann Carelius von dem Diebstahl verständige.
Aber während der Propst noch mit sich selbst zu Rat ging, sah er, wie das Gattertor, das die Einfahrt zu Hedeby abschloss, ganz sachte aufschwang und weitoffen stehen blieb.
Es sah recht merkwürdig aus, aber es gibt ja viele Gitter, die in dieser Weise von selber aufgehen, wenn sie nicht ordentlich zugemacht sind, und der Propst grübelte nicht weiter über die Sache nach. Er nahm dies jedoch als ein Zeichen, dass er in Hedeby einkehren sollte.
Der Rittmeister nahm ihn freundlich auf, eigentlich besser, als es bei ihm der Brauch war.
»Das ist aber schön, dass du dich hier sehen lässt, verehrter Freund«, sagte er. »Ich habe mich danach gesehnt, dich zu sprechen, und wollte heute schon mehrmals in den Pfarrhof hinübergehen, um dir, geschätzter Freund, etwas ganz Merkwürdiges zu erzählen.«
»Da wärst du vergebens gekommen, Freund Löwenfköld«, sagte der Propst. »Schon in aller Frühe musste ich zu einem Sterbenden auf die Olsbhalm und komme eben erst von dort zurück. Das ist ein abenteuerlicher Tag für mich alten Mann gewesen.«
»Das gleiche kann ich sagen, obwohl ich mich kaum aus meinem Sessel fortgerührt habe. Ich kann dir versichern, geschätzter Freund, dass, obwohl ich nun bald ein Fünfziger bin und in den harten Kriegsjahren, wie auch später allerhand mitgemacht habe, mir nichts so Wunderliches passiert ist, wie das, was ich heute erlebt habe.«
»Wenn dem so ist«, sagte der Propst, »will ich dir das Wort überlassen, Bruder Löwensköld. Auch ich habe meinem geschätzten Freund eine sonderbare Geschichte zu erzählen. Doch möchte ich nicht behaupten, dass sie das Merkwürdigste von allem sei, was mir je zugestoßen ist.«
»Nun ja«, sagte der Rittmeister, »es kann auch sein, dass du gar nichts Sonderbares an meiner Geschichte findest, Verehrtester. Das wollte ich eben fragen. — Du hast doch wohl schon von Gathenhielm gehört?«
»Von dem schrecklichen Seeräuber und Kaperkapitän, der von König Karl zum Admiral ernannt wurde? Wer hätte nicht von ihm gehört?«
»Heute Mittag«, fuhr der Rittmeister fort, »kamen wir beim Essen auf die alte Kriegszeit zu sprechen. Meine Söhne und ihr Hofmeister fingen an, mich auszufragen, wie alles damals gewesen sei, denn von derlei will die Jugend ja immer hören. Merke wohl, geschätzter Freund, von den schweren, harten Jahren, die wir Schweden nach König Karls Tod mitmachen mussten, als wir durch den Krieg und den Geldmangel in allem und jedem zurückgeblieben waren, danach fragen sie nie. Sondern nur nach den verderblichen Kriegsjahren. Bei Gott, sollte man nicht glauben, dass sie es für gar nichts rechnen, niedergebrannte Städte auszubauen, Eisenwerke und Fabriken anzulegen, abzuholzen und neue Erde zu pflügen. Ich glaube, Verehrtester, meine Söhne schämen sich meiner und meiner Zeitgenossen, weil wir aufhörten, auf Heereszüge auszuziehen und fremde Länder zu verwüsten. Sie scheinen zu glauben, dass wir schlechtere Männer sind als unsere Väter und dass die alte schwedische Kraft aus uns gewichen ist.«
»Da hast du freilich recht, Bruder Löwensköld«, sagte der Propst. »Die Liebe dieser Jugend zum Kriegshandwerk ist tief bedauerlich.«
»Nun wohl, ich willfahrte ihren Wünschen«, sagte der Rittmeister, »und da sie von einem großen Kriegshelden hören wollten, erzählte ich ihnen von Gathenhielm und seinem grausamen Verfahren gegen Kaufleute und friedliche Reisende, und vermeinte, dass ich damit ihr Entsetzen und ihren Abscheu hervorrufen würde. Und als dies mir auch gelang, bat ich sie, zu bedenken, dass dieser Gathenhielm ein echter Sohn der Kriegszeit war und fragte sie, ob sie die Erde wohl von solchen Teufelsbraten bevölkert sehen möchten.
Aber bevor meine Söhne noch darauf antworten konnten, ergriff ihr Hofmeister das Wort und bat mich, ihm zu gestatten, noch eine Geschichte von Gathenhielm zu erzählen. Und da er sagte, dass dieses Abenteuer nur bestätige, was ich schon früher von Gathenhielms furchtbarer Wildheit und Raserei gesagt, gab ich meine Einwilligung.
Er begann zu erzählen, dass, nachdem Gathenhielm in jungen Jahren verstorben und seine Leiche in der Onsalaer Kirche in einem Marmorsarkophag, den er dem dänischen König geraubt hatte, beigesetzt war, ein so furchtbarer Geisterspuk in der Kirche anging, dass die Onsalaer Kirchspielbewohner es nicht aushalten konnten. Sie wussten sich keinen anderen Rat, als die Leiche aus dem Sarge zu nehmen und sie auf einer öden Schäre weit draußen im Meere zu beerdigen.
In der Kirche hatte man nun Frieden, aber Fischer, die auf ihren Fahrten in die Nähe von Gathenhielms neuer Ruhestätte kamen, wussten zu erzählen, dass man dort immer Lärm und Getöse höre und dass der Schaum hoch über der Schäre aufspritze, auch wenn das Meer sonst spiegelglatt dalag. Die Fischer dachten sich, dass all die Seeleute und Krämer, die Gathenhielm aus den gekaperten Fahrzeugen über Bord hatte werfen lassen, nun aus ihren feuchten Gräbern emporstiegen, um ihn zu peinigen und zu malträtieren, und sie hüteten sich, nach dieser Richtung zu fahren. Aber einmal war doch einer von ihnen im Dunkel der Nacht der gefährlichen Stelle zu nahe gekommen. Er fühlte sich von einem Wirbelwind erfasst, der Schaum peitschte ihm ins Gesicht, und eine dröhnende Stimme rief ihm zu: ,Geh nach Gata in Onsala und sage meiner Frau, sie möge mir sieben Bündel Haselruten und zwei Wacholderknüttel schicken.«
Der Propst hatte der Erzählung bisher still und geduldig zugehört; aber als er nun merkte, dass sein Nachbar nur eine gewöhnliche Gespenstergeschichte aufzutischen hatte, konnte er eine ungeduldige Gebärde kaum unterdrücken. Der Rittmeister beachtete dies jedoch nicht.
»Du verstehst, Geschätztester, es blieb nichts anderes übrig, als diesem Befehl zu gehorchen.
Und Gathenhielms Frau, die gehorchte auch. Die zähesten Haselruten und die derbsten Wacholderknüttel wurden bereit gemacht, und ein Knecht aus Onsala ruderte mit ihnen ins Meer hinaus.«
Nun machte jedoch der Propst einen so deutlichen Versuch zu unterbrechen, dass der Rittmeister seine Ungeduld merkte.
»Ich weiß, was du denkst, liebwerter Freund«, sagte er. »Ich machte mir auch dieselben Gedanken, als ich heute Mittag die Geschichte hörte. Aber ich bitte dich, liebwerter Freund, mich bis zu Ende anzuhören. Ich wollte also sagen, er muss ein beherzter Mann gewesen sein, dieser Knecht, und seinem toten Herrn sehr zugetan, sonst hätte er es wohl kaum gewagt, den Auftrag auszuführen. Als er in die Nähe der Begräbnisstätte kam, schlugen die Wellen darüber zusammen, wie bei heftigem Sturm, und Lärm und Waffengeklirr ertönte im weiten Umkreis. Aber der Knecht ruderte dennoch so nahe heran, als er konnte, und es gelang ihm sowohl die Knüttel wie die Rutenbündel auf die Schäre zu werfen. Hieran entfernte er sich mit raschen Ruderschlägen von dem Ort des Grauens.«
»Geschätzter Freund«, begann der Propst, doch der Rittmeister ließ sich nicht beirren.
»Aber doch nicht sehr weit. Als er in etwa dreißig Faden Entfernung war, ruhte er auf den Rudern aus, denn er wollte sehen, ob sich nun etwas Merkwürdiger begeben würde, und er brauchte nicht vergeblich zu warten. Denn mit einem Mal stieg der Schaum himmelhoch über der Schäre an, der Lärm wurde wie das Donnern einer Feldschlacht, und schreckliche Jammerrufe erklangen über das Meer hinaus.
Dies ging eine Weile so fort, doch mit nachlassender Heftigkeit. Endlich ließen die Wellen ab, gegen Gathenhielms Grab anzustürmen. Bald lag es ebenso still und stumm da wie jede andere Insel. Der Knecht hob die Ruder, um sich auf den Heimweg zu machen, aber im selben Augenblick rief ihm eine dröhnende, triumphierende Stimme zu: ›Geh nach Gata in Onsala und bestelle meiner Frau, dass Lasse Gathenhielm im Tod wie im Leben über seine Feinde siegt!‹«
Der Propst hatte mit gesenktem Kopf da gesessen und zugehört. Nun die Erzählung zu Ende war, erhob er das Antlitz und sah den Rittmeister fragend an.
»Als der Hofmeister dies letzte erzählte«, sagte der Rittmeister, »merkte ich wohl, dass meine Söhne Mitgefühl mit diesem Schurken Gathenhielm empfanden und gerne von seinem Übermut hörten. Darum bemerkte ich, diese Geschichte scheine mir gut zusammengefügt, aber sie könne wohl kaum etwas andres sein als Lüge. Denn, so sagte ich, wenn ein roher Seeräuber wie Gathenhielm solche Kraft gehabt hätte, sich auch nach dem Tod zu Verteidigen, wie kann man dann erklären, dass mein Vater, der ein ebensolcher Haudegen war, aber obendrein ein guter, redlicher Mensch, einen Dieb in sein Grab, dringen und sich von ihm das Liebste rauben lassen konnte, was er besaß, ohne dass er die Macht hatte, dies zu hindern und ohne dass er den Schuldigen späterhin auch nur im geringsten zu molestieren vermochte?«
Bei diesen Worten erhob sich der Propst mit ungewöhnlicher Lebhaftigkeit.
»Das ist ganz meine Meinung«, sagte er.