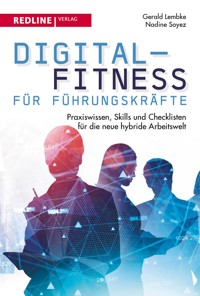2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die zunehmende Digitalisierung macht auch vor unserem Bildungssystem nicht Halt – die Stimmen, die mehr Einsatz von digitalen Medien beim Lehren und Lernen fordern, werden immer lauter. Schon die Kleinsten sind an iPads gewöhnt, Schulen setzen immer mehr auf digitale Medien und bei der beruflichen Weiterbildung sind Tablets und digitale Whiteboards inzwischen üblich. Eine Entwicklung, die nicht nur Vorteile mit sich bringt – ganz im Gegenteil. Gerald Lembke und Ingo Leipner zeigen die dunkle Seite der Ökonomisierung und Digitalisierung von Bildung. Kinder und Jugendliche entwickeln ein bulimieartiges Lernverhalten: Dinge werden schnell und kontextfrei auswendig gelernt, in der Prüfung »ausgekotzt« – und sofort wieder vergessen. Die Autoren belegen diese und andere Gefahren für unser Bildungssystem. Eine eindringliche Warnung – und ein Plädoyer für eine durchdachte Nutzung digitaler Medien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gerald Lembke | Ingo Leipner
Die Lüge der digitalen Bildung
Gerald Lembke | Ingo Leipner
Die Lüge der digitalen Bildung
Warum unsere Kinder das Lernen verlernen
Mit einem Gastbeitrag der Neurobilogin Prof. Gertraud Teuchert-Noodt »Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn«
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2016
© 2015 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Ulrike Kroneck, Melle-Buer
Umschlaggestaltung: Pamela Machleidt, unter Verwendung von iStockphoto.com
Satz: Carsten Klein, München
ISBN Print 978-3-86881-568-9
ISBN E-Book (PDF) 978-3-86414-696-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-86414-697-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter
www.muenchner-verlagsgruppe.de
eBook by ePubMATIC.com
Inhalt
Warum dieses Buch
Teil 1: Rund um die Geburt
1. Fötus-Tuning
Der Irrglaube, Embryonen bereits für den Nobelpreis fit zu machen
2. Brillante Babys
Die Sehnsucht nach dem perfekten Kind – oder warum Babys vorm Bildschirm verkümmern …
Teil 2: Was in Kindergarten und Grundschule gilt
3. Kreuzfeuer der Werbung
Wie Kinder zu unkritischen Konsumenten werden – beschleunigt durch digitale Medien
4. Impulskontrolle
Warum Verzicht glücklich macht – und digitale Medien das verhindern
5. Denken lernen
Wie wir uns auf den Weg machen, die Welt zu verstehen
6. Digital schnell entwurzelt
Warum uns Tablets nicht auf die Stürme des Lebens vorbereiten
7. Was bisher geschah …
Teil 3: Wichtig für weiterführende Schulen, Ausbildung und Studium
8. Lernen verlernen
Wie digitale Medien Motivation zerstören
9. Anfassen statt Angucken
Warum Schüler am Bildschirm keine realen Lernerfahrungen machen
10. Medienkompetenz
Irrwege zum Heiligen Gral – oder was Kinder in der virtuellen Welt wirklich brauchen
11. Fit für die Zukunft
Nicht Technik zählt, sondern der kritische Verstand – welche Fähigkeiten am Computer tatsächlich notwendig sind
12. Profit
Digitale Bildung ist ein riesiger Markt – egal ob pädagogisch wertvoll oder nicht
13. Murks mit MOOCs
Masse statt Klasse: Vorlesungen auf Video – oder wie es viel besser geht
Wie wir uns die Zukunft vorstellen
Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn
1. Drei zentrale Erkenntnisse
2. Dreiklang aus Aktivität, Dynamik und Kompensation
3. Ausblick
Unsere zehn Thesen
Unser großer Dank …
Über die Autoren
Literaturanmerkungen
Warum dieses Buch
Das waren schöne Zeiten: Das Faxgerät wurde zur Revolution, im Fernsehen gab es drei Programme und Kinder spielten im Matsch. Eine Idylle – ohne Cybermobbing, NSA-Skandal oder Tabletwahn in der Schule. Und so sah sie aus, die gute alte Kreidezeit: Lehrer standen mit staubigen Händen vor Kreidetafeln, um wahre Bildung zu verkünden. Ihre Schüler lauschten konzentriert, sie mussten keine WhatsApp-Nachricht unter der Bank lesen … Stopp!
Wenn wir so weiterschreiben, werfen Sie das Buch gleich in die Ecke. Nostalgie und Romantizismus wären noch freundliche Worte, die Sie uns an den Kopf schleudern würden. Genauso könnten wir fordern, alle Strommasten niederzureißen, um die Energiewende zu fördern. Einfach absurd, eine solche Verklärung der Kreidezeit.
Uns geht es aber nicht um Verklärung, sondern um Aufklärung: »Eine Kindheit ohne Computer ist der beste Start ins digitale Zeitalter«, lautet unsere erste These. Paradox? Eher ein bewusster Kontrapunkt zum Digital-Diskurs, der im Moment recht einseitig in der Öffentlichkeit läuft.
Fast einstimmig wird verkündet: Deutschland liegt bei der Digitalisierung der Schulen weit zurück, wir verpassen den Anschluss an globale Entwicklungen. Unterschwellig klingt mit: Unser Wohlstand ist in Gefahr, wahlweise stehen Koreaner, Chinesen oder Brasilianer vor den Toren Europas. So das fast einhellige Echo auf die ICILS-2013-Studie, die im November 2014 erschienen ist. Sie attestierte deutschen Achtklässlern nur Mittelmaß, wenn es um die Nutzung von Computern geht (Kapitel 10, Medienkompetenz).
Doch unsere These ist nicht paradox – und das beweisen wir in diesem Buch. Dabei leitet uns kein Gefühl der Nostalgie, sondern die Entwicklungsbiologie (Kapitel 5, Denken lernen). Unser roter Faden sind die Fragen:
Wie verläuft eigentlich die kognitive Entwicklung von Kindern?
Welche Wirkung entfalten digitale Medien auf diesen unterschiedlichen Stufen der Entwicklung?
Welche pädagogischen Konzepte sind für diese Entwicklungsstufen angemessen?
Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, haben wir intensiv mit vielen Experten diskutiert – unter anderem aus der Psychologie, Pädagogik und Neurobiologie.
Die Forschung gibt klare Antworten: Kinder brauchen eine starke Verwurzelung in der Realität, bevor sie sich in virtuelle Abenteuer stürzen. Ihr Gehirn entwickelt sich besser, wenn kein Tablet oder Smartphone reale Welterfahrung verhindert. Kinder sollten lieber im Matsch spielen als mit Tablets – das ist der beste Weg, um für das digitale Zeitalter fit zu werden. Warum das so ist, schildern wir ausführlich in Teil 1 und Teil 2 des Buches.
Außerdem konnten wir Prof. Gertraud Teuchert-Noodt für einen Gastbeitrag gewinnen: Zu Risiken und Chancen fragen Sie das Gehirn. Die Neurobiologin hat jahrzehntelang das Gehirn erforscht und untermauert viele Aussagen, die wir aus pädagogischer oder psychologischer Sicht treffen. Sie hat auch die Rubrik »Was das Gehirn sagt« gestaltet: kleine neurobiologische Schlaglichter, passend zu den Themen in einzelnen Kapiteln. Vielen Dank für die wissenschaftliche Unterstützung!
Aufklärung ist notwendig: Zu viele Trugschlösser entstehen in der Öffentlichkeit, zu wenig kritische Diskussion findet statt. Immer dann, wenn Tablets den Weg in Kindergärten und Schulen finden sollen. Wir haben den Eindruck: In erster Linie geht es um einen Multi-Milliarden-Markt für die IT-Industrie, pädagogische Konzepte dienen vor allem als Deckmäntelchen (Kapitel 12, Profit).
Begleitet durch ein Marketing der Angst, verklausuliert mit dem Mantra der »frühen Medienkompetenz«: Eltern sollen fürchten, ihre Kinder gingen im globalen Wettbewerb unter, wenn sie nicht mit drei Jahren ihre erste App programmieren können. Das halten wir für irreführend und gefährlich, deshalb unser provokanter Titel: Die Lüge der digitalen Bildung.
Wir wünschen uns mehr Gelassenheit. Gönnen wir den Kindern doch ihre Kindheit – mit Toben, Purzeln, Malen und Singen. Tablets bringen nichts im Kindergarten. Statt Milliarden in IT-Infrastruktur zu investieren, sollten wir das Geld besser für Erzieherinnen ausgeben. Sie stehen an vorderster Front. Ihr Einfühlungsvermögen entscheidet darüber, wie sich unserer Kinder entwickeln. Da kann es nicht sein, dass wir sie mit rund 2.200 Euro brutto abspeisen – trotz ihrer wichtigen Rolle im Bildungsprozess.
Unser Buch orientiert sich an der kognitiven Entwicklung der Kinder, entscheidend ist für uns die Erkenntnis: Wenn das Bildungssystem Kinder nicht zu früh mit Digitalität konfrontiert, sind sie ab der Pubertät eher in der Lage, vernünftig damit umzugehen (Kapitel 10: Medienkompetenz). Eine Frage der Entwicklungsbiologie: Jugendliche entfalten ihr volles kognitives Potenzial, wenn die Reifung des Gehirns in den ersten Lebensjahren ohne Störung verläuft. Digitale Medien können diesen Prozess stören.
Für junge Erwachsene sind diese Medien ein Gewinn, sobald sie eine wirkliche Medienkompetenz aufbauen (Kapitel 11, Fit für die Zukunft). Sie ist viel mehr als die Wisch- und Bedienkompetenz vieler Digital Natives, denn die Arbeit am Computer erfordert ein hohes Maß an Konzentrations- und Kritikfähigkeit. Diese Themen stehen in Teil 3 im Mittelpunkt. Um sie sollte sich auch der Bildungsauftrag der Schulen im digitalen Zeitalter drehen.
Unser Buch wendet sich besonders an alle, die in Erziehungsprozessen stehen: Eltern, Lehrer und Erzieher. Eigentlich aber auch an alle, die sich darüber wundern, …
… dass kleine Kinder von Tablets aufgesaugt werden (Kapitel 2, Brillante Babys).
… dass digitale Medien Kinder in einer Werbewelt einsperren (Kapitel 3, Im Kreuzfeuer der Werbung).
… dass bunte Videos Unterricht durch Menschen ersetzen sollen (Kapitel 8, Lernen verlernen).
Und vor allem, dass unsere Gesellschaft mehr an Technik glaubt als an Menschen. Ein großer Irrtum, weil es immer auf den Lehrer ankommt, damit Bildung gelingt (Kapitel 11, Fit für die Zukunft). Da ist es gleichgültig, ob hinter ihm ein Smartboard oder eine Kreidetafel hängt.
Lassen wir uns vom digitalen Hype nicht blenden, der Tanz ums goldene Tablet wird ein Ende finden. Vielleicht sieht die Welt dann so aus, wie wir uns das wünschen (Kapitel Wie wir uns die Zukunft vorstellen). Digitalität schlägt uns nicht mehr in den Bann, wir schaffen es, den Computer ab und zu auszuschalten. So nehmen wir mit unseren Kindern am wirklichen Leben teil – auf dem Sportplatz; im Wald, Theater oder Konzert.
Gerald Lembke & Ingo Leipner
Teil 1Rund um die Geburt
1. Fötus-Tuning
Der Irrglaube, Embryonen bereits für den Nobelpreis fit zu machen
Ein markerschütternder Schrei, das Baby ist da! Ein kurzer Blick aufs Tablet … und das Baby versteht, wie die Nabelschnur durchschnitten wird. Zweimal schnippt das Neugeborene mit den Fingern – und schon wird im Kreißsaal dem Wunderkind eine Schere gereicht. Schnipp, schnapp; endlich frei und bereit fürs erste Selfie: Das Baby angelt sich ein Smartphone, knipst sich und eine Schwester mit roter Haube. Rundum erstaunte Gesichter, der digitale Knirps amüsiert sich prächtig.
Jetzt kann er schon krabbeln, zielsicher steuert er einen Laptop an. Passwort? Kein Problem – und das Baby ist eingeloggt. Kurz mal die Cam aktiviert, und schon landet das strahlende Kindergesicht im Internet. Weiter geht’s: Der Knirps im blauen Strampler marschiert mit dem Smartphone zu einem Arzt, der vor Schreck auf dem Boden gelandet ist. Klick, auch dieses geschockte Gesicht ist im Kasten. Sicheren Schritts verlässt das Wunderkind den Kreißsaal, das Navi zeigt den Weg. Vorbei an einem Pfleger, der auf einen Bildschirm starrt, wo das Video aus dem Kreißsaal läuft … Kurze Einblendung: Born for the Internet.
Fötus-Tuning vom Feinsten, allerdings nur in einem Werbevideo, das ein russisch-indisches Telekom-Unternehmen durch soziale Netzwerke jagt. Auf Facebook wurde es über 13.000-mal geteilt, die Kommentare reichen von »sooooooooooooo süß!« bis zu »Das ist doch krank« (Stand Juli 2014).
Krank? Blättern wir doch einmal in einer vergilbten Ausgabe des Lakeland Ledger vom 10. November 1987 (1). Da wird eine »pränatale Universität« vorgestellt, die sich Dr. Rene Van de Carr in Hayward (Kalifornien) ausgedacht hatte. Er war einer der ersten Geburtshelfer und Gynäkologen, die Ungeborene in die Schule schicken wollten. Das geht natürlich nicht ohne Eltern! Sie müssen zum Beispiel bereit sein, ihrem Kind erste Worte laut durch die Bauchdecke zuzurufen: »pat« (klopfen), »rub« (reiben) oder »squeeze« (drücken). Das sind Begriffe erster Wahl – und zugleich wird der Bauch der Schwangeren beklopft, gerieben oder gedrückt. Van de Carr zum Lakeland Ledger: »Es ist wirklich ganz einfach. Manche Leute machen das auf Spanisch, Chinesisch oder Arabisch; die Babys assoziieren die Worte mit den Bewegungen.« Doch nicht alles ist erlaubt, Worte wie »poo-poo« landen auf einem vorgeburtlichen Index. Das ist in Amerika Baby Language und heißt schlicht »Aa machen«.
Wer aber für sein Kind den Doktortitel in Physik fest eingeplant hat, dem gibt Van de Carr weitere Tipps zum Lernen von Zahlen: einfach eine Halogenlampe auf den Bauch richten und dem Ungeborenen erst zweimal, dann drei-, vier- und fünfmal ein Lichtsignal geben. Dabei sagt die werdende Mutter: »Two lights«, »three lights« usw.
Das ist Mathe light, gelehrt im »prenatal classroom«, wie der Gynäkologe dieses Konzept genannt hat. Doch ohne weitere Hilfsmittel klappt keine Mathematik-Stunde: Eine Sprechtüte aus Papier muss her, durch die Mütter ihre Durchsagen verstärken – so wie ein Megafon Stimmgewalt auf Demonstrationen verleiht.
Das brachte Dawn Hodson aus Ventura (Kalifornien) auf eine Idee: Sie ließ sich Ende der 1980er-Jahre ein »Pregaphone« patentieren – ein hellgelbes Gerät, das aus drei Teilen bestand: einem Mundstück, einem 46 Zentimeter langen Schlauch und einem Trichter. Es diente der direkten Kommunikation zwischen Mutter und Kind; angeblich verkaufte Hodson 10.000 Stück. Heute gibt es ihre Firma Pregaphone, Inc. nicht mehr, aber das Netz vergisst bekanntlich nichts: Einfach die Patentnummer US D297234 S googeln, und schon lässt sich eine genaue Zeichnung der Erfindung anschauen.
Wer jetzt die Ideen von Van de Carr und Hodson für analoge Höhlenmalerei hält, der irrt gewaltig. Sie sind heute genauso präsent – aufgeladen mit digitaler Technik, die alle steinzeitlichen Versuche der 1980er-Jahre in den Schatten stellt. »Pränatale Stimulation« lautet das Zauberwort, das die Hersteller dieser Hardware in der Werbung aufblitzen lassen. Ihr Argument: Wenn ein Fötus gezielt Sinnesreizen ausgesetzt wird, entwickelt sich sein Gehirn besser. Ein höherer Intelligenzquotient sei die Folge, Babys sind nach der Geburt ruhiger – und damit pflegeleichter. Was für wunderbare Verheißungen für angehende Eltern, die Nachtruhe bald nur noch vom Hörensagen kennen. Und dann noch die Aussicht auf den Doktortitel in Teilchenphysik!
Mit solchen Hoffnungen spielt in ihrer Werbung die Nuvo Group USA, Inc. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Valley Cottage (Staat New York) – und preist einen Ritmo Pregnancy Audio Belt an: einen Gurt mit vier Lautsprechern, den sich Schwangere um den Bauch binden sollen. Die werdende Mutter lauscht über Kopfhörer, womit sie ihr Kind beglückt; der Sound kommt vom MP3-Player oder Smartphone. Warum gleich vier Lautsprecher? »Weil sich Babys im Bauch der Mutter viel bewegen, muss die Musik strategisch an verschiedenen Stellen zu hören sein. Nur so erreicht sie effektiv das Kind, egal wo sich gerade sein Kopf befindet«, behauptet die Nuvo Group USA, Inc.
Das Ergebnis ist ein Surround-Sound-System, das die gesamte Gebärmutter abdeckt. Seine Wirkung hat die Schwangere voll im Griff, sie bestimmt Lautstärke und Zeit der Beschallung. Anders beim Produkt Ritmo Advanced: Es wurde mit einem Ritmo Safe & Sound Controller ausgestattet, »der die Musik sicher, kontinuierlich in einer geeigneten Lautstärke abspielt, die exakt zur Wachstumsphase des Babys passt«, so die Werbung. Die werdenden Eltern können auch eigene Texte sprechen und als MP3 speichern. Außerdem macht es das System möglich, dass amerikanische Soldaten mit ihrem Ungeborenen »sprechen« – aus Afghanistan via Smartphone. Das verspricht zumindest die Werbung des US-Unternehmens.
Und die Slogans zur Fötenförderung kommen an, zum Beispiel bei der Schauspielerin Bree Turner, die begeistert schreibt: »Was für eine fantastische Idee! Unser kleines Mädchen wird bereits in der Gebärmutter musikalisch ausgebildet.« Zudem steigt durch den Mozart-Effekt der IQ – und wieder rückt die Reise nach Stockholm näher, wenn der eigene Nachwuchs den Nobelpreis erhält. Ein sicheres Zeichen, dass die Digitalisierung der Bildung am besten im Mutterleib beginnt, oder?
Mozart-Effekt: Dieser Mythos lässt werdende Eltern glauben, ihr Kind ergattere einen Wettbewerbsvorteil, sobald es klassischen Klängen lauscht, und das alles vor dem ersten Schrei im Kreißsaal. So ist ein spezielles Segment am Musik-Markt entstanden, das diese Nachfrage bedient. Ein Titel lautet: »W. A. Mozart – Wohlfühlen in der Schwangerschaft für mich und mein Baby«. Dazu heißt es in einer Rezension auf www.amazon.de: »Sehr schöne DVD, höre sie mir jeden Tag an. Es entspannt mich, und unserem Sonnenschein gefällt sie auch. Es boxt ab und zu zur Musik mit.«
Oder eine weitere CD heißt: »Mein Baby – Klassik für Mutter & Kind«. Eine Rezension zeigt, wie der Mythos vom Mozart-Effekt Wirkung entfaltet: »Ich bin sehr zufrieden mit der CD. (…) Sie hat eine beruhigende Wirkung auf mich, und mein Baby kann ja ab der 16. Woche mithören, und es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Mozart eine beruhigende Wirkung auf Babys hat, auch schon im Mutterleib [Hervorhebung durch die Autoren].«
Die »beruhigende Wirkung auf Babys« ist ein weiteres Versprechen, das oft zu hören ist, damit Eltern digital aufrüsten – für den globalen Wettbewerb, dem sich angeblich ihr Nachwuchs zu stellen hat. Im Vordergrund steht dabei immer die Intelligenz, um die sich Eltern gar nicht früh genug kümmern können.
Aber: Der Mozart-Effekt geht auf ein Experiment mit erwachsenen Studenten (!) zurück, das ein Team um die Neurologin Frances Rauscher durchgeführt hat. Es berichtete 1993 in der angesehenen Zeitschrift Nature: Wer zehn Minuten Musik von Mozart hört, zeigt direkt danach bessere räumlich-visuelle Vorstellungsleistungen als eine Vergleichsgruppe, die in derselben Zeit still in einem Zimmer saß oder eine Anleitung zum Entspannen hörte. Die Vorstellungsleistungen wurden durch spezielle Aufgaben getestet: Die Probanden mussten herausfinden, was für Muster sich ergeben, wenn Papier geschnitten, gedreht und gefaltet wird.
Dieses Experiment sorgte weltweit für Schlagzeilen, zumal die Forscher ihre Ergebnisse so interpretierten, dass die Mozart-Klänge die Studenten intelligenter machten. »Eine weitere Folge bestand in der Entwicklung einer ganzen Frühförderungsindustrie, die bildungsorientierte Eltern mit Mozart-CDs versorgte, mit denen die kognitive Entwicklung ihrer Kinder optimal gefördert werden sollte«, schreiben Ralph Schumacher und seine Koautoren (2). Eine andere Blüte des Mozart-Hypes in den USA: Der Staat Florida empfahl seinen Schulen, Kindern täglich klassische Musik vorzuspielen – und die Regierung von Georgia schenkte jedem Neugeborenen eine Mozart-CD.
Kritisch stellt Ralph Schumacher fest:
»Offensichtlich wurde im Zuge der Mozart-Euphorie gänzlich außer Acht gelassen, dass die Untersuchung von Rauscher et al. (1993) bestenfalls Belege dafür liefert, dass sich das Hören von Mozart komponierter Musik lediglich auf einen kleinen Bereich räumlich-visueller Fähigkeiten positiv auswirkt, aber keine Rückschlüsse auf die Wirkung des Musikhörens auf die Entwicklung der allgemeinen Intelligenz zulässt. Ebenso wenig wurde der in diesem Zusammenhang entscheidende Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen kognitiven Effekten beachtet, so dass vorschnell von kurzfristigen auf langfristige Effekte des Musikhörens geschlossen wurde.«
Entscheidend dabei: Viele Wissenschaftler versuchten, in eigenen Experimenten den Mozart-Effekt erneut nachzuweisen – so gut wie ohne Erfolg. Daher ging die spätere Forschung in eine eindeutige Richtung: Zwar lassen sich kurzfristig durch Musik unterschiedliche kognitive Fähigkeiten verstärken. Aber diese Effekte entstehen dadurch, »dass durch die Steigerung der kognitiven Erregung sowie durch die Verbesserung der Stimmung die Leistungsbereitschaft erhöht wird«, wie Schumacher schreibt. Das würden aber auch »angenehme Stimuli« leisten, etwa das Vorlesen von Geschichten, die Musik der Lieblingsband, eine Tasse Kaffee oder Süßigkeiten.
Zusätzlich stellt sich die Frage: Was »hört« ein Kind eigentlich im Mutterleib? Zwischen Lautsprechern oder Pregaphones befindet sich immer die Bauchdecke, hinzu kommt das Fruchtwasser, das ebenfalls Töne aus der Umwelt dämpft und verfremdet. Gleichzeitig prasseln ganz andere akustische Reize auf das Ungeborene: Herzschlag und Geräusche aus dem Verdauungstrakt übertönen die Laute, die von außen kommen. Im Werbevideo zum Ritmo Pregnancy Audio Belt bleibt davon nur ein freundliches Blubbern im Hintergrund …
Ende des Mozart-Hypes? Nein, denn in gesättigten Märkten ist jede Industrie dankbar, wenn sie für alte Produkte neue Zielgruppen erschließen kann. Warum also Mozart nicht neu eintüten – und als Geheimwaffe verkaufen, um pfiffige Föten zu züchten? Am besten mit dem Surrond-Sound-System aus Amerika, das eine lückenlose Berieselung garantiert.
Dabei appelliert das Marketing geschickt an die Sorgen von Vater und Mutter: »Die meisten Eltern haben das nagende Bedürfnis, etwas zu tun, um das Baby unterstützen, vor allem, wenn es um sein Gehirn geht«, schreibt der Entwicklungsbiologe John Medina in seinem Buch Brain Rules für Ihr Baby (3). »Dieser Drang«, so der Wissenschaftler weiter, »wird von einem riesigen Sektor der Spielzeugindustrie angeheizt, der meines Erachtens nichts anderes tut, als die Ängste wohlmeinender Eltern zu schüren.«
Nüchtern kommt Medina zu dem Schluss:
»Bei keinem kommerziellen Produkt konnte je auf wissenschaftlich verantwortungsvolle Weise (…) nachgewiesen werden, dass es in irgendeiner Form dazu beiträgt, die Gehirnleistung eines Fötus zu steigern. Es gibt keine doppelblinden, randomisierten Experimente, deren unabhängige Variable die An- oder Abwesenheit des Produkts war. Keine streng wissenschaftliche Studie hat je gezeigt, dass vorgeburtlicher Unterricht später einen schulischen Nutzen brachte. (…) Viele arglose Eltern lassen sich auch heute noch von solchen Produkten ködern und werfen ihr hart verdientes Geld zum Fenster raus.«
Zu diesem Thema haben sich auch deutsche Wissenschaftler geäußert, die Sophia Seiderer in einem Beitrag für die Welt zu Wort kommen lässt (4). So stellt der Neurobiologe Gerald Hüther den Sinn embryonaler Musikberieselung infrage: »Das ist, als würden Sie einem Erwachsenen immer ein lautes Geräusch vorspielen und ihm gleichzeitig Brechmittel verabreichen.« Niemand würde das erleben wollen. Hüther weiter: »Vor allem verleitet es Mütter dazu, Kinder als Objekt zu betrachten, das es zu optimieren gilt. Das ist für die Mutter-Kind-Beziehung fatal.«
Laut Seiderer kritisiert in ähnlicher Weise der Psychologe Martin Grunwald den Gedanken, Föten zu optimieren: »Das Streben nach dem Optimum, nach dem Besser-Sein, kann die Schwangerschaft zur Tortur machen.« Wenn es der Mutter gut gehe, sei sie bestens darauf vorbereitet, dieses Kind zu bekommen. »Das hat die Natur so geregelt«, argumentiert Grunwald, »demnach sollten wir ihr freien Lauf lassen und nicht zusätzlich versuchen, etwas zu verbessern, das so gut ist, wie es ist.«
Aber wie geht es der Mutter gut in ihrer Schwangerschaft? Wissenschaftler sprechen vom Goldlöckchen-Effekt, wie Medina in seinem Buch schreibt. Im Märchen Goldlöckchen und die drei Bären kommt ein blondes Mädchen in die Hütte einer Bärenfamilie, während die Bewohner im Wald unterwegs sind. Es kostet den Brei auf dem Tisch und probiert aus, ob es bequem in den Betten der Bären liegt. Was Vater und Mutter Bär gehört, gefällt ihr gar nicht. Aber alles vom Bärenjungen findet sie »genau richtig« – von der angenehmen Temperatur des Breis bis zur passenden Matratze im Kinderbett.
Dieses Genau-richtig-Prinzip spiegelt sich im Goldlöckchen-Effekt: »Das Phänomen ist deswegen so verbreitet, weil das biologische Überleben in dieser feindlichen Welt nach Ausgewogenheit verlangt: zu viel ist schlecht, zu wenig auch«, schreibt Medina. »Zu viel oder zu wenig Wärme, Wasser etc. schadet biologischen Systemen, die nach einem Gleichgewichtszustand (Homöostase) streben.«
Der Entwicklungsbiologe sieht vier Faktoren, die vor allem in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft Einfluss haben, wie sich das Gehirn des Ungeborenen entwickelt: Gewicht, Ernährung, Sport und Stress. Kurz ein paar Gedanken zu den ersten drei Faktoren:
Gewicht: Studien zur Mangelernährung haben gezeigt, dass der Fötus ab dem vierten Monat besonders empfindlich auf die Menge und Art der Nahrung reagiert, die eine Schwangere zu sich nimmt. Denn der IQ eines Babys hängt auch von der Größe des Gehirns ab, sodass Medina feststellt: »Das Gehirnvolumen ist mit dem Geburtsgewicht assoziiert, das heißt: Größere Babys sind gescheitere Babys. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt.«
Ernährung: »Die Schwangere ist ein Schiff mit zwei Passagieren, aber nur einer Kombüse«, schreibt Medina. Diese Küche sei mit den richtigen Zutaten auszustatten, um das Gehirnwachstum des Ungeborenen zu fördern. »Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und Gemüse ist immer noch der beste Rat für schwangere Frauen«, so der Wissenschaftler.
Sport: Eine »moderate, regelmäßige, ausdauernde Bewegungsaktivität« empfiehlt Medina werdenden Müttern. Sportlich aktiven Frauen fällt das Gebären leichter als Frauen, die nicht im Training sind oder Übergewicht haben. Je näher der Geburtstermin rückt, desto geringer sollten die Aktivitäten werden, ohne sie ganz aufzugeben. Auch die Gehirnentwicklung des Kindes wird so positiv beeinflusst.
Auf den Faktor Stress wollen wir etwas näher eingehen: Medina berichtet von sogenannten Eissturm-Kindern aus Kanada, die im Frühjahr 1998 einer starken pränatalen Belastung ausgesetzt waren. Sie erlebten vor der Geburt, wie ihre Mütter einen furchtbaren Wintersturm zu erdulden hatten: 80 Stunden fiel ununterbrochen Eisregen, Tausende Strommasten brachen zusammen – und wochenlanger Stromausfall war bei frostigen Temperaturen die Folge. Hinzu kamen: der Einsatz der Armee, Verkehrschaos und 30 Tote durch den eisigen Sturm. So befanden sich die schwangeren Frauen in einer außergewöhnlichen Stresssituation, was ebenfalls auf ihre ungeborenen Kinder durchschlug: »Die Auswirkungen dieses Wintersturms waren noch Jahre später in ihrem Gehirn zu erkennen«, stellt Medina fest. »Stress aufseiten der Mutter« könne die vorgeburtliche Entwicklung des Kindes massiv beeinflussen.
Das fanden Wissenschaftler heraus, die alle Eissturm-Kinder bis in die Vorschule begleiteten. »Ihr Verbal-IQ war deutlich niedriger und ihre Sprachentwicklung war gehemmt, selbst wenn Faktoren wie Bildungsniveau, Arbeit und Einkommen der Eltern bei der Datenanalyse berücksichtigt wurden«, so Medina in seinem Buch. »Die Stresshormone der Mutter passieren die Plazenta und dringen zum Gehirn vor (…). Die Regel lautet daher: gestresste Mutter, gestresstes Baby.«
Doch auch bei dieser Frage sollten wir an den Goldglöckchen-Effekt denken: »Moderaten Stress in kleinen Mengen« erleben die meisten Frauen während der Schwangerschaft. Das »scheint sich sogar positiv auf das Kind auszuwirken«, schreibt Medina. »Nur einer dauerhaften Belastung sind sie nicht gewachsen.«
Fazit: Die digitalisierte Bildung beginnt nicht in Kindergarten oder Schule. Nein, sie ist bereits weit in die Bezirke der Schwangerschaft vorgedrungen. Was Van de Carr noch mit Papier-Megafon und Halogenlampe erreichen wollte, erledigen heute Surrond-Sound-Systeme, gekoppelt an MP3-Player oder Smartphones. Dazu gehören im CD-Regal die richtigen Titel, das Cover ziert oft ein ästhetisch gewölbter Frauenbauch, auf dem lustige Plüschtiere liegen. So wirkt ungebrochen der Mythos vom Mozart-Effekt, trotz der vielen Gegenbeweise aus der Wissenschaft.
Dieses mythische Denken entspringt einer ökonomischen Scheinrationalität, der unser ganzes Leben unterworfen wird, von der Empfängnis bis zur Bahre. Das Optimum ist unschlagbar, alle Lebensprozesse sind zu optimieren – wie Produktionsstraßen in der Industrie. Das Motto dazu lieferte der Rennfahrer Dale Earnhardt: »Second place is just the first place loser«, der Zweite ist immer der erste Verlierer! Die Angst vor solchen Niederlagen grassiert unter werdenden Eltern, denn ihre Kinder könnten im globalen Wettbewerb scheitern, und das bereits auf Platz zwei! Diese Sorgen greift das Marketing der Hard- und Softwareproduzenten begierig auf. So entstehen Märkte für Produkte, deren Nachfrage erst künstlich geweckt wird.
Mehr Gelassenheit! Das ist zu fordern, um der optimierten Förderung von »Humankapital« im Mutterleib einen Riegel vorzuschieben. Wilhelm Busch (1832–1908) hat das bereits zum Ausdruck gebracht, und zwar in seinem Gedicht »Eh’ man auf diese Welt gekommen …«:
»Man schwebt herum, ist schuldenfrei, / Hat keine Uhr und keine Eile / Und äußerst selten Langeweile.«
Brauchen wir wirklich Neugeborene, die im Kreißsaal ihr erstes Selfie schießen?
Was das Gehirn sagt
Thema: pränatale Stimulation
»Musikbeschallung mag ich nicht, weil sie mich im Mutterleib beim Schlafen stört. Außerdem beeinträchtigt sie die Reifung meiner mentalen Funktionen. Wissenschaftler (5) haben gezeigt, welchen Einfluss das Bewegungsverhalten und die seelische Verfassung einer Schwangeren haben, und zwar auf meine frühe kognitive Entwicklung und späteren Leistungen in der Schule. Gut sind folgende Aktivitäten: Hausarbeiten, Lesen, Singen und Wandern. Negativen Einfluss nehmen Radfahren, wöchentliches Shopping im Großkaufhof und viel Fernsehen.«
2. Brillante Babys
Die Sehnsucht nach dem perfekten Kind – oder warum Babys vorm Bildschirm verkümmern …
Noch ist kein Baby aus dem Kreißsaal marschiert, das ein Navi im Smartphone startet, um die Welt zu erobern. Aber dieses Video spielt gekonnt mit dem Wunsch nach Perfektion, der Sehnsucht, das perfekte Kind in die Welt zu setzen. Pregaphone waren da nur ein plumper Versuch, die Entwicklung kleiner Genies in effiziente Bahnen zu lenken.
Heute hat sich im Kopf vieler Eltern die Redensart eingenistet: »Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.« Was bedeutet: Nichts kann früh genug auf den Nachwuchs einstürzen – und eine »Frühförderindustrie«(Ralph Schumacher) sorgt für Angebote, die Hänschen auf den Kampf ums Überleben vorbereiten. Und dieser Kampf wird immer stärker mit Computern ausgefochten. Daher sticht in der Werbung immer die Bildungskarte, zum Beispiel beim Produkt »Mein erster Laptop«, empfohlen für die Altersgruppe 12 bis 36 Monate.
Diese grellbunte Hässlichkeit aus Plastik »bietet abwechslungsreichen Spiel- und Lernspaß für kleine Entdecker«, so der Hersteller. Dabei drückt das Kleinkind lediglich auf farbige Tasten, und entsprechende Symbole leuchten in einem Display auf. »Zahlreiche Melodien und ein gesungenes Lied sorgen für zusätzliche Unterhaltung«, heißt es weiter in der Werbung. »Mit der beweglichen Kindermaus werden die feinmotorischen Fertigkeiten Ihres Kindes zusätzlich gefördert.«
Wer jetzt noch nicht einknickt und den Kaufen-Button drückt, den sollen noch folgende Argumente überzeugen: Das Produkt sei gut für die »Sprachentwicklung«, die »Sinneswahrnehmung« sowie »Erkundungsdrang und Neugier«. Alles unter der Überschrift: »Für die Entwicklung Ihres Kindes«. Wer kann da noch Nein sagen?
Wir sagen aber bewusst: Nein. Unsere These lautet:
Eine Kindheit ohne Computer …
… ist der beste Start ins digitale Zeitalter.
Paradox? Verwirrend? Ja, aber wir werden im Lauf des Buches zeigen, wie sich diese Aussage erhärten lässt. Wir werden darüber nachdenken, wie sich Hänschen zu einem Hans entwickelt, der souverän mit digitalen Medien umgeht – und die großen Chancen der Digitalität zu nutzen weiß. Denn für uns gilt: »Was Hänschen nicht lernt, kann Hans in aller Ruhe lernen.« Das Modewort der Entschleunigung sollte Einzug in die Bildungsdebatte halten, denn gerade digitale Medien können mit ihrer Geschwindigkeit, Reizüberflutung und Oberflächlichkeit Lernprozesse untergraben.
Und das besonders bei kleinen Kindern: »Wenn Sie ihnen etwas erklären, schlafen sie einfach mal weg«, erläutert die Neurobiologin Prof. Gertraud Teuchert-Noodt, »und dieser Schlaf ist sehr wichtig, weil sich dabei im Gehirn viel abspielt.« Der Erfolg des Lernens sei von einem »inneren Rhythmus« abhängig, Langsamkeit im Lernprozess von Vorteil. Wer diesen Rhythmus durcheinanderbringt, schafft es auch später nicht mehr, »durch eine Stunde Yoga Schulklassen auf das richtige Gleis zu bringen«, so die emeritierte Neurobiologin.
Was geschieht aber, sobald die Kinder auf der Welt sind? Sie werden einem medialen Trommelfeuer ausgesetzt, das wir in unserem Alltag nicht mehr wahrnehmen:
»Die Mutter stillt beim Fernsehen, der Vater wiegt das Baby in den Schlaf, während er im Internet recherchiert, der große Bruder passt auf das kleine Geschwister auf, während er ein Computerspiel macht …, derartige Situationen sind Familienalltag.«
So beschreiben Helga Theunert und Kathrin Demmler die Situation, in der Kleinkinder heute aufwachsen (1). Klingt harmlos, ist es aber nicht, wie die American Academy of Pediatrics (AAP) feststellt: Laut einer Umfrage versuchen bereits 90 Prozent der amerikanischen Eltern, Kinder unter zwei Jahren bei Laune zu halten, indem sie elektronische Medien einsetzen. Daher hat die AAP frühere Warnungen verschärft und 2011 Empfehlungen veröffentlicht, wie Eltern mit elektronischen Medien umgehen sollten, damit Kinder unter zwei Jahren keinen Schaden nehmen (2). In der AAP haben sich 60.000 amerikanische Kinderärzte und -chirurgen organisiert.
Kurz und knapp schreibt die Ärzteorganisation: »Die AAP rät davon ab, dass Kinder unter zwei Jahren elektronische Medien benutzen.« Dabei stützen sich die Ärzte auf 50 Studien, die seit 1999 untersucht haben, wie Fernsehen und Videos auf unter Zweijährige wirken.
Wie kommt die AAP zu ihren Empfehlungen? Betrachten wir einfach den Alltag von Eltern, die vor dem Fernseher sitzen und ihre Kinder im selben Raum spielen lassen. Die erste Wirkung ist offensichtlich:
»Kleinkinder werden einem Fernsehprogramm kaum aufmerksam folgen, wenn sie es nicht verstehen. Aber die Eltern sind damit beschäftigt. Der Fernseher mag für das Kind nur ein Hintergrund-Medium zu sein, doch für die Eltern steht er im Vordergrund. Der Fernseher lenkt die Eltern ab – und verringert die Interaktion zwischen Eltern und Kind. Das Wachstum seines Wortschatzes hängt aber direkt von der ›talk time‹ mit den Eltern ab bzw. von der Zeit, die Vater oder Mutter mit ihm sprechen. Wird in einem Haushalt sehr viel ferngesehen, kann sich das negativ auf die Sprachentwicklung des Kindes auswirken, einfach weil die Eltern wahrscheinlich zu wenig mit ihrem Kind sprechen.«
Das klingt sofort nachvollziehbar, aber wirklich neu dürfte vielen Eltern sein, wie Backround Media direkt auf Kleinkinder wirken.
Die AAP verweist auf ein Experiment, das Marie Evans Schmidt mit ihren Kollegen durchführte (3): 50 Kinder im Alter von 12, 24 und 36 Monaten spielten mit verschiedenen Spielsachen genau eine Stunde lang. 30 Minuten lief im selben Raum eine Spiel-Show im Fernseher, die andere halbe Stunde blieb das TV-Gerät ausgeschaltet. Der Effekt: Backround Media reduzieren nicht nur signifikant die Spielzeit der Kleinkinder, sondern auch die Aufmerksamkeit, mit der sie sich dem Spiel widmen. Der Fernseher unterbrach das Spiel der Kinder, auch wenn sie ihre Aufmerksamkeit nicht offensichtlich auf das Gerät gerichtet hatten.
Schmidt und Kollegen schreiben: »Diese Ergebnisse deuten auf spätere Einflüsse hin, die sich bei der kognitiven Entwicklung bemerkbar machen.« Ein erster Hinweis auf die negativen Wechselwirkungen zwischen Medienkonsum und Gehirnentwicklung – Wechselwirkungen, die in unserem Buch noch eine große Rolle spielen werden (siehe auch Gastbeitrag von Prof. Gertraud Teuchert-Noodt: »Zu Chancen und Risiken fragen Sie das Gehirn«).
Auch die amerikanischen Kinderärzte stellen fest: »Das ›unstrukturierte Spielen‹ ist wichtig, um Fähigkeiten zur Lösung von Problemen zu entwickeln. Außerdem fördert es die Kreativität der Kinder.«
Und was für die Berieselung aus dem Hintergrund gilt, entfaltet seine destruktive Wirkung erst recht, wenn Kleinkinder unmittelbar elektronische Medien konsumieren: Laut AAP gehen den unter Zweijährigen an Werktagen pro TV-Stunde neun Prozent Zeit verloren, um sich mit »unstrukturierten Spielen« zu beschäftigen. Am Wochenende sind es sogar elf Prozent. Daher machen die Kinderärzte ganz pragmatische Vorschläge: Zum Beispiel soll der Nachwuchs auf dem Küchenboden Becher ineinanderstecken, wenn Eltern eine Mahlzeit zubereiten. Das sei bereits eine »nützliche Zeit zum Spielen«, statt dieselbe Zeit einfach vor der Glotze zu sitzen.
Denn: »Das unstrukturierte Spiel ist wertvoller für die Gehirnentwicklung als jede Form der Nutzung elektronischer Medien«, so die AAP. Es sei nicht notwendig, dass sich die Erwachsenen immer aktiv mit den Kindern beschäftigen. Hauptsache, sie können in der Umgebung der Eltern spielen. Auch wenn Kinder erst vier Monate alt sind, hätten sie beim »Allein-Spielen« die Möglichkeit, »kreativ zu denken, Probleme zu lösen und Aufgaben zu bewältigen, ohne dass Eltern eingreifen.«
Außerdem sollten Eltern nicht außer Acht lassen: Unter Zweijährige weisen kurzfristig deutliche Defizite in der Sprachentwicklung auf, wenn sie viele Videos oder Sendungen im Fernsehen sehen. Drastisch sind auch die Folgen für unter Einjährige, die allein viel fernsehen: Für sie besteht eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer verzögerten Sprachentwicklung kommt. »Auch wenn die langfristigen Wirkungen unbekannt sind, geben die kurzfristigen Effekte Anlass zur Sorge«, so die Kinderärzte.
Zwei weitere interessante Punkte stellt die AAP zur Diskussion:
Schlafverhalten: In Amerika halten es 19 Prozent der Eltern für sinnvoll, ihren unter einjährigen Kindern ein TV-Gerät ins Schlafzimmer zu stellen. 29 Prozent der Kinder zwischen zwei und drei Jahren haben einen eigenen Fernseher. Und 30 Prozent der Eltern berichten, dass Fernsehen den Kindern beim Einschlafen hilft. Diesen überraschenden Zahlen setzen die Kinderärzte entgegen:
»Obwohl Eltern das Fernsehprogramm als beruhigende Einschlafhilfe betrachten, haben einige Sendungen tatsächlich negative Folgen: Die Kinder wehren sich mehr gegen das Zubettgehen, der Zeitpunkt des Einschlafens verzögert sich, es entstehen Ängste vor dem Einschlafen und die Schlafdauer geht zurück.«
Besonders bei Kindern unter drei Jahren gerät durch Fernsehen der Schlafrhythmus durcheinander, was sich negativ auf Gemüt, Verhalten und Lernfähigkeit auswirkt. Zwar sei zu dieser Fragestellung noch mehr zu forschen, so die Kinderärzte, aber bereits jetzt gäbe es »ausreichend Gründe zur Sorge«.
Interaktion mit Eltern: Kleinkinder sind nicht in der Lage, zwischen einer realen Situation und dem Geschehen auf einem Bildschirm zu unterscheiden (»Video-Defizit«). Sind sie zwischen 12 und 18 Monate alt, fällt es ihnen aber leichter, Informationen einer realen Person zu verarbeiten, als Inhalte aus dem Fernsehen zu verstehen. Die Kinder erinnern sich auch besser, wenn ihre Eltern mit ihnen direkt gesprochen haben.