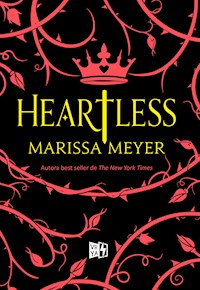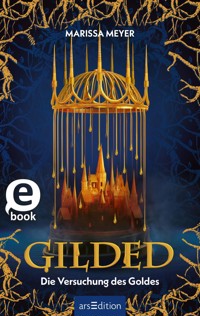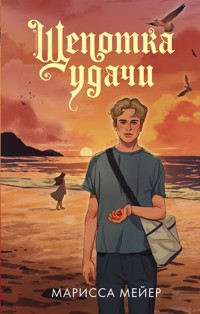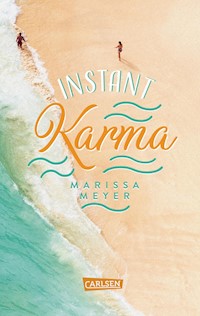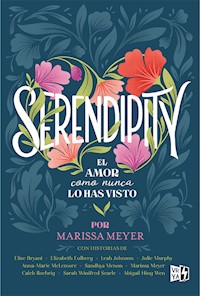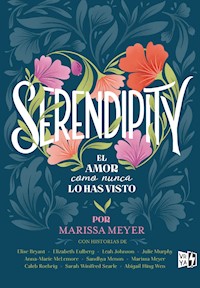9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Rotkäppchen mal ganz anders! Zwei ganze Wochen ist Scarlets Großmutter nun schon verschwunden. Entführt? Tot? Die Leute im Dorf sagen, sie sei sicher abgehauen. Sie sei ja sowieso verrückt. Aber für Scarlet ist Grandmère alles – von ihr hat sie gelernt, wie man ein Raumschiff fliegt, Bio-Tomaten anbaut und seinen Willen durchsetzt. Dann trifft Scarlet einen mysteriösen Straßenkämpfer – Wolf. Er fasziniert sie; doch kann sie ihm trauen? Immerhin: Die reißerischen Berichte über Cinder und das Attentat auf Prinz Kai hält Wolf ebenso wie sie für Quatsch. Aber irgendein Geheimnis verbirgt der Fremde … »Umwerfend!« Los Angeles Times Marissa Meyers Serie über Märchen, die in eine fantastische Sci-Fi Welt in der Zukunft verlegt sind, haben bereits jede Menge gühende Fans! So modern wurde die Geschichten von Cinerella, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen noch nie erzählt ... Alle vier Bände der packenden Luna-Chroniken – jeder Band einzeln lesbar: Wie Monde so silbern (Band 1) Wie Blut so rot (Band 2) Wie Sterne so golden (Band 3) Wie Schnee so weiß (Band 4)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Marissa Meyer
Die Luna-Chroniken 2: Wie Blut so rot
Aus dem Englischen von Astrid Becker
Zwei ganze Wochen ist Scarlets Großmutter nun schon verschwunden. Entführt? Tot? Die Leute im Dorf sagen, sie sei sicher abgehauen. Sie sei ja sowieso verrückt. Aber für Scarlet ist Grandmère alles – von ihr hat sie gelernt, wie man ein Raumschiff fliegt, Bio-Tomaten anbaut und seinen Willen durchsetzt.
Dann trifft Scarlet einen mysteriösen Straßenkämpfer – Wolf. Er fasziniert sie; doch kann sie ihm trauen? Immerhin: Die reißerischen Berichte über Cinder und das Attentat auf Prinz Kai hält Wolf ebenso wie sie für Quatsch. Aber irgendein Geheimnis verbirgt der Fremde …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Danksagung
Viten
Für Mom und Dad, meine besten Cheerleader
Erstes Buch
Wie sie nun in den Wald kam, begegnete ihr der Wolf. Sie aber wusste nicht, was das für ein böses Tier war, und fürchtete sich nicht vor ihm.
1
Scarlet steuerte gerade die Gasse hinter dem Gasthaus Rieux an, als ihr Portscreen auf dem Beifahrersitz summte und eine Computerstimme meldete: »Tele für Mademoiselle Scarlet Benoit von der Dienststelle für Vermisste Personen.«
Ihr Herz machte einen Satz. Kurz bevor das Raumschiff gegen die Steinmauer knallte, riss sie das Steuer zur Seite, machte eine Vollbremsung und kam abrupt zum Stehen. Dann stellte sie den Motor ab und angelte sich den Portscreen. Das Display warf blassblaues Licht auf die Armaturen im Cockpit.
Sie hatten etwas gefunden.
Die Polizei in Toulouse war auf eine Spur gestoßen.
»Tele annehmen!«, schrie sie, wobei sie den Port fast zerquetschte.
Sie hatte auf einen Vidlink von dem Kommissar gehofft, der den Fall ihrer Großmutter Michelle bearbeitete, erhielt aber nur einen Einstellungsbescheid.
28. Aug. 126 D.Z.
Re: Aktenzeichen Nr. AIG00155819 vom 11.08.126 D.E.
Hiermit informieren wir Scarlet Benoit, wohnhaft in Rieux, Europäische Föderation, dass die Ermittlungen im Fall der vermissten Person/en Michelle Benoit aus Rieux, Europäische Föderation, auf Grund der unzureichenden Beweislage hinsichtlich des Vorliegens einer Gewalttat bzw. einer anderen ungeklärten Gesetzesübertretung mit Wirkung zum 28.08.126, 15:42 Uhr, eingestellt worden sind. Es wird davon ausgegangen, dass die Person/en ihre/n Wohnort/e aus freiem Willen und/oder infolge eines Suizides verlassen hat/haben.
Der Fall gilt hiermit als abgeschlossen.
Wir danken Ihnen für das Vertrauen in unsere Ermittlungsleistungen.
Der Tele folgte eine Belehrung für die Piloten von Lieferschiffen mit dem Hinweis, die Sicherheitsbestimmungen einzuhalten und die Gurte erst zu lösen, wenn die Maschine ausgestellt war.
Scarlet starrte auf den Schirm, bis ihr die Buchstaben vor den Augen verschwammen und der Boden des Schiffs zu schwanken schien. Sie hielt den Portscreen so fest, dass die Plastikabdeckung knirschte.
»Ihr Idioten«, fauchte sie in das leere Lieferschiff.
Der Fall gilt hiermit als abgeschlossen.
Die Worte blickten ihr schadenfroh entgegen.
Sie stieß einen heiseren Schrei aus und donnerte den Port gegen das Armaturenbrett. Sollte er doch in seine Einzelteile zerschmettert durchs Schiff fliegen. Aber nach drei kräftigen Schlägen flackerte der Screen nicht einmal. »Was für Hohlköpfe!« Sie schmiss den Port in den Fußraum, ließ sich zurückfallen und drehte eine lockige Haarsträhne um den Finger.
Plötzlich schnitt ihr der Gurt in die Brust, sie bekam kaum noch Luft. Sie öffnete ihn, trat von innen gegen die Fahrertür und wäre fast in die dunkle Gasse gefallen. Aus dem Wirtshaus drang der Geruch von ranzigem Fett und Whiskey. Der Gestank und ihre Wut verschlugen ihr fast den Atem.
Sie würde zur Polizei gehen. Jetzt war es dafür zu spät – dann also morgen früh. Ganz früh. Sie würde ruhig bleiben, ihre Argumente vorbringen und ihnen erklären, warum sie sich irrten. Sie würde sie dazu bringen, den Fall wieder aufzunehmen.
Scarlet zog ihr Handgelenk über den Scanner neben der Frachtluke des Schiffs und stemmte sie gegen den hydraulischen Widerstand auf.
Sie würde dem Kommissar klarmachen, dass er weitersuchen musste. Sie würde ihn zwingen, ihr zuzuhören. Dann würde er verstehen, dass ihre Großmutter weder aus freien Stücken gegangen war noch sich das Leben genommen hatte.
Ein paar Plastikkisten mit Gartengemüse stapelten sich hinten im Schiff, aber Scarlet nahm sie kaum wahr. Sie war weit weg, in Toulouse, und legte sich zurecht, was sie morgen sagen würde. Nahm all ihre Überredungskraft, all ihre Argumentationskünste zusammen.
Irgendetwas war ihrer Grand-mère zugestoßen, irgendetwas Schlimmes, und wenn die Polizei nicht weitersuchte, musste Scarlet die Sache gerichtlich klären lassen, damit keiner dieser schwachsinnigen Kommissare je wieder ermitteln durfte und …
Sie schnappte sich zwei Tomaten, drehte sich auf dem Absatz um und klatschte sie mit voller Wucht gegen die Mauer. Die Tomaten platzten auf, Saft und Kerne spritzten auf ein paar Mülltüten.
Das tat gut. Scarlet nahm noch eine und stellte sich vor, wie die Tomate im selbstgefälligen Gesicht des Beamten zerplatzte, der zu bezweifeln wagte, dass ihre Großmutter nie und nimmer so einfach verschwinden …
Eine Tür schwang auf, als die vierte Tomate dran glauben musste. Scarlet wollte sich gerade die nächste schnappen und erstarrte mitten in der Bewegung – der Gastwirt hatte sich in der Tür aufgebaut. Gilles’ schmales Gesicht glänzte, als er sich die rote Soße ansah, die an seiner Hauswand heruntertropfte.
»Wehe, wenn das meine Tomaten sind!«
Sie wischte die verschmierten Hände an ihrer dreckigen Hose ab. Ihr Gesicht brannte, ihr Puls raste.
Gilles strich sich über den verschwitzten, fast kahlen Kopf und starrte sie an, als habe sie ein Verbrechen begangen. »Und?«
»Das waren nicht deine«, murmelte sie. Das stimmte auch, denn genau genommen gehörten sie so lange ihr, bis er sie bezahlt hatte.
Er grunzte. »Dann ziehe ich dir nur drei Univs ab, denn irgendwer muss diese Sauerei ja sauber machen. Und wenn du hier fertig bist, bringst du den Kram rein. Ich kann seit Tagen keinen frischen Salat servieren.«
Er verschwand im Restaurant, ließ die Tür aber geöffnet. Geschirrgeklapper und Gelächter drangen in die Gasse und hörten sich eigentümlich normal an.
Scarlets Welt war zusammengebrochen und niemandem fiel es auf. Ihre Großmutter Michelle war verschwunden und niemanden kümmerte es.
Sie griff nach der Tomatenkiste und wartete darauf, dass sich ihr Herzschlag beruhigte. Die Tele hatte sie völlig aus der Bahn geworfen, doch nachdem sie die erste Wut an den Tomaten ausgelassen hatte, wurden ihre Gedanken langsam klarer.
Als sie wieder, ohne zu keuchen, atmen konnte, stellte sie die Tomatenkiste auf die mit den rostbraunen Kartoffeln und hievte beide aus dem Schiff.
Die Hilfsköche nahmen keine Notiz von Scarlet, als sie auf dem Weg zum Kühlraum den Fettspritzern ihrer Bratpfannen auswich. Sie schob die Kisten in die Regale, deren Beschriftung über die Jahre ein ums andere Mal durchgestrichen und überschrieben worden war.
»Bonjour, Scarling!«
Scarlet drehte sich um und strich sich die Haare aus dem feuchten Nacken.
Emilie stand strahlend in der Tür. Ihre Augen funkelten geheimnistuerisch, offensichtlich lag ihr etwas auf der Zunge, aber als sie Scarlets Gesichtsausdruck sah, hielt sie an sich. »Was …«
»Ich möchte nicht darüber sprechen.« Scarlet drängte sich an der Kellnerin vorbei, um durch die Küche zurück zum Raumschiff zu gehen. Emilie schnalzte mit der Zunge und trottete hinter ihr her.
»Dann eben nicht. Ich bin froh, dass du gekommen bist«, sagte sie und hakte sich bei Scarlet unter, als sie die dunkle Gasse betraten. »Er ist nämlich wieder da.« Emilies engelsblonde Locken umrahmten ihr eher teuflisches Grinsen.
Scarlet nahm eine Kiste mit Pastinaken aus dem Laderaum und hielt sie der Kellnerin hin. Sie antwortete nicht, sie war unfähig, sich Gedanken darüber zu machen, wer er sein sollte und warum sie so betonte, dass er wieder da war. »Großartig«, sagte sie und lud Emilie einen Korb mit roten Zwiebeln auf.
»Erinnerst du dich wirklich nicht an ihn? Komm schon, Scar, der Straßenkämpfer, von dem ich dir vor ein paar … oder war das Sophia?«
»Ein Straßenkämpfer?« Scarlet kniff die Augen zusammen. Sie hatte pochende Kopfschmerzen. »Ach wirklich, Em?«
»Sei doch nicht so blöd. Er ist wirklich süß. In dieser Woche war er fast jeden Tag da, und er setzt sich immer an einen meiner Tische. Das hat doch sicher was zu bedeuten, oder?« Als Scarlet nichts sagte, stellte die Kellnerin die Kisten ab und fischte eine Packung Kaugummi aus ihrer Schürzentasche. »Er ist nicht laut wie Roland und seine Kumpel. Ich glaube, er ist schüchtern … und einsam.« Sie steckte sich ein Kaugummi in den Mund und bot Scarlet eins an.
»Ein schüchterner Straßenkämpfer?« Scarlet winkte ab, Kaugummi half ihr jetzt auch nicht. »Was faselst du denn da?«
»Du musst ihn selbst sehen. Sonst kannst du’s nicht verstehen. Seine Augen sind einfach so …« Emilie fächerte sich Luft zu.
»Emilie!« Wieder erschien Gilles in der Tür. »Hör auf zu quatschen und mach, dass du reinkommst. Tisch vier ruft nach dir.« Er warf Scarlet einen wütenden Blick zu – eine stumme Warnung, dass er ihr noch ein paar Univs abziehen würde, wenn sie nicht aufhörte, seine Angestellten von der Arbeit abzuhalten. Er verzog sich, ohne ihre Reaktion abzuwarten. Emilie streckte ihm die Zunge raus.
Scarlet setzte sich einen Korb Zwiebeln auf die Hüfte, schlug die Frachtluke zu und schob sich an der Kellnerin vorbei. »Ist er Tisch vier?«
»Nein, er sitzt immer an Tisch neun«, murrte Emilie und hob das Gemüse hoch. Als sie durch die dampfige Küche gingen, rief Emilie plötzlich hinter ihr: »O Mann, bin ich bescheuert! Ich wollte dir doch schon die ganze Woche eine Tele wegen deiner Großmutter schicken. Gibt’s was Neues wegen Michelle?«
Scarlet biss die Kiefer aufeinander. Der Fall gilt hiermit als abgeschlossen. Die Wörter der Tele schwirrten ihr wie Hornissen durch den Kopf.
»Nichts«, sagte sie und versuchte gar nicht erst, die Rufe der Köche zu übertönen.
Emilie folgte ihr in den Lagerraum und setzte die Pastinaken ab. Scarlet beschäftigte sich mit den Kisten, damit die Kellnerin nicht versuchte, sie aufzuheitern, doch Emilie hatte schnell Trost parat: »Mach dir keine Sorgen, Scar. Sie kommt bestimmt bald zurück.« Und damit verschwand sie im Gastraum.
Scarlet tat der Kiefer weh, so fest biss sie die Zähne aufeinander. Alle sprachen vom Verschwinden ihrer Großmutter, als sei sie eine streunende Katze, die schon nach Hause kommen würde, wenn sie Hunger hätte. Mach dir keine Sorgen, Scar. Sie kommt bestimmt bald zurück.
Es waren jetzt aber schon mehr als zwei Wochen. Sie war einfach verschwunden – ohne eine Tele zu schicken, ohne sich zu verabschieden, ohne jegliche Nachricht. Sie hatte sogar Scarlets achtzehnten Geburtstag verpasst, obwohl sie schon die Zutaten für Scarlets geliebten Zitronenkuchen gekauft hatte.
Kein Landarbeiter hatte sie weggehen sehen, kein Arbeitsdroide hatte etwas Verdächtiges aufgezeichnet. Ihr Portscreen war noch da, aber weder in den Teles noch im Kalender noch in der Netz-Chronik ließ sich irgendein Anhaltspunkt finden. Allein, dass sie ihn nicht mitgenommen haben sollte, war verdächtig genug: Man ging doch nirgends ohne seinen Port hin.
Aber das war noch nicht das Schlimmste. Weder der zurückgelassene Portscreen noch der nicht gebackene Kuchen.
Scarlet hatte den ID-Chip ihrer Großmutter gefunden.
Ihren ID-Chip! In einem kleinen Päckchen auf der Arbeitsfläche der Küche in blutverschmiertem Käsepapier.
Der Kommissar hatte dazu nur lapidar bemerkt: Das machen die Leute nun mal, wenn sie nicht aufgespürt werden wollen – sie schneiden sich die ID-Chips heraus. Er sagte das, als hätte er das Rätsel gelöst, aber Scarlet war sich sicher, dass die meisten Entführer diesen Trick auch kannten.
2
Gilles war in der Küche und strich gerade Mayonnaise auf ein Schinkenbaguette. Als Scarlet nach ihm rief, sah er missgelaunt von der Arbeit auf.
»Ich bin fertig«, sagte sie und hielt seinem finsteren Blick stand. »Quittierst du mir die Lieferung?«
Gilles schaufelte einen Haufen Pommes frites neben das Baguette und stieß den Teller über den Edelstahltresen zu ihr hinüber. »Bring das zu Tisch eins, dann ist der Lieferschein fertig, wenn du zurückkommst.«
Scarlet fauchte: »Ich arbeite nicht für dich, Gilles.«
»Sei froh, dass ich dich nicht hochkant rausschmeiße!« Er drehte ihr den Rücken zu; sein weißes Hemd war über die Jahre vom Schweiß gelb geworden.
Scarlet juckte es in den Fingern. Zu gerne hätte sie ihm das Baguette an den Hinterkopf geworfen. Aber dann kam ihr das ernste Gesicht ihrer Großmutter in den Sinn. Sie wäre so enttäuscht, wenn sie nach Hause zurückkäme und erfahren müsste, dass Scarlet mit einem ihrer gefürchteten Wutanfälle den besten Kunden vergrault hatte.
Also schnappte sie sich den Teller und stürmte aus der Küche. Sie konnte gerade noch einem Kellner ausweichen, der ihr durch die Schwingtür entgegenkam. Das Gasthaus Rieux war kein gutes Restaurant – die Böden starrten vor Dreck, man saß auf harten Stühlen an billigen Tischen und der Geruch von ranzigem Fett hing in der Luft. Aber weil man im Ort nichts lieber tat, als zu trinken und zu tratschen, war der Laden immer voll, vor allem an Sonntagen, wenn die Tagelöhner von den umliegenden Bauernhöfen freihatten.
Während Scarlet sich einen Weg durch die Menge bahnte, fiel ihr Blick auf die Netscreens über der Bar. Auf allen dreien flackerten seit der vergangenen Nacht dieselben Nachrichten vom jährlichen Ball im Asiatischen Staatenbund, auf dem die Königin von Luna Ehrengast gewesen war. Ein Cyborg-Mädchen hatte sich unter die Gäste geschmuggelt und einen Kronleuchter in die Luft gesprengt. Ein Attentat auf die Königin der Lunarier – und vielleicht auch auf den kurz zuvor gekrönten Kaiser – war jedoch vereitelt worden. Und nun schien jeder eine andere Theorie zu vertreten. Auf den Nahaufnahmen sah man ein Mädchen mit dreckigem Gesicht und wirren nassen Haarsträhnen, die aus einem aufgelösten Pferdeschwanz fielen. Es war rätselhaft, wie sie sich in diesem Aufzug überhaupt Zutritt zum königlichen Ball verschafft hatte.
»Man hätte sie gleich von ihrem Elend erlösen sollen, als sie die Treppe runtergefallen ist«, rief Roland, einer der Stammgäste, der allem Anschein nach schon stundenlang auf seinem Hocker am Tresen herumhing. Er zielte mit der ausgestreckten Rechten auf den Bildschirm und tat, als würde er schießen. »Ich hätte sie mit einem sauberen Kopfschuss erledigt. Und tschüss!«
Die umstehenden Männer murmelten zustimmend. Scarlet verdrehte angewidert die Augen und schob sich in den hinteren Teil des Raums durch.
Sie erkannte Emilies gut aussehenden Straßenkämpfer auf den ersten Blick. Mit seinen Narben und den blauen Flecken auf der olivfarbenen Haut stach er aus der Menge heraus, und außerdem war er der einzige Fremde in der Schänke. Er war weniger gepflegt, als sie nach Emilies verzückter Beschreibung erwartet hätte. Die Haare standen ihm verfilzt vom Kopf, ein Auge war zugeschwollen und blau angelaufen. Unter dem Tisch zappelte er nervös mit den Beinen.
Vor ihm standen drei Teller mit Resten eines fettigen Eiersalats, die Tomaten und Salatblätter hatte er jedoch nicht angerührt.
Ihr war nicht bewusst, dass sie ihn anstarrte, bis er ihren Blick erwiderte. Seine Augen waren von dem unnatürlichen Grün saurer Weintrauben. Scarlet hielt den Teller fester. Plötzlich verstand sie Emilie. Seine Augen sind einfach so …
Sie stellte das Baguette vor ihn auf den Tisch. »Der Croque Monsieur – war der für Sie?«
»Danke.« Seine Stimme war überraschend tief und stockend, nicht laut und barsch, wie sie vermutet hatte.
Vielleicht hatte Emilie Recht und er war wirklich schüchtern.
»Sind Sie sicher, dass wir Ihnen nicht gleich das ganze Schwein auftischen sollen?«, fragte sie ihn und stapelte die drei leeren Teller aufeinander. »Es würde uns die Arbeit abnehmen, immer wieder in die Küche zu rennen.«
Er sah sie mit großen Augen an. Scarlet dachte gerade, er würde sie beim Wort nehmen, aber dann sagte er: »Das Essen hier ist gut«, und wandte sich dem Baguette mit Schinken zu.
Sie verkniff sich eine spöttische Bemerkung. »Gutes Essen« war sicher nicht das Erste, was sie mit dem Gasthaus Rieux in Verbindung brachte. »Kämpfen macht wohl hungrig.«
Er spielte stumm mit seinem Strohhalm, und Scarlet sah, wie die Tischplatte über seinen zappelnden Beinen mitzutanzen begann.
»Guten Appetit«, sagte sie und nahm die Teller mit. Aber dann zögerte sie. »Sie wollen bestimmt keine Tomaten? Die sind das Beste daran und außerdem stammen sie aus meinem Garten. Der Salat übrigens auch, aber als ich ihn gepflückt habe, war er noch nicht welk. Jetzt würde ich ihn auch nicht mehr empfehlen. Aber was ist mit den Tomaten?«
Der Kämpfer sah sie offen an. »Ich habe noch nie welche probiert.«
Scarlet hob eine Augenbraue. »Was?«
Langsam setzte er das Glas ab, spießte zwei Tomatenscheiben auf und kaute darauf herum.
Er ließ sich Zeit und schien nachzudenken, bevor er sie herunterschluckte. »Sie schmecken anders, als ich erwartet habe«, sagte er und sah wieder zu ihr hoch. »Aber nicht schlecht. Ich hätte gerne noch welche, wenn’s geht.«
Scarlet balancierte den Tellerstapel und versuchte, ein Messer zu erwischen, bevor es auf den Boden fiel. »Wissen Sie, eigentlich arbeite ich gar nicht für …«
»Jetzt kommt’s!«, rief jemand an der Bar und ein Raunen ging durch das Wirtshaus. Scarlet sah hoch auf die Netscreens. In einem üppigen Garten voller Bambus und Lilien funkelten Regentropfen und rotes Licht fiel aus einem Saal auf eine große Treppe. Dunkle Gestalten warfen lange Schatten hinunter auf den Pfad vor den Stufen. Eine friedliche Szenerie.
»Zehn Univs, dass gleich ein Mädchen auf der Treppe seinen Fuß verliert!«, schrie jemand. Lautes Gelächter von der Bar. »Wettet jemand gegen mich? Nun kommt schon, die Chancen stehen doch gar nicht so schlecht!«
Einen Moment später erschien das Cyborg-Mädchen auf dem Schirm. Sie stürzte aus der hohen Tür, sprang panisch mit wehendem silbernen Kleid die Treppe herunter – die ruhige Atmosphäre im Garten war dahin. Scarlet hielt den Atem an. Sie wusste, was als Nächstes passieren würde, erschrak aber dennoch, als das Mädchen strauchelte, die Stufen herunterflog und unten auf dem Kiesweg aufschlug. Der Ton war abgestellt, doch Scarlet hörte das Mädchen fast nach Luft ringen, als es sich auf den Rücken rollte und wie gelähmt zur Tür hochstarrte. Schattenhafte Gestalten näherten sich und tauchten als Schemen über ihm auf.
Da sie die Szene jetzt schon mindestens ein Dutzend Mal gesehen hatte, hielt Scarlet nach dem verlorenen Fuß Ausschau, auf dem sich das Licht aus dem Ballsaal spiegelte. Nach dem Cyborg-Fuß des Mädchens.
»Angeblich ist das dort auf der rechten Seite die Königin«, meinte Emilie. Scarlet erschrak, sie hatte nicht bemerkt, dass die Kellnerin neben ihr stand.
Der Prinz – nein, jetzt war er ja Imperator – kam langsam die Stufen herunter und bückte sich nach dem Fuß. Das Mädchen bemühte sich, das Ballkleid über die Kabel zu zerren, die sich wie Tentakel aus ihrem Metallstumpf herauswanden, aber dazu war es schon zu spät.
Scarlet waren schon viele Gerüchte zu Ohren gekommen. Angeblich war das Mädchen nicht nur eine Lunarierin – ein illegaler Flüchtling und eine Gefahr für die Erde –, sie sollte es auch fertiggebracht haben, Imperator Kai einer Gehirnwäsche zu unterziehen. Manche vertraten die Meinung, sie sei auf Geld aus, und andere, es gehe ihr um Macht. Oder wollte sie den Krieg anzetteln, der schon so lange drohte? Welche Motive sie auch haben mochte, Scarlet hatte Mitleid mit ihr, wie sie so hilflos da unten an der Treppe lag. Das Mädchen war noch keine zwanzig, sogar jünger als sie selbst.
»Wie war das, wer wollte sie von ihrem Elend erlösen?«, brüllte ein Typ an der Bar.
Roland deutete auf den Bildschirm. »Ich hab in meinem ganzen Leben noch nie so was Ekelerregendes gesehen.«
Von hinten reckte jemand den Kopf aus der Menge, um Roland besser sehen zu können. »Mann, hör doch auf! Sie ist süß und so unschuldig. Die sollten sie besser mal zu mir schicken als auf den Mond.«
Dreckiges Lachen. Roland schlug so fest auf die Theke, dass ein senfverschmierter Teller klirrte. »Klar, so ein Metallbein macht ein Betthäschen erst richtig kuschelig!«
»Du Dreckskerl!«, zischte Scarlet, aber die Beleidigung ging in dem schallenden Gelächter unter.
»Mir würde es auch nichts ausmachen, sie ein bisschen aufzuwärmen!«, schrie ein anderer, und die Kneipe dröhnte von Beifall und allgemeiner Heiterkeit.
In Scarlet stieg die kalte Wut hoch. Sie knallte den Tellerstapel auf den Tisch und bahnte sich einen Weg hinter die Bar, ohne auf die überraschten Gesichter der anderen zu achten.
Der Barkeeper sah verdattert zu, wie Scarlet ein paar Flaschen aus dem Weg räumte und geschickt auf den Tresen sprang. Sie reckte sich, öffnete die Wandverkleidung unter dem Regal mit den Cognacgläsern und zerrte am Netlink-Kabel. Der Palastgarten und das Cyborg-Mädchen verschwanden, die drei Bildschirme in der Schänke wurden schwarz.
Die Gäste protestierten laut.
Scarlet wirbelte herum und fegte eine Weinflasche vom Tresen, die auf dem Boden zersplitterte, doch sie hörte es kaum. Sie fuchtelte mit dem Kabel über der aufgebrachten Menge herum. »Etwas mehr Respekt! Dieses Mädchen wird hingerichtet!«
»Das Mädchen ist Lunarierin!«, schrie jemand. »Geschieht ihr recht!«
Die Gäste nickten; jemand warf mit einem Brotkanten nach Scarlet und traf sie an der Schulter. Sie stemmte die Hände in die Hüften. »Sie ist doch erst sechzehn!«
Alle sprangen auf und schrien irgendwas über Lunarier durcheinander. Aus dem allgemeinen Gebrüll hörte Scarlet heraus: Das Mädchen wollte schließlich ein Staatsoberhaupt der Union töten!
»Hey, entspannt euch und lasst Scarlet in Ruhe!«, brüllte Roland. Der Whiskey hatte sein Selbstbewusstsein gestärkt. »Ihr wisst doch, dass die in Scars Familie nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Erst verduftet die alte Ziege spurlos und jetzt verteidigt Scarlet Lunarier!«
Das Gelächter und die höhnischen Rufe dröhnten Scarlet in den Ohren. Plötzlich hieb sie auf Rolands Kopf ein, ohne überhaupt zu wissen, wie sie vom Tresen gekommen war. Gläser und Flaschen gingen zu Bruch.
Er japste nach Luft. »Hey, was ist denn in dich gefahren?«
»Meine Großmutter ist nicht verrückt!« Sie packte ihn am Hemd. »Hast du das dem Kommissar auch gesagt? Hast du ihm gesagt, dass sie nicht richtig tickt?«
»Natürlich habe ich ihm das gesagt!«, schrie er. Seine Fahne war widerlich, trotzdem krallte sie sich an seinem Hemd fest, bis ihr die Fäuste wehtaten. »Und ich war mit Sicherheit nicht der Einzige. Die hat sich doch immer in ihrer Bruchbude eingeigelt und mit Tieren und Androiden geredet, als wären sie ihre Freunde. Und die Menschen hat sie dann mit dem Gewehr verjagt …«
»Nur ein einziges Mal, und das war ein Hausiererdroide!«
»Mich überrascht es jedenfalls nicht, dass die alte Benoit jetzt total durchgeknallt ist. Dass es mal so kommen wird, hat man sich ja schon ’ne ganze Weile gedacht.«
Scarlet gab Roland einen kräftigen Schubs. Er stolperte rückwärts und fiel gegen Emilie. Diese schrie auf und knallte auf den Tisch hinter sich. Dann hob sie abwehrend die Hände und versuchte Roland irgendwie von sich wegzuhalten.
Doch er blieb auf den Beinen und war unschlüssig, ob er grinsen oder seinerseits zum Angriff übergehen sollte. »Sei lieber vorsichtig, Scar, sonst endest du noch wie deine alte –«
Tischbeine quietschten über die Fliesen, dann nahm der Kämpfer Roland in den Schwitzkasten und hob ihn vom Boden hoch.
In der Kneipe wurde es still. Der Kämpfer hielt Roland wie eine Puppe in die Höhe, ohne sich um dessen Keuchen zu kümmern.
Scarlet holte tief Luft, die Kante des Tresens bohrte sich ihr in den Magen.
»Ich finde, jetzt ist hier mal eine Entschuldigung fällig«, sagte der Kämpfer gelassen.
»He, sofort loslassen!«, schrie ein Mann, dessen Stuhl mit lautem Gepolter hintenüberkippte. »Sie bringen ihn um!« Er packte den Kämpfer am Handgelenk, aber er hätte genauso gut an einem einzementierten Eisengitter zerren können. Der Arm bewegte sich keinen Millimeter. Der Mann wurde rot, ließ den Arm los und setzte zu einem Schlag gegen den Kämpfer an, aber der wehrte ihn mit der freien Hand blitzartig ab.
Scarlet schob sich auf die beiden zu. Auf dem Unterarm des Kämpfers registrierte sie eine Tätowierung aus Buchstaben und Ziffern. LSOW962.
Der Kämpfer war zwar immer noch wütend, sah jetzt allerdings auch belustigt aus, als hätte er sich gerade an die Regeln eines Spiels erinnert. Er ließ Roland wieder auf die Füße herunter und gab die Hand des anderen Mannes frei.
Roland sank schlotternd auf einen Hocker. »Was ist denn mit dir los?«, stieß er hervor und rieb sich den Hals. »Bist du irgend so ein durchgeknallter Großstädter oder was?«
»Du hast dich respektlos verhalten.«
»Respektlos?«, brüllte Roland. »Du hast mich fast umgebracht!«
Durch die Schwingtüren polterte Gilles herein. »Was ist hier los?«
»Der Bursche da zettelt eine Schlägerei an«, sagte einer aus der Menge.
»Und Scarlet hat die Screens kaputt gemacht.«
»Stimmt doch gar nicht, du Idiot!«, schrie Scarlet, auch wenn sie nicht sicher war, wer das gesagt hatte.
Gilles warf einen Blick auf die Bildschirme, auf die Splitter der zerbrochenen Flaschen und Gläser und funkelte den Straßenkämpfer wütend an. »Du«, sagte er und zeigte mit dem Finger auf den Kämpfer, »verschwindest auf der Stelle aus meinem Wirtshaus.«
Scarlet protestierte. »Er hat doch überhaupt nichts …«
»Versuch’s gar nicht erst, Scarlet. Was willst du denn heute noch alles demolieren? Oder legst du es darauf an, einen guten Kunden loszuwerden?«
Scarlet baute sich hitzig vor ihm auf. »Ich kann die Lieferung auch wieder mitnehmen. Wir werden ja sehen, wie deinen Gästen das vergammelte Gemüse schmeckt, das du ihnen dann vorsetzt.«
Gilles kam um den Tresen herum und riss Scarlet das Kabel aus der Hand. »Glaubst du wirklich, ihr habt den einzigen guten Bauernhof in Frankreich? Ganz ehrlich, Scar, ich bestelle nur bei euch, weil Michelle mich sonst ohne Ende nerven würde.«
Scarlet biss die Zähne zusammen. Sie wollte ihn nicht daran erinnern, dass ihre Großmutter nicht mehr da war und er vielleicht sowieso bald bei jemand anderem bestellen musste.
Gilles wandte sich wieder dem Kämpfer zu. »Raus! hab ich gesagt.«
Ohne ihn weiter zu beachten, half der Kämpfer Emilie auf die Füße, die immer noch rücklings auf dem Tisch lag. Ihr Gesicht war gerötet und ihr Rock mit Bier getränkt, aber sie blickte ihn verzückt an.
»Danke«, sagte sie in die unheilvolle Stille hinein.
Schließlich sah der Kämpfer Gilles an. »Ich gehe ja schon. Aber nicht, ohne zu zahlen.« Er zögerte. »Und ich komme auch für die kaputten Gläser auf.«
Scarlet traute ihren Ohren nicht. »Was?«
»Ich will dein Geld nicht!«, schrie Gilles. Das war ein weiterer Schock für Scarlet. Gilles redete immer nur über Geld und klagte über seine Lieferanten, die alles daransetzten, ihn in den Ruin zu treiben. »Verschwinde! Sofort!«
Der Kämpfer warf Scarlet einen Blick aus seinen hellgrünen Augen zu und kurz spürte sie eine Verbundenheit zwischen ihnen.
Sie waren beide Ausgestoßene. Unerwünscht. Verrückt.
Mit klopfendem Herzen verbannte sie diese Gedanken. Der Mann roch nach Ärger. Seinen Lebensunterhalt verdiente er durchs Kämpfen – oder vielleicht machte er es auch nur zum Zeitvertreib. Sie war sich nicht sicher, was sie schlimmer fand.
Im Hinausgehen deutete der Kämpfer eine Verbeugung an, die man als Entschuldigung werten konnte. Als er an ihr vorbeistrich, fand Scarlet, dass er trotz seiner offenkundigen Brutalität nicht bedrohlicher wirkte als ein verprügelter Hund.
3
Scarlet zerrte die Kiste mit den Kartoffeln vom untersten Regalbrett und ließ sie mit einem dumpfen Krachen auf den Boden fallen, bevor sie die Tomaten daraufstellte. Dann waren die Zwiebeln und Pastinaken an der Reihe. Sie würde zweimal zum Schiff gehen müssen, und das nervte sie mehr als alles andere. So viel zum Thema gelungener Abgang.
Sie wuchtete zwei Kisten hoch.
»Was machst du denn da?«, fragte Gilles von der Tür her, ein Geschirrtuch über der Schulter.
»Ich nehme das Zeug wieder mit.«
Seufzend lehnte sich Gilles an die Wand. »Scar, das vorhin, das war doch nicht so gemeint.«
»Ach, nicht? Und wie hast du es dann gemeint?«
»Hör mal, ich mag Michelle – und dich auch. Ja, ihr habt happige Preise und könnt einen ganz schön quälen mit eurem verrückten …« Er hob abwehrend die Hände, als Scarlet wieder wütend wurde. »Hey, du bist gerade auf meinen Tresen geklettert und hast die Leute aufgewiegelt, also sag nicht, dass nichts dran ist.«
Sie verzog das Gesicht.
»Aber es stimmt schon, deine Grand-mère führt ihren Hof gut und eure Tomaten sind in jeder Saison die besten, die man in Frankreich kriegen kann. Deswegen will ich ja auch, dass ihr mich weiter beliefert.«
Die glänzenden roten Tomaten in Scarlets Kiste rollten von einer Seite zur anderen.
»Nun stell sie doch zurück, Scar. Ich hab den Lieferschein schon abgezeichnet.«
Er ging wieder, bevor Scarlet noch einen Wutanfall bekommen konnte.
Sie blies sich eine rote Locke aus dem Gesicht, setzte das Gemüse ab und gab der Kartoffelkiste einen Tritt, so dass sie wieder im Regal verschwand. In der Küche lachten sich die Köche über das Drama im Gastraum halb tot. Was gerade geschehen war, hörte sich jetzt schon ganz anders an. Angeblich hatte der Kämpfer auf Rolands Kopf eine Flasche zerbrochen, ihn bewusstlos geschlagen und einen Stuhl zertrümmert. Dasselbe hätte er auch mit Gilles gemacht, wenn Emilie ihn nicht mit ihrem süßen Lächeln beschwichtigt hätte.
Da ihr sowieso egal war, was sie sich erzählten, wischte sich Scarlet die Hände an ihrer Jeans ab und marschierte durch die Küche zum Scanner neben der Hintertür. Eisiges Schweigen. Gilles ließ sich nicht blicken, aus dem Gastraum hörte sie nur Emilies Lachen. Scarlet hoffte, dass sie sich die gehässigen Blicke der Köche nur einbildete. Wie schnell würden sich die Gerüchte wohl in der Stadt herumsprechen?
Scarlet Benoit hat das Cyborg-Mädchen, diese Lunarierin, verteidigt! Jetzt hat sie endgültig den Verstand verloren, genau wie ihre …
Sie hielt das Handgelenk vor den uralten Scanner und kontrollierte gewohnheitsmäßig den Lieferschein, der auf dem Screen erschien, nur um sicherzugehen, dass Gilles nicht wie so oft einen Posten ausgelassen hatte. Aber er hatte lediglich drei Univs für die zermanschten Tomaten abgezogen. 687 U AUFKONTO GEMÜSE UND OBST VOM HOF BENOIT ÜBERWIESEN.
Sie ging durch die Hintertür hinaus, ohne sich zu verabschieden.
Auch wenn die Wärme des sonnigen Nachmittags noch in der Luft lag, war die schattige Gasse kühl im Vergleich zur stickigen Küche. Scarlet sortierte die Kisten im Heck des Schiffs. Sie war spät dran und würde noch lange brauchen, bis sie zu Hause ankam. Dabei musste sie am nächsten Morgen sehr früh aufstehen, um zur Polizeistation nach Toulouse zu fahren, sonst würde ein weiterer Tag vorübergehen, ohne dass etwas unternommen wurde, um ihre Großmutter wiederzufinden.
Zwei Wochen. Zwei geschlagene Wochen war ihre Grand-mère jetzt schon allein auf sich gestellt. Hilflos. Vergessen. Oder vielleicht sogar … tot, vielleicht lag sie erschlagen in irgendeinem matschigen Graben. Aber warum? Warum bloß?
Tränen schossen ihr in die Augen, doch sie schlug die Luke zu, ging um das Schiff herum – und blieb wie angewurzelt stehen.
Dort stand der Kämpfer lässig an die Hauswand gelehnt und beobachtete sie.
Sie wischte ihre Tränen weg und starrte ihn an. War das eine Drohgebärde? Er stand etwa fünf Meter vom Bug des Schiffs entfernt. Seine Haltung erschien ihr eher abwartend als aggressiv, aber er hatte auch nicht gefährlich ausgesehen, als er Roland in den Schwitzkasten genommen hatte.
»Ich wollte mich nur vergewissern, dass es dir gut geht«, sagte er so leise, dass sie seine Worte kaum verstehen konnte.
Sie ärgerte sich über ihre Nervosität, aber sie wusste einfach nicht, ob sie Angst vor ihm haben oder sich geschmeichelt fühlen sollte.
»Mir geht es jedenfalls besser als Roland«, sagte sie. »Er hatte schon die ersten blauen Flecken am Hals, als ich gegangen bin.«
Er warf einen Blick auf die Küchentür. »Damit ist er noch gut bedient.«
Normalerweise hätte sie das zum Lachen gebracht, aber nach all der Wut und Frustration dieses Nachmittags hatte sie keine Energie mehr. Noch nicht einmal zum Lachen. »Es wäre besser gewesen, wenn du dich rausgehalten hättest; ich hatte alles im Griff.«
»Ganz offensichtlich.« Er warf ihr einen Seitenblick zu, als versuchte er, ein Rätsel zu lösen. »Ich hab nur Angst gehabt, dass du die Pistole ziehen würdest. Und das wäre nicht besonders hilfreich gewesen. Was das Nicht-Verrücktsein angeht, meine ich.«
Ihre Nackenhaare stellten sich auf. Scarlet tastete instinktiv in ihrem Kreuz nach der Pistole, die warm auf ihrer Haut lag. Ihre Großmutter hatte sie ihr zum elften Geburtstag mit der paranoiden Warnung geschenkt: Nur für den Fall, dass du entführt wirst. Sie hatte Scarlet beigebracht, wie man mit der Pistole umging, und seitdem verließ Scarlet das Haus nie mehr ohne die Waffe, so albern ihr das auch vorkam.
Das war jetzt sieben Jahre her und sie war ziemlich sicher, dass die Pistole, die sie wie immer unter ihrem roten Kapuzenpulli verbarg, nie irgendwem aufgefallen war. Bis heute.
»Woher weißt du das?«
Er zuckte die Achseln – jedenfalls hätte man die Geste so deuten können, wenn sie nicht so verkrampft und ruckartig gewesen wäre. »Ich hab den Griff gesehen, als du auf den Tresen geklettert bist.«
Scarlet schob die Hand unter den Pulli, um die Pistole tiefer in den Hosenbund zu stecken. Sie versuchte ruhig zu atmen, aber der Gestank nach scharf angebratenen Zwiebeln und vergammelnden Küchenabfällen war zu stechend.
»Vielen Dank, das ist echt nett, aber mir geht’s gut. Und jetzt muss ich los – ich bin spät dran mit meinen Lieferungen und … allem.« Sie ging auf die Pilotentür zu.
»Gibt es noch Tomaten?« Der Kämpfer sah sie geduckt aus dem Schatten an. »Ich hab nämlich immer noch Hunger«, murmelte er.
Scarlet glaubte fast, die zermanschten Tomaten an der Wand hinter ihm riechen zu können.
»Ich kann auch bezahlen«, fügte er schnell hinzu.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das geht schon in Ordnung. Wir haben mehr als genug.« Sie wich zurück, ohne ihn aus den Augen zu lassen, und öffnete die Heckluke. Dann nahm sie eine Fleischtomate und einen Bund Karotten heraus. »Hier, die schmecken roh auch gut«, sagte sie und warf sie ihm zu.
Er fing sie mühelos auf und ließ die Tomate in einer Pranke verschwinden, während er die Möhren in der anderen Hand hielt. Er betrachtete sie prüfend von allen Seiten und fragte schließlich: »Was ist das?«
Sie lachte überrascht. »Wie bitte? Das sind Möhren!«
Wieder schien es ihm peinlich zu sein, dass er etwas Ungewöhnliches gesagt hatte. Er zog die Schultern ein, als wollte er sich kleiner machen. »Danke.«
»Deine Mutter hat wohl keinen Wert darauf gelegt, dass du Gemüse isst?«
Sie sahen sich an und waren plötzlich beide verlegen. In der Kneipe ging irgendwas zu Bruch, dann hörte man Gelächter.
»Macht ja nichts. Sie sind wirklich lecker.« Sie schloss die Luke, ging wieder zur Pilotentür und zog ihre ID über den Scanner des Schiffs, worauf sich die Tür öffnete. Die Scheinwerfer leuchteten auf. Im hellen Licht schien sein Veilchen noch dunkler als vorhin. Er fuhr zusammen wie ein Krimineller im Kegel eines Suchscheinwerfers.
»Ich frag mich, ob du vielleicht einen Landarbeiter gebrauchen kannst«, sprudelte es so schnell aus ihm heraus, dass die Worte kaum zu verstehen waren.
Nun begriff Scarlet endlich, warum er auf sie gewartet und dann so lange herumgedruckst hatte. Sie taxierte seine breiten Schultern und die kräftigen Oberarme – er war für körperliche Arbeit wie geschaffen. »Du suchst Arbeit?«
Ein schiefes Lächeln – und jetzt sah er gefährlich aus. »Kämpfen wird zwar ordentlich bezahlt, macht sich aber nicht so gut im Lebenslauf. Ich hab mir gedacht, du könntest mich vielleicht in Naturalien bezahlen.«
Sie lachte. »Ich hab gerade die Beweisstücke deines Riesenappetits weggeräumt. Da müsste ich wohl mein letztes Hemd an dich verfüttern.« Auf der Stelle wurde sie rot – war sie vielleicht zu weit gegangen? Sein Gesicht blieb vollkommen unbewegt und so sprach sie schnell weiter, bevor er reagieren konnte. »Wie heißt du eigentlich?«
Wieder dieses ungelenke Achselzucken. »Mein Kampfname ist Wolf.«
»Wolf? Das hört sich ja ziemlich wild an!«
Er nickte ernst.
Scarlet unterdrückte ein Grinsen. »Das mit den Straßenkämpfen solltest du wirklich nicht im Lebenslauf erwähnen.«
Er kratzte sich am Ellenbogen; die merkwürdige Tätowierung konnte sie im Dunklen nur erahnen. Vielleicht hatte sie ihn mit der Bemerkung über seinen Namen in Verlegenheit gebracht.
»Mich nennen jedenfalls alle Scarlet. Ja, genau, wegen meiner Haarfarbe.«
Sein Gesichtsausdruck wurde weicher. »Wegen was für einer Haarfarbe?«
Scarlet lehnte sich an die Tür. »Sehr komisch.«
Einen Moment schien er sehr zufrieden mit sich, und Scarlet fand den Fremden, diesen Außenseiter, langsam sympathisch. Den Straßenkämpfer mit der sanften Stimme.
Dann kribbelte ihr warnend der Hinterkopf. Sie vergeudete ihre Zeit. Großmutter war verschwunden. Vielleicht lag sie schon längst tot in irgendeinem Graben.
Scarlet stützte sich im Türrahmen ab. »Es tut mir wirklich leid, aber wir sind gut versorgt. Ich brauche keine Landarbeiter mehr.«
Der Funke in seinen Augen erstarb und er schien sich wieder unbehaglich zu fühlen. »Ich verstehe. Vielen Dank für das Essen«, sagte er nervös. Er kickte den Stab einer erloschenen Rakete vom Bürgersteig – ein Überrest der gestrigen Friedensfeier.
»Du solltest nach Toulouse oder Paris gehen. In den Städten gibt’s mehr Jobs – außerdem sind die Leute hier Fremden gegenüber misstrauisch, wie du vielleicht schon gemerkt hast.«
Er neigte den Kopf, so dass seine smaragdfarbenen Augen im Scheinwerferlicht des Schiffs noch heller leuchteten, und sah sie fast amüsiert an. »Danke für den Tipp.«
Scarlet kehrte ihm den Rücken zu und ließ sich auf den Pilotensitz sinken.
Wolf drückte sich an die Wand, als sie das Schiff startete. »Falls du es dir anders überlegst: Nachts bin ich oft beim verlassenen Haus der Morels. Ich bin vielleicht nicht so geschickt im Umgang mit Menschen, aber auf einem Bauernhof würde ich mich gut machen.« Seine Mundwinkel hoben sich kaum merklich. »Tiere mögen mich.«
»Da bin ich sicher«, sagte Scarlet und schenkte ihm ein geheucheltes aufmunterndes Lächeln. Sie schloss die Tür, bevor sie murmelte: »Gibt es Tiere, die keine Wölfe mögen?«
4
Mit der verhängnisvollen Seifenrebellion und ihren Auswirkungen hatte die Gefangenschaft Carswell Thornes denkbar schlecht begonnen. Doch seit Beginn seiner Einzelhaft war er der Inbegriff eines Gentlemans mit den allerbesten Manieren, und nach sechs Monaten dieses vorbildlichen Verhaltens hatte er die einzige weibliche Wärterin überreden können, ihm einen Portscreen zu leihen.
Er war ziemlich sicher, dass er damit keinen Erfolg gehabt hätte, wenn die Wärterin nicht davon überzeugt gewesen wäre, dass er ein Idiot war, der nur die Tage zählte und das Gerät benutzen wollte, um nach freizügigen Bildern von irgendwelchen Frauen zu suchen.
Natürlich hatte sie Recht. Technologie war für Thorne ein Buch mit sieben Siegeln und das Tablet hätte ihm selbst dann nicht geholfen, wenn er im Netz das Handbuch »Du und dein Portscreen: Gefängnisflucht leicht gemacht« gefunden hätte. Er hatte es weder geschafft seine Teles abzurufen noch die Nachrichten noch irgendwelche Informationen über das Gefängnis in Neu-Peking und das Viertel, in dem es sich befand.
Doch die anzüglichen Bilder wusste er zu schätzen, obwohl sie zensiert waren.
Am 228. Tag seiner Gefangenschaft scrollte er mal wieder durch seine Bilder und fragte sich, ob Señora Santiago noch mit dem Zwiebelfresser verheiratet war, als ein kreischendes Geräusch den Frieden seiner Zelle störte.
Er sah mit zusammengekniffenen Augen zur blendend weißen Decke hinauf.
Das Kreischen verstummte, dann folgte ein Scharren. Hammerschläge und weiteres Scharren.
Thorne setzte sich im Schneidersitz auf sein Feldbett und wartete ab, während die Geräusche immer lauter wurden und näher zu kommen schienen. Erst nach einigem Nachdenken kam er darauf, dass der Lärm nur von einer Bohrmaschine stammen konnte.
Wahrscheinlich Reparaturarbeiten an den Zellen.
Das Geräusch verstummte, auch wenn es ihm in den Ohren nachklang und die Wände noch zu vibrieren schienen. Thornes Zelle war ein perfekter Würfel mit schimmernden weißen Wandpaneelen, einer schneeweißen Liege, einem Urinal, das auf Knopfdruck aus der Wand glitt und wieder darin verschwand – und ihm selbst in seiner weißen Gefängnisuniform.
Falls renoviert wurde, so hoffte er, dass seine Zelle als Nächstes dran war.
Das Geräusch setzte wieder ein, diesmal knirschte es noch lauter und dann durchstieß ein langer Bohraufsatz die Decke und eine Schraube fiel klirrend auf den Zellenboden. Drei weitere folgten ihr. Eine rollte unter Thornes Feldbett.
Einen Augenblick darauf krachte eine quadratische weiße Platte herab. Durchs Loch baumelten zwei Beine, die in einem weißen Overall steckten, doch die Füße waren – im Gegensatz zu Thornes – nackt.
Einer war aus Haut und Knochen.
Der andere aus reflektierendem Metall.
Mit einem kehligen Schrei landete ein Mädchen mitten in seiner Zelle.
Die Ellenbogen auf die Knie gestützt beugte sich Thorne vor, um sie aus seiner sicheren Position besser sehen zu können. Sie war schmal gebaut, hatte gebräunte Haut und glattes braunes Haar. Ihre linke Hand war wie der linke Fuß aus Metall.
Das Mädchen fand sein Gleichgewicht wieder, stand auf und klopfte sich den Staub vom Overall.
»Es tut mir leid«, sagte Thorne.
Mit wildem Blick wirbelte sie zu ihm herum.
»Es kommt mir so vor, als wärst du in der falschen Zelle gelandet. Soll ich dir verraten, wie du in deine zurückkommst?«
Sie kniff die Augen zusammen.
Thorne lächelte.
Das Mädchen runzelte die Stirn.
Thorne fand, dass sie hübscher wurde, wenn sie so zornig war, stützte das Kinn in die Hand und musterte sie unverhohlen. Er hatte noch nie zuvor Bekanntschaft mit einem Cyborg gemacht, geschweige denn mit einem geflirtet, aber irgendwann war immer das erste Mal.
»Eigentlich sollten diese Zellen leer stehen«, sagte sie.
»Außergewöhnliche Umstände.«
Sie musterte ihn eine ganze Weile mit gerunzelten Brauen. »Mord?«
Er grinste breit. »Danke für die Blumen, aber das nun auch wieder nicht. Ich habe beim Hofgang einen Aufstand angezettelt.« Er nestelte an seinem Overall, bevor er fortfuhr: »Wegen der Seife.«
Das schien sie zu verwirren, aber sie blieb wachsam.
»Die Seife«, begann er wieder und fragte sich, ob sie überhaupt zugehört hatte, »trocknet meine Haut aus.«
Sie sagte nichts.
»Ich habe empfindliche Haut.«
Er erwartete etwas Mitfühlendes, aber es kam nur ein desinteressiertes »Hm«.
Sie trat gegen die heruntergefallene Bodenplatte und sah sich in der Zelle um. »So was Beklopptes«, murmelte sie, ging an Thorne vorbei zur Wand und lehnte sich dagegen. »Es ist eine Zelle weiter.«
Plötzlich flatterten ihre Wimpern, als hätte sie Staub in die Augen bekommen, und sie hieb sich mit der flachen Hand ein paarmal gegen die Schläfen.
»Du willst wohl fliehen.«
»Nicht in dieser Sekunde«, sagte sie mit zusammengebissenen Zähnen und schüttelte heftig den Kopf. »Aber im Prinzip trifft das zu.« Ihre Miene hellte sich auf, als sie den Port in seinem Schoß entdeckte. »Was ist das für einer?«
»Das darfst du mich nicht fragen.« Er reichte ihn dem Mädchen hinüber. »Ich bin gerade bei einer Bestandsaufnahme aller Frauen, die ich irgendwann mal geliebt habe.«
Sie schnappte sich den Portscreen und drehte ihn um. Die Kuppe eines ihrer Cyborg-Finger öffnete sich, ein kleiner Schraubenzieher kam zum Vorschein und schon hatte sie die Abdeckung des Geräts abgeschraubt.
»Was machst du da?«
»Ich brauche das Videokabel.«
»Wofür?«
»Meins ist kaputt.«
Sie zog ein gelbes Kabel aus dem Portscreen, warf Thorne das Gerät in den Schoß und setzte sich im Schneidersitz auf den Boden. Thorne sah ihr verblüfft zu, als sie den Kopf zur Seite neigte und eine Klappe an ihrem Hinterkopf öffnete. Einen Moment später hielt sie ein Kabel zwischen den Fingern, das dem aus dem Port ähnelte, abgesehen von einem schwarzen Ende. Das Mädchen steckte konzentriert das neue Kabel ein.
Erfreut schloss sie die Klappe und warf Thorne das alte Kabel zu. »Danke.«
Er wich entsetzt vor dem Kabel zurück. »Hast du einen Portscreen im Kopf?«
»So was Ähnliches.« Das Mädchen stand auf und tastete die Wand ab. »Ja, das ist schon besser. Und wie komme ich jetzt …« Sie unterbrach sich und drückte auf einen Knopf in der Ecke. Eine schimmernde weiße Platte hob sich und das Urinal glitt aus der Wand. Sie durchsuchte die Vertiefung dahinter.
Thorne rückte von dem weggeworfenen Kabel ab, verdrängte das Bild, wie sie die Abdeckung in ihrem Kopf geöffnet hatte, und gab sich wieder als vollkommener Gentleman. Er versuchte es mit Small Talk, während sie arbeitete, fragte, warum sie hier sei, und machte ihr Komplimente für die handwerkliche Perfektion ihrer Metallgliedmaßen. Sie schenkte ihm keine Beachtung und langsam fragte er sich, ob er durch die Abschirmung von der weiblichen Bevölkerung womöglich seinen Charme verloren hatte.
Aber das kam ihm unwahrscheinlich vor.
Ein paar Minuten später fand das Mädchen offensichtlich, wonach es gesucht hatte, und das nervtötende Bohren und Schrauben setzte wieder ein.
»Als man dich eingesperrt hat«, rief Thorne, »hat man sich da keine Gedanken darüber gemacht, dass das Gefängnis Sicherheitslücken haben könnte?«
»Da hatte es noch keine. Die Hand ist eine Neuerwerbung.« Sie starrte in die Ecke der Zelle, als wollte sie durch die Wand hindurchsehen.
Vielleicht hatte sie den Röntgenblick. Damit wüsste er allerdings auch etwas anzufangen.
»Lass mich raten«, sagte Thorne. »Einbruch?«
Nachdem sie lange schweigend den Zugmechanismus des Urinals untersucht hatte, rümpfte das Mädchen die Nase. »Zwei Anklagen wegen Hochverrats, wenn du es genau wissen willst. Dazu Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie rechtswidriger Einsatz von Bioelektrizität. Ach so, illegale Einwanderung, aber das ist ja nun wirklich überzogen.«
Er warf einen schnellen Blick auf ihren Hinterkopf, dann fragte er sie: »Wie alt bist du?«
»Sechzehn.«
Der Schraubenzieher auf ihrem Finger drehte sich wieder. Thorne wartete darauf, dass das Knirschen nachließ. »Und wie heißt du?«
»Cinder«, sagte sie und es wurde wieder laut.
Nachdem der Krach vorbei war, stellte er sich vor. »Ich bin Kapitän Carswell Thorne. Aber die meisten nennen mich …«
Lautes Knirschen.
»Thorne. Oder Kapitän. Oder Kapitän Thorne.«
Ohne zu reagieren, stocherte sie weiter in dem Loch in der Wand herum. Es sah so aus, als versuchte sie an einer Schraube zu drehen, die sich nicht lockern wollte, denn kurz darauf setzte sie sich frustriert auf den Boden.
»Du scheinst einen Komplizen zu brauchen«, meinte Thorne und strich seinen Overall glatt. »Und du hast Glück, denn ich bin ein kriminelles Superhirn.«
Sie warf ihm einen wütenden Blick zu. »Hau ab!«
»Leichter gesagt als getan.«
Seufzend kratzte sie die weißen Plastikteile vom Schraubenzieher.
»Was hast du vor, wenn du draußen bist?«
Sie wandte sich wieder der Wand zu. Das knirschende Geräusch dauerte eine Weile an, dann machte sie eine Pause und massierte sich den Nacken, der verspannt zu sein schien. »Am schnellsten aus der Stadt hinaus geht es nach Norden.«
»Ach, meine kleine, naive Gefangene. Glaubst du denn nicht, dass die genau das erwarten?«
Sie stieß den Schraubenzieher in die Nische. »Hör auf, mich abzulenken.«
»Ich hab doch nur gemeint, dass wir uns vielleicht gegenseitig helfen könnten.«
»Lass mich in Ruhe.«
»Ich habe ein Schiff.«
Sie warf ihm einen warnenden Blick zu.
»Ein Raumschiff.«
»Ein Raumschiff«, sagte sie gedehnt.
»Das bringt uns in zwei Minuten in die Umlaufbahn. Und es steht direkt vor der Stadt. Wir können es leicht erreichen. Und, was meinst du?«
»Ich meine, wenn du nicht aufhörst zu quatschen und mich arbeiten lässt, kommen wir keinen Meter weit.«
»Ein Punkt für dich«, sagte Thorne und hob die Hände. »Denk einfach mal darüber nach in deinem hübschen Köpfchen.«
Irritiert arbeitete sie weiter.
»Da fällt mir ein, dass es auf dem Weg mal einen ausgezeichneten Dim-Sum-Imbiss gab. Die Teigtaschen mit Hackfleisch waren zum Umfallen gut. Saftig und lecker.« Er schnipste mit dem Finger, allein bei dem Gedanken daran lief ihm das Wasser im Mund zusammen.
Gequält massierte Cinder sich den Nacken.
»Vielleicht könnten wir kurz da vorbeischauen und uns was mitnehmen. Ich brauche mal wieder was Richtiges nach dem faden Mist, den sie hier als Essen bezeichnen.« Er leckte sich die Lippen, aber als er wieder zu dem Mädchen sah, war ihr Gesicht schmerzverzerrt und Schweißtropfen standen ihr auf der Stirn.
»Was hast du?«, fragte er und streckte die Hand nach ihr aus. »Soll ich dir den Nacken massieren?«
Sie schlug seine Hand weg. »Bitte«, sagte sie flehend, die Hände abwehrend erhoben, und rang nach Luft.
Als Thorne sie anstarrte, verschwamm sie vor seinen Augen wie eine Fata Morgana über den erhitzten Gleisen der Magnetschwebebahn. Er taumelte rückwärts. Sein Herzschlag beschleunigte sich und in seinem Gehirn setzte ein eigenartiges Prickeln ein, das durch seine Nervenbahnen raste.
Sie war … schön.
Nein, göttlich.
Nein, vollkommen.
Sein Puls hämmerte. Er dachte nur noch an Anbetung und Verehrung. An völlige Selbstaufgabe. An absoluten Gehorsam.
»Bitte«, sagte sie noch einmal und hob abwehrend die Metallhand. Sie hörte sich verzweifelt an, als sie sich an der Wand herabgleiten ließ. »Hör einfach auf zu reden. Lass mich einfach in Ruhe.«
»In Ordnung«, sagte er vollkommen verwirrt – Cyborg, Mithäftling, Göttin. »Selbstverständlich. Ich tue alles, was du willst.« Er stolperte durch die Zelle und sank hilflos auf sein Feldbett.
5
Scarlets Gedanken überschlugen sich, als sie die Kisten aus dem Heck des Luftschiffs hievte und in den Hangar schleppte. Sie hatte den Portscreen vom Boden des Beifahrersitzes genommen und in die Hosentasche gesteckt. Die Nachricht der Polizeistelle brannte sich in ihren Oberschenkel, als sie routiniert die letzten Arbeiten des Tages erledigte.
Wahrscheinlich war sie vor allem auf sich selbst wütend, weil sie sich – und wenn es auch nur für eine Minute gewesen sein mochte – von einem gut aussehenden Gesicht und der Aura von Gefahr hatte ablenken lassen. So kurz nachdem sie erfahren hatte, dass die Ermittlungen im Fall ihrer Großmutter eingestellt worden waren. Es kam ihr vor, als würde sie durch ihr Interesse an dem Kämpfer alles, was ihr wichtig war, verraten.
Und dann waren da noch Roland und Gilles und all die anderen hinterhältigen Typen aus Rieux. Sie glaubten, dass Michelle verrückt war, und das hatten sie auch der Polizei gesagt. Und nicht, dass sie die fleißigste Bäuerin der ganzen Provinz war. Oder die besten Eclairs diesseits der Garonne herstellte. Oder ihrem Land achtundzwanzig Jahre als Armeepilotin gedient hatte und dafür immer noch die Ehrenmedaille an ihrer karierten Lieblingsschürze trug.
Nein, sie hatten der Polizei erzählt, dass sie verrückt war.
Und jetzt hatte die Polizei die Suche nach ihr aufgegeben.
Aber das würde sich ändern. Irgendwo musste sie ja sein und Scarlet würde sie finden, und wenn sie dafür alle Ermittler Europas erpressen musste.
Die Sonne sank schnell und Scarlets lang gezogener Schatten fiel auf den Weg. Neben dem Kiesweg erstreckten sich flüsternde Maisfelder und Reihen großblätteriger Zuckerrüben bis zu den ersten leuchtenden Abendsternen am Horizont. Ein einziges Natursteinhaus mit zwei warm leuchtenden Fenstern stand ein ganzes Stück westlich – ihr einziger Nachbar weit und breit.
Dieser Hof war Scarlets Paradies. Mehr als ihr halbes Leben hatte sie hier verbracht und über die Jahre waren ihr Himmel und Erde mehr ans Herz gewachsen, als sie jemals für möglich gehalten hatte – und ihrer Großmutter ging es genauso. Sie dachte zwar nicht gerne daran, aber eines Tages würde sie den Hof erben, und manchmal träumte sie davon, hier alt zu werden. Glücklich und zufrieden, mit Erde unter den Fingernägeln und in einem Haus, an dem dauernd Reparaturen anfielen.
Glücklich und zufrieden – wie ihre Großmutter.
Niemals wäre sie aus freien Stücken fortgegangen.
Scarlet schleppte die Kisten in die Scheune, stapelte sie in einer Ecke aufeinander, damit die Androiden sie am nächsten Morgen wieder füllen konnten, und trug den Kübel mit den Küchenabfällen hinaus. Beim Füttern scharten sich die Hühner ganz eng um sie.
Als sie um die Ecke beim Hangar bog, blieb sie wie angewurzelt stehen.
Im zweiten Stock des Hauses brannte Licht.
In Michelles Schlafzimmer.
Der Eimer fiel ihr aus der Hand. Die Hühner gackerten wild durcheinander und stoben in alle Richtungen davon, bevor sie sich erneut über die Gemüsereste hermachten.
Scarlet sprang über die Hühner hinweg und rannte so schnell los, dass die Kieselsteine in alle Richtungen flogen. Ihr Herz hämmerte und vom Sprint brannten ihre Lungen. Sie riss die Hintertür auf und schoss die Treppe hoch, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Die alten Bretter ächzten vernehmlich.
Die Tür zum Schlafzimmer ihrer Großmutter stand weit offen. Sie blieb wie angewurzelt auf der Schwelle stehen und hielt sich am Türrahmen fest.
Das Zimmer war verwüstet wie nach einem Hurrikan. Die Kommodenschubladen lagen zwischen Anziehsachen, Bürsten und Cremetuben auf dem Boden, die Bettdecken türmten sich in der Ecke, die Matratzen standen hochkant an der Wand, alle digitalen Fotorahmen waren von der Wand gerissen worden. Zurück blieben nur die dunklen Stellen, an denen der Putz nicht von der Sonne ausgebleicht war.
Neben dem Bett kniete ein Mann und wühlte in der Truhe mit Michelles alten Armeeuniformen. Als er Scarlet sah, sprang er auf und stieß sich um Haaresbreite den Kopf an dem niedrigen Eichenbalken unter der Decke.
Scarlet drehte sich alles vor Augen. Es war Jahre her, seit sie ihn zuletzt gesehen hatte, aber er war um Jahrzehnte gealtert. Auf seinem ehemals so sorgfältig rasierten Kinn spross ein Bart. Auf der einen Seite waren seine Haare verfilzt, auf der anderen standen sie ihm vom Kopf ab. Sein Gesicht war blass und eingefallen, als hätte er schon wochenlang nichts Richtiges mehr gegessen.
»Papa?«
Krampfhaft hielt er sich eine blaue Fliegerjacke vor die Brust.
»Was tust du hier?« Sie sah sich mit klopfendem Herzen in dem chaotischen Schlafzimmer um. »Um Himmels willen, was ist hier los?«
»Irgendwo hier«, sagte er. Seine Stimme klang rau, wie eingerostet. »Sie hat hier irgendwas versteckt.« Er sah auf die Uniformjacke hinab, dann schmiss er sie aufs Bett, kniete sich wieder vor die Truhe und kramte weiter darin herum. »Und das muss ich finden. Unbedingt.«
»Was musst du finden? Wovon redest du überhaupt?«
»Jetzt, wo sie weg ist«, flüsterte er, »und auch nicht mehr zurückkommt … Sie wird es ja nie erfahren und ich … ich muss es finden. Ich muss rauskriegen, warum …«
Der abgestandene Geruch nach Cognac verbitterte Scarlet. Wie er herausgefunden hatte, dass seine Mutter verschwunden war, war ihr schleierhaft, aber dass er so schnell die Hoffnung aufgab und dann auch noch zu glauben schien, ein Anrecht auf ihre Sachen zu haben, nachdem er sie beide im Stich gelassen hatte, das war ein starkes Stück. Jahrelang hatte er sich nicht blickenlassen, hatte in all der Zeit keine einzige Tele geschrieben, nur um jetzt hier betrunken aufzutauchen und Michelles Sachen zu durchwühlen.
Am liebsten hätte Scarlet die Polizei gerufen. Aber leider war sie auf die auch wütend.
»Raus aus unserem Haus! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Aber dalli!«
Vollkommen unbeeindruckt warf er die durchwühlten Uniformen in die Truhe.
Wutentbrannt stürzte sich Scarlet auf ihren Vater und zerrte ihn am Arm. »Hör auf damit!«
Er stöhnte laut auf, ließ sich wieder auf die alten Dielen fallen und kroch geduckt von ihr weg, als wäre sie ein tollwütiger Hund. Dabei hielt er sich den Arm. In seinem Blick stand der schiere Wahnsinn.
Überrascht stemmte Scarlet die Hände in die Hüften. »Was ist mit deinem Arm?«
Er antwortete nicht, aber er hielt den Arm umklammert.
Scarlet ging entschlossen auf ihn zu und packte ihn am Handgelenk. Er keuchte und versuchte verzweifelt, sich loszureißen, aber sie war stärker und schob seinen Ärmel hoch. Entsetzt ließ sie ihren Vater los, doch der Arm hing schlaff herab, als hätte er ihn vergessen.
Er war mit kreisförmigen Brandwunden übersät. Sie reihten sich wie Armbänder in regelmäßigen Abständen vom Handgelenk bis zum Ellenbogen aneinander. Auf einigen hatte sich matt glänzendes Narbengewebe gebildet, andere waren schwarz oder eiterten. Am Handgelenk, wo einst sein ID-Chip gewesen war, befand sich eine glatte dünne Narbe.
Scarlet drehte sich der Magen um.
Ihr Vater drückte das Gesicht in die an der Wand stehende Matratze. Verbarg sich vor den Brandwunden und vor Scarlet.
»Wer hat dir das angetan?«
Er presste den Arm gegen seinen Bauch und antwortete nicht.
Scarlet schoss ins Badezimmer und kam kurz darauf mit einer Tube Wundsalbe und Verbandsmull zurück. Ihr Vater hatte sich nicht von der Stelle gerührt.
»Die haben mich dazu gezwungen«, flüsterte er. Sein hysterischer Anfall war verflogen.
Vorsichtig sah sich Scarlet den Arm an und begann, die Wunden zu versorgen. Sie tat es, so sanft sie konnte, wenn auch mit zitternden Händen. »Wer hat dich wozu gezwungen?«
»Ich konnte nicht fliehen«, fuhr er fort, als hätte er ihre Frage gar nicht gehört. »Die haben mir Löcher in den Bauch gefragt, aber ich konnte ihnen keine Antworten geben. Ich hab’s ja versucht, aber ich wusste doch auch nicht …«
Scarlet warf ihrem Vater einen Blick zu. Er ließ den Kopf hängen und starrte auf den Deckenhaufen am Boden. Tränen standen ihm in den Augen. Ihr Vater … weinte. Das war fast noch schrecklicher als die Brandwunden. Ihr zog sich das Herz zusammen und sie erstarrte, obwohl sie seinen Arm erst zur Hälfte verbunden hatte. Ihr wurde plötzlich klar, dass sie diesen traurigen, gebrochenen Mann überhaupt nicht kannte. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, ein Schatten des charismatischen, egoistischen und nichtsnutzigen Vaters, den sie gekannt hatte.
Eben erst war sie wutentbrannt und hasserfüllt gewesen, jetzt tat er ihr unendlich leid.
Was war nur geschehen?
»Die haben mir den Schürhaken gegeben«, fuhr er mit schreckgeweiteten Augen fort, wie um ihre stumme Frage zu beantworten.
»Sie haben dir den …? Warum?«