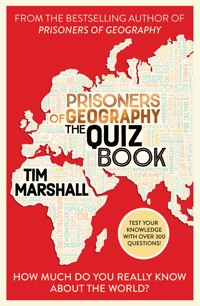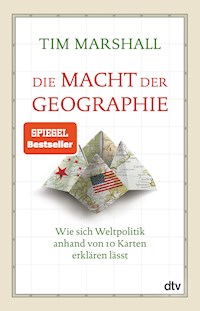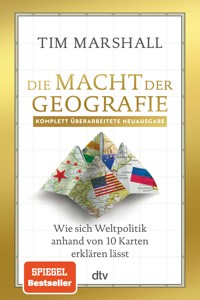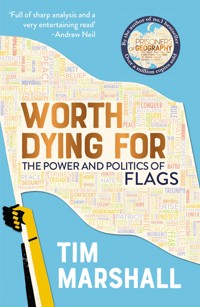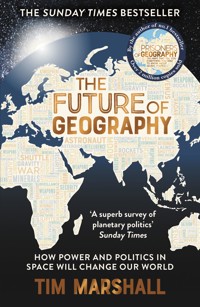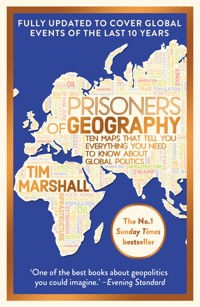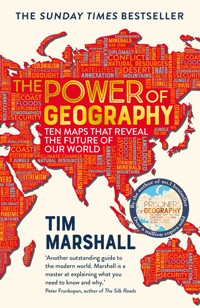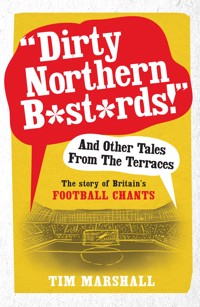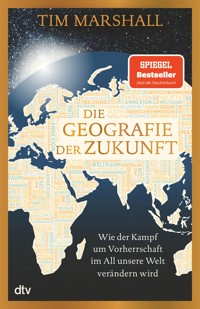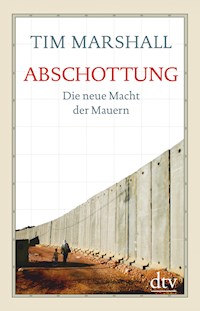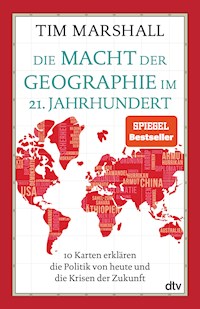
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer die Nachrichten von morgen heute schon verstehen möchte Die großen internationalen Konflikte des 21. Jahrhunderts sind heute bereits angelegt. Mit bestechender Klarsicht identifiziert der Politikexperte Tim Marshall, welche zehn Regionen die größten Krisenherde der nächsten Zukunft darstellen. Er erklärt, welche Rolle geographische Faktoren spielen, wer in die Konflikte verwickelt ist und welche Lösungen es geben könnte. So wird Australien im Pazifik mit der Supermacht China konfrontiert sein, Griechenland mit der Türkei um Gebiete im Mittelmeer kämpfen, die Sahelzone eine neue Flüchtlingskrise in Europa hervorrufen und der Weltraum unterschiedlichste Besitzansprüche wecken – ein äußerst spannendes Buch, das uns die Augen für die großen Herausforderungen der kommenden Jahre öffnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Die großen internationalen Konflikte des 21. Jahrhunderts sind heute bereits angelegt. Mit bestechender Klarsicht identifiziert Tim Marshall, welche zehn Regionen die größten Krisenherde der nächsten Zukunft darstellen. Er erklärt, welche geographische Faktoren diese Krisen bedingen, wer die Konflikte anheizt und welche Lösungsszenarien denkbar sind. So ist Australien im Pazifik zunehmend mit der aggressiv-expansiven Supermacht China konfrontiert und Griechenland wird sich mit der Türkei um rohstoffreiche Gebiete im Mittelmeer streiten. Aus der krisengeplagten Sahelzone wird ein neuer Flüchtlingsstrom nach Europa drängen und der Wettlauf um die besten Positionen im All die Großmächte in Atem halten.
Tim Marshall
Die Macht der Geographie im 21. Jahrhundert
10 Karten erklären die Politik von heute und die Krisen der Zukunft
Aus dem Englischenvon Lutz-W. Wolff
Für die Jugend der Generation Covid,
die ihren Beitrag geleistet hat.
Jetzt kommt eure Zeit!
VORWORT
Der Falke hört den Falkner nicht;
Die Dinge zerfallen; die Mitte hält nicht mehr stand.
The Second Coming, W.B. Yeats
Im Nahen Osten stehen sich die gewaltige Festung des Iran und seine Nemesis Saudi-Arabien am Persischen Golf gegenüber. Im Indo-Pazifik sieht sich Australien gefangen zwischen den beiden stärksten Nationen unserer Zeit: den Vereinigten Staaten und China. Im Mittelmeer befinden Griechenland und die Türkei sich in einem Konflikt, der bis in die Antike zurückreicht und jederzeit gewaltsam ausbrechen kann.
Willkommen in den Zwanzigerjahren des 21. Jahrhunderts! Die Ära des Kalten Kriegs, in der die USA und die Sowjetunion die Welt beherrschten, gerät zunehmend zu einer entfernten Erinnerung. Wir betreten ein neues Zeitalter der Rivalität zwischen diversen Großmächten, in dem verschiedene Akteure, darunter auch kleinere Mitspieler, heftig ins Rampenlicht drängen. Und das geopolitische Drama wächst bereits über die Erde hinaus, weil die unterschiedlichsten Länder Ansprüche jenseits unserer Atmosphäre anmelden, bis hin zum Mond und darüber hinaus.
Wenn eine Ordnung ins Wanken gerät, die für mehrere Generationen fest etabliert schien, wird man leicht nervös. Aber so etwas hat es schon früher gegeben, so wie es jetzt geschieht und auch in Zukunft geschehen wird. Seit einiger Zeit bewegen wir uns wieder in Richtung einer »multipolaren« Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war eine bipolare Ära entstanden, mit einem von Amerika geführten kapitalistischen System auf der einen und dem kommunistischen System auf der anderen Seite, das vom alten russischen Reich und China geführt wurde. Diese Ära dauerte je nachdem, wo man die zeitlichen Einschnitte setzt, etwa fünfzig bis achtzig Jahre. In den Neunzigerjahren gab es nach Ansicht einiger Beobachter eine kurze »unipolare« Dekade, in der die Macht der USA praktisch unangefochten war. Aber jetzt ist es offensichtlich, dass wir uns wieder auf eine Situation zubewegen, die für den größten Teil der Menschheitsgeschichte die Norm war: den Wettstreit verschiedener Machtansprüche.
Wann genau der erneute Wandel begonnen hat, ist schwer zu bestimmen; es kann kein einzelnes Ereignis ausgemacht werden, das die Veränderung ausgelöst hat. Aber manchmal gibt es Augenblicke, in denen man spürt, dass da etwas passiert, und die Nebelschleier der Machtpolitik plötzlich aufreißen. Ein solches Erlebnis hatte ich an einem nassen Sommerabend des Jahres 1999 in Pristina, der maroden Hauptstadt des Kosovo. Das Auseinanderbrechen der Bundesrepublik Jugoslawien im Jahre 1991 hatte zu jahrelangen kriegerischen Handlungen und Blutvergießen geführt. Jetzt hatten die Bombenangriffe der NATO die Serben gezwungen, das Kosovo aufzugeben, und die KFOR-Truppen standen bereit, die Region von Albanien aus zu besetzen. Aber schon während des ganzen Tages hatte es Gerüchte gegeben, dass eine russische Militärkolonne der in Bosnien stationierten SFOR im Anmarsch sei, um die serbischen Interessen zu wahren.
Zu diesem Zeitpunkt war Russland verarmt, verunsichert und nur noch ein Schatten seiner selbst. Es hatte ein Jahrzehnt lang zusehen müssen, wie die NATO auf seine Westgrenze vorrückte, weil eine osteuropäische Nation nach der anderen Regierungen wählte, die der Europäischen Union und/oder der NATO beitreten wollten. Auch in Lateinamerika und im Nahen Osten war der russische Einfluss geschwunden. Aber nun, im Jahr 1999, hatte Moskau wohl eine Entscheidung gegenüber den westlichen Mächten getroffen – bis hierhin und nicht weiter. Und das – Kosovo war die rote Linie. Präsident Jelzin befahl der russischen Armee einzugreifen, und manche Leute glauben, dass der aufstrebende nationalistische Politiker Wladimir Putin dabei eine Hand im Spiel hatte.
Ich war in Pristina, als die gepanzerte russische Kolonne in den frühen Morgenstunden über die Hauptstraße zum Flugplatz hinausrumpelte, wo sie drei Stunden vor den KFOR-Truppen der NATO eintraf. Ich habe später gehört, dass US-Präsident Clinton erst durch meinen Bericht »The Russians rolled into town, and back onto the world stage« von dem Ereignis erfahren hat. Es war nicht gerade Pulitzer-Preis-Material, aber als erste Skizze von Zeitgeschichte erfüllte es seinen Zweck. Die Russen hatten klargemacht, dass sie beim großen geopolitischen Ereignis des Jahres mitspielen und einen Gezeitenwechsel in der historischen Entwicklung herbeiführen wollten, die sich so lange gegen sie gerichtet hatte. Ende der Neunzigerjahre schienen die Amerikaner keine Gegenspieler mehr in der Welt zu haben, der Westen triumphierte auf ganzer Linie. Aber nun hatte der Gegenstoß begonnen. Russland war nicht mehr die ängstliche Macht, die es gewesen war, eine von vielen, sondern es würde kämpfen, um sich zu behaupten. In Georgien, in der Ukraine, in Syrien und anderswo sollte sich das bestätigen.
Vier Jahre später war ich in der irakischen Stadt Kerbela, dem heiligsten Ort der Schiiten. Saddam Hussein war von der amerikanisch-britisch geführten Koalition gestürzt worden, aber der eigentliche Machtwechsel stand noch bevor. Unter dem Sunniten Saddam waren viele religiöse Rituale der Schiiten verboten worden, dazu gehörte auch die öffentliche Selbstgeißelung. Jetzt sah ich zu, wie mehr als eine Million Schiiten aus dem ganzen Land an einem glühend heißen Tag in Kerbela zusammenströmten. Viele von ihnen peitschten sich den Rücken oder zerschnitten sich mit Messern die Stirn, bis der Staub auf den Straßen blutrot war. Für mich war klar, dass der Iran, der schiitische Gottesstaat jenseits der östlichen Grenze, jetzt alles tun würde, um eine von Schiiten beherrschte Regierung im Irak zu errichten, damit eine Brücke zu den schiitischen Kräften in Syrien und im Libanon zu schlagen und seine Macht bis zum Mittelmeer auszudehnen. Das war geopolitisch fast unvermeidlich. Ich dachte: »Das sieht religiös aus, aber es ist auch politisch, dieser Fanatismus wird Wellen bis an die Küste des Mittelmeers schlagen.« Das politische Gleichgewicht hatte sich verändert, und Teherans zunehmende Macht in der Region stellte die Vorherrschaft der Amerikaner im Nahen Osten infrage. Kerbela war nur die Kulisse für diese Entwicklung – und leider war sie blutrot gefärbt.
Das waren nur zwei der Schlüsselmomente, die dazu beitrugen, die komplizierte Welt entstehen zu lassen, in der wir uns heute bewegen und in der unzählige Kräfte in einem großen Spiel zusammenstoßen, sich schieben und ziehen. Aber sie gaben mir einen kurzen Einblick in die Richtung, in die wir uns bewegen. Das Bild wurde nach 2010 noch klarer, als die Ereignisse in Ägypten, Libyen und Syrien ins Rollen kamen. Der ägyptische Präsident Mubarak wurde durch einen Putsch der Militärs gestürzt, die ein gewalttätiges Straßentheater benutzten, um ihre Pläne verborgen zu halten. In Libyen wurde Oberst Gaddafi gestürzt und ermordet, und in Syrien konnte sich Präsident Assad nur noch mit letzter Kraft an der Macht halten, ehe die Russen und die Iraner ihn retteten. In allen drei Fällen ließen die Amerikaner durchblicken, dass sie keinen Finger krumm machen würden, um die jeweiligen Herrscher zu schützen, mit denen sie jahrzehntelang gute Geschäfte gemacht hatten. In den acht Jahren der Präsidentschaft von Barack Obama zogen sich die Vereinigten Staaten langsam von der internationalen Bühne zurück, und in den vier Jahren unter Präsident Trump beschleunigte sich diese Entwicklung noch. Unterdessen sind andere Länder mit raschem Wirtschaftswachstum wie Indien, China oder Brasilien zu neuen Weltmächten aufgestiegen und haben ihren Einfluss auf die Weltpolitik zu vergrößern versucht.
Auch wenn es vielen Leuten nicht gefiel, dass die USA in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Rolle eines »Weltpolizisten« übernommen hatten, kann man darin ebenso viel Positives sehen wie Negatives. Man kommt letztlich nicht umhin, festzustellen, dass in Abwesenheit eines solchen Weltpolizisten viele verschiedene Länder und Interessengruppen versuchen, ihre jeweilige Nachbarschaft unter Kontrolle zu bringen. Und je mehr verschiedene Parteien dabei am Werk sind, desto größer wird die Gefahr, dass die Stabilität darunter leidet.
Weltreiche wachsen und brechen zusammen. Bündnisse werden geschmiedet und lösen sich auf. Die europäische Ordnung nach den napoleonischen Kriegen hielt ungefähr sechzig Jahre; das »Tausendjährige Reich« nur etwas länger als ein Jahrzehnt. Niemand weiß, wie schnell sich das Gleichgewicht der Kräfte in den nächsten Jahren verändert. Ohne Zweifel wird es weiter ökonomische und geopolitische Riesen geben, die großen Einfluss auf die Weltpolitik haben: die USA und China, Russland, die Europäische Union mit ihren vielen Nationen, das wirtschaftlich aufsteigende Indien. Aber auch die kleineren Nationen zählen. Zur Geopolitik gehören auch Bündnisse, und gerade weil die Weltordnung gegenwärtig im Fluss ist, brauchen die Großmächte ebenso kleinere Staaten an ihrer Seite wie umgekehrt. Länder wie die Türkei, Saudi-Arabien oder das Vereinigte Königreich können sich durch solche Bündnisse für künftige Machtpositionen in Stellung bringen. Gegenwärtig wird das Kaleidoskop noch geschüttelt, und die vielen bunten Glassteinchen sind noch nicht zur Ruhe gekommen.
Es ist aber durchaus möglich, dass wir uns am Ende des Jahrhunderts erneut in einer bipolaren Welt wiederfinden, diesmal zwischen China und den USA. Diese Welt wird nicht dieselbe wie die frühere sein und auch nicht zu demselben »Kalten Krieg« führen, aber als stark verkürzte Beschreibung dessen, worauf wir zusteuern, sind die Begriffe »bipolar« und »Kalter Krieg« nützlich.
In dieser Neuauflage ist der Begriff »westlich« allerdings überholt. Diesmal wird der Wettbewerb zwischen einer amerikanisch geführten, informellen Koalition industrialisierter Demokratien und einer lockeren Allianz autoritärer Staaten stattfinden, die von China beherrscht wird. Es war kein Zufall, dass die britische Regierung im Sommer 2021, als das Vereinigte Königreich Gastgeber des G7-Gipfels war, auch Südkorea, Indien und Australien zur Teilnahme einlud. Diese »Demokratischen 10« umfassen 85% der Bewohner von fortgeschrittenen Demokratien. Die Einladungen fügten sich nahtlos in die allmählich erkennbar werdende Biden-Doktrin, die darauf abzielt, der Demokratie neue Kraft zu geben und eine globale Alternative zur chinesischen »Belt and Road«-Initiative, der »Neuen Seidenstraße«, zu schaffen.
2015 habe ich ein Buch mit dem Titel Die Macht der Geographie geschrieben, mit dem ich zeigen wollte, wie die Weltpolitik und die Handlungsoptionen der Nationen und ihrer Führer von geographischen Gegebenheiten bestimmt werden. Dabei habe ich untersucht, worin die geopolitischen Besonderheiten Russlands, Chinas, Europas, der USA, des Nahen Ostens, Afrikas, Indiens, Pakistans, Japans, Koreas, Lateinamerikas und der Arktis bestehen. Ich wollte mich auf die größten Spieler, die großen geopolitischen Blöcke und Regionen beschränken, um einen globalen Überblick geben zu können. Aber die Geschichte geht weiter. Die USA sind zwar nach wie vor das einzige Land, das sowohl im Atlantik als auch im Pazifik militärische Stärke entfalten kann, der Himalaja trennt nach wie vor Indien von China, und Russlands Schwachpunkt bleibt auch weiterhin die nordeuropäische Tiefebene. Und dennoch werden täglich neue geopolitische Risiken sichtbar. Neue Akteure verdienen unsere Aufmerksamkeit, weil es gut möglich ist, dass sie unsere Zukunft bestimmen könnten.
Ebenso wie das erste Buch fasst auch das vorliegende Gebirge und Flüsse, Meere, Straßen, Brücken, Flugplätze, Pipelines und Eisenbahnen ins Auge, um die politische Realität zu beschreiben. Die Geographie ist ein entscheidender Faktor, weil sie bestimmt, was der Mensch erreichen kann und was nicht. Ja, Politiker sind wichtig, aber die Geographie ist noch wichtiger. Die Entscheidungen, die Menschen treffen, lassen sich weder jetzt noch in der Zukunft völlig vom geophysikalischen Umfeld abtrennen. Der Ausgangspunkt eines Landes ist stets seine Lage im Verhältnis zu seinen Nachbarn, zu den Seewegen, Bodenschätzen und anderen Ressourcen. Sie leben auf einer windgepeitschten Insel am Rand des Atlantiks? Dann werden Sie lernen müssen, mit Wellen und Wind umzugehen. Sie leben in einem Land, wo das ganze Jahr die Sonne scheint? Dann sind Fotovoltaik und Sonnenkraftwerke der Weg in die Zukunft. Sie leben in einer Gegend, wo man Kobalt im Boden findet? Das kann ein Segen sein – oder ein Fluch.
Nach wie vor betrachten manche Leute das geopolitische Denken mit Misstrauen, weil es ihnen zu deterministisch erscheint. Andere behaupten, unser Planet sei wieder zur Scheibe geworden, zu einer flat world, weil die Kommunikation und die finanziellen Transaktionen im virtuellen Raum die Entfernungen aufheben und Berge und Meere bedeutungslos werden. Diese »flache« Welt existiert aber nur für jenen Bruchteil der Weltbevölkerung, der sich zu Videokonferenzen zusammenfindet oder in den Flieger steigt, um auf einem anderen Kontinent einen Vortrag zu halten. Die große Masse der acht Milliarden Menschen auf dem Planeten macht völlig andere Erfahrungen. Die ägyptischen Bauern brauchen immer noch das Wasser aus den äthiopischen Bergen, und die Berge und Schluchten im Norden Athens behindern immer noch dessen Handel mit dem Rest der EU. Die Geographie muss kein Schicksal sein – die Menschen haben da durchaus Spielraum –, aber sie spielt eine wichtige Rolle.
Es gibt viele Faktoren, die unseren Übergang in eine ungesicherte und tief gespaltene Dekade bestimmen und mitbestimmen: Globalisierung und Antiglobalisierung, Covid-19, neue Technologien, Klimawandel und anderes zeigen Wirkung, sie alle kommen in diesem Buch vor. Es untersucht einige der Ereignisse und Konflikte des 21. Jahrhunderts, die weitreichende Folgen in einer multipolaren Welt haben können.
Der Iran zum Beispiel gestaltet die Zukunft des Nahen Ostens. Ein Schurkenstaat mit einer nuklearen Agenda, der seinen Einfluss darauf gründet, dass er einen »schiitischen Korridor« zum Mittelmeer über Bagdad, Damaskus und Beirut offenhält. Sein regionaler Rivale Saudi-Arabien ist auf Öl und Sand gebaut und hat sich immer auf die Vereinigten Staaten, gestützt. Aber die Ölnachfrage lässt nach, weil die USA ihre Energie wieder selbst erzeugen, und ihr Interesse am Nahen Osten wird langsam nachlassen.
An anderer Stelle löst das Wasser Konflikte aus. Als »Wasserturm Afrikas« hat Äthiopien einen entscheidenden Vorteil gegenüber den Nachbarn, besonders Ägypten. Das ist einer der wichtigsten Schauplätze der möglichen Wasserkriege in diesem Jahrhundert. Gleichzeitig kann man hier die Wirkmacht der Technik beobachten, denn Äthiopien benutzt das Wasser zur Stromerzeugung, die sein Schicksal verbessern soll.
In großen Teilen von Afrika wie der Sahelzone, dem Buschland am südlichen Rand der Sahara, gibt es diese Möglichkeit nicht. Dieser Landstrich ist von Krieg und Gewalt zerrissen. Er umfasst alte geographische und kulturelle Gegensätze, und deshalb konnten sich al-Qaida und der Islamische Staat hier ungehemmt ausbreiten. Ein Teil der Flüchtlinge strebt immer auch nach Europa, und was heute schon eine große humanitäre Krise ist, könnte noch schlimmer werden.
Als Einfallstor nach Europa gehört Griechenland zu den Ländern, die jede neue Welle von Migration als erste zu spüren bekommen. Ohnehin liegt es an einem der geopolitischen Brennpunkte der kommenden Jahre: dem östlichen Mittelmeer. Zusätzlich haben die neu entdeckten Gasfelder in der Ägäis den EU-Mitgliedsstaat Griechenland auch noch mit der immer aggressiver auftretenden Türkei in Konflikt gebracht. Die Muskelspiele Ankaras beschränken sich aber nicht allein auf das östliche Mittelmeer. Die türkischen Ambitionen sind weitaus umfassender. Nicht nur die neoottomanische Agenda, die sich aus der imperialen Vergangenheit herleitet, sondern auch die Lage am Kreuzweg von Ost und West hat in Ankara das Bedürfnis geweckt, die Türkei zu einer globalen Großmacht werden zu lassen.
Eine andere Nation, deren Empire weitgehend verloren gegangen ist, wohnt auf einer Gruppe frostiger Inseln am westlichen Ende der europäischen Tiefebene. Das Vereinigte Königreich befindet sich gerade auf der Suche nach einer neuen Rolle. Seit dem Brexit ist es eine europäische Mittelmacht, die auf der ganzen Welt politische und ökonomische Bündnisse sucht. Die Herausforderungen, denen sie gegenübersteht, kommen aber nicht nur von außen, sondern auch aus dem Inneren. So muss man sich im Vereinigten Königreich unter anderem mit der Frage eines unabhängigen Schottland befassen.
Auch Spanien, einer der ältesten europäischen Staaten, droht auseinanderzubrechen. Die EU kann den katalanischen Unabhängigkeitsdrang nicht unterstützen; aber die Zurückweisung eines womöglich entstehenden neuen Staates könnte dem Einfluss der Russen oder Chinesen die Tür öffnen. Die Auseinandersetzungen in Spanien zeigen recht deutlich, wie verletzlich manche Nationalstaaten und supranationalen Bündnisse im 21. Jahrhundert geworden sind.
Die vielleicht faszinierendste Entwicklung der Gegenwart ist allerdings, dass sich die geopolitischen Machtkämpfe derzeit ihrer irdischen Fesseln entledigen und in den Weltraum ausdehnen. Wem gehört der Raum um uns herum? Wie soll man in diesen Konflikten entscheiden? Eine letzte Grenze wird es womöglich nie geben, aber der Weltraum kommt dem schon ziemlich nahe, und Grenzen haben eine Neigung zur Gesetzlosigkeit und Verwilderung. Jenseits von einer gewissen Höhe gibt es keine territoriale Souveränität mehr. Wenn es mir in den Sinn kommt, direkt über Ihrem Land einen Satelliten mit Laserwaffen zu stationieren, haben Sie keine gesetzliche Handhabe, um sich dagegen zu wehren. Gegenwärtig findet ein Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum statt, an dem sich sogar private Firmen beteiligen. Ein gefährlicher Rüstungswettlauf bereitet sich vor, den wir nur aufhalten können, wenn wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und die vielen Vorteile der internationalen Zusammenarbeit zu nutzen verstehen.
Aber beginnen wir unsere Geschichte auf einem Kontinent hier auf der Erde, der jahrhundertelang abgeschieden und unbekannt blieb und sich jetzt plötzlich zwischen China und den USA in der Lage befindet, die Zukunft im indo-pazifischen Raum als entscheidender Spieler mitzubestimmen: Australien.
ERSTES KAPITEL
AUSTRALIEN
Ihr müsst knallhart sein. Spielt sie in Grund und Boden!
Don Bradman, australischer Kricketspieler
Australien war früher am Ende der Welt, wurde dann ein großes Ding, und heute steht es im Rampenlicht. Wie ist es dazu gekommen? Das Land down under ist eine Insel, aber eine Insel wie keine andere. Sie ist gewaltig, so riesig, dass sie als eigener Kontinent mit üppigen tropischen Regenwäldern, brennend heißen Wüsten, ausgedehnten Savannen und schneebedeckten Bergen gilt. Auf der Fahrt von Brisbane im Osten nach Perth im Westen durchquert man nur ein einziges Land, aber die Entfernung entspricht der von London nach Beirut (eine Reise, auf der man durch Frankreich, Belgien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien, Bulgarien, die Türkei und Syrien käme).
Dass Australien mal am Ende der Welt lag, merkt man daran, dass zwischen Brisbane und den USA11500 Kilometer Pazifischer Ozean liegen, bis nach Chile sind es 13000 Kilometer. Von Perth am Indischen Ozean nach Afrika sind 8000 Kilometer zurückzulegen. Australiens »Nachbar« Neuseeland ist 2000 Kilometer entfernt, und bis zur Antarktis sind 5000 Kilometer Wasser und Eis zu durchqueren. Erst wenn man nach Norden blickt, erkennt man Australiens Lage im geopolitischen Sinn; und man sieht: Da befindet sich eine westlich orientierte, fortgeschrittene Demokratie mit einem riesigen Territorium unmittelbar südlich von der wirtschaftlich und militärisch mächtigsten Diktatur der Welt: China. Wenn man das alles zusammenführt, ergibt sich ein Bild von Australien als einem riesigen Nationalstaat/Kontinent mitten im Indischem und Pazifischem Ozean – dem wirtschaftlichen Kraftzentrum des 21. Jahrhunderts.
Die Geschichte fängt damit an, dass die Briten im 18. Jahrhundert ihre Strafgefangenen deportierten. Sie wollten sie außer Landes schaffen und nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Gab es da einen besseren Platz als jenen am anderen Ende der Welt, von dem aus sie nicht mehr zurückkommen konnten? Sie wurden weggesperrt und der Schlüssel im Meer versenkt. Dann aber begann diese weit entfernte Welt sich zu verändern, die geographischen Gefängnisgitter wurden allmählich durchlässig, und Australien spielte auf der globalen Bühne mit. Allerdings war es eine lange und höllische Reise dahin.
Das Zitat am Anfang dieses Kapitels bezieht sich auf den Nationalsport Kricket, aber die Worte Don Bradmans sind tief in der australischen Seele verwurzelt, die von der Geographie des Landes geprägt wurde. Die volkstümliche Vorstellung vom unverwüstlichen, egalitären, geradlinigen, nüchternen Geist der Aussies ist vielleicht ein Klischee, entspricht aber durchaus der Wirklichkeit. Dieser Geist entspringt einem riesigen, glutheißen Land, unbewohnbar in großen Teilen, aus dem eine blühende moderne Gesellschaft erwachsen ist, die anfangs nahezu monokulturell war und jetzt zu den multikulturellsten der Welt zählt.
Heute schaut sich Australien in seiner Nachbarschaft um und fragt sich, welche Rolle es spielen soll, und vor allem mit wem.
Wenn es um Außenpolitik und Verteidigung geht, darf man nicht fragen, was ein Land tun will, sondern wozu es fähig ist; und das wird häufig von der Geographie bestimmt. Australiens Lage und Größe sind seine Stärke und Schwäche zugleich. Sie schützen es vor einer Invasion, behindern aber gleichzeitig seine Entwicklung. Sie machen einen extremen Fernhandel notwendig, was wiederum eine starke Marine erfordert, um die Seewege offen zu halten. Und sie isolieren Australien auch von seinen wichtigsten Verbündeten in der Welt.
Eine Insel wurde Australien vor ungefähr 35 Millionen Jahren, als es sich von der Antarktis löste und sachte nach Norden trieb. Es liegt gegenwärtig auf Kollisionskurs mit Indonesien, aber die Bewohner beider Staaten brauchen sich deswegen nicht zu sehr zu beunruhigen, denn die Geschwindigkeit, mit der sie sich aufeinander zubewegen, beträgt nur sieben Zentimeter im Jahr, und so können sie sich noch einige Hundert Millionen Jahre auf den Zusammenprall vorbereiten.
Australien umfasst 7,7 Millionen Quadratkilometer und ist damit das sechstgrößte Land der Erde. Die Fläche verteilt sich im Wesentlichen auf sechs Bundesstaaten, der größte davon ist Western Australia, der ungefähr ein Drittel des Kontinents ausmacht und größer als ganz Westeuropa zusammen ist. Dann folgen der Größe nach: Queensland, South Australia, New South Wales, Victoria und die Insel Tasmanien. Es gibt außerdem noch mehrere Territorien, davon sind das Northern Territory und das Australian Capital Territory die größten, es gehören aber auch die Kokosinseln und die Weihnachtsinsel dazu.
Das Leben in Australien steckt voller Herausforderungen. In der Zeit nach der Trennung von der Antarktis und vor der Ankunft der Menschen vor etwa 60000 Jahren hatte die Natur reichlich Gelegenheit, sich zu entfalten. Gemessen daran, dass einen viele der dabei entstandenen Tiere beißen, stechen, totpicken oder vergiften wollen, ist es erstaunlich, dass sich die Menschen innerhalb von 30000 Jahren über den ganzen Kontinent verbreitet haben.
Dem schwierigen Gelände und dem Klima kann man kaum ausweichen. Der größte Teil der Landschaft besteht aus riesigen flachen Ebenen, und nur 6 Prozent davon liegen höher als 600 Meter über dem Meer. Die Temperaturunterschiede und die topographischen Gegensätze sind gewaltig, sie reichen von Wüsten über tropische Regenwälder bis hin zu schneebedeckten Bergen. Aber der größte Teil besteht aus dem sogenannten Outback, das ungefähr 70 Prozent von Australien einnimmt und größtenteils unbewohnbar ist. Die großen Ebenen und Wüsten im Inneren, die im Sommer 38 Grad Celsius heiß werden, erstrecken sich über große Entfernungen. Man findet kaum Wasser oder Schatten und niemanden, der einem helfen kann, wenn man ein Problem hat.
Im Jahre 1848 scheiterte ein Versuch, den gesamten Kontinent von Osten nach Westen zu durchqueren. Der Brandenburger Ludwig Leichhardt, der Leiter dieser Expedition, seine sieben Männer, darunter zwei Aborigines, fünfzig Zugochsen, zwanzig Maultiere und Berge von Ausrüstung verschwanden einfach, als sie versuchten, von Brisbane nach Perth zu gelangen. Das große Outback enthält viele Geheimnisse, darunter auch das Schicksal von Ludwig Leichhardt. Es wird bis zum heutigen Tage nach ihm gesucht.
Das Innere Australiens ist weitgehend unbewohnbar; der größte Teil der australischen Bevölkerung lebt in einem Siedlungsstreifen entlang der Südostküste.
Jahrtausendelang haben Klima und Landschaft bestimmt, wo es überhaupt zur Besiedlung kam. Während die Aborigines stets ihr traditionelles nomadisches Walkabout im Landesinneren unternahmen, klammern die europäischen Siedler sich heute noch an die Küsten des Landes. Ein halbmondförmiger Siedlungsgürtel erstreckt sich entlang der Ostküste über Brisbane, Sydney, Canberra und Melbourne nach Adelaide an der Südküste. Hinter den Küstenstraßen und Eisenbahnen ziehen sich Vororte und Satellitenstädte ins Landesinnere. Sie erreichen eine Breite von bis zu 320 Kilometern, ehe sie allmählich auslaufen, wenn man über die Berge in abgelegene Gebiete kommt. An der gegenüberliegenden Westküste liegt Perth und an der Nordküste Darwin, aber auch hier klammert sich die Besiedlung an die Küste. Es sieht so aus, als ob das so bleiben würde.
Thomas Griffith Taylor, der erste Geographieprofessor an der Universität Sydney, löste vor hundert Jahren große Empörung aus, als er erklärte, die Bevölkerung Australiens werde bis zum Jahr 2000 nicht wesentlich über zwanzig Millionen anwachsen, weil die Topographie dies nicht zulasse. Er wagte es, den Australiern zu sagen, dass die Wüste nahezu unbrauchbar für eine dauerhafte Besiedlung sei, was man damals für sehr unpatriotisch hielt. Die Presse heulte, und die Politiker schimpften über den angeblichen »Umwelt-Determinismus«. Sie stellten sich eine konstante Expansion von einer Küste zur anderen wie in den USA vor. Aber Professor Taylor hat recht behalten: Auch heute beträgt die australische Bevölkerung nicht mehr als 26 Millionen. Auch heute noch kann man die 3200 Kilometer von Sydney nach Darwin oder nach Perth fliegen, ohne unterwegs eine andere Stadt zu sehen. Fast 50 Prozent der Bevölkerung leben in nur drei Städten: Sydney, Melbourne und Brisbane. Es ist kein Zufall, dass sie alle in der Nähe des Murray-Darling-Beckens liegen.
Nur sehr wenige Flüsse des Landes führen ganzjährig Wasser, weshalb die Binnenschifffahrt keine große Rolle bei der Entwicklung Australiens gespielt hat. Die jährliche Wassermenge aller australischen Flüsse zusammen ist kleiner als die Hälfte der Wassermenge des Jangtse in China. Wenn wir Tasmanien einmal beiseitelassen, liegen alle australischen Flüsse, die ständig Wasser führen, im Osten oder Südosten des Landes. Die größten davon sind der Murray und sein Zufluss, der Darling River. Der Murray wird vom Schnee der australischen Alpen gespeist und führt genug Wasser, um die 2500 Kilometer zur Südküste ohne Unterbrechung zurückzulegen. Teile davon sind sogar schiffbar, und so stellt er das Kronjuwel der australischen Flüsse dar. Vom Meer aus ist der Murray allerdings nicht zugänglich, sodass der Warentransport deutlich eingeschränkt ist. Im 19. Jahrhundert wurde der Fluss noch als Verkehrsweg zur Entwicklung des Handels benutzt, aber auch die kleineren Schiffe hatten Probleme mit dem fehlenden Regen und blieben flussaufwärts und in den Nebenflüssen oft stecken. Andererseits umfasst das Murray-Darling-Becken viel fruchtbares Land, das Generationen von Australiern ernährt hat. Ohne dieses Gebiet wären sie vom Strand vielleicht niemals weggekommen.
Die Landwirtschaft im Murray-Darling-Becken ernährte die frühen europäischen Siedler im Südosten Australiens.
Es lohnt sich, die Geschichte Australiens mit der eines anderen kolonialen Experiments zu vergleichen, den USA. Auch die amerikanischen Kolonien entstanden aus Siedlungen an einer fruchtbaren Ostküste und wuchsen dann ins Innere des Landes hinein. Aber nachdem sie den Kamm der Appalachen überwunden hatte, konnte sich die junge amerikanische Nation in eins der flächenmäßig größten und vielleicht auch fruchtbarsten Flussgebiete der Erde ausdehnen – das Mississippibecken. Das Murray-Darling-Becken ist zwar von vergleichbarer Größe, erlaubte aber keine Binnenschifffahrt, nur wenig Ackerbau und keine dauerhafte Ansiedlung. Obendrein war es viel weiter von den internationalen Handelsrouten und -zentren entfernt. Zurück nach England waren es von hier aus 19000 Kilometer, während die dreizehn Kolonien, aus denen die Vereinigten Staaten entstehen sollten, nur 5000 Kilometer von Europa entfernt lagen.
Es gehört zu den verbreiteten Irrtümern, dass der englische Kapitän James CookAustralien im Jahre 1770 entdeckt habe. Ganz unabhängig von dem problematischen Ausdruck »entdeckt«, muss man nämlich wissen, dass der holländische Kapitän Willem Janszoon und seine Mannschaft von der Duyfken (»Täubchen«) die Küste von Nordaustralien schon im Jahre 1606 betreten haben. Janszoon glaubte allerdings, dass er auf der Insel Neuguinea gelandet sei, und reiste nach einer kurzen, feindseligen Begegnung mit den Einheimischen rasch wieder ab. Einige weitere europäische Expeditionen kamen und gingen, aber keine von ihnen machte sich die Mühe, das Innere des Landes genauer zu untersuchen.
Als Cook schließlich eintraf, war bereits klar, dass er die fabelhafte Terra australis incognita vor sich hatte. Der Begriff war bereits 1600 Jahre alt und ging auf die Berechnungen des griechischen Mathematikers ClaudiusPtolemäus zurück, der zu dem Ergebnis gekommen war, dass es auf der Südhalbkugel eine gewaltige Landmasse geben müsse, damit die Erde nicht umkippte. Zumindest im Ansatz war das goldrichtig. Auch heute wird Australien in Europa immer noch als down under gesehen.
Cooks Seekarten waren genauer als die Karten des Ptolemäus. Er war der erste Europäer, der an der Ostküste Australiens landete. Die Botany Bay ist heute ein Teil von Sydney, und Cook blieb dort sieben Tage mit der Endeavour. Die ersten Begegnungen seiner Mannschaft mit den Leuten, die damals dort lebten, mögen wie unbedeutende Zwischenfälle erschienen sein, aber im Nachhinein wirken sie wie bedrohliche Vorzeichen. In seinem Tagebuch schrieb der mitreisende Botaniker Joseph Banks: »So leben diese, ich hätte fast gesagt, glücklichen Menschen, zufrieden mit wenig, nein, eigentlich gar nichts; weit entfernt sind sie von der Sorge um Reichtümer oder Dinge, die wir Europäer als unentbehrlich bezeichnen … Bei ihnen erkennt man, wie gering die wahren Bedürfnisse des Menschen eigentlich sind, die wir Europäer bis zu einem Exzess aufgebläht haben, den diese Menschen wohl völlig unglaublich fänden, wenn man ihnen davon erzählen würde.«
Diese Begegnung mit einer anderen Kultur hinderte Banks aber nicht, die Botany Bay später als Standort für eine Strafkolonie zu empfehlen, mit der man die Lage in den überfüllten Gefängnissen Englands verbessern und die Strafgefangenen ein für alle Mal loswerden könne. Natürlich fanden auch die strategischen Vorteile reichlich Erwähnung, die entstehen würden, wenn man 17000 Kilometer entfernt von London die britische Fahne aufpflanzte.
Es wurden Schiffe vorbereitet, Strafgefangene zusammengezogen, Vorräte eingeladen. Die First Fleet (»Erste Flotte«) verließ Portsmouth am 13. Mai 1787 und traf Mitte Januar 1788 in der Botany Bay ein. Die elf Schiffe hatten etwa 1500 Seelen an Bord, davon 730 Strafgefangene (570 Männer und 160 Frauen). Der Rest bestand vor allem aus Seeleuten.
Nach wenigen Tagen beschloss Gouverneur Arthur Phillip, der für das Unternehmen verantwortlich war, dass die Botany Bay zur Besiedlung vollkommen untauglich sei, und zog mit Sack, Pack und Sträflingen ein paar Kilometer weiter nördlich zur Sydney Cove um, die nach dem damaligen britischen Innenminister benannt wurde. Hier, im heutigen Sydney Harbour, in einem Land, das er für die britische Krone beanspruchte, hielt er eine Rede, in der es nach den Aufzeichnungen des Schiffsarztes George Worgan hieß, »dass die Eingeborenen auf keinen Fall beleidigt oder belästigt werden dürften. Sie sollten mit Freundschaft behandelt werden.« In Wirklichkeit kam es ganz anders. Nach dem ersten Kontakt mit den Stämmen der Eora und Darug entwickelten sich bald Handelsbeziehungen, aber was die Eora und Darug nicht wussten: Diese fremden, neuen Menschen wollten nicht handeln, sie wollten ihr Land!
Obwohl die Aborigines lange als ein einziges Volk betrachtet wurden, gibt es viele verschiedene Völker und Sprachen, zum Beispiel die Murri in Queensland, die Nunga in South Australia, die Palawa auf der Insel Tasmanien, die wieder alle in Untergruppen eingeteilt werden können. Man vermutet, dass die Zahl der Ureinwohner im Jahre 1788 etwa 250000 bis 500000 betrug, einige Schätzungen liegen höher. In der folgenden Zeit starben Zehntausende in einem Frontier War, der bis ins 20. Jahrhundert andauern sollte.
Als sich die Siedlungen um Sydney ausdehnten und weitere britische Niederlassungen in Melbourne, Brisbane und Tasmania entstanden, dehnte sich auch der »Grenzkrieg« aus. Die Historiker streiten sich über das Ausmaß der Gewalt und die Zahl der Opfer, aber man schätzt, dass etwa 2000 Siedler und ein Vielfaches an Ureinwohnern getötet wurden. Die Aborigines fielen dabei oft großen Massakern zum Opfer. Es ist eine traurige Geschichte. Die Siedler waren der Ansicht, die Ureinwohner hätten keinerlei Rechte, und viele von ihnen bezweifelten, dass sie überhaupt Menschen seien.
Bereits 1856 wurde die Zerstörung der Kulturen der Aborigines von dem Journalisten Edward Wilson in einem Artikel der Zeitschrift Argus aus Melbourne beklagt: »In weniger als zwanzig Jahren haben wir sie hinweggefegt. Wir haben sie niedergeschossen wie Hunde … und ganze Stämme einem qualvollen Tod ausgeliefert. Wir haben sie zu Säufern gemacht und mit Krankheiten infiziert, die den Erwachsenen die Knochen zerfressen und die wenigen Kinder, die noch geboren werden, vom Tag der Geburt an furchtbarem Elend und Schmerzen aussetzen. Wir haben sie zu Ausgestoßenen im eigenen Land gemacht und verurteilen sie jetzt zur völligen Ausrottung.«
Das Elend dauerte das ganze 19. und auch noch im 20. Jahrhundert an, auch nachdem das unmittelbare Töten schon aufgehört hatte. Seit 1910 wurden Familien der überlebenden Aborigines-Völker Tausende Kinder weggenommen und in weiße Familien oder in Heime gesteckt, um die Assimilation zu erzwingen. Diese Praxis wurde erst 1970 beendet. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Zahl der Betroffenen bereits 100000, sie werden die »gestohlene Generation« genannt. Die Aborigines erhielten nicht vor 1962 das Wahlrecht, und erst 1967 wurden sie offiziell als Teil der Bevölkerung anerkannt. Mit einer Volksabstimmung wurde die Verfassung dahin gehend geändert, dass Aborigines bei der Volkszählung mitgezählt wurden und dadurch leichteren Zugang zu staatlichen Mitteln erhalten konnten. Noch 1965 hatte die Bürgerrechtsaktivistin Faith Bandler beklagt: »Die Australier müssen jeden Hund und jedes Stück Vieh registrieren lassen, aber wie viele Ureinwohner im Land leben, wissen wir nicht.«
Die Verfassungsänderung von 1967 erreichte bei der Volksabstimmung eine Mehrheit von 90 Prozent bei einer Beteiligung von 93 Prozent. Dieses beeindruckende Ergebnis betrachten viele Australier als Wendepunkt: Auch wenn die praktischen Auswirkungen eher gering waren, zeigte es doch, dass die Australier nach mehr Gleichberechtigung strebten. Dabei ist der Kampf noch längst nicht zu Ende. Aborigines besuchen mittlerweile erfolgreich die Universitäten, gehören zur Mittelklasse des Landes und bevölkern alle Aspekte des modernen Australiens; aber ihre Lebenserwartung ist noch immer niedriger als der australische Durchschnitt, chronische Krankheiten, Kindersterblichkeit und Gefängnisaufenthalte sind häufiger. In einigen Gemeinden sind Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und Krankheit ein Dauerproblem. Der seit fünfzig Jahren anhaltende Trend zur Verstädterung führt zu Entfremdung und Depressionen.
Die Einstellung zu den Aborigines hat sich sehr langsam verändert, aber es gab einige symbolische Wegmarken. In den Neunzigerjahren wurde zum Beispiel der riesige rostfarbene Wüstenmonolith Ayers Rock in »Ayers Rock/Uluru« umbenannt. Uluru war der ursprüngliche Name des Felsens in der Sprache des Anangu-Volkes, für das er ein heiliger Ort ist. Im Jahr 2002 wurde dann »Uluru/Ayers Rock« daraus. 2008 sprach Premierminister Kevin Rudd in Anerkennung der fortdauernden Verantwortung für zweihundert Jahre ungerechter Behandlung, Repression und Vernichtung eine offizielle Entschuldigung gegenüber den Aborigines-Völkern aus.
Trotz all der Benachteiligung wuchs die Zahl der Aborigines im 20. Jahrhundert wieder. Während man in den Zwanzigerjahren schätzte, dass womöglich nur noch 60000 Nachkommen der Ureinwohner in Australien lebten, gibt es heute etwa 800000 Aborigines und Torres-Strait-Insulaner (die sich ethnisch von den Aborigines unterscheiden), vor allem in Queensland, New South Wales, Western Australia und dem Northern Territory. Von den Hunderten Sprachen der Aborigines sind allerdings die meisten verloren gegangen, und es gibt höchstens 50000 Personen, die überhaupt noch eine davon beherrschen.
Das Vordringen der Siedler, das zu dieser Zerstörung geführt hatte, war langsam und unbarmherzig. Es kamen mehr und mehr Schiffe aus England, vorwiegend mit Strafgefangenen, und die weiße Bevölkerung wuchs jährlich um mehrere Tausend. Im Jahre 1825 hatte ihre Vorhut bereits erste Wege durch die Blue Mountains westlich von Sydney gefunden, die bis dahin als unpassierbare Barriere gegolten hatten, und das dahinterliegende Outback entdeckt. Damals betrug die Bevölkerung der Kolonie 50000, sechsundzwanzig Jahre später gab es schon 450000 weiße Siedler im Land. Der Transport von Strafgefangenen hatte nahezu aufgehört; die Neuankömmlinge waren vor allem Einwanderer, die sich in einer neuen Welt ein neues Leben aufbauen wollten.
Am 12. Februar 1851 wurde nördlich von Melbourne erstmals Gold in Australien gefunden. Hunderttausende strömten ins Land, um ihr Glück zu versuchen, und veränderten dadurch die Gesellschaft für immer. Viele kamen aus England, aber auch aus China, Kalifornien, Italien, Deutschland, Polen und verschiedenen anderen Ländern. Dank der Goldgeneration wuchs Australiens Bevölkerung bis 1870 auf 1,7 Millionen und wurde kulturell und ethnisch diverser. Der Goldrausch in seinem Irrsinn führte dazu, dass vor allem unverheiratete junge Männer die Küsten stürmten und eine Zeit lang eine Art Wildwest-Atmosphäre erzeugten. Erst allmählich veränderte sich das Wesen der Einwanderung, und es kamen auch ausgebildete Handwerker, Kaufleute, Händler, Buchhalter und Rechtsanwälte mit ihren Familien ins Land.
Sie alle haben zur Ausprägung des australischen Nationalcharakters beigetragen, aber es gibt die Theorie, dass es vor allem die Diggers, die Goldgräber, waren, die mit ihrem Einfallsreichtum, ihrem unverwüstlichen Optimismus und ihrer Freundlichkeit das Bild des Australiers geprägt haben, wie wir es heute kennen. Die Höflichkeiten der Alten Welt hatten in den rauen, schlammigen Goldfeldern wenig Bedeutung, und der unabhängige, aber solidarische Geist der Goldsucher führte zu einer rebellischen Identität mit weniger Respekt vor den britischen Autoritäten als früher.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde Australien zwar ein modernes Land, aber die einzelnen Kolonien waren sehr mit sich selbst und ihren politischen und wirtschaftlichen Problemen beschäftigt. Die formalen Beziehungen untereinander waren noch kaum entwickelt. Vor allem die Entfernungen zwischen den Siedlungen waren eine Herausforderung. Die Flüsse waren für Handel und Warentransport ungeeignet, und da es nur wenige Zugtiere gab, mussten die Menschen große Lasten auf schmalen Karrenwegen selbst über Land ziehen. Das ursprüngliche Transportsystem bestand hauptsächlich darin, dass von jedem Hafen aus Waren ins Landesinnere gebracht oder ins Mutterland England verschifft wurden. Da jede Region eine eigene Kolonie war, schien es nicht vordringlich, sie zu verbinden. Die frühen Straßen führten daher ins Landesinnere, aber nicht (oder zumindest nicht über größere Strecken) entlang der Küste. Letztlich führte dies dazu, dass sich jede der sechs Kolonien als getrennte politische Einheit entwickelte.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Eisenbahnlinien gebaut, auch hier zunächst kurze Strecken von den Häfen ins Landesinnere. Verbindungen zwischen den Küstenstädten entstanden nur sehr allmählich und litten unter dem Problem verschiedener Spurweiten. In den Jahren 1898–1900 kam es zu einer Serie von Volksabstimmungen, aus denen gegen starke Opposition der Beschluss zur Vereinigung ganz Australiens hervorging, und am 5. Juli 1900 verabschiedete das britische Parlament in Westminster schließlich den Commonwealth of Australia Constitution Act, der vier Tage später von Queen Victoria unterschrieben wurde. Am 1. Januar 1901 entstand auf diese Weise ein australischer Bundesstaat, in Sydney waren 500000 Menschen auf den Beinen, um das Ereignis zu feiern. Ein souveräner Staat war Australien damit noch nicht, sondern vorerst nur eine »sich selbst regierende Kolonie«, aber es war ein großer Schritt in Richtung Selbstbestimmung. Die volle Unabhängigkeit sollte erst der Australia Act von 1986 dem Land bringen.
Inzwischen gab es mehr als drei Millionen Australier, und die Gesellschaft wurde immer urbaner. Sowohl Sydney als auch Melbourne zählten fast 500000 Einwohner. Die Mehrzahl der Einwanderer kam immer noch aus Großbritannien, aber auch die anderen waren nahezu ausschließlich weiß. Eines der ersten Gesetze der neuen Regierung war der Immigration Restriction Act mit seiner Politik eines »Weißen Australiens«. Diese Zielsetzung wurde zwar nicht explizit so benannt, aber sie war insofern deutlich, als jedem Zuwanderer, der »nicht in der Lage war, einen Text von fünfzig Worten in einer europäischen Sprache niederzuschreiben, den ihm ein Beamter diktierte«, der Zugang verwehrt bleiben sollte.
Für den eher ungewöhnlichen Fall, dass ein Bewerber aus China zum Beispiel fünfzig Worte in portugiesischer Sprache zu schreiben vermochte, konnte man ihn immer noch auffordern, die Prüfung in flämischer Sprache zu wiederholen. Die Sprache bestimmte laut Gesetz der Beamte, und die Prüfung sollte meist nur eine vorgefasste Entscheidung juristisch bestätigen. Die meisten Zuwanderer, die man abwies, waren Nichtweiße. Das Gesetz enthielt auch die Bestimmung, dass nicht naturalisierte Einwanderer deportiert werden konnten, wenn sie eines Gewaltverbrechens für schuldig befunden wurden. Zu dem populären Lied Advance Australia Fair, das bei der Gründungszeremonie des Bundesstaates gespielt worden war und später die Nationalhymne wurde, passte das nicht so recht:
We’ve boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia fair.
Die vorherrschende politische und öffentliche Meinung war, dass die »grenzenlosen Ebenen« besser nur mit weißen Menschen, am besten Briten, geteilt werden sollten. Das neue Gesetz zielte vor allem auf Chinesen, Japaner, Indonesier und andere Nationalitäten aus der Nachbarschaft, die nicht nur die Löhne drücken, sondern auch die rassische »Reinheit« Australiens verwässern würden. Die Politik des weißen Australiens wurde bis in die Siebzigerjahre fortgesetzt. Von den asiatischen Nachbarn Australiens wurde sie stets negativ bewertet, besonders in den Staaten, die selbst aus Kolonien entstanden waren.
Nach dem Zweiten Weltkrieg brach die Epoche der »Ten Pound Poms« an. Australien brauchte Arbeitskräfte, und deshalb wurden Briten eingeladen, für schlappe zehn Pfund in ein neues Leben zu starten. Normalerweise war die Reise nach Australien viel teurer: Sie kostete 120 Pfund, was sechs Monatslöhnen eines Arbeiters entsprach. Das Angebot der australischen und neuseeländischen Regierungen konnte man eigentlich gar nicht ablehnen, wenn man dem trüben Nachkriegsengland und seiner Klassengesellschaft entkommen wollte. Zwischen 1947 und 1982 machten 1,5 Millionen sich auf den Weg nach down under mit seinen vielen Möglichkeiten, seinem Sonnenschein und den zunächst oft unvermeidlichen Härten. Auch meine Tante, mein Onkel und ihre vier Kinder gehörten dazu. Ann war Krankenschwester, Dennis Angestellter in einem Schuhgeschäft. Sie schifften sich 1972 in Southampton ein, gingen von Leeds nach Melbourne und tauschten schließlich ihre niedrigen Gehälter in England gegen einen deutlich höheren Lebensstandard in der neuen Heimat ein.
Zu dieser Zeit waren die meisten Arbeitskräfte immer noch britischen oder irischen Ursprungs, aber der demographische Hintergrund des Landes begann sich allmählich zu wandeln. Immer mehr andere Europäer wurden von den Ereignissen auf der Welt nach Australien getrieben und veränderten die dortige Einwanderungspolitik. Italiener, Deutsche und Griechen wanderten in Gemeinden ein, die schon seit Langem bestanden. Nach dem Aufstand im Jahre 1956 kamen viele Ungarn, nach der Besetzung ihres Landes durch Truppen des Warschauer Pakts folgten 1968 die Tschechen. Nach und nach wurden auch Verfolgte aus Lateinamerika und dem Nahen Osten hereingelassen. Nach dem Ende des Vietnamkriegs nahm Australien auch Tausende boat people auf. Während der Balkankriege und des folgenden Zusammenbruchs Jugoslawiens in den Neunzigerjahren kamen ebenfalls Flüchtlinge.
Das führte zu einer spürbaren Verschiebung von einer ursprünglich britischen oder anglo-keltischen zu einer multikulturellen Gesellschaft. Diese Veränderung des heutigen Australiens zu einer Gesellschaft, deren kulturelles Erbe in 190 verschiedene Länder zurückverfolgt werden kann, ging bemerkenswert schnell vonstatten. Bei der Volkszählung von 2016 zeigte sich, dass 26 Prozent der Bevölkerung im Ausland geboren waren, die eigentliche Veränderung bestand aber darin, woher diese Zuwanderer kamen. Die Briten stellten zwar noch immer die größte Zahl, aber zu den zehn größten Gruppen gehörten auch die Neuseeländer (8,4 %), die Chinesen (8,3 %), Inder (7,4 %), Filipinos (3,8 %) und Vietnamesen (3,6 %). Fünf der wichtigsten Zuwanderergruppen kommen also aus dem asiatischen Raum.
Das ist ein großer Unterschied zu der Situation von 1901 oder gar 1788. Wie in jedem anderen Land gibt es auch in Australien noch immer Rassismus und Ungleichheit, aber das Wesen der Veränderung hat Kevin Rudd im Jahre 2019 so beschrieben: »Unsere Definition der australischen Identität muss sich auf die Ideale, Institutionen und Übereinkünfte unserer demokratischen Gesellschaft beziehen, nicht auf ihre rassische Zusammensetzung.«
Das Land bleibt nach wie vor ein attraktives Ziel für Zuwanderer und Flüchtlinge, und die Migranten sind oft zum Äußersten entschlossen, um sich dort anzusiedeln. Gleich mehrere australische Regierungen des 21. Jahrhunderts haben daher scharfe Maßnahmen gegen alle erlassen, die illegal einreisen wollen.
Bereits 2001 begann die australische Küstenwache, Flüchtlings- und Migrantenschiffe abzufangen. Die Insassen wurden entweder zum Umkehren gezwungen, in Drittländer oder, wenn sie an Bord der Schiffe der Küstenwache genommen wurden, auf die zu Papua-Neuguinea gehörende Insel Manus oder nach Nauru gebracht. Diese Politik wurde 2008 abgebrochen, aber 2012 wieder aufgenommen. Seitdem sind 3000 Personen festgesetzt worden. Einige sind in ihre Herkunftsländer zurückgebracht worden, einige haben Flüchtlingsstatus in den USA erhalten. Im Jahre 2020 befanden sich noch 290 Menschen in den von Australien als »Abwicklungszentren« bezeichneten Lagern, wo sie immer wieder Angriffen der örtlichen Bevölkerung ausgesetzt waren.
Menschenrechtsaktivisten haben diese Politik als unmenschlich gebrandmarkt, aber die australischen Wähler scheinen sie doch ausreichend zu schätzen, sodass sie beibehalten wurden. Die Zahl der Flüchtlingsboote hat sich praktisch auf null reduziert, dafür treffen vermehrt Migranten auf dem Luftweg ein und beantragen bei der Ankunft Asyl.
Sie kommen, weil Australien immer noch The Lucky Country ist, wie der Titel eines Buches von Donald Horne aus dem Jahre 1964 lautet. Er hat das ein bisschen ironisch gemeint, aber der Name blieb hängen, und das hat auch seinen Grund. Australien ist eins der reichsten Länder der Erde, und wie es aussieht, wird das so bleiben. Das liegt vor allem an den Bodenschätzen und Agrarprodukten des Landes, die weltweit begehrt sind. Bei der Erzeugung von Wolle, Lammfleisch, Rindfleisch, Weizen und Wein ist Australien führend. Ein Viertel der Uranvorräte und die größten Zink- und Bleivorkommen der Welt findet man hier. Das Land ist ein wichtiger Erzeuger von Wolfram und Gold, hat große Silbervorkommen und exportiert immer noch Unmengen von Kohle. Aber damit steckt Australien auch in der Klemme.
Denn die Regierung und die Bevölkerung Australiens wissen natürlich genau, dass die fossilen Brennstoffe den Klimawandel vorantreiben. Die schrecklichen Brände der Jahre 2019/20, die von Rekordtemperaturen und Wasserknappheit verschlimmert wurden, waren auch auf die globale Erderwärmung zurückzuführen. Es kamen zwar nur wenige Menschen um, aber Hunderttausende von anderen Geschöpfen fielen dem Feuer zum Opfer, darunter Tausende Koalas, die das Symbol des Landes sind. Die Flammen erreichten die städtischen Gebiete zwar nicht direkt, aber die Wolken von beißendem Rauch, die über Canberra hingen, verschlechterten die Luftqualität zeitweilig auf nahezu unerträgliche Weise. Weiße Ascheflocken rieselten auf das Land wie heißer Schnee und wurden bis nach Neuseeland getrieben. Am 4. Januar 2020 war Sydney einer der heißesten Orte der Erde, die Thermometer zeigten 48,9 Grad Celsius.
Wer will unter solchen Bedingungen leben? Im Augenblick sind das 26 Millionen Menschen, aber wenn die Berechnungen des Australian Bureau of Statistics zutreffen, werden es im Jahre 2060 bereits 40 Millionen sein – und das ist nur die mittlere Schätzung. Wenn die Modelle der Klimatologen zutreffen, wird Australien weiter schwere Hitzewellen, Dürreperioden und Waldbrände durchmachen, die verbranntes unbewohnbares Land hinterlassen. Je weiter sich die Siedlungen ins Landesinnere vorschieben, desto mehr Menschen geraten dabei in Gefahr. Das bedeutet, dass sich die Australier weiterhin an die Küsten klammern und immer größere Städte dort bauen werden, obwohl der Anstieg des Meeresspiegels absehbar ist. Wahrscheinlich werden sich die Australier sogar aus einigen Gebieten wieder zurückziehen und langfristige Bebauungspläne entwickeln müssen, die das Risiko für die Bevölkerung wieder vermindern.
Eine Stromquelle ist in Australien überreichlich vorhanden: die Sonnenkraft. Dafür fehlt es an einer anderen: der Wasserkraft. Wasserkraftwerke sind wegen der ebenen Landschaft keine echte Option. Die Flüsse haben weder genügend Gefälle noch führen sie genug Wasser. Die einzige Ausnahme bildet Tasmanien, wo es bereits zahlreiche Wasserkraftwerke gibt. Der Wassermangel ist seit jeher das größte Problem in Australien und könnte bald höchste politische Priorität haben. Das Land wird eine offene Debatte über Nachhaltigkeit führen müssen.
Das heißt auch, dass die Australier über ihre Kohleindustrie nachdenken müssen. Angesichts der Tatsache, dass in allen Bundesstaaten Kohle abgebaut wird, dass dieser Industriezweig jährlich 70 Milliarden australische Dollar (etwa 45 Milliarden Euro) umsetzt und Zehntausende Menschen beschäftigt, wird das nicht leicht werden. Schon ehe er 2018 zum Premierminister gewählt wurde, löste Scott Morrison große Empörung aus, als er im Parlament einen großen Kohleklumpen hochhielt und erklärte: »Habt keine Angst und fürchtet euch nicht! Das wird euch nicht wehtun, das ist bloß Kohle.« Wenn Australien seine Kohleförderung heute einstellen würde, würde das die globale Luftverschmutzung nur wenig vermindern (dieses Problem kann nur gelöst werden, wenn jedes Land den eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern versucht), aber die nationale Wirtschaft würde es stark verändern. Deshalb wird die Kohle wohl noch jahrelang abgebaut werden, auch wenn das Land heute schon nach anderen Energiequellen sucht.
Um die Energieversorgung macht man sich große Gedanken in Australien, und wenn man die geostrategische Lage des Landes mit in Betracht zieht, sieht man schnell, dass es dabei auch um die militärische Sicherheit geht.
Wirtschaftlich ist Australien heute enger an seinen Standort gefesselt als früher. Seine Politiker erklären, dass es Teil der asiatisch-pazifischen Gemeinschaft sei, mögen aber nicht viel darüber reden, ob die asiatisch-pazifische Gemeinschaft das auch so sieht. In der unmittelbaren Umgebung ist diese ehemalige Kolonie und mit dem Westen verbündete Monarchie die wichtigste Macht und wird respektiert, aber nicht geliebt. Für die Staaten in der weiteren Umgebung ist Australien eine von mehreren Großmächten und ein möglicher Verbündeter ebenso wie ein möglicher Gegner.
Strategisch orientiert sich Australien vor allem nach Norden und Osten. Die erste Verteidigungslinie ist das Südchinesische Meer, darunter liegen die Philippinen und der indonesische Archipel, dann folgen die dazwischenliegenden Meere und Papua-Neuguinea. Im Osten konzentriert sich Australien auf die Inseln des Südpazifiks wie die Fidschi-Inseln und Vanuatu.
Australien hat dabei einige Vorteile: Es ist schwer zu erobern. Unmöglich wäre es nicht, aber schwierig. Der größte Teil eines Angriffs müsste amphibisch erfolgen, und wegen der Inseln im Norden und Osten sind die Angriffskorridore nur schmal. Ein Angreifer wäre kaum in der Lage, den ganzen Kontinent zu besetzen, und alle Punkte von militärischem Wert würden mit Sicherheit energisch verteidigt. Wenn feindliche Truppen im Northern Territory landen würden, wären sie immer noch 3200 Kilometer von Sydney entfernt, die Nachschublinien aufrecht zu erhalten, wäre ein Albtraum, und auch der Vormarsch selbst wäre sehr schwierig.
Was Australien gefährlich werden könnte, ist eine Blockade. Die meisten Importe und Exporte werden durch schmale Meerengen im Norden befördert, die im Falle eines Konflikts leicht gesperrt werden könnten. Dazu gehören die Sundastraße, die Lombokstraße und die Straße von Malakka, die den kürzesten Weg vom Indischen Ozean in den Pazifik bildet. Allein durch diese Meerenge fahren jährlich 80000 Schiffe. Fast ein Drittel des gesamten Welthandels und 80 Prozent der Ölversorgung Ostasiens müssen durch dieses Nadelöhr. Wenn diese Schifffahrtswege geschlossen würden, müssten andere Routen gefunden werden. Die für Japan bestimmten Tanker könnten zum Beispiel versuchen, weiter südlich an Nordaustralien und Neuguinea vorbei durch die mit Korallenriffen gespickte Torresstraße oder gleich ganz um Australien herumzufahren. Das würde die Transportkosten erheblich erhöhen, aber Japan und Australien weiterhin im Geschäft halten.
Eine erfolgreiche Blockade könnte Australien sehr rasch in eine Ölkrise treiben. Es hat an Land strategische Ölreserven für etwa zwei Monate gebunkert, und es sind ständig Tanker mit Öl für weitere drei Wochen nach Australien unterwegs. Canberra hat den Crash der Ölpreise 2020 genutzt und in den USA weitere Ölreserven gekauft, aber die könnte es im Konfliktfall womöglich gar nicht erreichen.
Ein solches Szenario hat die australische Verteidigungspolitik durchaus im Blick. Australien hat Schiffe und U-Boote, die zum Schutz von Konvois eingesetzt werden könnten. Seine Luftwaffe ist in der Lage, Fernaufklärung und Patrouillen über dem Meer zu fliegen. Es besitzt sechs Luftwaffen-Stützpunkte nördlich des 26. Breitengrads, von denen drei vollbesetzt und in ständiger Bereitschaft sind. Der 26. Breitengrad stellt die Trennlinie zwischen dem Norden und dem Süden des Kontinents dar. Sie beginnt etwa 100 Kilometer nördlich von Brisbane und läuft bis zur Shark Bay am Indischen Ozean. Nur zehn Prozent der australischen Bevölkerung leben nördlich davon, und es gibt Spekulationen, dass sie im Fall eines militärischen Angriffs nicht geschützt werden könnten, weil sich die Streitkräfte darauf beschränken müssten, die wichtigsten Städte im Süden zu schützen. Aber das ist nur ein Szenario für den äußersten Notfall, den die Regierung zu vermeiden hofft. Sie setzt vielmehr auf eine robuste Vorwärtsverteidigung durch die Luftwaffe und die Marine.
Angesichts der riesigen Fläche Australiens, seiner geringen Besiedlung und begrenzten Wirtschaftskraft, kann man allerdings nicht davon ausgehen, dass es eine Marine aufbauen kann, die alle Zugänge vom Meer an jeder Stelle wirksam verteidigen kann. Schon die Küstengewässer und die unmittelbar angrenzenden Seegebiete zu kontrollieren, ist eine Herausforderung. Das Festland hat eine Küstenlinie von 35000 Kilometern; dazu kommen 24000 Kilometer Küstenlinie der zugehörigen Inseln, die überwacht werden müssen. Die Royal Australian Air Force investiert deshalb jetzt viel Geld in F-35A-Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeuge, die bei der Verteidigung der Küsten ganz nützlich sein könnten. Hinsichtlich der zunehmenden Bedrohung durch Langstrecken- und Hyperschallraketen ist die australische Luftwaffe aber wohl noch mehrere Jahre im Rückstand. Deshalb ist sie jetzt mit der Schaffung einer Space Division beauftragt worden.
Um jede militärische Bedrohung zu verhindern, investiert die Regierung außerdem in eine starke Marine und setzt vor allem auf Diplomatie und eine sorgfältige Auswahl der Verbündeten. Canberra hat sein Augenmerk immer darauf gerichtet, wer die beherrschende Seemacht ist. Solange das noch die Royal Navy war, hat sich die Regierung Australiens an Großbritannien, die frühere Kolonialmacht, gehalten. Als sich aber abzeichnete, dass die USA zur beherrschenden Seemacht wurden, war offensichtlich, dass die politische und militärische Strategie sich nun an Washington ausrichten musste.
Den Wendepunkt in den militärischen Beziehungen zu Großbritannien markierte der Zweite Weltkrieg. Im Ersten Weltkrieg waren noch Tausende Australier zu den Fahnen geeilt und auf europäischen Kriegsschauplätzen gefallen. Nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor, Hongkong und Singapur am 7./8. Dezember 1941 wurde jedoch schnell klar, dass die Briten Australien nicht würden verteidigen können, und im weiteren Verlauf des Pazifikkriegs zeigte sich, wer die künftige Weltmacht sein würde.
Bereits im Dezember 1941 erklärte Premierminister John Curtin in einem Artikel mit der Überschrift »Die künftigen Aufgaben« unmissverständlich: »Die australische Regierung betrachtet den Krieg im Pazifik als einen Kampf, bei dem die militärischen Maßnahmen der demokratischen Staaten ganz wesentlich von den USA und Australien bestimmt werden müssen. Ohne alle Befangenheit kann ich sagen, dass Australien jetzt, unbeschadet unserer traditionellen Verbundenheit und Verwandtschaft mit dem Vereinigten Königreich, nach Amerika blickt.« Mit typisch australischer Grobheit fügte er hinzu, welche realpolitische Botschaft diesen Sätzen zugrunde lag: »Australien kann weiterkämpfen, England kann durchhalten, davon sind wir überzeugt.«
Es war die Wasserscheide. Jetzt kamen die Amerikaner. Die Vorhut war schon vor Ort, und Mitte 1943 befanden sich 150000 amerikanische Militärangehörige in Australien, vor allem in Queensland, wo General Douglas MacArthur sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Schiffe der US Navy lagen in Perth und Sydney vor Anker, die amerikanische Alltagskultur schlug erste Wurzeln. Coca-Cola, Hamburger, Pizza, Hotdogs, Hollywoodfilme und Produkte made in America begannen die Importe aus dem britischen Mutterland zu verdrängen.
Auch der Krieg kam nach Australien. Am 19. Februar 1942 führten Teile der japanischen Luftflotte, die Pearl Harbor angegriffen hatte, einen verheerenden Schlag gegen den Kriegshafen Darwin. Einen Monat zuvor hatten die Japaner den Norden der Insel Neuguinea besetzt, die von australischen und amerikanischen Truppen verteidigt wurde. Neuguinea ist die zweitgrößte Insel der Welt und liegt in unmittelbarer Nähe Australiens. Wäre Neuguinea gefallen, wäre die Insel mit Sicherheit der Ausgangspunkt einer japanischen Invasion oder einer Blockade Australiens geworden. In der Schlacht im Korallenmeer gelang es den amerikanisch-australischen Streitkräften jedoch, eine japanische Landung in Port Moresby (auf der Südseite von Neuguinea) zu verhindern. Im weiteren Verlauf des Krieges wurde die Insel dann zum Sprungbrett für General MacArthurs Rückeroberung der Philippinen und trug damit wesentlich zur Niederlage der Japaner im Zweiten Weltkrieg bei.
Seitdem ist Australiens Verhältnis zu den Amerikanern ähnlich wie das vor dem Zweiten Weltkrieg zu Großbritannien. Australien unterstützt die USA mit einem Teil seiner Streitkräfte (insbesondere den gut ausgebildeten Special Forces), die US Navy sorgt dafür, dass die Seewege offen bleiben, und hält den Schirm der nuklearen Abschreckung über Australien. Canberra hat Truppen in den Koreakrieg (1950–53), den Vietnamkrieg (1955–75), den zweiten Golfkrieg (1990–91) und den Irakkrieg (2003) geschickt, so wie es auch an beiden Weltkriegen teilnahm. Die Amerikaner wiederum sind entschlossen, auf Dauer die stärkste Seemacht zu bleiben. In Darwin haben sie einen großen Flottenstützpunkt errichtet. Die 2500 dort stationierten Marines werden die Chinesen nicht groß beunruhigen, aber es sind mehr als genug, um zu zeigen, dass die Amerikaner vor Ort und bereit sind, Australien zu verteidigen. Zumindest jetzt noch …
Denn das ist das große Dilemma Australiens. Der Aufstieg der Volksrepublik China zwingt die Amerikaner zu einer Entscheidung im Südwestpazifik. Sie können sich Pekings Versuch, seinen vermeintlichen Hinterhof unter Kontrolle zu bringen, in den Weg stellen; sie können versuchen, sich über regionale Einflusszonen mit Peking zu einigen; oder sie können die Hörner einziehen und einen langen, langsamen Rückzug bis nach Kalifornien antreten. Immerhin liegen zwischen der amerikanischen West- und der chinesischen Ostküste 11000 Kilometer Pazifik. Die amerikanischen Diplomaten und Militärs versichern Australien zwar immer wieder, dass die Allianz felsenfest sei, aber Präsident Trump hat die Australier durchaus verunsichert, als er den Eindruck erweckte, autoritäre Machthaber aus einer mickrigen Diktatur wie Nordkorea seien ihm lieber als bewährte Verbündete aus demokratischen Staaten. Mit der Wahl eines neuen Präsidenten hat sich der Tonfall geändert. Vier Wochen nach Präsident Bidens Sieg im November 2020 erklärten die Oberkommandierenden der US Navy, der Marines und der Coast Guard, dass die Volksrepublik China unter allen Weltmächten die »umfassendste langfristige« Bedrohung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten darstelle.
Bei den Australiern hatten die Alarmglocken schon Anfang 2020 geschrillt, als sich die Chinesen die zu Papua-Neuguinea gehörende Insel Daru vornahmen, um dort eine Fischfabrik zu errichten. Die Insel liegt an der Torresstraße, nur 200 Kilometer vom australischen Festland entfernt, und weil das Meer dort nicht gerade wegen des Fischfangs bekannt ist, werden die chinesischen Trawler immer wieder der Spionage verdächtigt. Vielleicht handelt es sich tatsächlich nur um ein kommerzielles Projekt, aber vielleicht könnten die Hafenanlagen auch als Anlaufpunkt für chinesische Kriegsschiffe dienen. Das ist nur eines der Beispiele für die ständige Wachsamkeit, zu der sich Australien genötigt sieht, wenn es um chinesische Aktivitäten in der Region geht. Und es erklärt, warum Australien ständig prüfen muss, in welchem Maße die USA noch zur gemeinsamen Sicherheitspolitik stehen.
Australien weiß, dass der amerikanische Verteidigungsetat gegen Mitte des Jahrhunderts vielleicht nicht mehr so viel höher als der chinesische sein wird wie heute. Der Unterschied zwischen der Zeit des Kalten Kriegs und heute ist krass: Damals fiel eine geschwächte Sowjetunion wirtschaftlich weit hinter die USA zurück und konnte schließlich beim Rüstungswettlauf nicht länger mithalten. China ist dagegen eine aufsteigende Volkswirtschaft, und man erwartet, dass sie Amerikas Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2050 übertrifft, womöglich sogar noch früher. Die amerikanischen Entscheidungen in diesem Zusammenhang haben auch Auswirkungen auf die Frage, wie sich Australien zu China stellt.
Wir neigen dazu, Australien und China für relativ enge Nachbarn zu halten. Das hat wahrscheinlich zwei Gründe: Australien ist in Richtung Osten, Süden und Westen so weit von jeder anderen großen Landmasse entfernt, dass China beim Blick nach Norden relativ nahe erscheint und man die beiden als Nachbarn sieht. Aber die übliche Mercator-Projektion unserer Landkarten verzerrt die Entfernungen, weil sie die Erdkrümmung auf einer zweidimensionalen Fläche abbildet. (Wenn Sie wissen wollen, wie sehr Mercator unsere Vorstellung von der Welt beeinflusst, dann sollten sie sich einmal die Waterman-Karten anschauen, an die man sich etwas gewöhnen muss, die aber eine ganz andere Perspektive zeigen.) Jedenfalls würden wir China wohl nicht als unmittelbaren Nachbarn von Polen bezeichnen, aber von Warschau ist es auch nicht weiter nach Peking als von Canberra. Das ist der Grund, warum China die Welt ständig mit einem Rundumblick von 360 Grad betrachtet, während Australien im Wesentlichen nach Norden blickt. Oder anders gesagt: China hat mehr Möglichkeiten als Australien.
Im Hinblick auf China muss Australien einen Drahtseilakt zwischen wirtschaftlichen Interessen, Verteidigungsstrategie und Diplomatie vollführen. China ist sein bei Weitem größter Handelspartner, obwohl die Investitionen je nach außenpolitischem Klima gelegentlich schwanken. In den letzten Jahren sind jährlich etwa 1,4 Millionen Chinesen zum Urlaub nach Australien gekommen, und aus China kommt auch etwa ein Drittel der ausländischen Studenten an den australischen Hochschulen. China kauft ungefähr ein Drittel der Agrarexporte Australiens, darunter 18 Prozent der Rindfleischexporte und die Hälfte der Gerste. Auch für Australiens Eisenerz, Erdgas, Kohle und Gold ist es ein wichtiger Markt. Aber Chinas sonstige Interessen in der Region und seine Versuche, territoriale Ansprüche durchzusetzen und größeren Einfluss zu nehmen, decken sich nicht immer mit den Interessen Australiens. Die Situation vor der chinesischen Küste ist sehr kompliziert. China beansprucht aus geographischen und historischen Gründen mehr als 80 Prozent des Südchinesischen Meeres. Ein schneller Blick auf die Landkarte legt nahe, dass diese Ansprüche nicht unbedingt berechtigt sein müssen, worauf Vietnam, die Philippinen, Taiwan, Malaysia und Brunei auch regelmäßig hinweisen. Sie haben andere geographische und historische Ansichten, und das erklärt wiederum, warum die Gebietsansprüche sich so oft überschneiden. Trotzdem baut Peking weiterhin 1600 Kilometer vom Festland entfernte kleine Felsenriffe zu künstlichen Inseln aus, auf denen es Landeplätze, Radarstationen und Raketenbatterien zu stationieren versucht.
Der gegenwärtige Ausbau der chinesischen Volksbefreiungsarmee deutet darauf hin, dass sie mittelfristig darauf abzielt, ihre Area-Denial-Fähigkeit zu erweitern. Diese Anti-Access/Area Denial-Strategie zielt darauf ab, gegnerische Kräfte daran zu hindern, ein bestimmtes Gebiet zu betreten, zu besetzen oder auch nur zu durchqueren. Das bedeutet, dass China versucht, Einrichtungen und Waffen bereitzustellen, die geeignet sind, die Amerikaner oder andere im Falle eines Krieges aus dem Südchinesischen und Ostchinesischen Meer zu verdrängen und hinter die Inselkette zu treiben, die sich von Japan bis zu den Philippinen erstreckt. Australien fürchtet nun, dass die Chinesen versuchen könnten, diese Zone noch weiter nach Süden bis in das Seegebiet südlich von Indonesien und den Philippinen auszudehnen, was sie bis in die Bandasee und an die Küsten von Papua-Neuguinea bringen würde. Die Erinnerungen an die japanische Invasion und die Kämpfe auf Neuguinea im Zweiten Weltkrieg sind in Australien noch sehr präsent. Zwar gibt es auch die Befürchtung, dass Indonesien in die Hände von Islamisten geraten könnte, aber was die Militärs in Canberra vor allem beunruhigt, ist die Vorstellung, dass die Chinesen näher an sie heranrücken könnten.