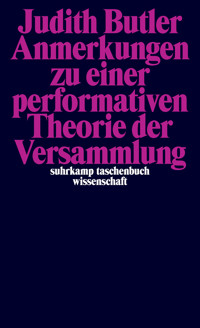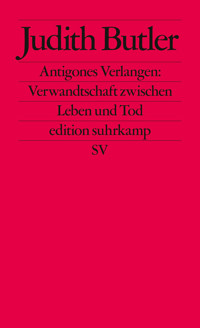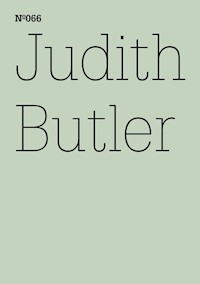19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Gewaltlosigkeit wird häufig als eine Praxis der Passivität verstanden, welche die ethische Einstellung sanftmütiger Einzelpersonen gegenüber existierenden Formen von Macht reflektiert. Dieses Verständnis ist falsch, wie Judith Butler in ihrem neuen Buch darlegt. Denn Gewaltlosigkeit kann durchaus eine aktive, ja aggressive Form annehmen, zudem ist sie ebenso wenig wie die Gewalt eine Angelegenheit einzelner Individuen, sondern stets eingebettet in soziale und politische Zusammenhänge. Auch deshalb gibt es erhebliche Meinungsverschiedenheiten darüber, wo die Grenze zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit verläuft sowie durch wen und wann Akte der Gewalt gerechtfertigt sind.
Mit Foucault und Fanon arbeitet Butler die Widersprüche und exkludierenden Phantasmen heraus, die häufig am Werk sind, wenn Akte der Gewalt legitimiert oder verdammt werden. Und mit Freud und Benjamin macht sie deutlich, dass wir noch grundsätzlicher fragen müssen: Wer sind wir und in welcher Welt wollen wir leben? Butlers kraftvolle Antwort lautet: in einer Welt radikaler sozialer Gleichheit, die getragen ist von der Einsicht in die Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten menschlicher Existenz. Diese Welt gilt es, gemeinsam im politischen Feld zu erkämpfen – gewaltlos und mit aller Macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Judith Butler
Die Macht der Gewaltlosigkeit
Über das Ethische im Politischen
Aus dem Amerikanischen von Reiner Ansén
Suhrkamp
7Je mehr Raum Waffengebrauch, körperlicher Zwang oder nackte Gewalt einnehmen, desto weniger Raum bleibt für Seelenstärke. Mahatma Gandhi
Die Entscheidung fällt heute nicht mehr zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. Die Wahl ist die zwischen Gewaltlosigkeit und Nichtsein. Martin Luther King, Jr.
Das Erbe (der Gewaltlosigkeit) ist kein individuelles, sondern ein kollektives Erbe zahlloser Menschen, die sich zusammenschlossen und erklärten, dass sie sich den Kräften des Rassismus und der Ungleichheit niemals unterwerfen würden. Angela Davis
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Motto
Inhalt
Danksagung
Einleitung
1. Gewaltlosigkeit, Betrauerbarkeit und die Kritik des Individualismus
Abhängigkeit und Verpflichtung
Gewalt und Gewaltlosigkeit
2. Das Leben der anderen bewahren
3. Ethik und Politik der Gewaltlosigkeit
Betrauerbares Leben: Gleichheit von unschätzbarem Wert
Foucault und Fanon über die Kriegslogik der »Rasse«
Die Gewalt des Rechts: Benjamin, Cover, Balibar
Relationalität im Leben
4. Politische Philosophie bei Freud: Krieg, Zerstörung, Manie und das kritische Vermögen
Die Gewalt in Schach halten
Postskriptum: Gefährdung, Gewalt, Widerstand – noch einmal durchdacht
Namenregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
249
9Danksagung
Ich danke den Zuhörerinnen und Diskussionsteilnehmern, die frühere Versionen der Kapitel dieses Buches bei den Tanner Lectures an der Yale University 2016, den Gifford Lectures an der University of Glasgow 2018 und den Cuming Lectures am University College Dublin 2019 gehört haben. Ebenso danke ich der Zuhörerschaft und den Kollegen und Kolleginnen für ihre kritischen Beiträge am Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, an der Universität Zürich, der Sciences Po in Paris, der Meiji University in Tokyo, der Free University of Amsterdam, dem Institut für Philosophie und Gesellschaftstheorie der Universität Belgrad, dem Institute for Critical Social Inquiry an der New School for Social Research, WISER an der University of the Witwatersrand, der Konferenz Psychology and the Other in Cambridge 2015 und bei den Versammlungen der Modern Language Association 2014. Ganz besonders möchte ich mich auch bei meinen Studierenden an der University of California, Berkeley, sowie den Kolleginnen und Kollegen des International Consortium of Critical Theory Programs bedanken, die mein Denken geschärft haben. Wie immer danke ich Wendy Brown für die so angenehme Gesellschaft ihrer Intelligenz und für ihre unermüdliche Unterstützung. Ich widme dieses Buch einer für die UC Berkeley kostbaren Freundin und Kollegin, Saba Mahmood. Sie hätte meiner Argumentation hier gewiss widersprochen, und ich hätte diese Diskussion gern mit ihr geführt.
10Kapitel 2 und 3 sind überarbeitete und erweiterte Fassungen der Tanner Lectures von 2016 am Whitney Humanities Center der Yale University. Kapitel 4 erschien in einer früheren Fassung in Richard G. T. Gipps und Michael Lacewing (Hg.), The Oxford Handbook of Philosophy and Psychoanalysis, Oxford: Oxford University Press 2019.
11Einleitung
Plädoyers für Gewaltlosigkeit treffen im gesamten politischen Spektrum auf Kritik. Auf der linken Seite ist mancher überzeugt, allein Gewalt könne radikale gesellschaftliche und politische Veränderungen bewirken, während andere die moderatere Auffassung vertreten, Gewalt solle zumindest als verfügbares taktisches Mittel für solche Veränderungen nicht ausgeschlossen werden. Sowohl für Gewaltlosigkeit wie für den instrumentellen oder strategischen Einsatz von Gewalt lassen sich Argumente vorbringen, jedoch lassen sich diese Argumente im öffentlichen Raum nur vertreten, wenn grundsätzlich Übereinstimmung darüber herrscht, was als Gewalt bzw. Gewaltlosigkeit zu gelten hat. Ein zentrales Problem für die Verteidiger der Gewaltlosigkeit liegt darin, dass die Begriffe »Gewalt« und »Gewaltlosigkeit« umstritten sind. So sind verletzende Äußerungen für die einen Akte der Gewalt, während andere der Auffassung sind, dass Sprache nur im Fall expliziter Drohungen als »Gewalt« im eigentlichen Sinn gelten kann. Wieder andere möchten den Begriff der Gewalt restriktiver handhaben und den versetzten »Schlag« als entscheidendes physisches Moment des Gewaltakts verstehen, während wieder andere darauf beharren, dass wirtschaftliche und rechtliche Strukturen »gewaltsam« sind und auf Körper einwirken, auch wenn diese Einwirkung nicht in jedem Fall die Form physischer Gewaltakte annimmt.
Tatsächlich drehen sich manche zentralen Debatten bezüglich der Gewalt unausgesprochen um die12ses Bild des Schlags, wobei angenommen wird, dass Gewalt etwas ist, das sich zwischen zwei Parteien in einer hitzigen Begegnung abspielt. Ohne die Gewaltsamkeit des physischen Zusammenpralls infrage zu stellen, lässt sich indes durchaus sagen, dass soziale Strukturen oder Systeme – unter ihnen der systematische Rassismus – gewaltsamer Natur sind. In manchem Fall ist der physische Schlag gegen Kopf oder Körper tatsächlich Ausdruck systemischer Gewalt, und hier muss man den Bezug des Aktes zur Struktur oder zum System begreifen. Um strukturelle oder systemische Gewalt zu verstehen, muss man über bloße Berichte hinausgehen, die uns eher daran hindern zu verstehen, wie Gewalt funktioniert, und man braucht auch einen weiter gefassten Rahmen als den mit zwei Beteiligten, von denen einer schlägt und der andere geschlagen wird. Erklärungen von Gewalt, die dem Schlag selbst, dem Akt des sexuellen Übergriffs (bis hin zur Vergewaltigung) nicht Rechnung tragen oder die mögliche Gewalt in intimen Zweierbeziehungen oder in der direkten Begegnung nicht verständlich machen können, sind natürlich deskriptiv und analytisch zum Scheitern verurteilt, wo es darauf ankommt, die Gewaltfrage wirklich zu klären, das heißt zu klären, wovon genau wir sprechen, wenn wir über Gewalt und Gewaltlosigkeit debattieren.[1]
Es scheint ganz einfach, sich gegen Gewalt auszusprechen und anzunehmen, damit sei die eigene Position zu dieser Frage geklärt. In öffentlichen De13batten ist der Begriff der Gewalt aber nicht eindeutig festgelegt, seine Semantik unterliegt Vereinnahmungen, gegen die man sich wehren muss. Für Staaten und Institutionen ist in manchen Fällen jeder Ausdruck abweichender politischer Überzeugungen und jede Opposition gegen den Staat oder die Autorität der betreffenden Institution ein »Gewaltakt«. Demonstrationen, Protestlager, Versammlungen, Boykotte und Streiks werden als »gewalttätig« bezeichnet, auch wo ihre Verfechter gar keine physische Gewalt anwenden und sich auch nicht auf die genannten Formen systemischer oder struktureller Gewalt beziehen.[2] Wo Staaten oder Institutionen diese Haltung einnehmen, versuchen sie, gewaltlose Praktiken als gewaltsame hinzustellen, und führen damit gleichsam einen politischen Krieg auf der Ebene der öffentlichen Semantik. Wird eine Demonstration für Meinungsfreiheit, die ebendiese Freiheit ausübt, als »gewalttätig« bezeichnet, dann nur, weil die die Sprache missbrauchende Macht durch Verunglimpfung ihrer Gegner ihr eigenes Gewaltmonopol sichern und zugleich den Einsatz von Polizei, Armee oder Sicherheitskräften gegen diejenigen rechtfertigen will, die ihre Freiheit ausüben und verteidigen wollen. Der Amerikanist Chandan Reddy argumentiert, dass die liberale Moderne der Vereinigten Staaten den Staat als Garanten der Freiheit von Gewalt betrachtet, der zugleich grundlegend von Gewalt gegen ethnische Minderheiten und gegen alle Völker abhängt, die als irrational und außerhalb der nationa14len Norm hingestellt werden.[3] Nach seiner Auffassung gründet der Staat in rassistischer Gewalt und übt diese Gewalt nach wie vor systematisch gegen Minderheiten aus. Rassistische Gewalt soll so der Selbstverteidigung des Staates dienen. Wie oft werden in den Vereinigten Staaten und anderswo People of Color auf der Straße oder in ihren Häusern und Wohnungen von der Polizei, die sie festnimmt oder erschießt, als »gewalttätig« bezeichnet, auch da, wo diese Personen gar keine Waffen tragen, und selbst da, wo sie einfach weggehen oder weglaufen, sich beschweren wollen oder einfach nur tief schlafen.[4] Es ist schon sehr merkwürdig und empörend zu sehen, wie Gewalt unter solchen Umständen gerechtfertigt wird; diejenigen, auf die sie abzielt, müssen als Bedrohung, selbst als Träger realer Gewalt dargestellt werden, damit tödliche Polizeieinsätze als Selbstverteidigung erscheinen können. Hat die fragliche Person überhaupt nichts sichtbar Gewalttätiges getan, galt sie vielleicht einfach nur als gewalttätig, als gewalttätige Art von Person oder schlicht als Verkörperung reiner Gewalt. Diese letztere Behauptung verrät meistens Rassismus.
Was sich also zunächst als moralische Auseinandersetzung für oder gegen Gewalt darstellt, wird schnell zu einer Debatte darüber, wie Gewalt definiert ist und 15wer als »gewalttätig« eingestuft wird – und in welcher Absicht. Wenn sich eine Gruppe Menschen zusammenfindet, um gegen Zensur oder mangelnde demokratische Freiheiten zu protestieren und wenn diese Gruppe als »Mob« bezeichnet oder als chaotische oder destruktive Bedrohung der sozialen Ordnung betrachtet wird, bedeutet das zugleich, dass sie als tatsächlich oder potenziell gewalttätig gilt mit der Folge, dass der Staat sein Einschreiten als Verteidigung der Gesellschaft gegen eine gewaltsame Bedrohung rechtfertigen kann. Folgen darauf Gefängnis, Verletzungen oder Tötungen, ist diese Gewalt Staatsgewalt. Staatliche Gewalt können wir als »Gewalt« auch dort bezeichnen, wo sie kraft eigener Macht andere Positionen bestimmter Gruppen als »gewalttätig« kennzeichnet. So lässt sich eine friedliche Demonstration wie die im Gezi Park in Istanbul 2013[5] oder ein offener Friedensappell wie der 2016 von zahlreichen türkischen Akademikern unterzeichnete[6] effektiv als »Gewaltakt« nur darstellen, wo der Staat über seine eigenen Medien verfügt oder die Medien weitgehend kontrolliert. Unter derartigen Bedingungen gilt dann die Ausübung des Rechts auf Versammlungsfreiheit als »Terrorismus«, was wiederum staatliche Zensur, Polizeiknüppel und Tränengas, Kündigungen, unbefristete Inhaftierungen, Haftstrafen und Exil nach sich zieht.
Die Lage wäre einfacher, könnte man Gewalt eindeu16tig und im Konsens definieren. Das ist aber unmöglich in einer politischen Situation, in der die Macht, oppositionelle Handlungen als Gewalt zu definieren, selbst Instrument zur Erweiterung der Staatsmacht und zur Diskreditierung der Ziele der Oppositionellen wird und sogar deren Entrechtung, Einkerkerung und Ermordung rechtfertigt. Unter solchen Umständen müssen Gewaltzuschreibungen als unwahr und unfair zurückgewiesen werden. Wie ist das aber in einem öffentlichen Raum möglich, in dem für semantische Verwirrung darüber gesorgt wurde, was Gewalt ist und was nicht? Bleibt uns hier nur ein wirres Meinungsspektrum über Gewalt und Gewaltlosigkeit und ein genereller Relativismus? Oder lässt sich doch unterscheiden zwischen taktischer Gewaltzuschreibung, die die Zielrichtung der Gewalt offenlegt und umkehrt, und Gewaltformen – oft struktureller und systemischer Art –, die sich nur zu oft der direkten Benennung und Wahrnehmung entziehen?
Argumente für Gewaltlosigkeit setzen Klarheit darüber voraus, wie Gewalt vorgestellt und in einem Feld diskursiver, gesellschaftlicher und staatlicher Macht zugeschrieben wird; man muss hier die taktischen Umkehrungen und den phantasmatischen Charakter der Zuschreibung selbst verstehen. Darüber hinaus müssen wir die Muster zu kritisieren versuchen, nach denen staatliche Gewalt sich selbst rechtfertigt, und ebenso die Beziehung zwischen diesen Rechtfertigungsmustern und der Bemühung um den Erhalt des Gewaltmonopols. Dieses Monopol hängt von einer Benennungspraxis ab, in der Gewalt oft als rechtliche Zwangsmaßnahme verschleiert oder in ihr Zielobjekt 17verlagert und dann als vom anderen ausgehende Gewalt wiedergefunden wird.
Argumente für oder gegen Gewaltlosigkeit setzen voraus, dass wir möglichst zwischen Gewalt und Nichtgewalt differenzieren. Es gibt aber keinen einfachen Weg zu einer stabilen semantischen Unterscheidung, da der Unterschied zwischen Gewalt und Nichtgewalt so oft zur Verschleierung und Erweiterung gewaltsamer Ziele und Praktiken genutzt wird. Anders gesagt können wir nicht direkt auf das Phänomen zusteuern, sondern müssen den Umweg über die Begriffsmuster gehen, die die unterschiedlichsten Begriffsverwendungen ermöglichen, und wir müssen analysieren, wie diese Festlegungen des Gewaltbegriffs funktionieren. Wenn diejenigen, die keine Gewaltakte begehen und dennoch der Gewalt beschuldigt werden, dieser Beschuldigung als ungerechtfertigt entgegentreten wollen, müssen sie zeigen, wie diese Beschuldigung eingesetzt wird; es geht nicht nur darum, was die Anschuldigung »besagt«, sondern auch darum, was mit ihr faktisch »getan« wird. In welcher Episteme gewinnt sie Glaubwürdigkeit? Anders gefragt: Weshalb wird ihr manchmal Glauben geschenkt, und – ganz entscheidend – wie lässt sich der Plausibilitätseffekt des Sprechakts aufdecken und entkräften?
Um diesen Weg einzuschlagen, müssen wir akzeptieren, dass die Begriffe »Gewalt« und »Gewaltlosigkeit« unterschiedlich und täuschend verwendet werden, ohne deshalb der nihilistischen Annahme nachzugeben, Gewalt und Gewaltlosigkeit sei eben das, was die Machthabenden dafür ausgeben. Zu den Anliegen dieses Buches gehört es, die Schwierigkeit anzunehmen 18und zu einer tragfähigen Definition von Gewalt zu gelangen, obwohl diese instrumentell im Dienst politischer Interessen und manchmal auch im Dienst der staatlichen Gewalt selbst definiert wird. Meiner Ansicht nach führt diese Schwierigkeit nicht zu einem chaotischen Relativismus, der die Aufgabe kritischen Denkens untergräbt, um eine falsche und schädliche Instrumentalisierung dieser Unterscheidung ans Licht zu bringen. Sowohl der Begriff der Gewalt wie der der Gewaltlosigkeit sind in der moralischen Debatte und in der politischen Analyse immer schon gedeutete Begriffe, die durch ihren vorhergehenden Gebrauch geprägt sind. Interpretationen von Gewalt und Gewaltlosigkeit und die Sicherung der Unterschiede zwischen beiden sind unumgänglich, wenn wir staatlicher Gewalt widerstehen und sorgfältig über mögliche Rechtfertigungen gewaltsamer Taktiken der Linken nachdenken wollen. Wenn wir uns hier auf das Terrain der Moralphilosophie wagen, finden wir uns in Bereichen, in denen Moralphilosophie und politische Philosophie aufeinanderprallen, und das hat Folgen sowohl für unser politisches Handeln wie für die Vorstellungen von der Welt, die wir gestalten helfen wollen.
Eines der beliebtesten Argumente vonseiten der Linken zugunsten des taktischen Einsatzes von Gewalt geht von der Behauptung aus, dass viele Menschen bereits im Kraftfeld der Gewalt leben. Da Gewalt schon eine Tatsache ist, so das Argument weiter, gibt es gar keine wirkliche Wahl mehr in der Frage, ob man mit dem eigenen Handeln das Feld der Gewalt betreten will oder nicht: Wir befinden uns bereits in diesem Feld. Nach dieser Auffassung ist die Distanz 19der moralischen Deliberation zur Frage »Gewalt – ja oder nein?« ein Privileg und Luxus und verrät etwas über die eigene Machtposition. In dieser Sicht ist die Frage der gewaltsamen Aktion keine Frage der Wahl, da wir uns schon – und gegen unseren Willen – im Feld der Gewalt befinden. Weil Gewalt die ganze Zeit schon stattfindet (und regelmäßig gegen Minderheiten ausgeübt wird), ist der Widerstand gegen sie nur eine Form von Gegengewalt.[7] Neben der allgemeinen und traditionellen linken Behauptung über die Notwendigkeit eines »gewaltsamen Kampfes« zu revolutionären Zwecken sind hier noch spezifischere Rechtfertigungsstrategien am Werk: Gegen uns wird Gewalt eingesetzt, also sind gewaltsame Aktionen unsererseits gerechtfertigt gegen (a) diejenigen, die mit der Gewaltausübung angefangen haben und (b) diese Gewalt gegen uns gerichtet haben. Wir handeln hier im Namen unseres eigenen Lebens und unseres Rechts, in dieser Welt am Leben zu bleiben.
Zur Behauptung, Widerstand gegen Gewalt sei Gegengewalt, stellen sich indes einige Fragen: Selbst wenn Gewalt immer schon im Spiel ist und wir uns in einem Kraftfeld von Gewalt bewegen, wollen wir nicht ein Mitspracherecht darüber haben, ob Gewalt weiter angewendet werden soll? Wenn sie immer schon angewendet wird, ist sie deshalb unvermeidlich? Was würde es heißen, ihre Unvermeidbarkeit infrage zu stellen? Das Argument könnte lauten: »Andere wenden 20Gewalt an, also sollten wir es auch tun«, oder: »Andere setzen Gewalt gegen uns ein, also sollten wir im Namen des Selbsterhalts Gewalt gegen sie einsetzen«. Das sind unterschiedliche, aber wichtige Behauptungen. Die erste beruft sich auf das Prinzip der schlichten Wechselseitigkeit und geht davon aus, dass ich das Recht habe zu tun, was immer der andere tut. Diese Argumentation berücksichtigt allerdings nicht die Frage, ob das Handeln des anderen zu rechtfertigen ist. In der zweiten Behauptung wird Gewalt mit Selbstverteidigung und Selbsterhaltung verknüpft, worauf wir in den folgenden Kapiteln zurückkommen werden. Fragen wir an dieser Stelle zunächst: Wer ist dieses »Selbst«, das im Namen der Selbstverteidigung verteidigt wird?[8] Wie wird dieses Selbst von anderen Selbsten abgegrenzt, von der Geschichte, vom Land, von seinen sonstigen definierenden Bezügen? Gehört derjenige, dem Gewalt widerfährt, nicht irgendwie auch zu dem »Selbst«, das sich in einem Akt der Gewalt selbst verteidigt? In einem bestimmten Sinn ist Gewalt, die einem anderen angetan wird, auch Gewalt, die dem Selbst angetan wird, aber nur dort, wo die Beziehung zwischen ihnen sie auf grundlegende Weise definiert.
Damit ist ein zentrales Anliegen dieses Buches benannt. Denn steht derjenige, der Gewaltlosigkeit praktiziert, in Beziehung zu demjenigen, gegen den Gewaltanwendung erwogen wird, dann scheint zwischen beiden ein vorgängiger sozialer Bezug zu bestehen; sie sind Teil voneinander, das eine Selbst ist im anderen 21impliziert. Gewaltlosigkeit wäre dann eine Weise, diesen Bezug anzuerkennen, so belastet er auch sein mag, und auch die normativen Zielsetzungen zu bejahen, die sich aus diesem schon bestehenden sozialen Bezug ergeben. Daher kann eine Ethik der Gewaltlosigkeit nicht in Individualismus gründen und daher muss sie eine führende Rolle in der Kritik des Individualismus als Basis sowohl von Ethik als auch von Politik spielen. Eine Ethik und Politik der Gewaltlosigkeit müsste der wechselseitigen Weise Rechnung tragen, die die Leben der Selbste miteinander verbindet und deren Bezüge ebenso destruktiv wie lebenserhaltend sein können. Die Beziehungen, die binden und definieren, reichen über die dyadische Begegnung von Menschen hinaus, und deshalb betrifft die Frage der Gewaltlosigkeit nicht nur menschliche Beziehungen, sondern sämtliche lebendigen und wechselseitig konstitutiven Beziehungen.
Zu dieser Untersuchung sozialer Beziehungen müssten wir allerdings wissen, welche Art potenzieller oder faktischer sozialer Bindung zwischen den beiden Subjekten eines gewaltsamen Aufeinandertreffens besteht. Wenn das Selbst durch seine Bezüge zu anderen konstituiert ist, dann gehört zum Erhalt oder zur Negierung dieses Selbst auch der Erhalt oder die Negierung der weiter reichenden sozialen Bindungen, die dieses Selbst und seine Welt definieren. Entgegen der Auffassung, das Selbst müsse zum individuellen Selbsterhalt Gewalt anwenden, geht diese Untersuchung davon aus, dass Gewaltlosigkeit sowohl eine Kritik der egologischen Ethik wie des politischen Erbes des Individualismus erfordert, um die Idee des Selbstseins als Spannungsfeld sozialer Bezüglichkeit fassen zu können. Diese Bezüglichkeit ist natürlich auch definiert durch Negativität, das heißt durch Konflikt, Zorn und Aggression. Mit dem destruktiven Potenzial menschlicher Beziehungen wird nicht jede Bezüglichkeit geleugnet, und die Betrachtung aus dieser Bezüglichkeit heraus kann auch die potenzielle oder faktische Zerstörung sozialer Bindungen nicht außer Acht lassen. Daher ist Bezüglichkeit nicht schon an sich gut, ein Zeichen der Verbundenheit, eine ethische Norm als Gegensatz zur Destruktion. Vielmehr ist Bezüglichkeit ein irritierendes und ambivalentes Feld; die Frage der ethischen Verpflichtung muss hier im Lichte fortdauernder und konstitutiver destruktiver Potenziale geklärt werden. Was sich am Ende auch immer als »das Richtige tun« erweist – es setzt den Durchgang durch die Spaltung oder die Auseinandersetzung voraus, die von vornherein die ethische Entscheidung bedingt. Diese Aufgabe ist nie nur reflexiver Art, das heißt, sie hängt nie nur von meiner Beziehung zu mir selbst ab. Stellt sich die Welt als Kraftfeld der Gewalt dar, muss die Gewaltlosigkeit Wege finden, in dieser Welt so zu leben und zu handeln, dass die Gewalt in Schach gehalten oder gemindert oder dass ihre Stoßrichtung geändert wird, und das in ebenjenen Momenten, wo sie die Welt völlig zu erfüllen und keinen Ausweg zu lassen scheint. Der Körper kann der Vektor dieser Wende sein, aber ein solcher Vektor können auch der Diskurs, kollektive Praktiken, Infrastrukturen und Institutionen sein. Als Antwort auf den Einwand, Gewaltlosigkeit sei schlicht unrealistisch, gehen wir hier davon aus, dass zunächst kritisch zu fragen ist, was überhaupt als 23Realität gilt; damit nutzen wir auch die Stärke und die Notwendigkeit eines anderen, eines Gegen-Realismus in Zeiten wie diesen. Gewaltlosigkeit verlangt vielleicht den Abschied von der Realität, wie sie sich heute darstellt, und die Offenlegung von Möglichkeiten eines erneuerten politischen Imaginären.
Viele auf der Linken behaupten zwar, an Gewaltlosigkeit zu glauben, nehmen aber für die Selbstverteidigung eine Ausnahme in Anspruch. Um ihre Position nachvollziehen zu können, müssten wir wissen, wer dieses »Selbst« ist – wo seine territorialen Grenzen und seine konstitutiven Bindungen liegen. Wenn das Selbst, das ich verteidige, in mir, meinen Angehörigen, anderen Mitgliedern meiner Gemeinschaft, Nation oder Religion oder allen besteht, die meine Sprache sprechen, dann bin ich insgeheim eine Kommunitaristin, die, wie es scheint, das Leben derjenigen schützt, die ihr gleichen, bestimmt aber nicht das Leben derjenigen, die ihr nicht gleichen. Zudem lebe ich dann offensichtlich in einer Welt, in der dieses »Selbst« als solches anerkannt werden kann. Sobald uns klar wird, dass das eine Selbst verteidigungswürdig ist, das andere aber nicht, stellt sich doch wohl das Problem der Ungleichheit, das sich aus der Rechtfertigung von Gewalt im Dienst der Selbstverteidigung ergibt. Diese Form der Ungleichheit, die bestimmten Gruppen im globalen Spektrum ein bestimmtes Maß an Betrauerbarkeit zugesteht, lässt sich nicht ohne Rückgriff auf die »rassischen« Schemata erklären, die so grotesk unterscheiden zwischen wertvollem (und im Verlustfall betrauerbarem) Leben und dem Leben derjenigen, für die diese Kriterien nicht gelten.
24Da Selbstverteidigung oft als zu rechtfertigende Ausnahme von den Normen einer Praxis der Gewaltlosigkeit betrachtet wird, müssen wir (a) fragen, wer als ein solches Selbst zählt, und (b), wie umfassend dieses Selbst der Selbstverteidigung eigentlich ist. (Noch einmal: Umfasst es die eigene Familie, Gemeinschaft, Religion, Nation, das angestammte Land, die eigene Lebensweise?) Für diejenigen, die als nicht betrauerbar gelten (die behandelt werden, als ob man sie weder verlieren noch betrauern kann) und die sich schon in der »Zone des Nicht-Seins« befinden, wie Frantz Fanon sagt, kann das Beharren auf einem Leben, das zählt, dieses Schema durchbrechen, wie wir an der Black-Lives-Matter-Bewegung sehen können. Leben zählen in dem Sinn, dass sie in der Sphäre der Erscheinung physisch Gestalt annehmen; Leben zählen, weil sie alle gleich geschätzt werden müssen. Und doch ist die Berufung auf Selbstverteidigung vonseiten derjenigen, die Macht ausüben, allzu oft nichts anderes als die Verteidigung dieser Macht, ihrer Vorrechte und der von ihr vorausgesetzten und geschaffenen Ungleichheiten. Das in diesen Fällen verteidigte »Selbst« ist ein Selbst, das sich mit anderen identifiziert, mit anderen, die weiß sind, einer bestimmten Nation, einer Partei in einem Grenzstreit angehören. So fördert Selbstverteidigung den Krieg. Ein solches »Selbst« kann wie eine Art von Regime fungieren, das in seiner erweiterten Form alle einschließt, die die eigene Hautfarbe teilen, der eigenen Klasse angehören, die eigenen Privilegien besitzen, und das alle aus diesem Regime des Subjekts/Selbst ausschließt, die in dieser Ökonomie durch Anderssein gekennzeichnet sind. Obgleich wir uns Selbst25verteidigung als Reaktion auf einen Schlag von außen denken, benötigt das privilegierte Selbst gar keinen solchen Antrieb, um seine Grenzen zu ziehen und seine Ausschlüsse durchzusetzen. Jede mögliche Bedrohung, das heißt jede imaginierte Bedrohung, jedes Phantasma der Bedrohung, genügt schon, um ohne Weiteres Gewalt anzuwenden. Die Philosophin Elsa Dorlin hat darauf hingewiesen, dass nicht jedem Selbst das Recht auf Selbstverteidigung zugestanden wird.[9] Wessen Berufung auf Selbstverteidigung findet etwa vor Gericht mehr Glauben und wessen Inanspruchnahme von Selbstverteidigung wird mit größerer Wahrscheinlichkeit verworfen? Anders gefragt: Wer ist Träger eines Selbst, das Verteidigung verdient und eine Existenz darstellt, die vor den Gesetzen der Macht als Leben mit eigenem Recht auftreten kann, als Leben, das der Verteidigung wert und vor seinem Verlust zu bewahren ist?
Eines der stärksten Argumente für den Einsatz von Gewalt auf der Linken lautet, dass Gewalt taktisch erforderlich ist, um struktureller oder systemischer Gewalt wirksam zu begegnen oder um gewalttätige Regime wie das Apartheid-Regime, Diktaturen oder totalitäre Regime zu überwinden.[10] Das mag stimmen, 26ich widerspreche dem nicht. Damit dieses Argument jedoch überzeugen kann, müssten wir zunächst einmal wissen, wo der Unterschied zwischen der Gewalt des Regimes und der Gewalt liegt, die das Regime zu Fall bringen will. Kann man diesen Unterschied immer benennen? Muss man unter Umständen hinnehmen, dass sich kein Unterschied zwischen der einen und der anderen Gewalt mehr angeben lässt? Anders gefragt: Kümmern die Gewalt diese Unterscheidungen und unsere Typologien überhaupt? Verdoppelt der Einsatz von Gewalt die Gewalt, und zwar in Richtungen, die sich nicht vorher eingrenzen lassen?
Hier und da wird zugunsten der Gewalt argumentiert, dass sie nur ein Mittel ist, um einen anderen Zweck zu erreichen. Eine Frage lautet also: Kann Gewalt bloßes Instrument oder Mittel sein, um gegen Gewalt – ihre Strukturen, ihre Regime – anzugehen, ohne selbst zum Zweck zu werden? Die instrumentalistische Verteidigung der Gewalt hängt ganz entscheidend davon ab, ob sie zeigen kann, dass Gewalt sich auf den Status eines Werkzeugs, eines Mittels beschränken lässt, ohne dass sie Selbstzweck wird. Der Einsatz des Werkzeugs zur Erreichung solcher Zwecke setzt die durchgehende Handlungsorientierung an klaren Intentionen voraus. Und sie setzt auch Klarheit darüber voraus, an welchem Punkt das gewaltsame Handeln enden wird. Was, wenn die Gewalt außer Kontrolle gerät, wenn sie zu Zwecken eingesetzt wird, die nie beabsichtigt waren, und wenn sie die handlungsleitende Intention sprengt? Was, wenn Gewalt eben die Art von Phänomen ist, das immer wieder »außer Kontrolle gerät«? Und schließlich: Was, wenn der Einsatz von 27Gewalt als Mittel zu einem Zweck implizit oder faktisch eine weiterreichende Gewaltanwendung rechtfertigt und damit nur noch mehr Gewalt in die Welt bringt? Kann sich daraus nicht eine Situation ergeben, in der andere mit gegenläufigen Absichten sich auf diese Rechtfertigung berufen, um ihre eigenen Zwecke zu verwirklichen und destruktive Ziele zu verfolgen, die denen der instrumentell beschränkten Gewaltanwendung entgegenstehen, Ziele, die vielleicht überhaupt keiner klaren Intention mehr folgen oder sich als zerstörerisch, diffus und unbeabsichtigt erweisen?[11]
Hier wird deutlich, dass uns jede Diskussion über Gewalt und Gewaltlosigkeit in weitere Fragen verstrickt. Zunächst verweist die Tatsache, dass der Begriff »Gewalt« strategisch zur Beschreibung ganz unterschiedlich interpretierter Situationen verwendet wird, darauf, dass Gewalt immer schon interpretiert wird. Das heißt nicht, dass Gewalt bloß eine Frage der Interpretation ist, wobei Interpretation als subjektive und willkürliche Art der Bezeichnung aufgefasst wird. Gewalt unterliegt vielmehr in dem Sinne der Interpretation, dass sie innerhalb manchmal unvereinbarer oder gegensätzlicher Rahmensetzungen erscheint; daher erscheint sie ganz unterschiedlich – oder auch gar nicht –, je nachdem, wie der jeweils gesetzte Rahmen sie erscheinen lässt. Eine stabile Definition der Gewalt hängt weniger vom Wissen um ihre konkreten Anwendungsfälle als davon ab, dass man ihr Oszillieren unter 28gegensätzlichen politischen Rahmensetzungen begrifflich zu fassen bekommt. Die Konstruktion eines neuen Rahmens zu ebendiesem Zweck ist denn auch eines der Anliegen dieses Projekts.
Zweitens wird Gewaltlosigkeit sehr oft als moralische Haltung verstanden, als Frage des individuellen Gewissens oder der Beweggründe für eine individuelle Entscheidung gegen gewaltsames Handeln. Gut möglich jedoch, dass die überzeugendsten Gründe für eine Praxis der Gewaltlosigkeit direkt eine Kritik des Individualismus implizieren und ein erneutes Durchdenken der sozialen Bindungen erfordern, die uns als lebendige Wesen konstituieren. Wenn jemand zu Gewalt greift, gibt er nicht einfach sein Gewissen oder seine tiefsten Überzeugungen auf, vielmehr gefährdet Gewalt bestimmte für das Zusammenleben sozialer Wesen erforderliche »Bindungen«. So scheint auch in der argumentativen Rechtfertigung von Gewalt als Selbstverteidigung von vornherein Klarheit darüber zu bestehen, was dieses »Selbst« ist, das ein Recht auf Selbstsein hat, und wo seine Grenzen verlaufen. Begreift man das »Selbst« jedoch als in Beziehungen eingebunden, müssen die Verteidiger der Selbstverteidigung nachvollziehbar angeben können, wie die Bindungen dieses Selbst aussehen. Ist ein Selbst im Kern mit einer Gruppe anderer verbunden und ohne diese Beziehungen gar nicht denkbar, wo beginnt und endet dieses singuläre Selbst dann? Die Argumentation gegen Gewalt impliziert daher nicht nur eine Kritik des Individualismus, sondern auch eine Klärung der sozialen Bindungen oder Bezüge, die Gewaltlosigkeit verlangen. An die Stelle von Gewaltlosigkeit als Frage der 29individuellen Moral tritt damit eine Sozialphilosophie der lebendigen und haltbaren Bindungen.
Darüber hinaus müssen die unabdingbaren sozialen Bindungen mit Blick darauf gedacht werden, dass die der Verteidigung würdigen »Selbste« im politischen Raum gesellschaftlich ungleiche Artikulationsbedingungen haben.[12] Die Beschreibung der sozialen Bindungen, ohne die das Leben gefährdet ist, ist auf der Ebene einer Sozialontologie angesiedelt, die eher als ein gesellschaftliches Imaginäres denn als eine Metaphysik des Sozialen zu begreifen ist. Anders gesagt lässt sich ganz allgemein davon ausgehen, dass Leben durch soziale Interdependenz gekennzeichnet ist und Gewalt einen Angriff auf diese Interdependenz darstellt, einen Angriff auf Personen, ja, aber noch grundlegender einen Angriff auf »Bindungen«. Obgleich Interdependenz Differenzierungen von Unabhängigkeit und Abhängigkeit begründet, impliziert sie auch soziale Gleichheit: Jeder ist abhängig oder durch Abhängigkeitsbeziehungen geformt und durch sie am Leben erhalten, und von jedem wiederum sind auf diese Weise andere abhängig. Wovon jeder abhängt und was von jedem abhängt, variiert, denn hier geht es nicht nur um das Leben anderer Menschen, sondern um alle empfindungsfähigen Wesen, um die Umwelt und um Infrastrukturen, von denen wir abhängen und die ihrerseits von uns abhängen, was Voraussetzung für den Erhalt einer lebensfähigen Welt ist. Wenn man in einem solchen Kontext von Gleichheit spricht, meint das nicht die Gleichheit aller Personen, sofern wir un30ter »Person« ein singuläres, abgegrenztes Individuum verstehen, das sich durch seine Grenzen definiert. Singularität und Abgrenzung existieren, ebenso wie Grenzziehungen, aber sie bilden ausdifferenzierende Merkmale von Wesen, die kraft ihrer wechselseitigen Beziehungen existieren. Ohne diesen übergreifenden Sinn von Interrelationalität stellen sich uns die Grenzen des Körpers als Endpunkt statt als Schwelle von Personen dar, als Raum des Übergangs und der Durchlässigkeit, als Beleg für das Offensein auf das Andere hin, das doch definierendes Moment des Körpers selbst ist. Die Schwelle des Körpers, der Körper als Schwelle unterminiert die Vorstellung des Körpers als abgeschlossene Einheit. Gleichheit lässt sich daher nicht auf ein Kalkül reduzieren, in dem jeder abstrakten Person der gleiche Wert zugeschrieben wird, denn die Gleichheit von Personen muss in Begriffen der wechselseitigen sozialen Abhängigkeit gedacht werden. Zwar ist richtig, dass alle Personen gleich behandelt werden sollen, aber Gleichbehandlung ist nicht möglich außerhalb einer sozialen Organisation des Lebens, in der materielle Ressourcen, die Verteilung von Lebensmitteln, Wohnungen, Arbeit und Infrastruktur auf gleiche Bedingungen der Lebbarkeit abzielen. Der Bezug auf diese Gleichheit der Lebbarkeit ist daher unverzichtbar für jede substanziell sinnvolle Bestimmung von »Gleichheit«.
Fragen wir darüber hinaus, welches Leben als verteidigungswürdiges Leben eines »Selbst« mit dem daraus folgenden Recht auf Selbstverteidigung gilt, dann hat diese Frage nur Sinn, wenn wir uns immer der allgegenwärtigen Ungleichheit bewusst sind, die das Le31ben der einen, nicht aber das der anderen überproportional zu lebenswertem und betrauerbarem Leben macht. Formen der Ungleichheit finden sich immer in einem ganz bestimmten Rahmen, aber Ungleichheit ist immer auch geschichtlich geprägt und wird durch konkurrierende Rahmenbedingungen infrage gestellt. Sie besagt nichts über den intrinsischen Wert eines Lebens. Denken wir zudem daran, wie bestimmten Bevölkerungsgruppen nach der vorherrschenden, ausdifferenzierenden Art Wert zu- und abgesprochen wird, wie sie geschützt oder im Stich gelassen werden, dann sehen wir uns bestimmten Machtformen gegenüber, die verschiedene Leben ungleich werten, indem sie deren Betrauerbarkeit ungleich ansetzen. Ich will hier »Bevölkerungsgruppen« oder »Populationen« nicht als soziologisch gegeben behandeln, denn sie werden zum Teil dadurch hervorgebracht, dass sie gemeinsam Verletzungen und Zerstörungen ausgesetzt sind und in unterschiedlichen Graden als betrauerbar (und schutzwürdig) oder als nicht der Trauer würdig gelten (als schon verloren und damit als leicht zu vernichten oder den Kräften der Zerstörung auszusetzen).
Diese Ausführungen zu sozialen Bindungen und zur Demografie der ungleichen Betrauerbarkeit scheinen vielleicht in keinem Bezug zur vorherigen Diskussion der Argumente zu stehen, mit denen Gewalt gerechtfertigt bzw. Gewaltlosigkeit verteidigt wird. Der Punkt ist aber, dass alle diese Argumente Vorstellungen darüber voraussetzen, was als Gewalt gilt, da Gewalt immer im Rahmen solcher Debatten diskutiert wird. Sie setzen auch bestimmte Ansichten über Individualismus und soziale Bezüglichkeit, Interdependenz, De32mografie und Gleichheit voraus. Wenn wir die Frage stellen, was Gewalt zerstört oder auf welcher Grundlage wir Gewalt im Namen der Gewaltlosigkeit als solche benennen oder ablehnen, müssen wir Praktiken der Gewalt (ebenso wie gewaltträchtige Institutionen, Strukturen und Systeme) vor dem Hintergrund der Lebensbedingungen betrachten, die sie zerstören. Ohne ein Verständnis der Lebensbedingungen und der Lebbarkeit und ihrer relativen Unterschiede können wir weder wissen, was die Gewalt zerstört noch warum uns das etwas angehen sollte.
Der dritte Punkt – auf den Walter Benjamin in seinem Aufsatz »Zur Kritik der Gewalt« von 1920 aufmerksam gemacht hat – ist der, dass Rechtfertigungen der Gewalt bislang vor allem einer instrumentalistischen Logik gefolgt sind.[13]