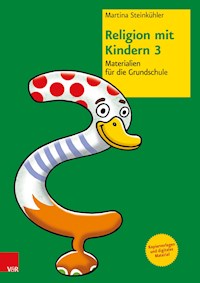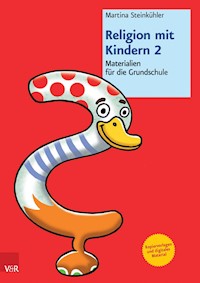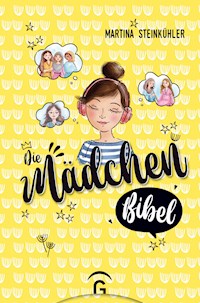
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ladenpreisänderung zum 01.03.26 - neu 13,00 € statt 24,00 €
Die Bibel als Abenteuerbuch für Mädchen entdecken
Nur wenige Mädchen und Frauen kommen in der Bibel namentlich vor, oft sind sie nur die „Tochter von“, „Frau von“, „Magd von“ ohne eigenen Namen. Aber sie hatten alle Namen - nur die Bibel schweigt davon. Die meisten Mädchen aber kommen gar nicht erst in den Blick, weder zu Wort noch zur Erwähnung. Und doch müssen sie dagewesen und dabei gewesen sein, immer und überall und mittendrin. Sie haben die Jungen und die Männer gekannt, von denen die Bibel erzählt. Sie haben sie geliebt und bewundert, gefürchtet und gehasst. Sie haben sich ihren Teil gedacht. Sie haben mitgemacht, beraten, getröstet, gestärkt. Recht und Unrecht getan, Recht und Unrecht verhindert. Schaden angerichtet und Schaden wiedergutgemacht. Herz und Seele gegeben, gezweifelt, geglaubt. An Götter, an das Gute, an Gott.
Es wird Zeit, die Bibel aus ihrer Sicht zu erzählen. Es werden die vertrauten Erzählungen sein, und doch anders. Mehr privat als öffentlich – so wie es der Rolle der Mädchen entsprach in biblischer Zeit; und immer wird es um Beziehungen gehen, zwischen den Menschen und zwischen Gott und Mensch. Denn so entspricht es uns, Mädchen und Frauen zu aller Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ein faszinierender und spannender Einblick in die Welt der Bibel – aus der Sicht von Mädchen und Frauen!
Wenige Mädchen (und Frauen) werden in der Bibel mit ihrem Namen genannt, die meisten Mädchen kommen gar nicht in den Blick, weder zu Wort noch zur Erwähnung. Und doch müssen sie dagewesen und dabei gewesen sein, immer und überall und mittendrin. Sie haben die Jungen und die Männer gekannt, von denen die Bibel erzählt. Sie haben sie geliebt und bewundert, gefürchtet und gehasst. Sie haben sich ihr Teil gedacht. Sie haben mitgemacht, beraten, getröstet, gestärkt. Recht und Unrecht getan, Recht und Unrecht verhindert. Schaden angerichtet und Schaden wieder gut gemacht. Herz und Seele gegeben, gezweifelt, geglaubt. An Götter, an das Gute, an Gott.
Es wird Zeit, die Bibel aus ihrer Sicht zu erzählen.
Martina Steinkühler, Dr. theol., geb. 1961, ist Theologin und Religionspädagogin mit dem Schwerpunkt Bibel und Bibeldidaktik. Sie arbeitete als Lehrerin, Dozentin, Verlagslektorin und in der kirchlichen Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit forscht Sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Ev. Theologie der Universität Regensburg. Sie verfasst Unterrichtsmaterialien, Bibelgeschichten, Schulbücher und Kinderbibeln. Sie lebt mit ihrer Familie in Göttingen.
Angela Gstalter studierte zunächst Modedesign in Berlin, wechselte dann in die Grafik und arbeitete für einige Jahre in einer Werbeagentur. Heute lebt sie mit ihrer Familie in der Nähe von Heidelberg und hat sich mit dem selbstständig gemacht, was sie am allerliebsten tut, dem Illustrieren von Kinder- und Jugendbüchern.
Martina Steinkühler
Die Mädchenbibel
Mit Illustrationen von Angela Gstalter
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht gelungen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber.
Copyright © 2021 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81 673 München
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagmotiv und Innenillustrationen: © Angela Gstalter
ISBN 978-3-641-27303-3V002
www.gtvh.de
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 1. Abraham und Sara (Genesis 12–25)
Eine von Saras Mägden erzählt
(+ Nachtrag: Genesis 22)
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 2. Isaak und Rebekka (Genesis 24.25–33)
Rebekkas erste Magd erzählt
(+ Nachtrag: Genesis 32)
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 3. Lea und Rahel (Genesis 29–33)
Rahels erste Magd erzählt
(+ Nachtrag: Genesis 31)
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 4. Jakobs Kinder (Genesis 33–35)
Dinas Magd erzählt
(+ Nachtrag: Genesis 34,30 f.37–50)
Geschichten vom Auszug aus Ägypten: Mose, mein Bruder (Exodus)
Mirjam erzählt, die sich einst als Magd ausgeben musste
(+ Nachtrag: Numeri 12 f.)
Geschichten vom Einzug in das Gelobte Land (Josua)
Eine Jebusiterin erzählt, genannt »die Hure«
(+ Nachtrag)
Geschichten von der ersten Zeit im Gelobten Land: 1. Jeftah (Richter 11 f.)
Eine, die nie Richterin war, erzählt
(+ Nachtrag: Richter 11,37–40 und 12; Genesis 22)
Geschichten von der ersten Zeit im Gelobten Land: 2. Simson (Richter 13–17)
Eine Philisterin erzählt, eine »Feindin«
(+ Nachtrag: Richter 14,8–14)
Eine Geschichte vom Ende der Richterzeit (Rut)
Eine Midianiterin erzählt, eine »Fremde«
(+ Nachtrag: Rut 2–4)
Geschichten von König David (Die Bücher Samuel)
Michal erzählt, die manche eine Hexe nannten
(+ Nachtrag)
Geschichten vom Kommen des Retters (Lukas 1)
Eine Kleine erzählt
Eine Alte erzählt
(+ Nachtrag)
Geschichten von Johannes und Jesus (Lukas 2–9)
Ein Mädchen aus Nazaret erzählt
(+ Nachtrag)
Geschichten vom Suchen und Finden (Lukas 10 + Johannes 11; Lukas 8 + Markus 16; Lukas 2)
Ein Mädchen aus Betanien erzählt
Ein Mädchen aus Magdala erzählt
Geschichten von Ende und Anfang (Lukas 8,1–3; Markus 9–16; Johannes 12)
Eine, die achtgeben sollte, erzählt
(+ Nachtrag; + Anfang: Apostelgeschichte 2)
Epilog und Anmerkungen
Prolog
»Wo waren die Mädchen?«, frage ich. »Es müssen doch Mädchen da gewesen sein, in all diesen Lebensgeschichten, von denen die Bibel erzählt.«
Wenige Mädchen (und Frauen) kommen in der Bibel namentlich vor – Hagar und Rebekka, Lea und Rahel, Dina und Tamar, Mirjam und Zippora. Rahab und Delila. Rut und Hanna und Michal. Abigajil und Batseba. Tamar und Isebel, Judit und Sara. Maria und Maria Magdalena, Salome und die andere Salome. Lydia, Damaris und Junia.
Manche sind genannt als »Tochter von«, »Frau von«, »Magd von« ohne eigenen Namen. Obwohl sie natürlich alle ihre Namen hatten: Jeftahs Opfer und Jairus’ Liebling und jede der Nebenfrauen Davids, mit denen Absalom schlief, um seinen Vater David zu blamieren – sie alle hatten Namen! Die Bibel schweigt davon.
Die meisten Mädchen kommen gar nicht in den Blick, weder zu Wort noch zur Erwähnung. Und doch müssen sie da gewesen und dabei gewesen sein, immer und überall und mittendrin. Sie haben die Jungen und die Männer gekannt, von denen die Bibel erzählt. Sie haben sie geliebt und bewundert, gefürchtet und gehasst. Sie haben sich ihr Teil gedacht.
Sie haben mitgemacht, beraten, getröstet, gestärkt. Recht und Unrecht getan, Recht und Unrecht verhindert. Schaden angerichtet und Schaden wiedergutgemacht. Herz und Seele gegeben, gezweifelt, geglaubt. An Götter, an das Gute, an Gott.
Es wird Zeit, die Bibel aus ihrer Sicht zu erzählen. Es werden die vertrauten Erzählungen sein, und doch anders. Mehr privat als öffentlich – so, wie es der Rolle der Mädchen entsprach in biblischer Zeit; und immer wird es um Beziehungen gehen, zwischen den Menschen und zwischen Gott und Mensch. Denn so entspricht es uns, Mädchen und Frauen zu aller Zeit. Eva heißt übrigens: Mutter des Lebens.
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 1. Abraham und Sara (Genesis 12–25)
Eine von Saras Mägden erzählt
Mägde und Knechte: Hier stand zuerst »Sklavinnen und Sklaven«, weil deutlich werden sollte, dass diese Menschen kein Selbstbestimmungsrecht hatten. Aber »Sklave« passt nicht in den Vorstellungsbereich des alten Israel. Da trifft es Martin Luthers altertümliche Übersetzung besser: Mägde und Knechte waren Hausgenossen, ohne Rechte zwar, jedoch nicht ohne Würde. Die Begriffe können ebenso wertschätzend wie geringschätzig gebraucht werden, der Status kann ehrenvoll sein oder missbraucht werden. Das alles drücken Luthers Begriffe besser aus als das Fremdwort »Sklave«. Zumal das hebräische Wort für »Knecht« auch jeden Menschen meint – vor seinem Gott: Geschöpf in der Hand des Schöpfers und sein Ebenbild.
Seit ich denken kann, lebe ich unter Abrahams Leuten.
Ich habe nie ein anderes Zuhause gehabt. Von klein auf war es meine Pflicht, allabendlich der Herrin einen Trank zur Nacht zu bringen. Ich fand sie stets schlaflos, mit geröteten Augen. Sie weinte Tränen des Zorns. »Ein Kind«, sagte sie. »Ich brauche ein Kind. Keine Frau ist eine gute Frau ohne ein Kind.« Ich an ihrer Stelle, ich wäre traurig gewesen. Sie aber, sie war zornig. »Dein Gott hat mir das angetan«, hörte ich sie einmal zu Abraham sagen. »Und ich weiß nicht, warum.«
Ich dachte viel über diese beiden Sätze nach. Keine Frau ist eine gute Frau ohne ein Kind. Und: Gott hat mir das angetan. Ich fragte mich, wie sie darauf kommt. Warum sie das glaubt. Ich dachte, das mit dem Kind, das hat sie so gelernt. Aber das mit Gott? Wer hat ihr das gesagt? Götter, dachte ich damals, Götter sprechen nicht mit Menschen …
Dann eines Tages kam der große Wandel.
Und wieder war es Abend und wieder ging ich zu ihr. Aber an diesem Abend ist alles anders. »Gut, dass du kommst!«, empfängt sie mich. Keine Spur von roten Augen; gerötet ist stattdessen ihr Gesicht. Ihre Truhen sind geöffnet. Sie steht gebeugt über ihrem Schmuck. »Du kannst mir helfen«, sagt sie. »Wir packen.« Natürlich verstehe ich sie nicht. Aber da es uns nicht erlaubt ist, zu fragen, trete ich vor, den Becher noch in der Hand. »Stell das weg!«, befiehlt sie. »Dafür ist jetzt keine Zeit.« Und während ich ihre Kleider zusammenlege, beginnt sie zu erzählen: Dass Abraham fortgehen will aus unserer Stadt. Und nie mehr wiederkommen. Dass wir kein Haus mehr haben werden, sondern Zelte. Dass wir einen langen, langen Weg vor uns haben, und keine Ahnung vom Ziel.
»Das stimmt nicht, Sara. Und das weißt du!« Abraham ist gekommen, der Herr. Ich sehe ihn nur selten. Er macht mir Angst mit seinem langen weißen Bart und den buschigen Augenbrauen. Sara richtet sich auf und sieht ihn an. »Du sagst es anders, ich weiß«, sagt sie. »Du sprichst von Gottes Befehl und von Gottes Versprechen. Du sprichst von Segen und von Kindern.«
»So ist es«, sagt Abraham, »und so wollen wir es weitersagen: Unser Gott hat mit mir gesprochen. Unser Gott hat zu mir gesagt: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und siehe, ich will dich zum Vater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.«1 Abraham sieht mich an, als er diese Worte spricht, feierlich und fest. »So wollen wir es weitersagen«, wiederholt er. »Und das mit dem Land und den Nachkommen wollen wir glauben.« »Ja«, sagt Sara. »Ja, das wollen wir.«
Mir blieb im Sinn, was Abraham sagte. Vor allem diese Worte: Unser Gott hat mit mir gesprochen. Dann sprechen sie also doch, die Götter? Oder nur dieser eine? Wer ist das – unser Gott?
Es wurde so, wie Sara gesagt hatte.
Jedenfalls der Teil mit dem Weggehen und dem langen Weg und dem Zelten. Der andere Teil, das, was wir glauben wollten, das blieb nichts als glauben. Und glauben heißt hoffen, was man nicht sieht. Aber das erfuhr ich erst durch Hagar …
Eine neue Magd kam zu uns. Vom Hof des Pharaos brachte Sara sie mit. Der Pharao ist der König von Ägypten. Denn unser Weg, dieser lange, lange Weg, hatte uns für eine Weile nach Ägypten geführt, weil wir hungerten und es dort Brot gab. Sara hatte dieser Weg in den Harem des Pharaos geführt, weil sie schön war. Aber das ist eine andere Geschichte, die will ich nicht erzählen.
Orientalische Männer heirateten bisweilen mehr als eine Frau. Orientalische Herrscher konnten mehrere Frauen haben; diese Frauen lebten zusammen in einem eigenen Bereich im Inneren des Palastes; das war der Harem.
Die neue Magd, die hatte einen Namen. Hagar.
Eines Abends – in Ägypten hatte ich abends keine Pflichten; ich saß am Feuer und einer von uns spielte Flöte – war Sara wieder da. Und neben ihr, mit ihrem Bündel, stand jene Andere … Ich weiß noch: Feuer und Wasser, dachte ich gleich. Wasser ist Sara. Feuer ist die Neue. Und ich hörte es knistern und zischen. Gewiss, sie senkte vor Sara den Blick. So, wie es uns befohlen ist. Aber ich sah, dass sie es nicht meinte, ich sah, dass sie nur so tat.
Sara sieht uns an. Sie hebt die Hand und zeigt auf mich. »Nimm sie in dein Zelt«, sagt Sara. »Sie muss meine Sprache lernen, so schnell und so gut wie möglich. Sie wird die Erste unter euch sein. Ich sage ihr, was zu tun ist, und sie sagt es euch. Und dazu muss sie mich verstehen.« Natürlich erschrecke ich. Eine Erste hat es bei uns nie gegeben, keine Erste außer Sara. Aber weil wir nicht erschrecken dürfen, stehe ich einfach auf und gehe zum Zelt. Es ist groß genug für drei. Wir sind vier.
Sie folgt mir, die Neue. Ich hebe den Teppich, der die Öffnung verschließt, hebe ihn für sie und lasse sie eintreten. Und da steht sie dann, mitten im Zelt, mit ihrem Bündel. Und sie sagt ein ägyptisches Wort. Ich kann kein Ägyptisch. Aber ich spüre, was sie meint. Sie meint, dass unser Leben so ist wie getrockneter Ziegen-Dung. Ohne Schönheit, ohne Ansehen. Bloß nützlich.
Ich weiß nicht, warum. Aber ich nicke, nicke heftig. Und sie, sie lacht. »Wie heißt du?«, fragt sie in unserer Sprache. Ich antworte nicht. Da sagt sie ein anderes ägyptisches Wort. Und sie fügt hinzu: »Ich heiße Hagar.«
Mit Hagar wurde alles anders.
Viele Tage lang hatte ich keine andere Aufgabe mehr, als mich um Hagar zu kümmern. Sie muss unsere Sprache lernen. Saras Befehl war deutlich gewesen: so rasch und so gut wie möglich. Aber wie sollte ich das machen? Und was, wenn sie nicht wollte? Hagar hatte nicht nur einen Namen. Sie hatte auch einen eigenen Willen. (Ich hätte das damals nicht so ausdrücken können. Aber gewusst habe ich es, von Anfang an.) »Tuch«, sage ich. »Wolle«. »Schaf.« Sie lacht und sagt: »Du – Schaf.«
»Ich weiß, dass du mich verstehst«, sage ich. »Bitte: Du musst es zeigen. Sonst wird die Herrin zornig.« Hagar nickt. Sie streckt die Hand aus und streicht mir Haar aus dem Gesicht. »Noch nicht«, sagt sie mit ihrer fremden Stimme. »Es darf eine Weile dauern.«
Sie lässt sich Zeit damit, Worte zu lernen, die sie in Wahrheit längst kann. Wir reden. Nie habe ich viel geredet. Hagar lässt mich Worte sagen wie »Tuch« und »Wolle«, »Frau« und »Mann« und »Gott«. Was ist das?«, fragt sie dumm. Und wenn ich es erkläre, fragt sie weiter. Sie fragt mehr, als ich weiß. Mehr, als ich dachte, dass ich weiß. »Gott«, sage ich, »ist unsichtbar. Er ist Abrahams Gott. Oder, wie Abraham sagt: unser Gott. Für Abraham ist Gott ein Wegweiser und ein Begleiter. Sara sagt, Gott ist gegen sie. Ich denke: Vielleicht hat Gott einen Grund. Er kann nicht einfach ungerecht sein, denke ich.«
»Du denkst viel«, sagt Hagar. »Hast du auch schon einmal darüber nachgedacht, warum euer Gott nur einer ist? Genügt das denn?« Hagar erzählt von den vielen ägyptischen Göttern. Ich höre ihr zu und ich denke nach. »Abraham hat nur einen Gott«, sage ich. »Das ist gut, denke ich. Sonst kommt man durcheinander.« Hagar macht so ein Geräusch – fast wie unser Esel. »Unsinn«, sagt sie. »Du bist keine, die leicht durcheinanderkommt. Und außerdem: Warum ist er ER?« Ich starre sie wortlos an. Sie starrt zurück. Und dann beginnt es, mir zu dämmern. »Siehst du?«, sagt Hagar. »Du – Schaf!«
Sara kommt und fragt: »Was macht ihr? Wie geht es?« Und Hagar senkt den Blick und sagt »gut«. Sie deutet auf mich und nickt und sagt: »Sehr – gut.«
Als Hagar zu uns kam, hatte sie Farbe im Gesicht.
Sie hatte schwarze Striche um die Augen, außen hochgezogen fast bis zu den Schläfen. Blau waren ihre Lider, mit Grün und Gold, und ihre Lippen rot. Am nächsten Tag war die Farbe verschwunden. Ich dachte, dass Sara keine Farbe erlaubte.
Hagar zeigt mir, was sie hat: Farbe für das Gesicht, die Fingernägel, die Fußnägel, und Salben und Öle für die Haut. »Ihr – Brot«, sagt sie. »Ägypten – Kuchen.« Ich verstehe sie nicht. Oder doch? »Ziegen-Dung«, sage ich. Sie lacht und sagt das ägyptische Wort, mit dem sie mich ruft. Ich weiß noch immer nicht, was es bedeutet.
Nach und nach wurde alles so, wie Sara wollte: Sara sagte Hagar, was getan werden musste. Und Hagar sagte es uns. Hagar war die Erste bei uns. Sie war es ohne Mühe. Und wir hatten keine Mühe mit Hagar. Wir lernten von ihr. Wir bekamen etwas Kuchen neben all dem Brot. Und so verging die Zeit …
Im nächsten Jahr brauchte Sara wieder ihren Schlaftrunk.
Das war, als wir schon eine Weile in dem Land lebten, das Abraham »Land der Verheißung« nannte. Es war ein raues Land, eher wie Brot als wie Kuchen. Aber unsere Herden gediehen, und Abraham hatte Ansehen bei unseren Nachbarn, den Fürsten des Landes.
Eines Abends kommt Hagar zu mir und ihr Feuer brennt niedrig. Sie sagt meinen ägyptischen Namen und dann: »Hilf mir, rasch! Die Herrin ist zornig. Sie kann nicht schlafen. Sie sagt, du weißt, was ihr hilft, und ich soll es ihr bringen.«
Ich wundere mich. Aber ich sage nichts. Erst während ich den Trank bereite, frage ich nach: »Sagt Sara wieder: Keine Frau ist eine gute Frau ohne Kind? Und sagt sie wieder: Gott tut mir das an?« Hagar nickt. »Beides«, sagt sie. »Und beides ist Unsinn.« »Sag es ihr nicht«, rate ich ihr. Der Trank ist fertig. Ich reiche Hagar den Becher. Hagar hat so eine Art, ihre Hand zu bewegen. Als ob sie etwas wegwirft. »Wer weiß?«, sagt sie. »Wenn der richtige Augenblick kommt.«
Der richtige Augenblick kam nicht.
Hagar sagte es ihr nicht. Sie sagte Sara nicht, dass ihre beiden Sätze Unsinn sind. Und Sara half sich selbst …
Eines Tages kommt Hagar und ist starr. Kein Feuer brennt. »Was ist?«, frage ich gleich. Hagar ist die Erste unter uns. Aber noch immer kümmere ich mich um sie. Es macht mir Angst, wie hart ihr Gesicht ist. Und doch habe ich es gesehen, von Anfang an, dass Hagar hart sein kann. Bitter und hart.
Hagar antwortet nicht. Sie öffnet ihr Bündel. Sie holt ihre Salben und Öle. Sie badet. Sie salbt sich. Sie zieht das Leinengewand an, mit dem sie zu uns gekommen ist. Dann die Farben: schwarz und blau für die Augenlider. Grün und Rot. Ich stehe dabei. Ich schaue zu. Ich frage nicht noch einmal.
»Sara hat einen Weg gefunden«, sagt Hagar. »Einen Weg?«, frage ich. Auf einmal ist sie voll Ungeduld. »Hast du es vergessen?«, fährt sie mich an: »Keine Frau ist eine gute Frau ohne Kind.« Natürlich habe ich das nicht vergessen. Aber was, um Gottes willen, bedeutet es?
Hagars Ungeduld ist vorbei. Jetzt ist sie müde. »Und sie wird eine gute Frau sein«, fährt sie fort: »Durch mich.« Und sie erklärt mir mit wenigen harten Worten, was Sara geplant hat: Hagar soll für Sara ein Kind bekommen. Ein Kind mit Abraham.
Ich schreie leise auf, als ich das höre. Ich weiß nicht genau, wie das geht. Aber ich sehe in Hagars Gesicht: Es ist nichts Gutes. »Hast du ihr nicht gesagt, dass es Unsinn ist?«, frage ich. Hagar beginnt, ihre Augen anzumalen. »Nein«, sagt sie. »Dann tu’s!«, sage ich. »Geh und tu’s.« Hagar malt ihre Lippen tiefrot. »Oh nein«, sagt sie. »Das mache ich anders.« Und dann, unvermittelt: »Wie sehe ich aus?« Da muss ich nicht überlegen. »Feuer«, sage ich. Da lacht sie. »Gut«, sagt sie. »Oh, gut!«
In dieser Nacht ging Hagar fort.
Sie kam drei Tage nicht zurück. Dann, als wäre nichts geschehen, war sie wieder da, ohne Farbe, mit gesenktem Blick, die Augen rot wie sonst Sara. Sie sagte nichts, sie suchte kein Gespräch. Ich wusste, ich musste sie in Ruhe lassen. Und wollte mich doch so gern um sie kümmern. Ihr Feuer war wieder aus. Und sie war hart und bitter.
Es dauert lange, bevor sie wieder spricht. Es ist am Morgen und sie hat ihre Farben aufgetragen. »Was ist?«, frage ich, weil sie mich so ansieht, als ob ich fragen darf. Als ob ich fragen soll. »Es ist gelungen«, sagt sie. »Saras Plan. Und meiner.«
Dein Plan? Ich schreie wieder leise auf. »Wir dürfen keine Pläne …« Aber sie lacht und sagt: »Du wirst schon sehen – Schaf!« Sie steht auf. »Die Herrin wartet«, sagt sie und lacht. »Geh nicht«, sage ich. »Geh nicht so! Wisch dir die Farben vom Gesicht!« »Nie mehr«, sagt sie und lacht.
Tagelang ging Hagar in Farbe.
Ich beobachtete sie. Ich sah: Sie senkte den Blick nicht mehr. Sie schaute Sara gerade in die Augen. Sara sagte nichts. Aber ich sah Saras Zorn. Und ich wusste: Wasser ist stärker als Feuer. Feuer kann man löschen. Wasser aber bahnt sich seinen Weg. Ich sah, wie Sara mit Abraham sprach. Und Abraham sagte nein. Er sagte es matt und müde. Zweimal sagte er nein. Beim dritten Mal nickte er. Das Wasser hatte einen Weg gefunden. Und mit Hagars Farben war es aus.
Es ist Mittag, als Hagar sich in meine Arme stürzt. »Hilf mir!«, ruft sie. »Ich muss weg!« Ich frage nicht einmal: »Was ist?« Ich nehme einen Becher und fange an zu brauen: Saras Schlaftrank, dreimal stärker. Hagar bindet wild ihr Bündel. Ich lege ihr die Hand auf die Schulter. »Ruhig«, sage ich, »es darf noch eine Weile dauern.«
Dann gehe ich und bringe Sara ihren Trank. »Und wo ist Hagar?«, fragt sie zornig. »Sie kommt«, sage ich. »Sobald ihr nicht mehr schlecht ist.« Ich lüge nicht (sehr). Denn Hagar hat sich öfter übergeben, in den letzten Tagen. Als ob sie unser Essen, an dem sie immer etwas auszusetzen hat, auf einmal gar nicht mehr verträgt. Als Sara mich endlich gehen lässt, ist Hagar nicht mehr da. Ich bin zwar nicht überrascht; jedoch: Weh tut es trotzdem. Ich habe mich sehr gern um sie gekümmert.
Nicht lange, da war Hagar wieder da.
Es traf mich wie ein Blitz. Ich komme vom Brunnen und sehe sie liegen – liegen! – liegen vor Abraham und Sara am Boden. »Ich darf euer Kind nicht in Gefahr bringen«, sagt Hagar. »Verzeiht mir. Was ich tat, war Unsinn.« Jetzt zeigt sie, wie sie reden kann, fließend und gut in unserer Sprache.
»Unser Kind?«, sagt Abraham und strahlt. »Keine Farben mehr!«, verlangt Sara. »Du hörst auf mich und senkst den Blick. Ich bin die Mutter dieses Kindes. Die Mutter dieses Kindes, das bin ich.« Abraham nimmt Hagar bei der Hand und hebt sie auf. »Es ist gut, dass du zurückgekommen bist«, sagt er. »Denn sonst«, sagt Sara und ihr Zorn schwillt an: »Gnade dir Gott!«
Ein Schauder läuft mir über den Rücken. Gnade dir Gott! Ich weiß nicht, was es bedeutet. Aber es klingt schlimm. Abraham sieht mich und winkt mich heran. »Kümmere dich um Hagar«, sagt er. »Sie braucht Wasser und Brot.«
Hagar ist in der Wüste gewesen. Sie hat sich verirrt. So viel verstehe ich gleich. Saras Zorn hat Hagar in die Wüste getrieben. »Wo ist Abrahams Kind?«, frage ich. Hagar streicht sich langsam über den Bauch. »Hier«, sagt sie. »Hier drin.« Und sie verrät mir ein Geheimnis. »Es ist mein Kind«, sagt sie. »Und: Es ist gesegnet.«
Segen, das ist eines der Worte, die ich Hagar nicht habe beibringen können. Obwohl ich mich sehr bemüht habe. Wieso weiß sie auf einmal, was das ist? »Ich bin Gott begegnet«, sagt Hagar. »Abrahams Gott?«, frage ich. »Abrahams Gott«, sagt sie, »ist nicht nur Abrahams Gott. Er ist auch mein Gott.«
Hagar erzählte, wie sie in der Wüste war.
Weit und breit Wüste. Steine und kein Brot. Sonne und kein Wasser. Sie sagt, sie wollte sterben. »Und dann habe ich etwas gehört«, sagt Hagar. »Gehört?«, frage ich. »Eine Frage habe ich gehört«, sagt Hagar: »Hagar, Mädchen: Wo kommst du her? Wo willst du hin?«2 Ich staune. Aber ich frage nicht nach. Ich will sie nicht unterbrechen. »Und Gott sprach: Geh zurück, Hagar, geh zurück zu Abraham und Sara. Deinem Kind darf nichts geschehen. Es wird ein starker Junge, Hagar, er wird der Vater eines wilden Volkes.«
Hagar packt mich an den Schultern. »Hast du gehört?«, fragt sie feurig. »Mein Kind! Gott hat gesagt: mein Kind!« Sie packt ihr Bündel aus, Farben, Kleider und alles. Ich sehe zu. »Hast du nicht gehört, was Sara gesagt hat?«, frage ich später. »Hast du keine Angst mehr vor Saras Zorn?«
Hagar sieht mich an, mit einem stillen Feuer in den Augen. »Es darf noch eine Weile dauern.« Ich schaudere. Ich sage, was Sara gesagt hat: »Gnade dir Gott!« Hagar lacht, aber es ist ein anderes Lachen als sonst. »Gott gibt mir Gnade!«, sagt sie. »Gott ist ein Gott, der mich sieht.«3
Zur Zeit der Lämmer gebar Hagar Ismael.
Und sie lag in Saras Armen, als das Kind aus ihr herauskam, und Sara hielt es in den Armen, als es seinen ersten Schrei tat. Ich stand dabei. Ich hatte geholfen. Hagars Augen waren geschlossen. Aber ich wusste, dass sie wach war. Als Sara sagte: »Mein Kind«, da hat Hagar ihr insgeheim widersprochen. Und ich bin zu Abraham gegangen und habe gesagt: »Herr, Hagars Kind ist geboren.«
Abraham nannte das Kind Ismael. Und Sara gab es Hagar zum Stillen. Und während Sara mit erhobenem Haupt und geröteten Wangen umherging und Glückwünsche entgegennahm von den Nachbarn, saß Hagar bei mir und hielt ihr Kind im Arm. Und sah es an und sagte: »Gott ist ein Gott, der mich sieht.«
»Glaubst du an unseren Gott?«, frage ich. »Was ist Glauben?«, entgegnet Hagar. »Glauben ist Hoffen, was man nicht sieht«, sage ich. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Es ist mir einfach eingefallen. »Sieh doch«, sagt Hagar: »Sieh dieses Kind!«
Dreizehn Jahre vergingen, da feierte Abraham ein blutiges Fest.
Es gab einen Brauch zwischen uns und den Nachbarn, um Frieden zu schließen. Einen Bund schneiden, hieß das und man zerschnitt gemeinsam ein Opfertier und teilte das Fleisch.
Und Hagar kommt zu mir, Feuer und Flamme. »Unser Gott hat mit Abraham gesprochen«, sagt sie. Sie sagt: unser Gott. »Gott will mit uns einen Bund schneiden!« Und sie sagt, dass alle Männer und Jungen ein Zeichen bekommen, ein Zeichen des Bundes.
»Was ist es?«, frage ich. »Ein Stück von der Vorhaut«, sagt sie. »Ein Stück wird abgeschnitten, bei allen Männern und Jungen.« Sie atmet schnell. Sie sieht Ismael nach, der gerade ein paar junge Ziegen vorbeitreibt. »Auch bei meinem Sohn«, sagt sie. »Ja, bei meinem Sohn zuerst!« »Wird es nicht wehtun?«, frage ich. »Es darf ein wenig wehtun«, sagt sie. »Weil es wichtig ist.«
Es tat mehr als nur ein wenig weh. Die kleineren Jungen schrien vor Schmerz. Ismael ertrug es tapfer. Aber dann war er drei Tage krank, wie auch Abraham, sein Vater. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich froh, dass ich ein Mädchen bin.
Als Abraham hundert Jahre alt war,
wurde Saras große Hoffnung wahr, die Hoffnung, die wir geglaubt hatten: Sara gebar Isaak. Sie war nun, wie sie dachte, eine gute Frau. Ich half ihr. Und dann ging ich zu Abraham und sagte: »Herr, Sara hat dein Kind geboren.«
Und Sara gab es mir zum Stillen. (Denn ich hatte gerade ein Kind verloren; aber das ist keine Geschichte, die erzählt wird.) Und während Sara mit erhobenem Haupt und geröteten Wangen umherging, Glückwünsche entgegennahm von den Nachbarn und sagte: »Gott hat mein Flehen erhört«, saß ich mit dem Kind im Arm. Und Hagar saß neben mir und jammerte.
»Was soll nun werden?«, fragt sie mich. »Was soll aus Ismael werden?« Ich verstehe sie nicht. »Ismael ist Abrahams Sohn. Isaak auch. Hagar, sie sind Brüder!« Und Hagar sieht mich an und sagt zu mir, was sie lange nicht mehr gesagt hat: »Du – Schaf.«
Was Hagar Sorge machte, sah ich bald danach.
Es war am Abend nach Isaaks Beschneidung. Es gehörte zu meinen Aufgaben, Isaak am Nachmittag zu Sara zu bringen und ihn wieder abzuholen, wenn es Zeit zum Schlafen war. Isaak wachte nachts oft auf und schlief nur wieder ein, wenn ich ihn stillte.
Isaak liegt allein auf Saras Lager. Er strampelt und lacht mich an. Hinter der Zeltwand höre ich Stimmen, Saras und Abrahams. Ich nehme Isaak hoch. Ich kann nicht verhindern, dass ich höre, was Sara sagt. »Abraham«, sagt sie. »Du musst Hagar und Ismael fortschicken. Du brauchst sie nicht mehr. Der Wille Gottes ist erfüllt. Du hast jetzt einen rechtmäßigen Erben.« Und ich höre, was Abraham antwortet: »Ismael ist mein Sohn.« Und Sara sagt: »Er ist eine Gefahr für Isaak.«
Ich nehme Isaak und gehe leise hinaus. Hagar liegt auf ihrem Lager und weint. Ich setze mich zu ihr und streiche über ihr Haar. »Sieh mal«, sage ich, als Isaak an meiner Brust liegt: »Sieh dieses Kind.« Hagar dreht sich um. Sie kommt hoch und schnaubt. »Ich weiß, wie Isaak aussieht«, sagt sie. »Das Kind, das meinem Kind gefährlich ist!«
»Das Kind, das dich befreit«, sage ich fest. Das ist mir eingefallen auf dem Weg. Hagar sieht mich an. »Befreit?«, fragt sie nach. »Befreit«, sage ich. Und ich erinnere sie an ihre Flucht in die Wüste. »Es darf eine Weile dauern«, erinnere ich sie. »Das hast du damals gesagt. Um deines Kindes willen musste es eine Weile dauern, bevor du fortgehst und frei bist. Jetzt aber ist Ismael erwachsen. Und Sara braucht dich nicht mehr. Jetzt ist es Zeit zu gehen.«
Staunend schaut sie mich an. »Gelobt sei Gott!«, ruft sie plötzlich. »Gott hält sein Wort: Ismael wird der Vater eines eigenen Volkes. Mein Kind, mein Kind Ismael!« Sie hat es besser verstanden als ich.
Diesmal ging Hagar endgültig fort.
Und ich wusste, es war gut, und dennoch war ich traurig. Unser Zelt war für drei und wir wohnten dort zu viert. Und dennoch hinterließ Hagar, die eine Weile unsere Erste gewesen war, eine große Lücke. Für mich füllte Isaak diese Lücke. Er war ein schönes, ein freundliches, ein sehr liebevolles Kind. Er hing an mir, als wäre ich … nein, das sage ich nicht. Das will ich nicht einmal denken.
Hagar hat mich nicht ohne Trost zurückgelassen. Am Morgen ging sie fort. Am Abend finde ich auf meinem Lager einen flachen Stein mit einer eingeritzten Hieroglyphe (Hagar hat mir erklärt und gezeigt, wie die Ägypter schreiben). Diese Hieroglyphe stellt ein Tier dar. Etwas wie einen Hund, aber schöner. Mit einem kleinen runden Kopf. Darunter steht in unserer Schrift: Du – Katze. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe einen Namen. Miw. Der ist ägyptisch. Und er bedeutet »Katze«.
Nachtrag (Genesis 22)
Später, viel später, geschah noch einmal etwas, das ich erzählen muss. Denn es betraf alle: Abraham und Gott, Sara und Isaak. Und mich, Miw, Isaaks Amme.
In manchen Kulturen ist es üblich, dass die Hausherrin ihr Baby anderen Frauen zum Stillen gibt. Diese werden »Ammen« genannt. Beim Stillen entsteht eine enge Beziehung. Mit »Amme« ist das Wort »Mama« verwandt.
Es ging Abraham nicht gut.
Seit Isaaks Geburt war er alt geworden, so wie er es nach Jahren ja auch war. Natürlich sagte mir niemand, was ihn quälte. Und ich wunderte mich. Ich dachte: So lange hat er auf Isaak gewartet, nun ist Isaak da. Warum ist Abraham nicht froh? Aber er war es, ganz sicher, auf seine stille Weise. Jedoch mehr, als er froh war, war Abraham besorgt.
»Er ist so klein«, höre ich Abraham einmal sagen. »Und ich bin alt. Wie soll ich ihn beschützen?« Er steht über Isaaks Lager gebeugt; ich bin gekommen, um das Kind zu holen. Ich hätte in aller Stille verschwinden können. Aber ich lege Abraham die Hand auf die Schulter – ich, Miw, ihm, meinem Herrn. »Du bist nicht allein«, sage ich. »Hat nicht dein Gott dein Kind gesegnet?« Abraham richtet sich auf und sieht mich an. »Wie heißt du?«, fragt er plötzlich. Ich sage es ihm. Abraham nickt. »Miw«, sagt er, »du hast recht.« Und dann segnet er mich.
Von Sara hörte ich, was die Nachbarn sagten. »Die Erstgeburt gehört den Göttern«, sagten sie. »So ist es Brauch in Kanaan, von Alters her.« Ich schaue Sara ungläubig an. »Was heißt das: Sie gehört den Göttern?«, frage ich. »So, wie man es sagt«, sagt Sara, und ihre Augen sind rot und in ihrer Stimme ist Zorn, »bedeutet es: Die Erstgeburt muss geopfert werden.« »Geopfert?«, frage ich dumm. »Verbrannt«, sagt Sara, »auf dem Altar der Götter.« »Unser Gott ist nicht wie jene Götter«, sage ich. »Sag das nicht mir, sag es Abraham«, sagt Sara. »Du weißt, wie er ist! Er will es seinem Gott immer recht machen. Um jeden Preis.«
Von da an zitterte ich.
Um jeden Preis. Diese Worte hatten sich in mir festgegraben. Ich hielt Isaak im Arm und zitterte. Ich zog ihn an und zitterte. Ich lehrte ihn laufen und sprechen und sogar Hieroglyphen malen – und zitterte. Und Abraham wurde älter und älter und seinerseits zitterig. Und wie er den Jungen anschaute, in scheinbar unbeobachteten Augenblicken – das jagte mir Schauer über den Rücken.
Und dann, als Isaak sein Reifefest feierte – und ich dachte an Ismael und sein Fest und an Hagar, die danach für immer fortgegangen war – da las ich es in Abrahams Blick: Es ist so weit. Abraham glaubt, was er gehört hat. Er hat den Glauben aufgegeben, die Hoffnung auf das, was man nicht sieht, und er wird eine Untat begehen und denken, es ist eine Tat.
Die Erstgeburt muss geopfert werden. Ein Satz wie Gift. Ein Satz wie der von Sara damals. Auf einmal habe ich Hagars Stimme im Ohr. »Unsinn. Das ist Unsinn.« Und meinen Rat, meinen unrechten Rat: Sag es nicht. Und da weiß ich: Diesmal muss ich es sagen.
Als Abraham Isaak nahm und sagte: »Wir wollen ein Opfer bringen«,
da ging ich den beiden nach. Und Sara sah, was ich tat, und nickte. »Geh mit Gott.« Sie gehen zum Berg Morija, Abraham und Isaak, sein Sohn (meiner!). Und ich gehe mit. Ich weiß, ich muss es Abraham sagen: Das ist Unsinn! Unsichtbar steht Hagar hinter mir und ruft es in mein Ohr. Aber noch zeige ich mich nicht. Noch wage ich es nicht.
»Es darf eine Weile dauern«, höre ich. Zuerst denke ich: Es ist die unsichtbare Hagar, die spricht, die in meinen Gedanken zu mir spricht. Aber die Worte hallen nach. Sie klingen nicht nach Hagar. Sie klingen, anders kann ich es nicht sagen: heilig.
Wir sind oben angekommen. Abraham und Isaak schichten Holz auf. Abraham sieht Isaak an. Ich sehe, er hält Lederriemen in den Händen. Gleich wird er Isaak fesseln. Es darf eine Weile dauern … »Nein!«, schreie ich stumm. »Mein Herr, mein Gott: Nein!«
Und ich höre: »Halt, Abraham, das ist Unsinn. Lege deine Hand nicht an den Jungen und tu ihm nichts. Ich weiß, dass du es Gott recht machen willst, um jeden Preis.« Ein Engel, denke ich. Anders kann es nicht sein.
Mir fehlen die Worte. Ich glaube, was ich endlich sehe: Unser Gott ist anders als die Götter. Abraham darf die Erstgeburt auslösen. Ich erinnere mich nicht genau. Aber mir war, als opferte er an Isaaks statt einen Widder …
Amen, so ist es. Und das schreibt
Miw
Geschichten aus der Zeit der Erzeltern: 2. Isaak und Rebekka (Genesis 24. 25–33)
Rebekkas erste Magd erzählt
Als Rebekka dreizehn Jahre alt war,
machte ihr Vater ihr mich zum Geschenk. Rebekka und ich waren aufgewachsen wie Schwestern. Meine Mutter war Rebekkas Amme. Rebekka war stärker als ich, wilder und neugieriger. Sie tat gern Dinge, die sie nicht sollte. Ich konnte sie nie daran hindern. Aber ich konnte die Schuld auf mich nehmen und die Folgen. Das war meine Aufgabe und sie war nicht immer leicht. Und doch hatte ich Rebekka gern. Und ich glaube, sie mich auch.
»Es wird sich nichts ändern zwischen uns«, sagt Rebekka zu mir am Ende des Festtages. Ich weiß nicht, ob das gut für mich ist. Sie denkt aber, es ist etwas Gutes. »Ja«, sage ich. Und dann zum ersten Mal: »Herrin«. Rebekka nickt. Sie wundert sich nicht.
Rebekka spricht ein Gebet vor unserem Hausaltar. Sie hat ihn mit Blumen geschmückt und verbrennt etwas Weihrauch. Die meisten ihrer Aufgaben als einzige Tochter in Betuels Haus überträgt sie mir; einzig die Sorge um den Hausgott nimmt sie so ernst, dass sie ihn niemals vergisst.
Ich lege ihr Nachthemd zurecht. »Nun werde ich bald heiraten«, sagt sie, als sie umgezogen ist. Sie sitzt auf ihrem Lager und umschlingt die Knie mit den Armen. Ich bin müde, aber offenbar will Rebekka mich noch nicht gehen lassen. »Drei haben heute um mich angehalten, sagt Amma«, erzählt sie. »Und sie hat mir die Namen verraten.« Sie flüstert mir die Namen ins Ohr, die Namen der Väter, die für ihre Söhne solche Verhandlungen führen.
Bei einem der Namen bekomme ich einen roten Kopf. Sein zweiter Sohn bringt mir seit einiger Zeit kleine Geschenke. Ich lächele ihn an und er lächelt zurück und dann träume ich nachts, dass ich bei ihm bin. Rebekka merkt nichts. »Ich sag dir was«, fährt sie fort. »Keiner von denen kommt in Frage. Wir sind viel reicher als sie. Und ihre Söhne sind Dummköpfe.« Ich bin wirklich sehr müde. »Das hast nicht du zu entscheiden«, sage ich. Ich denke, sie wird die Freude an dem Gespräch verlieren und mich endlich gehen lassen. Stattdessen fährt sie auf. »Wie sprichst du mit mir!«, ruft sie wütend. Ich senke den Blick. So viel zu den Worten, die sie gerade erst gesprochen hat: Es wird sich nichts ändern.
Und sie spricht weiter, als sei nichts geschehen. »Im Ernst«, sagt sie. »Ich heirate keinen, der mir nicht gefällt.« Ich weiß es besser. Die Ehen der Töchter sind Sache der Familien. Auch Rebekka wird das nicht ändern. »Er müsste anders sein«, sagt Rebekka träumerisch, »ganz anders als die Jungen aus der Nachbarschaft. Die sind so albern, so eingebildet!« Sie zieht die Nase kraus. »Er müsste klug sein, mindestens so klug wie ich. Stark und schlank und schön. Er müsste mich lieben. Von gleich zu gleich, verstehst du?«
Nein, das verstehe ich nicht. Und es ergibt überhaupt keinen Sinn. Von gleich zu gleich – was für ein Gedanke! Endlich merkt sie, wie still ich bin. »Schwesterchen«, sagt sie plötzlich. So hat sie mich immer genannt. »Sag mal – du bist mir aber nicht böse?« Lachend streckt sie die Hand nach mir aus. Und ich lasse mich ziehen.
Rebekka machte sich gern einen Spaß
mit den Jungen, die zum Brunnen kamen. Abends, wenn wir Mädchen Wasser schöpften für unsere Familien. Wir wussten, dass die Jungen kamen, um uns anzuschauen. Und hinterher sprachen sie über uns und welche sie gern küssen würden. Und mancher, heißt es, hat sich schon verliebt, vom Schauen am Brunnen.
Einer von ihnen hatte mich angeschaut. Er hatte etwas helleres Haar als die anderen, fast so wie ich, und so ein Lächeln … Er kam mir ein wenig verloren vor, so wie ich. Ein wenig traurig, ein wenig enttäuscht vom Leben, so wie ich. Und voller Hoffnung, auch wie ich. Joram, sein Name war Joram, und für mich klang er wie Musik in der Ferne.
Rebekka wusste nicht, wie ich zu Joram stand. Sie scherzte mal mit dem einen, bald mit dem anderen, und mit keinem von ihnen war es ihr ernst. Ich war mir aber sicher, dass sie alle in sie verliebt waren. Denn Rebekka war sehr hübsch und sehr fröhlich. Und ihr Vater war mächtig und reich.
Und dann, eines Abends, war da dieser Fremde.
Er war ein alter Mann, unfrei wie ich, das sah ich gleich. Von weither, mit Kamelen, die müde waren von einer langen Reise. Er saß am Brunnen und wartete. Seine Kamele standen noch unversorgt. Darum war ich gegen ihn, von Anfang an.
Als Rebekka und ich uns nähern – wir sind wieder einmal die Ersten, auf Rebekkas Betreiben –, da steht er auf und spricht Rebekka an. »Ich habe Durst«, sagt er. »Willst du für mich schöpfen?« Und Rebekka nimmt das Wasser, das ich gerade hochgezogen habe, und bietet es ihm an. »Und deine Kamele tränke ich auch, wenn du willst«, sagt sie. Denn gerade sind die Jungen erschienen, und ich weiß, es gefällt ihr, ihnen zu zeigen, dass sie bereits Gesellschaft hat, und besondere Gesellschaft zudem.
Der Fremde gerät fast außer sich vor Freude. »Das willst du tun?«, ruft er dreimal. »Wirklich? Mädchen, du bist allzu lieb! Gott möge es dir lohnen!« Rebekka nickt mir auffordernd zu. Ich bin nicht überrascht. Natürlich werde ich die Arbeit tun, während Rebekka lächelt und der Fremde sie preist. Während die Jungen herüberschauen und sie bewundern.
Als der Fremde und seine Kamele ihren Durst gestillt hatten,
packte der Fremde Geschenke aus: Armreifen, silberne und goldene, Tücher und Gürtel. »Für dich«, sagte er zu Rebekka. »Bitte, sag mir doch, wer dein Vater ist und ob es Platz in eurem Haus gibt für einen Fremden über Nacht.« Rebekka weiß, was sich gehört. Sie nimmt die Gaben nicht und sie antwortet nicht. »Lauf!«, sagt sie zu mir. »Sag meinem Vater, was hier geschieht, und hole meinen Bruder.«
Die Gesetze der Gastfreundschaft sind heilig. Nicht lange, da sitzen die Männer, Rebekkas Vater und ihr Bruder Laban und der Fremde, Elieser, bei uns im Haus am Tisch. Da höre ich zum ersten Mal von Kanaan, jenem Land der Verheißung, das einer aus der Familie gesucht hat: Abraham, der Onkel meines Herrn.
Abraham war eines Tages aufgebrochen, nach dem Ruf seines Gottes, wie er sagte, und die Familie hatte nie mehr von ihm gehört. Unversehens erfuhren wir nun von seinem Geschick. Abraham hatte Reichtum und Ansehen gewonnen in jenem Land der Verheißung. 137 Jahre alt war er inzwischen und gerade Witwer geworden, und sein Sohn und Erbe war im heiratsfähigen Alter. Da hatte Abraham sich seiner Wurzeln erinnert und Elieser gesandt, um für den Sohn ein Mädchen zu suchen, eine Verwandte.
»Isaak«, sagte Elieser. »Isaak bar-Abraham ist ein schöner Mann, stark und klug, von Gott gesegnet.« Ich habe gleich gewusst: Das wird Rebekka gefallen. Wenn man mich gefragt hätte: Mir gefiel diese ganze Geschichte genauso wenig, wie mir der Fremde gefiel, der seine Kamele unversorgt ließ.
Und während Rebekka im Hintergrund saß und doch an seinen Lippen hing, an jedem einzelnen Wort, das er sprach, erzählte er weiter von einer Wette, von einem Gottesurteil, das er ersonnen hatte, um das rechte Mädchen auszuwählen: Er habe am Brunnen gewartet und zu seinem Gott gesagt: »Wenn ein Mädchen kommt und ich es um Wasser bitte, und wenn es dann nicht nur mir zu trinken gibt, sondern auch den Kamelen – siehe, das soll das Zeichen sein. Dann ist diese die Rechte.«
In diesem Augenblick schauen alle auf Rebekka. Und Rebekka errötet und sagt: »Amen, so ist es geschehen.«
Danach ging alles sehr schnell.
Die Männer wurden sich noch vor dem Essen einig: Rebekka sollte Isaaks Frau werden. So war es der Wille des Gottes, der Abraham berufen und begleitet hatte. Ich dachte mir: Wenn es der Wille dieses Gottes ist, dass Rebekka diesen Isaak heiratet – warum konnte Abraham dann nicht einfach zu Hause bleiben, hier bei uns, wo es gut und bequem ist zu leben? Wo es Wasser gibt, in Hülle und Fülle, und Früchte und Blumen und fette Weiden? Und Joram!
Unbeachtet verlasse ich den Raum. Ich suche meine Mutter. Sie schläft. Ich lege mich zu ihr und lasse mich halten wie früher, als ich noch klein war, und höre sie murmeln: »Sternchen, alles geht seinen Gang.« Allzu bald erreicht mich Rebekkas Ruf. »Rasch, die Herrin: Sie braucht dich.« Rebekka ist in ihrem Zimmer. Aufgeregt geht sie hin und her. Nimmt Dinge aus den Truhen, lässt sie fallen. Sie ist barfuß, halb im Ausziehen. Die Armreifen des Fremden trägt sie am Arm.
»Siehst du!«, ruft sie mir zu, als ich eintrete. »Siehst du!« »Was?«, frage ich. »Was soll ich sehen!?« Rebekka bleibt stehen, ganz nahe vor mir bleibt sie stehen. »Ich habe selbst entschieden!«, sagt sie. »Du alte Eule! Sie haben mich gefragt.«
Ich erinnere mich, wie ich einmal in den Fluss gefallen bin. Wie das Wasser über mir zusammenschlug und ich nicht mehr wusste, wo oben war und wo unten. So fühle ich mich jetzt. Und ich weiß: Ich bin nicht gefallen. Ich werde gestoßen.
»Ich habe ja gesagt!« Rebekka strahlt. Sie breitet die Arme aus. »Sie haben gesagt, es darf noch eine Weile dauern. Ich habe gesagt: Je eher, desto besser.« Und sie beginnt und singt ein Liebeslied. Isaak, Isaak, Isaak … Ich gehe zum Altar und packe den Hausgott. Ich hebe ihn hoch und schleudere ihn in die Ecke. Ich fege die Blumen fort und trampele auf ihnen herum. Und laufe weg, bevor Rebekka sich auch nur rühren kann vor Schreck.
Diese Nacht verbringe ich mit Joram.
Und sage ihm erst hinterher, warum. »Wenn Rebekka fortgeht, muss ich mit«, sage ich. »Rebekka haben sie gefragt. Doch wer fragt mich?« Am Morgen bringt Joram mich zurück.
Er geht allein zu Rebekka. Er bleibt lange. Dann kommen sie beide zu mir. »Schwesterchen«, sagt Rebekka. Sie hat Tränen in den Augen. »Warum hast du nichts gesagt? Joram kann natürlich mit! Ich werde Vater bitten, mit Jorams Familie zu reden.«
Bevor ich weiß, wovon sie spricht, hat sie mich fest umarmt. Und Joram steht dabei und lächelt so, wie ich es liebe. Und ich versuche zu vergessen: Ich wurde wieder nicht gefragt.
Rebekkas Reise zu Isaak war lang und beschwerlich.
Die meiste Zeit waren wir in der Wüste. Wir hatten zu wenig Zelte für all die Leute, die mit uns zogen: Außer meiner Mutter und Joram und mir waren da noch weitere Mädchen und Frauen aus Betuels Haushalt. Und Wachen, die uns geleiten und dann zurückkehren sollten. Nach Hause.
Joram trieb eine kleine Herde vor uns her, Schafe und Ziegen und vier wunderschöne Eselinnen – Betuels Mitgift für Rebekka. Rebekka saß auf ihrem Kamel wie eine Königin auf ihrem Thron. Über die Blicke, die Joram ihr zuwarf, wenn er dachte, ich sehe es nicht, konnte ich mich nicht freuen.
»Sieh dich vor«, sagt meine Mutter. »Rebekka liebt dich. Aber du darfst sie nicht reizen.« Meine Mutter verträgt die Wüste schlechter als ich. Mir ist sie nur leid. Aber Mutter wird krank. Rebekka lässt Joram eine Sänfte bauen. Wir legen meine Mutter hinein und Betuels Wachen tragen sie.
»Warum macht Rebekka das?«, frage ich Mutter. »Rebekka war immer ein wildes Kind«, sagt Mutter. »Mit dem, was sie geschenkt bekommt, gibt sie sich nie zufrieden.« »Und ich?«, frage ich. »Sternchen«, sagt Mutter. »Du und ich – wir bekommen nichts geschenkt.«
Nach vierzig Tagen kamen wir an.
Im Land der Verheißung, Kanaan. Und ich wusste gleich: Zu Hause war es schöner. Rebekka aber strahlte. »Schau es dir an, Schwesterchen!«, rief sie übermütig. »Sieht es nicht aus wie der Ort deiner Träume?« Ich habe nie genug Zeit zum Träumen gehabt. »Zu Hause war es schöner«, sagte ich.
Ich sehe ihn eher als sie: Ein einzelner Mann kommt uns entgegen. Die Eselin, die er reitet, bockt und tritt. Er hat alle Hände zu tun, sie zu bändigen. Er hat feste Hände und er bleibt ruhig. Das gefällt mir. Andere würden längst schlagen. Rebekka wendet sich an den alten Knecht, der neben ihr reitet: »Wer ist das?«, fragt sie. »Das ist Isaak ben-Abraham«, sagt der Alte feierlich. Rebekka schlägt die Hand vor den Mund. Sie zieht ein Tuch über Haar und Gesicht. Ich sehe noch, wie ihre Augen blitzen.