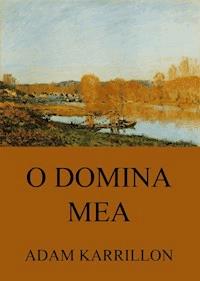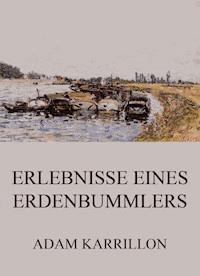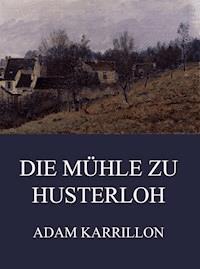
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im 1906 publizierten Roman Die Mühle von Husterloh wird der wirtschaftliche und soziale Abstieg der Familie Höhrle im abgelegenen Odenwald-Dorf Husterloh (= Wald-Michelbach) vor dem Hintergrund der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erzählt. Deren traditionelle Bachmühle ist gegenüber der Dampfmühle der Firma "Groß und Moos" im Ulfenbachtal nicht konkurrenzfähig und verliert zunehmend ihre Kundschaft. Andererseits beschleunigen die hohen Ansprüche der Müllersfrau und die Ausgaben für das Studium des Sohnes Hans, auf dessen Karriere als Pfarrer oder Arzt die Eltern hoffen, die Krise ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Mühle zu Husterloh
Adam Karrillon
Inhalt:
Adam Karrillon – Biografie und Bibliografie
Die Mühle zu Husterloh
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel.
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel.
19. Kapitel.
20. Kapitel.
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel.
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Die Mühle zu Husterloh, Adam Karillon
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849628895
www.jazzybee-verlag.de
Adam Karrillon – Biografie und Bibliografie
Deutscher Arzt und Schriftsteller, geboren am 12. Mai 1853 in Wald-Michelbach, verstorben am 16. September 1938 in Wiesbaden. Besuchte das Gymnasium in Mainz und studierte dort ab 1873 Medizin. Das Studium schloss er 1878 in Würzburg ab, es folgte 1879 die Promotion in Freiburg. K. begann als Arzt in seinem Geburtsort Wald-Michelbach zu wirken, von 1883 bis 1918 arbeitete er in Weinheim. Neben seinen Pflichten als Arzt reiste er sehr gerne und besuchte unter anderem die Schweiz, Italien, Griechenland, Dänemark, Norwegen, den Nahen Osten, Japan, China und Rußland. K. ist Träger des "Georg-Büchner-Preises", der für Verdienste um das künstlerische und geistige Leben in Hessen verliehen wird.
Wichtige Werke:
Eine moderne Kreuzfahrt (1898)Michael Hely (1900/1904)Die Mühle zu Husterloh (1906)domina mea (1908)Im Lande unserer Urenkel (1912)Adams Großvater (1917)Sechs Schwaben und ein halber (1919)Am Stammtisch zum faulen Hobel (1922)Erlebnisse eines Erdenbummlers (1923)Viljo Ronimus: Das Schicksal eines Kassenarztes (1925)Windschiefe Gestalten (1927)Meine Argonautenfahrt (1929)Es waren einmal drei Gesellen (1933)Der Rosenstock (1935)Die Mühle zu Husterloh
1. Kapitel
Hans Höhrle war in der Tat ein richtiges »Röhrle«. Denkt ihr, es wäre ihm eingefallen, auf die Welt zu kommen, als seine guten Eltern ihn mit Fug und Recht erwarten konnten? Kein Gedanke daran. Er schickte seine Schwester Suse voraus in den Kampf ums Dasein. Er selber blieb in der Reserve. Mochte Suse einstweilen wachsen und groß werden, damit sie ihn warten und pflegen könne, wenn es ihm gefällig wäre, sich in die Welt hineinzubemühen. Es verstrichen einige Jahre, ohne daß Hans Höhrle auch nur das geringste tat, um sich eine Existenz zu gründen. Schon in seiner Keimzelle lag ein bedauerlicher Beharrungstrieb. So überholte ihn auch seine Schwester Liese, und beide Mädchen waren schon ziemlich erwachsen, als der lang Erwartete endlich kam. Man badete ihn, was er geduldig hinnahm, setzte ihm eine feine Spitzenhaube mit rosa Schleifchen auf und legte ihn in einer blitzblanken Wiege unter eine Federwolke, die von rot und weiß gewürfeltem Barchent zusammengehalten war. Hans hielt die Augen geschlossen und schlief sorglos weiter, 2 als ob mit ihm gar kein Ortswechsel vorgegangen wäre und als ob er nicht die Verpflichtung hätte, seine neue Umgebung mit einem herablassenden Lächeln zu begrüßen. Sein Atem ging ruhig, nur zuweilen trat eine kleine weiße Blase zwischen seine Lippen und ruhte da auf rosigem Grunde wie eine Perle in der Muschel. Die ganze Familie war um das Bettchen versammelt, zwei zur Rechten, zwei zur Linken, Hans Höhrle in der Mitte.
Er war ein goldiger Junge, das fühlten alle, aber Suschen fand zuerst die Sprache. »Er ist zum Anbeißen,« sagte sie. Erschrocken fuhr Lieschen zusammen und beugte sich mit ihrem Oberkörper über den Schläfer, als ob sie ihn gegen das menschenfresserische Gelüste ihrer Schwester schützen müsse.
Der Vater Höhrle hatte sich endlich satt gesehen. Er drehte sich um, aber seine Gedanken weilten doch bei dem Kinde. Seine Blicke schweiften durch das Fenster. Vor dem Hause schäumte von den Mühlenrädern nieder sein bester Knecht, der forellenreiche Olfenbach. An dessen Ufern hin streckte sich die Nährmutter seines Viehes, die saftgrüne Wiese. Drüben auf dem ansteigenden Pfade, der sich in den Tannenwald verkroch, ging bedächtig ein Trupp schwerbeladener Esel, die das Mehl nach den Bäuernhöfen trugen und das Korn wieder nach der Mühle zurückbrachten. Lustig und taktfest klapperten die Stühle, und wenn der Korntrichter leer war, so schellten sie den Mahlknecht herbei, als ob sie nun einmal ohne Arbeit nicht leben könnten. Allerlei Reichtum war in der Mühle, 3 nur Pferde gab es nicht. »Pferdverrecken das sind Schrecken« war ein Sprichwort, nach dem der Bauer in damaliger Zeit seinen Betrieb einrichtete, und schließlich hatte man ja die Kraft der bedächtigen Ochsen, um ganze Berge von Erntesegen heimzufahren, wenn auch langsam.
Wie war das Glück des Hauses Höhrle so wohlgefügt, so reich, auf so breiter Basis, als ob es die Jahrhunderte überdauern sollte. Speicher und Keller des weit ausladenden Hauses waren wohlgefüllt. Auf Stunden im Umkreis war kein Hof, der sich mit der Mühle von Husterloh messen konnte. Alle Tage überschaute der Müller sein Glück, heute aber fühlte er es, heute, wo der Erbe geboren war seines Namens und seiner Habe. Er wußte jetzt, für wen die Kühe kalbten, für wen der Tannenwald die hellgrünen zarten Sprößlinge trieb. Auf ein weiteres Menschenleben hinaus sah er den Bestand der Dinge gesichert. Ihm war so warm ums Herz, und so schweigsam und verschlossen er sonst auch war, heute mußte er reden. Er schickte die beiden rosenschönen Töchter an irgend eine Arbeit, klopfte sich mit der Hand den Mehlstaub aus den Hosen und setzte sich vorsichtig auf den Rand des breiten Bettes, in dem die Wöchnerin lag. Er war nicht mehr ganz jung. Seine glatt rasierten Backen hingen schon wie müde Flügel eines Zugvogels nieder, und wenn er sprach, so tanzte ein langer Zahn verwegen zwischen seinen Lippen. Er hatte ein demütiges subalternes Gesicht und stach ab gegen die energievolle Erscheinung seiner Frau, deren runde Formen die Bettdecke lüpften und auf deren 4 drallen Backen man wohl eine Erbse zerdrücken konnte. Wer die beiden so nebeneinander sah, konnte leicht erraten, wer der Herr im Hause sei.
Vater Höhrle nahm die Hand der Entbundenen und sah ihr mit den demütigen Augen in das breite Antlitz, das auch durch das Weh des Geburtsaktes nichts von seiner Energie verloren hatte. »Mutter«, begann er weitausholend, »sieh doch, was der Junge für kräftige Fäuste hat.«
»Was willst du damit sagen«, entgegnete die Angeredete, und ihr Blick nahm dabei etwas Lauerndes an, wie das Auge eines Fechters, der den Hieb erwartet und ihn mit dem Hiebe zu parieren gedenkt.
»Nun doch,« fuhr er ruhig fort, »das Haus braucht auch einmal eine kräftigere Faust, als die meinige ist, und der Pflug und die Egge wollen geführt sein.«
»Ah,« platzte sie höhnisch heraus, »denkst du, mein Kind soll hinter den Riegelwänden deiner Bude wie die Schwänze deiner Kühe hin- und herpendeln. Daraus wird nichts!«
»Willst du das Kind hinaustreiben und in der Ferne finden lassen, was es hier ungesucht haben kann?«
»Soll er sich zu einem Gerippe herunterrackern wie du,« schrie sie zornig, »daraus wird nichts. Der Junge studiert und wird ein hochwürdiger Herr, und wenn er's nicht zum Bischof bringt, ein Pfarrer wird er jedenfalls.«
»Rege dich nicht auf,« so suchte Vater Höhrle einzulenken.
5»Du regst mich auf,« warf sie dazwischen. »Du willst nichts an das Kind hängen. Du brauchst es auch nicht. Denkst du, ich hätte umsonst seit Jahren die Milch gewässert; und dann das Geld, das ich in die Ehe gebracht habe. War die Tochter aus dem Hause Schütteldich eines Bettelmannes Kind?«
In diesem Augenblick ging die Tür auf, und Röse Ricke, die Hebamme, trat aus der Küche, wo sie ein wenig gelauert hatte, ins Zimmer. Sie kannte also den Gegenstand der Familienkontroverse, schob ihre Brille auf die Stirne und hauchte das hadernde Paar ungefähr folgendermaßen an:
»Seid ihr verrückt, ihr Narren? Die Frage ist doch noch gar nicht prinzipiell« – Gott weiß, woher sie das Fremdwort hatte, aber sie hatte es nun einmal und schoß damit bei jeder Gelegenheit gefährlich um sich – »wartet's ab, bis der Junge prinzipiell hinter den Ohren trocken ist. Bis dahin kann noch viel passieren. Es kann ein Erdbeben euer Haus verschlingen. Eine Sintflut kann es in den Neckar schwemmen. Und dann, muß denn jeder etwas werden? Seht, da ist sein Onkel Schütteldich. Bis dato hat er drei Ledersofas zu Schanden gesessen und am vierten hobelt er zur Stunde mit der Kehrseite. Der Junge wird einst der Erbe seines Reichtums sein und dessen, was ihr zusammengeschrappt. Wozu braucht er einmal anderen Leuten die Arbeit wegzustehlen? Ich an seiner Stelle würde mich an jedem Quatemberfasttage einmal waschen und damit paßta!«
6Vater Höhrle, der wohl ahnte, daß nun das Wasser zweier Beredsamkeitskatarakte ineinander plätschern würde, erhob sich, schlug mit seinem Stulpkäppchen einen Haufen Mücken tot, der auf der Tischplatte an einem Tropfen Milch kneipte, und ging nach seiner Mühle.
Jetzt belebte sich die Stube und füllte sich wie ein Jahrmarkt. Nachbarsweiber kamen und brachten in unterschiedlichen Geschirren eine mehr oder minder kräftig ausgefallene Weinsauce, an der die Wöchnerin sich erlaben und stärken sollte. Röse Ricke dirigierte eine Anzahl dieser Töpfe zwischen die Blumenscherben des Fensterbrettes, setzte sich daneben und fing an einzunehmen wie eine Sekundärbahnlokomotive. So kam's, daß sie bereits einen kleinen Affen hatte, als der Doktor ins Zimmer trat. Wäre der Mann eigentlich nötig gewesen? O nein, aber Mutter Höhrle hatte nun einmal einen Stich ins Großartige; sie liebte das Außergewöhnliche, weil sie sich dadurch abheben wollte von der Masse und vor allem von denen, die es weniger machen konnten als sie selber.
Der gute, dicke Herr balancierte den Sprößling des Hauses Höhrle auf seiner breiten Hand wie auf einem Nudelbrett, horchte an ihm herum, betrachtete ihn durch seine Brillengläser, und es fehlte nicht viel und er hätte an ihm wie an einem Handschuh die Innenseite nach außen gekehrt. Endlich legte er ihn auf den Tisch mit den Worten: »So einer wird nicht alle Tage geboren. Glücklich der Mann, der zwischen Martini und Fastnacht ein 7 Spanferkel von seinem Gewichte auf dem Tische hat.« Die ganze Korona war hochbefriedigt von dem günstigen Urteil dieses Sachverständigen. Suse und Liese waren froh, daß ihr guter Bruder aus den Bärentatzen des Übermenschen heil und ganz herausgekommen war. Sie machten sich über den Buben her und stritten sich, wer ihn unter Singsang durchs Zimmer tragen dürfe.
So war alles in bester Ordnung, und der Arzt hätte seine zwei Zentner Doktorfleisch dem mageren Klepper, der vor der Türe wartete, wieder überantworten können, wenn nicht Röse Ricke wie ein Wegelagerer aus dem Hinterhalt hervorgebrochen wäre. Sie hatte ihre Brille zwischen linkem Daumen und Zeigefinger geklemmt, stemmte, um durch ihre Fläche zu imponieren, die Hände in die Seite und überraschte den Arzt mit der erstaunlichen Frage: »Haben Sie auch gesehen, daß die Haut prinzipiell gerötet ist?«
»Sie haben das Kind gebadet,« entgegnete der Angeredete trocken, »und wohl etwas zu heiß. Die Röte kommt von der Wärme,« damit verneigte er sich gegen die Versammlung, bedeckte den Kahlhieb seines Schädels mit einem emeritierten Zylinder und verschwand mit geringschätzigem Lächeln.
Röse Ricke versank darob einen Moment in verärgerte Beschämung, aber sie erholte sich rasch und verkündete der erlauchten Versammlung: »Wenn die prinzipielle Röte von den Wörm kommt, so weiß ich Rat. Habt ihr Wurmsamen im Haus?«
Man suchte danach. Die weise Frau vermengte ihn sorgfältig mit Latwerg und stopfte das Gemenge dem 8 Kleinen mit rücksichtsloser Gründlichkeit in den Mund. Dabei nahm jedoch nicht alles den richtigen Kurs. Einiges geriet auf ein totes Geleise und blieb auf den Backen hängen, und so kam's, daß Hans Höhrle eine Stunde nach seiner Geburt aussah wie ein Schnautzer, der vom Mäusegraben kommt. 9
2. Kapitel
Während der nun zunächst folgenden Jahre erstrahlte scheinbar der Himmel des Höhrleschen Glückes in lachender, wolkenloser Bläue. Der Wald gab sein Holz, das Feld die glänzende Ähre, die Kühe die Milch. Mit Bienenfleiß gingen die Esel aus und ein, die Mühle prägte Geld, von den Hühnern fielen die Eier, von den Bäumen die Äpfel, und es fehlte wenig und selbst der Sägebock auf dem Speicher hätte angefangen zu kälbern. Die Mutter Höhrle baute sich nach der Peripherie aus und glich einer Melone, Suse und Liese zweien Pfirsichen, die zu reifen beginnen. Hans Höhrle hatte den Mund voller Zähne bekommen, die etwas weit auseinanderstanden, woraus Röse Ricke den Schluß zog, daß er prinzipiell weit in der Welt herumkommen würde. Das einzige, was man zu beklagen hatte, war der Verlust des tanzenden Zahnes zwischen den Lippen des Vaters Höhrle. Hatte der Müller vorher das Aussehen eines Pfarramtskandidaten, der mit dreißig Kreuzern Tagesgehalt auskommen muß, so glich er jetzt, wo seine Lippen sich etwas nach innen umkrempelten, mehr und mehr einem gutmütigen Großmütterlein.
10Allein über die versöhnliche Abendstimmung, die auf diesem alternden Antlitz thronte, zog zuweilen wie Höhenrauch ein Schatten von Sorge. Vater Höhrle, und zwar er allein, sah am äußersten Rande seines Besitzstandes ein Wölkchen sich entwickeln und rasch sich zu Klumpen ballen, und er fürchtete, daß aus diesem jetzt noch so schattenhaften Luftgebilde ein Hagelschauer niederprasseln möchte, der sein Glück vernichten könnte.
Weiter unten im Tal, dort wo der Bach kurz vor seiner Mündung in den Fluß noch einmal wie ein zorniger Truthahn seine Federn sträubt und fauchend sich über Felsstücke stürzt, dort im Wiesengrunde fing man an ein Fundament zu graben. Es war die Firma Groß und Moos, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftpflicht und unbeschränkter Rücksichtslosigkeit. Bauern, die des Abends in der Mühlstube zu schlafen pflegten und warteten, bis der Mahlgang das als Mehl ausspie, was sie dem Trichter als Korn anvertraut hatten, erzählten umständlich, was man da unten plante. So erfuhr der alte Höhrle die schier unglaubliche Mär, daß man statt des Wassers den Dampf einspannen wolle, die Mühlräder zu treiben. Er konnte es nicht glauben; aber er mißtraute gleichwohl den Veranstaltungen da drunten und den hohen Mauern, die, wie von Geisterhänden gebaut, rasch aus der Erde wuchsen und einen Schornstein wie einen drohenden Finger in die Luft reckten, der ungefähr sagen sollte: »Nehmt euch in acht, es kommt rascher als ihr denkt!« Höhrle verstand und fürchtete die Drohung. Der unheimliche 11 Backsteinkoloß da unten hielt ihn fest in seinem Banne, ja lähmte ihn fast wie das Auge der Kreuzotter den Zaunkönig.
Manchmal schon, wenn sich der Abend niedersenkte, war er auf Waldwegen talab gegangen. Er sah, wie sich der Sonnenball in hunderten von Scheiben spiegelte, das fand er erklärlich; aber er wollte fast vor Schreck in die Erde sinken, als das steinerne Ungetüm im Dämmerlicht wie auf einen Zauberschlag von innen heraus zu glühen begann. Was war das? Hatte die Firma Groß und Moos die Sonne gepachtet und hing sie in ihrer Mühle aus, wenn sie den übrigen Sterblichen unterging? Der Bachmüller stand wie angewurzelt in den Haselnußstauden verborgen. Es fror ihn von innen heraus, und als er seine Beine gebrauchen wollte, um nach Hause zu gehen, war es ihm, als ob er sie aus steifem Schusterkleister herausziehen müsse. Auch folgten sie nicht seinem Willen. Sie trugen ihn hin, wohin er nicht wollte. Sie gingen im Dunkeln den moosigen Hang hinunter ins feuchte Gras des Wiesentales, überschritten den Bach, seither seinen Bach, und Höhrle stand nun vor den drahtübersponnenen Fenstern der Maschinenhalle. Aus einer offenen Feuerung schlug ihm die rote Glut eines ganzen Fegefeuers in die Augen. Alles, was diesen Flammenball allenfalls umgeben mochte, gewahrte er nicht. Wer in die Sonne schaut, übersieht die Fliegen. Die Helle nahm des Mannes ganzen Sinn gefangen. Da hörte er, wie eine schwere eiserne Tür mit dem exakten Geräusche eines Pistolenschusses ins Schloß fuhr, und nun mit einem Male kamen in dem hohen 12 weißgetünchten Raume seltsame Dinge zum Vorschein. Ein schwarzer unheimlich auf dem Bauche kriechender Riesenleib hob silberhell glänzende, gigantische Glieder, ließ sie sausend niederfallen, um sie, in tausend Gelenke gebrochen, blitzschnell wieder zu heben. Räder schnurrten scheinbar frei im Raume schwebend mit pfeifendem Zischen durch die Luft; Taue und Riemen drehten sich um unsichtbare Wellen und geigten scheinbar zwecklos in der Luft wie Libellen über einem Sumpf. Bei all dem Lärm und all dem Schnauben mußte das eiserne Ungeheuer doch nicht allzu gefährlich sein; denn Höhrle sah Menschen da drinnen herumlaufen, leibhaftige Menschen mit blauen, ölfleckenglänzenden Hosen, die friedlich aus kurzen Pfeifen rauchten. Einer der rußgeschwärzten Gesellen riß mit einem eisernen Haken die Tür der Feuerung auf, und Höhrle sah wiederum in die brodelnde, funkensprühende Glut. Wiederum versanken alle Gegenstände wie in der Helle eines Weltbrandes. Aber da kam vom Boden aus, langsam sich hebend, eine Schaufel mit einer unförmlich schwarzen Masse mitten in die leuchtende Scheibe. Ein kurzer Ruck, und der rätselhafte Stoff fuhr mit Funkengeknister in den feurig flüssigen Brei. Der Vorgang wiederholte sich ein paarmal, dann fuhr die schwere Eisentür in ihr Schloß und alles im Raum nahm wieder die Gestalt und Form an, die es vorher hatte. Höhrle dachte nach und fand heraus, daß die schwarze Masse die Steinkohle sein könne, von der er irgendwo gelesen hatte, daß sie berufen sei, die Welt umzuformen. Ein Gruseln überkam ihn vor diesem 13 unheimlichen Wechselbalg, der dem Schoß der Erde entsprungen war, um der Mutter Antlitz zu zerkratzen. Was konnte noch alles kommen! Vater Höhrle suchte Hilfe bei Gott und erhob das Auge zum Sternendom. Aber was fand er da? Oben in der klaren stahlblauen Nachtlust da stand wohl einen Kilometer lang und länger ein schwarzes Ungetüm, das den Mond verdeckte und wie in Schmerzen sich krümmend den klumpigen Schlangenleib wandte. Der erschreckte Mann sah genauer hin und entdeckte, daß der schwarze Wurm, der seinem Auge den Blick zum Himmel verlegte und das Tal mit einem stinkenden Brodem füllte, aus dem Riesenschornstein geboren wurde, den Menschenhand aus kleinen Backsteinen zusammengesetzt hatte. Da zum ersten Male verlor er den Respekt vor der Allmacht Gottes, der sich seinen Himmel wie einen Schinken räuchern ließ, und er fing an zu glauben an die Macht der Kohle und des Goldes. Ihn fror. Er bohrte die Fäuste tief in die Taschen seines Rockes, schlug die Absätze in den Straßenkot und senkte den müden Blick dem Boden zu, das Herz so schwer, das Herz so bang. Aber was gewahrte er da? Wie ein Notenblatt sah die Straße aus mit ihren in steifem Kote stehenden Wagenspuren. Das war ja die reine Verkehrsstatistik der Firma Groß und Moos. Was wollten ihr gegenüber die paar Hufspuren der Esel besagen, die hier und da wie Notenköpfe eingezeichnet waren. Höhrle versuchte mit geschlossenen Lidern weiterzulaufen. Doch ihn zwang die Angst, zuweilen sich umzusehen.
14Ihm war, als ob der schwarze Wurm da oben in den Lüften ihm nachkriechen und nach ihm schnappen könne, und er nahm mit Eifer den Weg zwischen die Beine.
Als er aber in den Wiesenpfad nach seiner Mühle einschwenkte, wurde er ruhiger. Das schier melodische Klappern, das nun an sein Ohr drang, und der Schimmer des Öllampenlichtes zwischen dem Blattwerk des Erlengebüsches senkten ihren Frieden in sein Herz und gaben ihm wieder Sicherheit. Ohne eines von den Seinen aufzusuchen, ging er in sein Bett. Doch schlafen konnte er nicht. Er zog sich an, stieg die Treppe hinunter, und trat zu ebener Erde in den Raum ein, wo die Bauernkundschaft schlief oder Karten spielte, um sich die Zeit zu vertreiben. Von dem mehlbestaubten Balkenwerke der Decke pendelte die Laterne nieder und warf wandernde Lichter auf ein halbes Dutzend kräftiger Gestalten, die auf Spreusäcken am Boden lagen oder saßen.
»Grüß Gott«, rief Vater Höhrle zwischen das Geklapper der Mahlstühle hinein.
»Grüß Gott,« tönte es vielstimmig zurück, und eine Anzahl Männer richtete die Köpfe in die Höhe, zum Zeichen, daß sie geneigt seien, sich in eine Unterhaltung einzulassen.
»Woher zu dieser Stunde, Vater Höhrle?« rief eine Stimme aus dem Hintergrund. »Habt Ihr Euch beim Kartenspiel verspätet?«
»Das nicht, ich war im unteren Tale.«
»Und habt die Mühle von Groß und Moos 15 angesehen? Ich denke, Ihr besinnt Euch und verkauft beizeiten Eure Spreusäcke, Vater Höhrle, denn in ein paar Jahren liegt Euch hier kein Bauer mehr herum!«
»Und versäumt seine Zeit,« rief eine boshafte Stimme. »Wer drunten Korn ablädt, braucht nur den Wagen zu wenden, und er kann mit seinem Mehle wieder von dannen fahren.«
»Nehmt Euch in acht, Müller,« sagte ein anderer beißend, »als der Dampf sich vor die Wagen spannte, wurden die Fuhrleute gerädert, wenn er die Steine dreht, so zerquetscht er die Müller.«
»Man schneidet keinem die Haare, der nicht still hält,« sagte Höhrle und suchte einen zuversichtlichen Ton in seine Worte zu legen, aber es gelang ihm nicht, zumal da es ihm den Eindruck machte, als ob er zur Stunde schon einige Spreusäcke entbehrlich hätte. Er ging in seine Kammer; aber der Gott des Schlafes kam jetzt erst recht nicht, obwohl nickende Mohnköpfe, zu Bündeln geknüpft, vom Durchzug des Zimmers herniederhingen. 16
3. Kapitel
Früh am nächsten Morgen erhob sich Vater Höhrle. Wer mochte auch auf einem Lager bleiben, auf dem die Sorge das Leintuch in tausend scharfe Fältchen zerknüllt hatte? Es war ein Sonntag, und der Kuhbub hatte heute seinen Kirchgang. So ging denn der Hausherr hinter den Rindern her, die in gemächlichem Wiegen das Dorf durchschritten, zuweilen auch ein wenig stehen blieben und die Häuser betrachteten, die sie wohl alle kannten, die aber heute in ihrer sonntäglichen Sauberkeit einen kuriosen Eindruck machten. Sie kamen an einen steilen Pfad, der die Berglehne hinaufführte, und bogen in diesen ein, ohne daß ihnen irgend jemand einen Wink gegeben hätte. Sie kannten sich aus in der Gemarkung, und Vater Höhrle konnte unbesorgt hinterhergehend seinen Gedanken nachhängen. Als sie an einen geschorenen, aber wieder frisch treibenden Kleeacker kamen, fingen sie an zu fressen, und ihr Hüter konnte sich die Sache noch bequemer machen. Er setzte sich auf eine kleine Böschung, die das Feld vom Walde schied, und hatte hinter sich die schwarzgrünen Nadeln eines Tannenwaldes und vor sich das hellgrüne 17 Wiesental mit seinen zerstreuten Bauernhöfen, seinem strudelnden Bache, seinem weißglänzenden schäumenden Wehr und über dem ganzen mildstrahlend die Morgensonne des Frühherbstes. Gewiß dies alles waren dem Vater Höhrle bekannte Dinge, und doch betrachtete er alle wieder mit stillem Wohlgefallen. Nur nach einer Seite hin konnte er nicht blicken, das Tal abwärts, dorthin wo gestern das schmutzige, schwarzgraue Ungetüm in den Lüften hing, wo die Dampfmühle stand, der er so sehr mißtraute. Und doch war kein Gedanke daran, daß er von dem Punkte aus, wo er sich befand, den Backsteinkoloß hätte sehen können; das Tal war viel zu gewunden. Aber einerlei, er mochte nicht einmal nach der Himmelsrichtung schauen. Er ahnte, von dort heraus, von dem Schienenstrang der Eisenbahn aus, der sich durchs Neckartal wie eine falsche Schlange wand, kam die neue Zeit mit ihren Tücken und ihrer Grausamkeit, ihrer Großmannssucht, ihrem Geldhunger, deren Opfer er werden sollte.
Das Tal herunter wälzte sich jetzt in getragenen Wellen der Klang der Kirchenglocken. Vater Höhrle war ein frommer Mann und ging gern zur Kirche, aber heute war doch der Kühbub an der Reihe, also mußte der Bauer seinen Gottesdienst im Freien halten. So faltete er die Hände über seinem Stocke und betete ein Gebet, das er selber verfaßt hatte und das also lautete:
»Lieber Gott erhalte, was du mir gegeben hast. Laß mich deine Scholle bebauen, so lange ich lebe, und laß sie mein Bett werden, wenn ich gestorben bin. So viel 18 erflehe ich für mich und mehr auch nicht für meine Kinder. Meinem Weibe aber gib einen friedfertigen demütigen Sinn, damit sie nicht nach Dingen strebe, die dem Bauer nicht erreichbar sind.«
Es war nicht viel, was der Landmann da erbat, und wenn der Himmel nicht geizig war, konnte er's gewähren. Aber er tat's nicht.
Eben war Vater Höhrle fertig mit seiner Andacht und setzte sein Stulpkäppchen wieder auf, als der Viertakt eines Zweigespannes auf der Straße unter ihm erklang. Höhrle schaute hinunter. Was war das? Auf dem Rücken zweier mutwilliger Goldfüchse spiegelte sich die Morgensonne und dahinterher rollten fast lautlos die schwellenden Lederpolster eines Wagens, für einen König, der zur Krönung fährt, eben gut genug, und doch saßen nur zwei Bürgerfrauen darin. Der Bauer brauchte einige Augenblicke, um die Erscheinung zu deuten. Da schneidet ihm wie ein Peitschenhieb ein widerwärtiger Gedanke durch das Gehirn: Das ist die Firma Groß und Moos, das sind die Damen mit der beschränkten Haftpflicht. – Jetzt war's vorbei mit dem Sonntagsgottesfrieden, vorbei mit seiner Ruhe und seiner Andacht. Er verließ das freie Feld und vergrub seine Aufregung und seine Angst im Waldesdunkel. Nur zuweilen schielte er wie ein verscheuchter Räuber unter den Tannenzweigen hervor, und als er nach Stunden der Zurückgezogenheit sah, daß seine Rinder die Nasen häufig in die Luft streckten und nur lässig fraßen, trieb er sie auf einsamen Pfaden ins Dorf den Ställen zu.
19Als Vater Höhrle gegen Mittag sich seiner Mühle näherte, gewahrte er, wie ein Bündel Unterröcke voller Grazie um die Hausecke flog. Obwohl er nicht sehen konnte, wer in den Röcken steckte, so wußte er doch, daß dies der Kometschweif von Röse Ricke sei und daß der dazugehörige Stern sich nun die Treppe zum zweiten Stock hinaufschob, um oben irgend ein Unheil zu verkünden. Er hatte keine Eile zu erfahren, was vorging. Er begab sich in den Stall und legte gemächlich eine Kuh nach der andern an die Kette.
»Vater Höhrle, Vater Höhrle, hört Ihr denn nicht, Vater Höhrle?« so rief mit einem Male Röse Ricke die Treppe herunter, »die Hausherrin wünscht, daß Ihr zur Stelle sein sollt, und ich denke Ihr werdet erscheinen!«
»Gewiß werde ich das,« gab der Müller zur Antwort und beeilte sich, die ausgetretenen Stufen zu ersteigen. Vor der Stubentür ordnete er erst in etwas seine Kleider und trat in demütiger Haltung ins Zimmer. Als er in das Antlitz seiner Frau sah, fuhr er ängstlich zusammen, denn obgleich der Kopf nicht die Hörner von Michelangelos Moses trug, lag doch die ganze eiserne Härte eines unerbittlichen Gesetzgebers in seinem Ausdruck.
»Hab ich dir's nicht immer gesagt,« polterte die Müllerin los, »so kann's nicht weiter gehen. Hast du dich je bemüht, deine Familie auf das Niveau hinaufzuheben, wohin sie gehört? Wer spielt nun im Tale die erste Geige? Groß und Moos. Wer fährt auf Gummirädern und hat seidene Schleier vorm Gesicht? Die Damen Groß und Moos. 20 Wer hat in der Kirche einen eigenen Stuhl und läßt niemand anders mehr hinein? Groß und Moos. Und wer muß sich die Beine in den Leib stehen, solange die Predigt währt und die Messe? Die Kinder des Hauses Höhrle. Wer kommt daher wie eine Kuhmagd, hat nichts aufzusetzen und nichts anzuziehen? Die Frau vom Hause Höhrle.«
In dem Augenblick, wo sie sich so ganz erbärmlich nackt und bloß der Welt zeigen mußte, übermannte sie das Mitleid mit sich selber. Sie fing heftig zu weinen an und hob die Schürze nach den Augen, woraus der Leser sehen mag, daß sie allzudick auftrug, und daß sie immerhin noch etwas mehr am Leibe hatte, als unsere ehrsame Stammutter Eva nach dem Sündenfall.
Zunächst hörte man freilich nichts weiter als ein ausdrucksvoll vorgetragenes Schluchzen, das nicht einmal Röse Ricke sonderlich zu rühren schien, denn sie lief mit erheucheltem Seufzen nach der Küche, holte eine blecherne Waschschüssel und stellte sie der Mutter Höhrle auf den Schoß. »So,« sagte sie, »nun laßt die Tränen fließen. Das Wasser, was einer weint, das braucht er nicht zu schwitzen. So hat der liebe Gott prinzipiell die Wasserfrage entschieden, und wenn der eine Topf voll ist, so hol' ich einen andern.«
Nun konnte eigentlich alle Welt erwarten, daß man es tropfen höre, allein es geschah ganz etwas anderes. Höhrle junior stürzte aus einer Seitenkammer und benutzte die Pause des Schweigens, um sich seinem Vater in einem neuen eleganten Anzuge vorzustellen. Wenn ich von einem 21 neuen Anzug rede, so ist das eigentlich etwas zu viel gesagt, denn der Stoff zum mindesten war nicht neu. Er hatte vordem schon durch manches Jahr Vater Höhrles Beine geziert, und wenn ich sage, elegant, so ist auch dies ein Euphemismus, denn da der Meister Eisengarn die Metamorphose mehr mit der Scheere als mit der Nadel bewerkstelligt hatte, so waren die Hosen etwas völlig ausgefallen, und sie täuschten an der Rückseite vor allem bedeutend mehr vor, als Höhrle junior sein eigen nennen konnte. Aber der Junge, der noch wenig ästhetisches Zartgefühl besaß, war mit seinem Aussehen offenbar sehr zufrieden, und er verlangte von seinem Vater einige Worte bewundernder Anerkennung. Dieser, glücklich über die kleine Ablenkung, fuhr dem Knaben mit der Hand durch das lichtblonde Haar und sagte: »Schön, mein Junge, sehr schön, du könntest der Sohn des Amtmannes sein.«
Diese Worte rissen die geborene Schütteldich plötzlich aus tränenfeuchter Lethargie empor, und sie schrie in bellendem Tone: »O, der Hohn, das muß Unsereiner sich bieten lassen! Da sieh einer den Jungen an, gleicht der noch einem Menschen?«
»Ihr übertreibt, Nachbarin,« fiel Röse Ricke ein, »er ähnelt immer noch dem Dalai-Lama von Taklakott, den ich einmal in einem Guckkasten kennen gelernt habe,« und sie lachte hell hinaus.
Auch Vater Höhrle lachte, und da er an derartige Rührszenen längst gewohnt war, so benutzte er die Gelegenheit und brachte die Tür hinter seinen Rücken. Der kleine Hans, 22 der merkte, daß man sich über ihn amüsiere, hatte nichts dagegen einzuwenden, sondern griff mit beiden Händen an die Hosennähte und fing an, in den unaussprechlich weiten einen Cancan zu tanzen. Jetzt nahm Mutter Höhrle die Schürze von den Augen, und da sie wußte, daß sie vorhin gewaltig übertrieben hatte, so wollte sie wenigstens Röse Ricke gegenüber etwas einlenken, und sie sagte kleinlaut: »Ist nicht sein Aussehen so, daß man ihn auf Jahrmärkten sehen lassen könnte?«
»Doch,« sagte Röse Ricke, »und wenn wir zwei mit dem Zinnteller sammeln gingen, so dürfte immerhin ein Stück Geld dabei herausspringen.«
Die Tür ging auf, und Suse und Liese, die im Sonntagsputz vom Kirchgang nach Hause kamen, machten sich ungestüm über ihren drolligen Bruder her und bedeckten ihn mit einer schier endlosen Anzahl von Küssen. Mutter Höhrle fand das langweilig und kürzte die Szene des Wiedersehens mit der Frage ab, ob denn die Mädchen nichts Neues im Kirchdorfe erfahren hätten. Doch, sie hatten die Damen der Firma Groß und Moos in einem Viktoriawagen gesehen, und sie bestätigten ausdrücklich, was Röse Ricke nur gerüchtweise erzählt hatte, daß Groß und Moos in einem eigenen Kirchenstuhle saßen, der durch eine Tür für andere Leute abgesperrt war, daß der Kirchendiener vor ihnen einen Knicks gemacht, mit seinem Sacktuch die Sitze abgestäubt und ein Polster auf ihre Kniebank gelegt habe. Mutter Höhrle war empört über eine derartige Bevorzugung hereingeplackter Menschen vor dem 23 Angesichte des Herrn, und sie erklärte rundweg: »So, entweder räumt jetzt der Pfarrer der Familie Höhrle gleichfalls einen eigenen Stuhl ein, oder wir werden Protestanten.«
»Wacker geredet,« sagte Röse Ricke, »und dem guten Hirten über dem Kirchenportal geschieht es recht, wenn seine Schafe aus dem Pferch brechen, warum speist er sie mit so unterschiedlichem Futter. Unheil, du bist im Zug,« murmelte sie noch, ging gut gelaunt nach der Türe und überließ die Mutter Höhrle dem Dämon des Neides, der mit seinen Krallen ihr Herz zerfleischte. 24
4. Kapitel
Schade, recht schade, daß Entschließungen oft so rasch reifen, und daß sie nicht wie die Schlehen am ernährenden Stiele hängen müssen, bis es einmal tüchtig gefroren hat. Mutter Höhrle hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag den altbäuerlichen Erfahrungssatz, daß Pferdewirtschaft dem kleinen Besitzer gefährlich werden kann, aus Eitelkeit über Bord geworfen und lenkte ihr Boot ins gefährliche Fahrwasser der Großtuerei verwegen hinein. »Uns übertrumpft keiner,« sagte sie und bestellte die Amtschaise. Sie hatte sich vorgenommen in die Stadt zu fahren, um für die Kinder modische Kleider zu kaufen. »Es geht absolut nicht mehr an, daß die Würmer in ihren billigen Fähnchen herumlaufen und abstechen gegen das Personal der Firma Groß und Moos,« sagte sie zu ihrem Mann, »und Hans, der nun schon bald zur Schule geht, kann nicht länger die Fleischseite deiner abgeworfenen Häute als Galalivree tragen.« Das war's, was sie sagte, was sie verschwieg, war das Folgende: »Schirren wir das Pferd von hinten auf, und haben wir erst die Chaise, so 25 sieht der Dümmste ein, daß sie ohne Pferde zwecklos wäre.« Zur Reise hatte sie sich leidlich modern zurechtgestutzt, und als sie breit wie ein Abbild des Allvaters Brahma in den roten Polsterschonern der Amtschaise saß, konnte sie für einen, der nicht zu nahe stand, immerhin für eine Dame gelten. Ihren Kurs nahm sie an der neuen Dampfmühle vorbei, obwohl es einen näheren Weg nach Heidelberg gab, denn sie wollte, daß ihre Gegner sie sehen und sich überzeugen sollten, daß es auch noch andere Leute gebe, die in einer Chaise eine gute Figur machten. Auch fuhr sie neben der Eisenbahn her. Ihr fiel nicht ein, so was zu benutzen. Mochten arme Leute sich in einem solchen Fuhrwerk wie Dampfpflaumen zusammenquetschen lassen, sie brauchte Platz, und sie war unabhängig genug, um sich weder eine Abfahrts- noch Ankunftszeit vorschreiben zu lassen.
Ihre Einkäufe in den Konfektionsgeschäften waren bald erledigt. Nun kam für sie die Hauptsache, ein Wagenbauer, und womöglich der gleiche, von dem Groß und Moos bezogen hatten. Der Mann fand sich und auch eine gediegene Auswahl von Wagen; als aber der Preis genannt wurde, da erwachte in der geborenen Schütteldich für einen Augenblick wenigstens das Mitleid mit dem Bachmüller Höhrle, und wie der Kutscher seine Pferde stramm nahm und rückwärts zum Hofe hinaushufte, so griff sie, wenn auch ungern, ihren Wünschen in die Zügel und zerrte sie vorübergehend auf ein Pflaster zurück, wo Begehrlichkeit und Ausführbarkeit gleichen Schritt miteinander 26 halten konnten. Ein kalter Blitzstrahl war niedergefahren vor der Mühle zu Husterloh, er hatte sie nicht beschädigt.
In verärgerter Stimmung kam Frau Höhrle, die ihren Groll in der Zugluft des Neckars kühlte, an den Fuß des Schloßberges, wo durch Zierstauden hindurch rote Sättel leuchteten, die auf grauen Eseln lagen. Da schlug ihr der Gedanke ins Gehirn: »Das muß verfangen und kommt nicht zu teuer. Esel haben wir ja und Geld für Sättel auch.«
Nach einer halben Stunde waren drei Sättel, zwei für Damen und einer für einen Herrn gebaut, in der Kutsche verstaut, und die Amtschaise schaukelte zum Karlstore hinaus, der Strömung des Flusses entgegen.
Auf der Heimfahrt nahm man den kürzeren Weg. Mutter Höhrle konnte nicht darauf rechnen, daß sie von den Fenstern der Dampfmühle aus noch einmal gesehen würde, denn der Abend war finster, und eine beträchtliche Kühle dämpfte den Haß der leidenschaftlichen Frau. Zu Hause angekommen, wurden die Sättel im Erdgeschoß untergebracht, die verschiedenen Kartons aber brachte man in die Wohnstube, wo deren Inhalt bei den Kindern freudiges Erstaunen, bei dem Vater Höhrle aber, der trotz seiner blöden Augen weit voraus in die Zukunft blickte, eine bange Furcht erweckte.
Am folgenden Tage ging eine Aufforderung an die bucklige Nähkatherine und ihre Schule, daß sie zur Mühle kommen sollten. Allein es geschah das Unerhörte, die Bucklige lehnte ab, mit dem Ausdruck des Bedauerns, weil 27 sie bei Groß und Moos zugesagt habe. So was war einfach zum Überschäumen. In Mutter Höhrle kochte und brodelte es wie in einem Wurstkessel, und Röse Ricke erhielt den Befehl, der Mißgeburt zu verkünden, »daß es auch wieder andere Zeiten geben könne, und daß der Winter den Haufen Kartoffeln im Keller abflachen und das Holz am Herde knapp werden lasse. Dann aber sollten gewisse Leute nicht wagen, vor gewisse Türen zu kommen. Die Treppe der Mühle sei steil, und leichthin könne einer, der herunterflöge, das Genick brechen.« Röse Ricke richtete ihren Auftrag wörtlich aus und fügte aus dem eigenen noch hinzu: »Die Nähkatherin möchte es nicht so weit treiben, daß die Müllerin prinzipiell werde, denn in diesem Falle werde sie – Röse Ricke – sogar dem Teufel raten, ihr aus dem Wege zu gehn.«
Die Furcht vor der Mühle zu Husterloh war zu der Zeit noch groß genug, um die arme Nähkatherine umzustimmen. Sie zog mit ihrem Gefolge von Nahsichtigen und Halbgelähmten in die Mühle ein. Mutter Höhrle hatte einen staunenswerten diplomatischen Erfolg zu verzeichnen, und ihr Siegerauge glühte über den bleichsüchtigen Mädchengestalten, wie das des Pompejus über seinen Legionen.
Nun begann ein gewaltiges Nadeleinfassen, Garnwickeln, Sticheln und Steppen, und bald blähten sich die Kleider der Mädchen über Puppen von Rohr und Weidengeflecht wie Festwimpel dem großen Tage entgegen, der ihrer harrte. Gehörten die Tagesstunden der Schneiderei, so war der 28 Abend der Reiterei aufgehoben. Der Mühlbaschel mit seinem Anflug von Triefaugen mußte den Kindern im Grasgarten die Kunst des Reitens beibringen.
Hans ließ sich das gern gefallen, die Mädchen aber beugten sich mit verschämten Gesichtern dem Willen der Mutter. So hätte Frau Höhrle vorerst glücklich sein können, wenn nicht zuweilen die Chaise der Firma Groß und Moos vor ihrem Fenster vorübergerasselt wäre und wenn nicht Röse Ricke die Neuigkeit gebracht hätte, daß der Sattler im Dorfe Husterloh eine phänomenale Sache – »Lamperkins« für genanntes Haus in Arbeit habe.
So hatte denn die Woche ihre sechs Werkeltage heruntergearbeitet und Mutter Höhrle ihre Vorarbeiten, um den Kirchenstuhl zu erstürmen, den die Firma Groß und Moos widerrechtlich usurpiert hatte. Diese Leute sollten sehen, daß es vor Gottes Angesicht keine Logenplätze gibt, auch für den nicht, der viel Geld in den Klingelbeutel werfen kann. Die Müllerin hatte große Aussichten in diesem Ringen zu siegen, zumal da sie noch mit gewandter Kavallerie ins Feld rücken konnte, denn die Kinder sollten zum ersten Male auf den roten Plüschsätteln zur Kirche traben. Suse und Liese wollten nicht recht, sie fürchteten aufzufallen. Sie hatten vom Vater die Demut geerbt und den Verstand, und der Wert der Mutter war in ihren Augen gesunken, gerade da, als sie ihren Willen durchgesetzt und sie mit harten Worten in die Sättel gezwungen hatte. So ritten sie denn verschämt und mit niedergeschlagenen Augen die Straße entlang, ihren Bruder 29 in der Mitte. Kam irgend jemand des Weges, so spornten sie ihre Tiere, um rasch vorbeizukommen. Sie hatten das Gefühl, daß sie sich lächerlich machten, und sie fürchteten irgend einen, der ihnen das geradezu ins Gesicht schleuderte. Richtig, eben hatten sie einen Trupp langsam schreitender Kirchgänger überholt, als sie hinter sich die Bemerkung hörten: »Die Bachprinzessinnen. Die Bachprinzessinnen.« Ach, was war das für die Mädchen ein hartes Wort. War damit nicht ausgedrückt, daß man sie der Überhebung beschuldigte, daß man sie für halbverrückt hielt? Hatten sie das verdient, weil man sie einen Meter über das Niveau erhob, auf dem andere sich fortbewegen, indem man sie zwang, auf einen Esel zu steigen? Am liebsten wären sie heruntergerutscht und zu Fuß weitergegangen, aber die Mutter, die eigenwillige, schreckliche Mutter! Und dann ihr Bruder Hans, der sich auf dem Esel wie ein Maharadschah fühlte. Von all dem Herzeleid, das die Schwestern bedrückte, hatte er nicht die mindeste Unbequemlichkeit. Er freute sich der frischen Morgenluft, die mit seinen Locken spielte, war ausgelassen, quälte seinen Esel und wollte vor Lachen vergehen, wenn das Tier allerlei Kapriolen machte, um seinen Quälgeist in den Sand zu setzen. So hatten die Mädchen auch noch die Sorge, daß ihm ein Unfall zustoßen könne, und sie waren wie erlöst, als sie bei einer Biegung des Weges ihren guten Vater vor sich sahen. Still und gedrückt ging er dahin in seinem Sonntagsanzuge, der in seiner stellenweisen Fadenscheinigkeit nicht vermuten ließ, daß sein Träger der 30 Ernährer sein könne so hochtrabender Kinder. Ach wie schnitt die armselige Erscheinung des Vaters wie ein giftiger Vorwurf in das Herz der Töchter ein, ganz anders noch als vorhin der Spottname: »Bachprinzessinnen«. Und gar als er zu ihnen aufsah mit den staunenden stillen Augen, da fühlten sie, daß ihr Platz am Boden sei, bei dem einsamen unscheinbaren Fußgänger, und beide rutschten mit einem Schlage aus den Sätteln und schmiegten sich an seine Seite. In diesem Augenblicke war die Familie Höhrle zerrissen in zwei Teile, von denen der eine weiches Eisen war, der andere ein harter Hammer, der mit permanenter Gefühllosigkeit niederfuhr und die Masse nach seinem Willen formte.
Zuerst war alles still. Die drei fühlten, daß sie in ihrem Empfinden zusammengehörten und freuten sich, daß niemand da war, die Harmonie ihrer Seelen zu stören. Ach! wer war der Niemand? Sie alle wußten es, und doch wäre ihr Geheimnis nie über ihre Lippen gekommen. So wollen wir es sagen. Die Mutter war es, die eitle Mutter, die kein Verständnis hatte für das zartere Fühlen ihres Mannes und ihrer Töchter, und die Furcht vor ihr war es, die aus dem schwachen Vater redete, als er die verschüchterten Mädchen aufforderte, so schnell wie möglich ihre Tiere zu besteigen und dem wilden Bruder nachzutraben, der in toller Ausgelassenheit seinen Esel tummelte und eben auf dem Punkte war, an einer Straßenbiegung sich den kontrollierenden Augen seiner Schwestern zu entziehen. Die Sorge um den Wildfang verdrängte jetzt 31 jedes andere Empfinden. Es begann eine wahre Hetzjagd hinter ihm her, und wie ein Wirbelsturm sauste die kleine Kavalkade die Straße von Husterloh hinauf. Als man vor der Kirchentür angekommen und die Mädchen abgestiegen waren, begann die Verlegenheit erst recht. Was sollte man mit den unleidlichen Eseln machen inmitten der stechenden Blicke aller derer, die um das Gotteshaus standen und auf das Zusammenläuten warteten? Hans Höhrle kam nicht aus der Fassung. Er blieb auf dem Grauen sitzen, und als die Leute lachten, schnitt er ihnen von dem Rücken des Kreuzträgers herunter Fratzen. Die Mädchen aber standen beschämt da und legten die Köpfe mit den verschüchterten Rehaugen auf den Hals ihrer Tiere, rat und hilflos und warteten, wie führerlose versprengte Soldaten, auf irgend jemand, der kommen und ihnen befehlen möchte.
Die Mutter hatte heute wieder ihren großartigen Tag. Sie hatte die Amtschaise bestellt, saß geschwollen darin, überholte gleichfalls ihren nominellen Gebieter und kam nach einer Weile glücklich bei ihren Sprößlingen an. Nun kam Leben in die Gruppe. Man band die Esel an kleine eiserne Ringe, die an der Mauer des Wirtshauses angebracht waren, und großartig, als ob sie zu einer Krönung schritte, sah man die Müllerin, die drei Kinder hinter sich, unter dem Spitzbogen des Kirchenportals verschwinden.
Das Gotteshaus war noch wenig gefüllt. Nur hier und da saß einer, der sich die Zeit mit dem Anschauen der Stationsbilder vertrieb, ein anderer gähnte und ein dritter benutzte die Zeit, bevor die Orgel anfing, störend 32 dreinzureden, zu einem kleinen Schläfchen. Mutter Höhrle erregte Aufsehen bei diesen wenigen, als sie mit ihrem Gefolge zwischen den Bänken dahinschritt, mit einem Schlüssel, den ihr der Schlosser angefertigt hatte, den Stuhl der Firma Groß und Moos aufschloß und sich mit herausfordernder Stirne umsah, als ob sie sagen wolle: »Hier bin ich, und ich will den sehen, der mich da hinauswirft.« Vor dieser Haltung verduftete der Kirchendiener in die Sakristei, und Röse Ricke, die von dem Kitzel, etwas zu erleben, hergetrieben, gedankenlos einen Rosenkranz zöpfte, weckte ihre Nachbarin, deutete mit dem Finger nach der Müllerin und flüsterte leise: »Das kann gut werden.« –
Indessen fingen die Glocken an zu läuten, und alles, was draußen seither stumpfsinnig herumgestanden hatte, drängte sich nun wie eine Herde Kamelkälber in das Gotteshaus, stieß und drückte sich, trat sich auf die Hühneraugen und tat so, als ob es durchaus keine andere Gelegenheit mehr gebe, sich einen Unterstützungswohnsitz im himmlischen Jerusalem zu sichern. Getragen von dieser schwappenden Menschenwelle kamen auch die Damen der Firma Groß und Moos herangeschwommen und trieben auf ihre reservierten Plätze zu. Als sie diese schon zum Teil besetzt sahen, warfen sie hochmütig fragende Blicke um sich, die Mutter Höhrle mit einem grimmverbissenen Lächeln beantwortete. Suse und Liese wollten nichts sehen. Sie knieten da, drückten die Gesichter in ihre Gebetbücher. Der kleine Hans aber, der die Mimik richtig beurteilte, hoffte auf eine kleine Abwechslung und hätte zunächst 33 nichts lieber gesehen, als eine kleine Balgerei zwischen den zwei feindlichen Firmen. Er glühte förmlich in dem Verlangen, zerfetzte Hauben zu sehen und heruntergerissene Zöpfe. Doch er sowohl wie Röse Ricke kamen nicht auf ihre Kosten. Die Orgel fing an zu präludieren, und ihre milden Töne lockten aus dem Gewölbe herab einen wahren Tauregen von Gottesfrieden, der Starres geschmeidig machte und allzu Sprödes leise niederbog. Dann fing man an zu singen, und es war, als ob das Herz den Schatz mild versöhnlicher Regungen nicht fassen könne und ihn hinauswerfen müsse in alle Lüfte. Suse und Liese knieten in der Menge drin. Sie sangen nicht; die Angst, daß sich irgend etwas ereignen könne, drückte ihnen die Lippen zu, aber sie beteten leise: »Herr Gott, gib Frieden allen Herzen.«
Da mit einem Male, was war denn das? Von draußen her ein fürchterliches Brüllen, mitten hinein in den frommen Gesang der Gemeinde.
»Suse, die Esel,« flüsterte Liese und sank tief in sich zusammen. »Auch das noch,« gab Suse leise zurück und zog ihren Bruder, der die Sache von der heitersten Seite nehmend bereits auf die Bank gestiegen war und Faxen machte, zu sich herunter und hielt ihm den Mund zu, als er stoßweise Versuche machte, laut hinauszulachen. Mutter Höhrle fing mit ihrem breiten Rücken all die höhnenden Blicke auf, die wie Pfeile von allen Seiten nach ihnen geschossen wurden. Aber die Mädchen, die armen Mädchen, sie hatten das Gefühl, als ob sie nackt 34 im prasselnden Hagelwetter ständen. Was konnten sie mehr tun, als die Augen zu schließen? O, hätten sie doch auch die Ohren schließen können, um nicht die Esel hören zu müssen, die schrecklichen Esel und das Zischeln giftiger Zungen neben sich.
Endlich ward's draußen stille. Der Kirchendiener war hinausgeeilt. Er fand den Vater Höhrle bereits bei der Arbeit, und die zwei brachten die Tiere nach einem entfernten Stalle, wo sie sich aus Mangel an Anregung wieder schweigsam verhielten. Hans, den seine Schwestern unter die Bank gedrückt hatten, war da unten eingeschlafen, und nun hätten auch diese wieder ruhig werden können, wenn sie nicht der Gedanke an den Heimweg in qualvoller Aufregung gehalten hätte. Wer gab ihnen ein Gewand, das sie, der Menge unsichtbar, meinetwegen durch die Nacht des Hades in ihre stille Dachkammer entführte?
Ach das Geschick ist grausam, und wem es einmal übel will, dem spart es keine Demütigung und keine Schande. Umsonst blieben die verschüchterten Tauben nach dem Gottesdienst noch eine geraume Weile auf ihrem Platze, endlich mußten sie doch hinaus. Draußen stand die steifgewordene Menge, die es sonst so eilig hatte, zum Mittagstische zu kommen, fest wie eine Mauer, und achtete nicht der glühenden Sonne, welche die Partei der Mädchen ergreifend, unbarmherzig niederbrannte. Es half nichts, auch dieses Spießrutenlaufen mußte noch ausgehalten werden. Mit niedergeschlagenen Blicken gingen die Kinder durch die lachende Gasse, die man so gefällig für sie geöffnet hatte. 35 Sie sahen nichts als den Fußboden, aber sie hörten leise höhnendes Kichern und wieder das schreckliche Wort: die »Bachprinzessinnen«.
Vater Höhrle hatte für seine Töchter vorausgedacht. Er trat neben sie, nahm sie bei der Hand und führte sie in den Flur eines befreundeten Hauses. Das Hinzutreten des schlichten Alten gab den armen, durch Putz verunzierten Mädchen wieder Ansehen und Würde. Man hörte keine Zurufe mehr.
Hans blieb der Mutter überlassen, die Mannes genug war, für ihn zu sorgen und sich über alles hinwegzusetzen.
Den ganzen Tag über hielten die Töchter zusammen mit dem Vater sich im Hause des Gastfreundes, und erst am Abend, als der Neumond über den Bergen stand und ein fahles Zwielicht, das alles in graue Schleier hüllte, über das Tal hin ausgoß, wagten sie es, eng an den Vater geschmiegt, der Mühle zuzustreben. Ohne die Wohnstube noch einmal zu betreten, schlichen sie die Holzstiege hinaus zu ihrer Kammer, wo der Gott des Schlafes die Müden und Vergrämten in seine Arme nahm, sie leise wiegte und sie vergessen ließ, was der Tag ihnen Schweres zugefügt hatte. 36
5. Kapitel
Der folgende Montag war in der Familie Höhrle ein kritischer Tag erster Ordnung. Lange vor dem Hahnenschrei donnerte die Müllerin in der Küche herum. Zuweilen schlug es ein, und Blechkannen und zinnerne Löffel tanzten klirrend auf dem Wasserstein. Alles, was im Hause als Schmarotzer lebte, machte, daß es unter den Füßen fortkam. Das Volk der Mäuse floh in die Löcher hinter die Lamperien, die Katzen dehnten sich wie die Gummischläuche und verzogen sich durch einen Türspalt hinaus nach dem Kornboden, und Röse Ricke, die gekommen war, ihre Kaffeemilch zu holen, entfernte sich in eiligen Sprungschritten wie ein Wiedehopf.
Vater Höhrle, der im Stalle unter der Küche seine Kühe putzte, bekreuzte sich, als er zu seinen Häupten das Unwetter brausen hörte. Es gab wohl niemand auf der Welt, der ihn für einen tapferen Mann gehalten hätte, aber seiner Frau gegenüber war er geradezu ein Feigling. Mit Zittern stieg er die Treppe hinauf, als er zwischen mancherlei unartikulierten Lauten kurz und scharf akzentuiert den Namen »Höhrle, Höhrle!« unterscheiden konnte. Er fand die Küche 37 leer und bemühte sich nach der Wohnstube hinüber. In dieser war das Tageslicht durch das Zuziehen der Vorhänge etwas abgetönt, und da Mutter Höhrle unbeweglich und mit strengem Antlitz am Kopf des Tisches saß, so gewann das sonst so anspruchslose Gemach die ernste Würde eines Gerichtssaales. Vater Höhrle wußte wohl, daß er der Angeklagte, ja der Verurteilte war, ob die Verhandlungen sich in die Länge zogen oder nicht, und deshalb wollte er wenigstens Zeit sparen und unterbrach das verlegene Schweigen mit den Worten: »Warum hast du mich hierher gerufen?«
»Das fragst du noch,« wetterte die erregte Frau los, »wer hat all die Schmach von gestern über unser Haus gebracht?«
Vater Höhrle hätte einfach sagen können: »Dein Hochmut;« aber er schwieg, und sie fuhr fort, die ganze Anklage in immer neuen Fragesätzen aufbauend: »Wer drückt seine Familie, daß sie sich beugen muß vor hergelaufenem Volk? Wer bleibt an altem Herkommen kleben und läßt sich von dem ersten besten Hereingeplackten aus dem Sattel heben? Könnten nicht auch wir wie andere Menschen Geld verdienen und in einer Chaise fahren? Wer ißt seine Suppe mit dem Kaffeelöffel und glaubt mit seinem alttestamentlichen Eselbetrieb siegen zu können über die Planwagen der Firma Groß und Moos, die eine Schiffsladung Weizen auf ihrem Rücken tragen?«