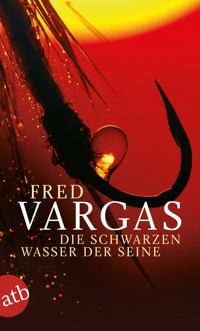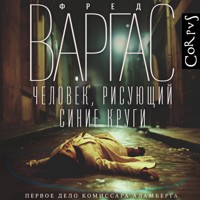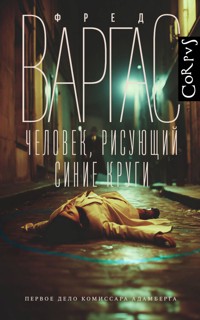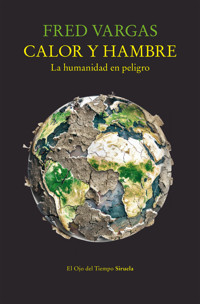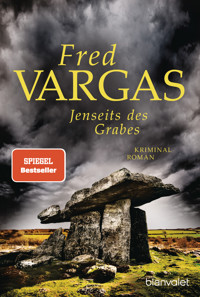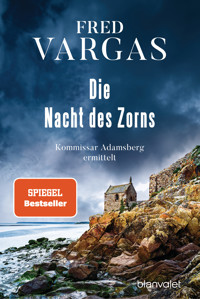
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Wen das »Wütende Heer« mit sich reißt, für den gibt es keine Hoffnung mehr …
Es ist Hochsommer in Paris, als eine verängstigte alte Dame Kommissar Adamsberg um Hilfe bittet. Ihre Tochter Lina will in der Normandie das »Wütende Heer« gesehen haben. Vier Menschen seien in der Gewalt der geisterhaften Reiter gewesen – der Legende nach sind sie dem Tode geweiht. Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis das erste Opfer des Wütenden Heeres stirbt. Adamsberg bricht sofort in Richtung Norden auf, denn er ist sich sicher: Jemand macht sich die mittelalterliche Sage zunutze, um ungestört zu morden. Und Adamsberg bleibt nicht mehr viel Zeit, denn das nächste Opfer wird gefunden …
»Fred Vargas' Krimis sind etwas Besonderes – eigenwillig, mit geradezu genialem Plot und viel französischem Esprit!« Bestsellerautorin Sophie Bonnet
»Lässig, klug, anarchisch und manchmal ziemlich abgedreht – die Krimis von Fred Vargas sind sehr französisch und zum Niederknien gut.« Bestsellerautor Cay Rademacher
»Fred Vargas erschafft nicht nur Figuren, sondern echte Charaktere. Sie kennt die Abgründe, die Sehnsüchte und die Geheimnisse der Menschen – und Commissaire Adamsberg ist für mich einer der spannendsten Ermittler in der zeitgenössischen Literatur.« Bestsellerautor Alexander Oetker
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Das Buch
Es ist Hochsommer in Paris, als eine verängstigte alte Dame Kommissar Adamsberg um Hilfe bittet. Ihre Tochter Lina will in der Normandie das »Wütende Heer« gesehen haben. Vier Menschen seien in der Gewalt der geisterhaften Reiter gewesen – der Legende nach sind sie dem Tode geweiht. Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis das erste Opfer des Wütenden Heeres stirbt. Adamsberg bricht sofort in Richtung Norden auf, denn er ist sich sicher: Jemand macht sich die mittelalterliche Sage zunutze, um ungestört zu morden. Und Adamsberg bleibt nicht mehr viel Zeit, denn das nächste Opfer wird gefunden …
Die Autorin
Fred Vargas, geboren 1957, ist ausgebildete Archäologin und hat Geschichte studiert. Sie ist heute die bedeutendste französische Kriminalautorin mit internationalem Renommee. 2004 erhielt sie für »Fliehe weit und schnell« den Deutschen Krimipreis, 2012 den Europäischen Krimipreis für ihr Gesamtwerk und 2016 den Deutschen Krimipreis in der Kategorie International für »Das barmherzige Fallbeil«.
Alle unabhängig voneinander lesbaren Bände der Kommissar Adamsberg-Reihe:
1. Es geht noch ein Zug von der Gare du Nord
2. Bei Einbruch der Nacht
3. Fliehe weit und schnell
4. Der vierzehnte Stein
5. Die dritte Jungfrau
6. Der verbotene Ort
7. Die Nacht des Zorns
8. Das barmherzige Fallbeil
9. Der Zorn der Einsiedlerin
fredVARGAS
Die Nacht des Zorns
Kriminalroman
Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »L’Armée furieuse« bei Éditions Viviane Hamy, Paris 2011.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© der Originalausgabe Fred Vargas et Les Éditions Viviane Hamy 2011
Taschenbuchausgabe 2020 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
© Deutsche Erstveröffentlichung Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2012
Die Zitate aus dem im Anhang erwähnten Werk von Claude Lecouteux folgen seiner deutschsprachigen Ausgabe, »Das Reich der Nachtdämonen. Angst und Aberglaube im Mittelalter«, Artemis & Winkler, 2001 (Übersetzung H. Ehrhardt)
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: mauritius images / Mark Robertz; www.buerosued.de
JB Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-26930-2V002
www.blanvalet.de
1
Eine Spur kleiner Brotkrumen lief von der Küche zum Zimmer bis auf die sauberen Laken, in denen die alte Frau ruhte, tot und mit offenem Mund. Kommissar Adamsberg ging mit langsamen Schritten die Krümelspur entlang, schweigend betrachtete er die Bröckchen und fragte sich, welcher kleine Däumling oder in diesem Fall auch welcher Oger sie hier verstreut hatte. Die Wohnung bestand aus drei dunklen kleinen Zimmern im Erdgeschoss eines Hauses im 18. Pariser Arrondissement.
Im Schlafzimmer die alte Frau auf dem Bett. Im Esszimmer der Ehemann. Geduldig und ohne jede Gefühlsregung wartete er, allein auf seine Zeitung sah er begehrlich, sie lag auf der Seite mit den Kreuzworträtseln aufgeschlagen, doch er traute sich nicht weiterzuraten, solange die Bullen da waren. Seine kurze Geschichte hatte er schon erzählt: Er und seine Frau hatten sich in einer Versicherungsgesellschaft kennengelernt, sie war dort Sekretärin, er Buchhalter, im Überschwang hatten sie geheiratet, ohne zu ahnen, dass das neunundfünfzig Jahre dauern sollte. Und nun war die Frau in der Nacht gestorben. An Herzstillstand, wie der Kommissar des 18. Arrondissements am Telefon präzisiert hatte. Da er ans Bett gefesselt war, hatte er Adamsberg angerufen mit der Bitte, ihn zu vertreten. Tu mir den Gefallen, es kostet dich nicht mal eine Stunde, reine morgendliche Routine.
Noch einmal ging Adamsberg die Krümelspur entlang. Die Wohnung war in makellosem Zustand, die Sessel zierten Schonbezüge für den Kopf, alle Kunststoffoberflächen waren blankpoliert, die Fenster geputzt, der Abwasch erledigt. Er ging bis zum Brotkasten zurück, in dem noch ein halbes Baguette lag und, eingeschlagen in ein sauberes Geschirrtuch, ein großer Kanten, dessen Inneres ausgehöhlt war. Dann kam er zu dem Mann zurück und zog sich einen Stuhl zu dessen Sessel heran.
»Keine guten Nachrichten heute Morgen«, meinte der Alte und sah von seiner Zeitung auf. »Diese Hitze aber auch, da kocht einem das Gemüt. Hier im Erdgeschoss kann man die Kühle wenigstens halten. Darum lasse ich auch die Fensterläden zu. Und viel trinken muss man, sagen sie.«
»Sie haben nichts bemerkt?«
»Als ich mich hinlegte, war sie ganz normal. Ich sah nämlich immer noch mal nach ihr, weil sie herzkrank war. Erst heute Morgen habe ich bemerkt, dass sie gestorben ist.«
»In ihrem Bett sind Brotkrümel.«
»Ja, das mochte sie. Im Liegen noch was knabbern. Ein Stückchen Brot oder einen Zwieback vorm Einschlafen.«
»Ich könnte mir eher vorstellen, dass sie danach alle Krümel beseitigt hätte.«
»Aber sicher. Sie putzte von früh bis abends, als wenn das ihr Lebenszweck wäre. Am Anfang war es gar nicht so schlimm. Aber mit den Jahren wurde es geradezu eine Besessenheit. Sie hätte etwas schmutzig gemacht, nur um es sauber machen zu können. Das hätten Sie mal sehen müssen. Und gleichzeitig war sie dadurch auch beschäftigt, die Gute.«
»Aber das Brot? Hat sie gestern Abend nicht sauber gemacht?«
»Natürlich nicht, denn da hab ich es ihr ja gebracht. Sie war zu schwach, um aufzustehen. Klar hat sie mir befohlen, die Krümel wegzunehmen, aber mir ist das doch so was von egal. Sie hätte es am nächsten Tag ohnehin gemacht. Jeden Tag hat sie das Bettzeug ausgeschüttelt. Keine Ahnung, was das soll.«
»Sie haben ihr also Brot ans Bett gebracht und haben es dann in den Kasten zurückgelegt.«
»Nein, ich habe es in den Mülleimer geworfen. Es war viel zu hart, das Brot, sie konnte es schon nicht mehr essen. Ich habe ihr einen Zwieback gebracht.«
»Es liegt aber nicht im Mülleimer, es liegt im Brotkasten.«
»Ja, ich weiß.«
»Und die Krume ist rausgepult. Hat sie die ganze Krume gegessen?«
»Aber nicht doch, Kommissar. Warum sollte sie sich mit Brotkrume vollstopfen? Noch dazu von altbackenem Brot? Sie sind doch Kommissar, oder?«
»Ja. Jean-Baptiste Adamsberg, Brigade criminelle.«
»Und warum kommt nicht die für das Viertel zuständige Polizei?«
»Der Kommissar liegt mit einer Sommergrippe im Bett, und sein Stab ist unabkömmlich.«
»Alle die Grippe?«
»Nein, es gab eine Schlägerei heute Nacht. Zwei Tote und vier Verletzte. Wegen eines gestohlenen Motorrollers.«
»Scheiße. Ich sag’s ja, bei dieser Hitze kocht den Leuten das Gehirn. Also, ich bin Tuilot Julien, Finanzbuchhalter im Ruhestand der Versicherungsgesellschaft ALLB.«
»Ja, habe ich notiert.«
»Sie hat mir immer vorgeworfen, dass ich Tuilot heiße, ihr Mädchenname, Kosquer, sei viel schöner. Womit sie übrigens gar nicht so unrecht hatte. Dass Sie Kommissar sind, hab ich mir gedacht, so, wie Sie einen über Brotkrümel ausfragen. Der Kollege von hier ist nicht so.«
»Sie finden, dass ich mich zu lange bei den Krümeln aufhalte?«
»Nein, machen Sie ruhig, wie Sie wollen. Das ist für Ihren Bericht, irgendwas müssen Sie ja in den Bericht schreiben. Verstehe ich vollkommen, ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht bei der ALLB, Abrechnungen und Berichte. Wenn es noch ehrliche Berichte gewesen wären. Von wegen. Der Chef hatte seine Devise, er sagte immer: Eine Versicherung muss nicht zahlen, selbst wenn sie zahlen muss. Fünfzig Jahre Betrug in dieser Weise, das verkleistert einem ganz schön den Verstand. Ich sagte zu meiner Frau: Wenn du mal meinen Kopf waschen könntest statt der Gardinen, das wäre weiß Gott nützlicher.«
Tuilot Julien lachte, wie um seinen Geistesblitz zu unterstreichen.
»Ich verstehe ja nur diese Geschichte mit dem Brotkanten nicht.«
»Wer verstehen will, muss logisch vorgehen, Kommissar, logisch und schlau. Ich, Tuilot Julien, bin es, ich habe sechzehn Kreuzworträtselmeisterschaften in zweiunddreißig Jahren gewonnen. Im Schnitt alle zwei Jahre eine, allein mit meinem Grips. Logisch und schlau. Das bringt auf diesem Niveau sogar Geld ein. Das hier«, sagte er und wies auf die Zeitung, »ist Kinderkram. Allerdings muss man dabei häufig seine Bleistifte anspitzen, und das gibt Späne. Was ist sie mir auf den Geist gegangen mit diesen Spänen! Was stört Sie eigentlich an diesem Brot?«
»Es liegt nicht im Mülleimer, ich finde es gar nicht besonders alt, und ich begreife nicht, warum es keine Krume mehr hat.«
»Geheimnis des Hauses«, sagte Tuilot, und er schien amüsiert. »Ich habe nämlich zwei kleine Untermieter, Toni und Marie, ein richtiges kleines Paar, unheimlich nett, und sie lieben sich innig. Nur sind sie nicht nach dem Geschmack meiner Frau, das können Sie mir glauben. Über Tote soll man ja nichts Schlechtes sagen, aber sie hat alles versucht, sie mir umzubringen. Und ich hintertreibe nun seit drei Jahren alle ihre Listen! Logisch und schlau, das ist das Geheimnis. Nicht du, meine arme Lucette, sagte ich zu ihr, wirst einen Kreuzworträtsel-Champion austricksen. Ich und diese beiden, wir sind ein Trio, sie wissen, dass sie auf mich zählen können, und ich auf sie. Allabendlich ein kleiner Besuch. Da sie schlau sind und sehr feinfühlig, kommen sie nie, bevor Lucette im Bett ist. Sie wissen ja, dass ich auf sie warte. Toni kommt immer als Erster, er ist der Größere, Kräftigere.«
»Und die haben also die Krume gefressen? Während das Brot im Mülleimer lag?«
»Sie sind ganz verrückt danach.«
Adamsberg warf einen Blick auf die Kreuzworträtsel, die ihm durchaus nicht so einfach erschienen, dann schob er die Zeitung von sich.
»Und wer sind ›sie‹, Monsieur Tuilot?«
»Ich spreche nicht gern darüber, die Leute verurteilen so was. Sie sind borniert, die Leute.«
»Tiere? Hunde, Katzen?«
»Ratten. Toni ist brauner als Marie. Und sie lieben sich so sehr, dass sie oft mitten im Fressen innehalten, um einander mit ihren Pfoten den Kopf zu kraulen. Wenn die Leute nicht so vernagelt wären, würden sie so ein Schauspiel bemerken. Marie ist die Lebhaftere. Nach ihrer Mahlzeit klettert sie auf meine Schulter und krallt sich in meine Haare. Sie kämmt mich sozusagen. Es ist ihre Art, sich zu bedanken. Oder mich zu lieben? Wer kann das sagen? Jedenfalls ist es irgendwie tröstlich. Und dann, nachdem wir uns eine Menge netter Dinge gesagt haben, trennen wir uns bis zum nächsten Abend. Durch das Loch hinter dem Fallrohr gelangen sie wieder in den Keller. Einmal hat Lucette alles zuzementiert. Arme Lucette, sie hat keine Ahnung, wie man Zement anmischt.«
»Ich verstehe«, sagte Adamsberg.
Der Alte erinnerte ihn an Félix, der achthundertachtzig Kilometer von hier Weinstöcke beschnitt. Er hatte eine Ringelnatter mit Milch gezähmt. Eines Tages hatte ein Kerl seine Ringelnatter getötet. Daraufhin tötete Félix den Kerl. Adamsberg ging zum Schlafzimmer zurück, wo Lieutenant Justin bei der Toten wachte, bis der behandelnde Arzt käme.
»Sieh mal in ihren Mund«, sagte er. »Sieh nach, ob du weißliche Überreste findest, wie Brotkrume.«
»Ich habe keine große Lust, das zu tun.«
»Tu’s trotzdem. Ich denke, dass der Alte sie erstickt hat, indem er sie mit Brotkrume vollstopfte. Danach hat er die Krume wieder rausgeholt und sie irgendwohin geschmissen.«
»Die Krume, die in dem Kanten war?«
»Ja.«
Adamsberg öffnete das Fenster und stieß die Läden auf. Prüfend sah er in den kleinen, mit Vogelfedern übersäten Hof hinaus, der zur Hälfte als Gerümpelablage diente. In seiner Mitte bedeckte ein Rost den Wasserabfluss, er war nass, obwohl es nicht geregnet hatte.
»Geh dann mal raus und nimm den Rost ab. Ich vermute, er hat die Krume da reingeschmissen und einen Eimer Wasser drübergekippt.«
»Schwachsinn«, murmelte Justin, während er seine Taschenlampe in den Mund der alten Frau richtete. »Wenn er das getan hat, warum hat er den leeren Kanten dann nicht weggeworfen? Und die Krümel beseitigt?«
»Um den Kanten wegzuwerfen, hätte er zu den Mülltonnen gehen, sich also auf der Straße zeigen müssen in der Nacht. Genau nebenan ist eine Caféterrasse, und in solchen warmen Nächten sitzen da sicher eine Menge Leute. Man hätte ihn gesehen. Und er hat sich eine sehr gute Erklärung für den Brotkanten und die Krümel ausgedacht. So originell, dass sie schon wieder wahrscheinlich wird. Er ist Champion im Kreuzworträtselraten, er hat so seine Art der Gedankenverbindung.«
Deprimiert und zugleich mit ein wenig Bewunderung ging Adamsberg zu Tuilot zurück.
»Als Marie und Toni kamen, haben Sie das Brot wieder aus dem Mülleimer rausgeholt?«
»Aber nicht doch, die kennen das Ding, und sie mögen das. Toni setzt sich auf den Tritt, der Deckel springt auf, und Marie holt alles raus, was sie interessiert. Clever, was? Ja, schlau sind die, da kann man nichts gegen sagen.«
»Also, Marie hat das Brot rausgeholt. Und dann haben alle beide die Krume gefressen? Und sich dabei geliebt?«
»So ist es.«
»Die gesamte Krume?«
»Es sind große Ratten, Kommissar, die sind gefräßig.«
»Und die Krümel? Warum haben sie die Krümel liegen lassen?«
»Kommissar, geht’s hier um Lucette oder um die Ratten?«
»Ich begreife nicht, warum Sie das Brot, in ein Tuch gewickelt, weggeräumt haben, nachdem die Ratten es ausgehöhlt hatten. Während Sie es davor direkt in den Müll geworfen hatten.«
Der Alte setzte ein paar Buchstaben in sein Rätsel.
»Sie sind vermutlich nicht besonders gut im Kreuzworträtselraten, Kommissar. Wenn ich den leeren Brotkanten in den Mülleimer geworfen hätte, das können Sie sich doch wohl denken, hätte Lucette erkannt, dass Toni und Marie da waren.«
»Sie hätten ihn ja draußen in den Müll werfen können.«
»Die Tür quietscht wie ein Schwein auf der Schlachtbank. Haben Sie das nicht bemerkt?«
»Doch.«
»Also habe ich es einfach in das Geschirrtuch gewickelt. Das erspart mir eine Szene am Morgen. Denn Szenen macht sie mir endlos, jeden Tag. Mein Gott, fünfzig Jahre lang geht sie nun schon schimpfend mit ihrem Putzlappen überall rum, wischt unter meinem Glas, unter meinen Füßen, unter meinem Hintern. Als ob ich nicht mehr das Recht hätte, zu laufen oder mich hinzusetzen. Wenn Sie so was erleben würden, hätten Sie den Kanten auch versteckt.«
»Und im Brotkasten hätte sie ihn nicht gesehen?«
»Eben nicht. Morgens isst sie Zwieback mit Rosinen. Sie scheint das absichtlich zu tun, denn diese Zwiebäcke verbreiten Tausende von Krümeln. Sodass sie hinterher zwei Stunden lang zu putzen hat. Begreifen Sie die Logik?«
Justin trat ins Zimmer und gab Adamsberg ein kurzes Zeichen der Bestätigung.
»Aber gestern«, sagte Adamsberg etwas matt, »ist es nicht so gelaufen. Sie haben die Krume aus dem Brot gebohrt, zwei große Batzen Krume, fest geknetet, und sie ihr in den Mund gestopft. Als sie nicht mehr geatmet hat, haben Sie die ganze Krume wieder rausgeholt und in den Abfluss im Hof geschmissen. Es verblüfft mich, dass Sie auf diese Methode gekommen sind, sie umzubringen. Das habe ich noch nie erlebt, dass einer jemanden mit Brotkrume erstickt hat.«
»Einfallsreich«, bestätigte Tuilot gelassen.
»Sie ahnen sicherlich, Monsieur Tuilot, dass man auf der Brotkrume den Speichel Ihrer Frau finden wird. Und da Sie logisch vorgehen und schlau, wird man auf dem Kanten auch die Spuren der Rattenzähne finden. Sie haben sie die restliche Krume rausfressen lassen, um Ihrer Geschichte Glaubwürdigkeit zu verleihen.«
»In einen Brotkanten reinkriechen, das mögen sie, es ist eine helle Freude, ihnen dabei zuzusehen. Ja, wir hatten gestern wirklich einen schönen Abend miteinander. Ich habe sogar zwei Gläschen getrunken, während Marie mir den Kopf kraulte. Ich habe mein Glas danach abgewaschen und wieder eingeräumt, um mir keinen Tadel einzuhandeln. Während sie doch schon tot war.«
»Während Sie sie doch gerade umgebracht hatten.«
»Ja«, sagte der Mann mit einem achtlosen Seufzer, während er wieder einige Kästchen in seinem Rätsel ausfüllte. »Der Arzt war den Abend vorher da, sie zu untersuchen, er hat mir versichert, dass sie noch etliche Monate durchhalten würde. Das hieß noch Dutzende Dienstage mit fetten Pastetchen, noch Hunderte Beschwerden, noch Tausende Male der Putzlappen vor meiner Nase. Mit sechsundachtzig Jahren hat man das Recht, mit dem Leben zu beginnen. Und dann kommt so ein Abend. Ein Abend, wo ein Mann aufsteht und handelt.«
Und Tuilot stand auf, öffnete die Fensterläden des Esszimmers und ließ die bleierne, klebrige Hitze dieser ersten Augusttage hereinströmen.
»Auch die Fenster wollte sie nicht aufmachen. Aber das alles werde ich nicht sagen, Kommissar. Ich werde sagen, dass ich sie getötet habe, um ihr Leiden zu ersparen. Mit der Krume vom Brot, weil sie die so mochte, gleichsam als eine letzte kleine Leckerei. Ich habe alles hier drin bedacht«, sagte er und pochte sich an die Stirn, »niemand wird beweisen können, dass ich es nicht aus Barmherzigkeit getan habe. Stimmt’s? Aus Barmherzigkeit. Ich werde freigesprochen werden, und zwei Monate später bin ich wieder zu Hause, ich werde mein Glas einfach so auf den Tisch stellen, ohne einen Untersetzer, und wir werden uns alle drei sehr wohl fühlen, Toni, Marie und ich.«
»Ja, das glaube ich«, sagte Adamsberg und stand sachte auf. »Es kann aber auch sein, Monsieur Tuilot, dass Sie es nicht wagen werden, Ihr Glas auf den Tisch zu stellen. Dass Sie vielleicht doch diesen Untersetzer rausholen. Und dass Sie am Ende sogar die Krümel wegwischen.«
»Und warum sollte ich das tun?«
Adamsberg zuckte mit den Schultern.
»Ich sage nur, was ich gesehen habe. Häufig geschieht es eben so.«
»Keine Sorge, nicht bei mir. Ich bin schlau, wissen Sie.«
»Das stimmt, Monsieur Tuilot.«
Die Hitze draußen ließ die Leute in den Schatten flüchten, mit offenen Mündern schlichen sie dicht an den Häuserwänden entlang. Adamsberg wählte den sonnenbeschienenen leeren Bürgersteig und beschloss, sich zu Fuß nach Süden treiben zu lassen. Ein langer Marsch, um das vergnügte – und in der Tat schlaue – Gesicht des Kreuzworträtsel-Champions loszuwerden. Der sich an einem der nächsten Dienstage vielleicht ein Schweinspastetchen zum Abendessen kaufen würde.
2
Eineinhalb Stunden später kam er in der Brigade an, sein schwarzes T-Shirt war schweißnass, und seine Gedanken waren wieder geordnet. Es kam selten vor, dass ein guter oder ein schlechter Eindruck Adamsbergs Verstand sehr lange beschäftigte. Wobei man sich fragen konnte, ob er überhaupt einen hatte, einen Verstand, wie seine Mutter zu sagen pflegte. Er diktierte seinen Bericht für den vergrippten Kommissar, ging beim Empfang vorbei, um nach eingegangenen Nachrichten zu fragen. Brigadier Gardon, der an der Telefonzentrale saß, hielt den Kopf gesenkt, um den Luftstrom eines kleinen Ventilators abzubekommen, der auf dem Fußboden stand. Seine feinen Haare wehten in dem frischen Lüftchen, so als säße er unter der Trockenhaube eines Frisiersalons.
»Lieutenant Veyrenc wartet im Café auf Sie, Kommissar«, sagte er, ohne sich aufzurichten.
»Im Café oder in der Brasserie?«
»Im Café, im Würfelbecher.«
»Veyrenc ist nicht mehr Lieutenant, Gardon. Erst heute Abend werden wir wissen, ob er von Neuem in den Ring steigt.«
Adamsberg betrachtete den Brigadier einen kurzen Moment, wobei er sich fragte, ob wohl Gardon einen Verstand hatte und, wenn ja, was er da hineintun mochte.
Er setzte sich zu Veyrenc an den Tisch, und beide Männer begrüßten sich mit einem offenen Lächeln und einem langen Händedruck. Nur manchmal noch jagte die Erinnerung an Veyrenc’ plötzliches Auftauchen in Serbien* Adamsberg einen kurzen Schauer über den Rücken. Er bestellte einen Salat, und während er aß, gab er einen sehr langen Bericht über Madame Tuilot Lucette, Monsieur Tuilot Julien, Toni, Marie, ihre Liebe, den Brotkanten, den Tritt vom Mülleimer, die geschlossenen Fensterläden, die Schweinspastete vom Dienstagabend. Von Zeit zu Zeit warf er einen Blick durch die Fensterscheibe des Cafés, die Tuilot Lucette viel gründlicher geputzt hätte.
Veyrenc bestellte zwei Kaffee beim Wirt, einem dicken Kerl, dessen ohnehin grantige Laune sich bei der Hitze noch verschlimmert hatte. Seine Frau, eine stumme kleine Korsin, huschte wie eine schwarze Fee vorüber und servierte die Speisen.
»Eines Tages«, sagte Adamsberg und wies mit einer Geste auf sie, »wird sie ihn mit zwei großen Batzen Brotkrume ersticken.«
»Schon möglich«, meinte Veyrenc zustimmend.
»Da steht sie immer noch auf dem Bürgersteig«, sagte Adamsberg und warf erneut einen Blick nach draußen. »Sie wartet seit fast einer Stunde unter dieser bleiernen Sonne. Sie weiß nicht, was sie machen soll, wie sie sich entscheiden soll.«
Veyrenc folgte Adamsbergs Blick und sah eine schmächtige kleine Frau, adrett bekleidet mit einer geblümten Bluse, einer, wie man sie in den Geschäften in Paris nicht findet.
»Bist du sicher, dass sie auf dich wartet? Sie steht nicht gegenüber der Brigade, sie läuft zehn Meter davon entfernt auf und ab. Sie hat eine Verabredung, die nicht eingehalten wurde.«
»Sie steht meinetwegen dort, Louis, kein Zweifel. Wer würde sich in so einer Straße verabreden? Sie hat Angst. Das ist es, was mir zu denken gibt.«
»Weil sie fremd ist in Paris.«
»Vielleicht ist sie sogar das erste Mal hier. Also hat sie ein ernstes Problem. Was aber deines nicht löst, Veyrenc. Du überlegst nun schon seit Monaten, hängst die Füße in deinen Fluss und hast noch immer nichts entschieden.«
»Du könntest die Frist verlängern.«
»Das habe ich schon gemacht. Heute Abend um sechs musst du unterschrieben oder nicht unterschrieben haben. Dass du in den Polizeidienst zurückkehrst oder nicht. Du hast noch viereinhalb Stunden«, fügte Adamsberg unbekümmert hinzu und sah auf seine Uhr, genauer gesagt auf die beiden Uhren, die er am Handgelenk trug, ohne dass man recht wusste, warum.
»Ich hab noch genügend Zeit«, sagte Veyrenc und rührte seinen Kaffee um.
Kommissar Adamsberg und der Ex-Lieutenant Louis Veyrenc de Bilhc, aufgewachsen in zwei benachbarten Dörfern der Pyrenäen, besaßen beide gleichermaßen eine Art abgehobener Ruhe, die etwas ziemlich Verwirrendes hatte. Sie konnte bei Adamsberg alle Anzeichen einer erschreckenden Unaufmerksamkeit und Gleichgültigkeit annehmen. Bei Veyrenc führte diese Teilnahmslosigkeit mitunter zu unerklärlichem plötzlichen Verschwinden, zu hartnäckigem Eigensinn, der rigoros und verschwiegen war und sich gelegentlich sogar zu Anwandlungen von Jähzorn steigerte. »Das hat das alte Gebirge so gemacht«, sagte Adamsberg ohne jede weitere Begründung. »Das alte Gebirge kann keine lustig wogenden Gräser ausspucken wie die weiten Auen des Flachlands.«
»Gehen wir«, sagte Adamsberg plötzlich und zahlte schnell ihr Essen, »die kleine Frau haut gleich ab. Sieh nur, sie verliert den Mut, ihr Zweifel gewinnt die Oberhand.«
»Auch ich zweifle«, sagte Veyrenc und trank seinen Kaffee in einem Zug aus. »Aber mir hilfst du nicht.«
»Nein.«
»Also gut. So geht er zögernd denn, allein, vom Zweifel gebeugt,/Und nirgends eine Hand, die hilfreich sich ihm zeigt.«
»Man kennt seine Entscheidung immer schon lange, bevor man sie trifft. Im Grunde von Anfang an. Darum nutzen Ratschläge überhaupt nichts. Nur dass ich dir wieder einmal sagen muss, dass dein Verseschmieden Commandant Danglard auf den Geist geht. Er mag es nicht, wenn man die Dichtkunst massakriert.«
Adamsberg grüßte den Wirt mit einer sparsamen Geste. Überflüssig, ihn anzusprechen, der Dicke mochte das nicht, oder genauer gesagt, er mochte nicht sympathisch sein. Passend zu seinem Etablissement war er kahl, betont proletenhaft, ja nahezu kundenunfreundlich. Es tobte ein erbitterter Kampf zwischen dem stolzen, kleinen Bistro und der opulenten Brasserie auf der anderen Straßenseite. Je mehr die Brasserie der Philosophen ihr Image einer reichen, etwas preziösen alten Dame pflegte, desto kärglicher gab sich der Würfelbecher, denn beide lagen in gnadenlosem sozialem Wettbewerb miteinander. »Eines Tages«, murmelte Commandant Danglard, »gibt es hier noch einen Toten.« Nicht gerechnet die kleine Korsin, die ihrem Mann den Hals mit Brotkrume stopfen würde.
Beim Verlassen des Cafés stöhnte Adamsberg auf unter dem Eindruck der glühenden Luft und näherte sich vorsichtig der kleinen Frau, die immer noch ein paar Schritte von der Brigade entfernt stand. Eine Taube hockte vor dem Eingangsportal des Gebäudes, und er fürchtete, wenn er den Vogel im Vorbeigehen aufschreckte, würde die Frau durch einen mimetischen Effekt ebenfalls davonfliegen. Als wäre sie leicht, flüchtig und fähig, wie ein Strohhalm im Wind zu verschwinden. Aus der Nähe betrachtet, schätzte er sie auf etwa fünfundsechzig Jahre. Sie hatte darauf geachtet, zum Friseur zu gehen, bevor sie in die Hauptstadt fuhr, ein paar blonde Locken hielten sich noch in ihrem grauen Haar. Während Adamsberg sie ansprach, rührte sich die Taube nicht, und die Frau wandte ihm ein verängstigtes Gesicht zu. Adamsberg sprach langsam und fragte, ob er ihr irgendwie helfen könne.
»Vielen Dank, nein«, erwiderte die Frau und sah zur Seite.
»Wollten Sie nicht da rein?«, meinte Adamsberg und wies auf das alte Gebäude der Brigade criminelle. »Um mit einem Polizisten zu sprechen oder so was? Denn ansonsten gibt es in dieser Straße kaum was zu tun.«
»Aber wenn einen die Polizisten nicht anhören, braucht man auch gar nicht erst hinzugehen«, meinte sie und wich ein paar Schritte zurück. »Sie glauben einem nicht, die Polizisten, wissen Sie.«
»Also wollten Sie genau dahin? Zur Mordbrigade?«
Die Frau senkte ihre fast durchsichtigen Brauen.
»Sind Sie das erste Mal in Paris?«
»Weiß Gott, ja. Und ich muss heute Abend zurück sein. Sie dürfen es nicht merken.«
»Sie sind gekommen, um mit einem Polizisten zu reden?«
»Ja. Also, vielleicht.«
»Ich bin Polizist. Ich arbeite da drin.«
Die Frau warf einen Blick auf Adamsbergs nachlässigen Aufzug und schien enttäuscht oder auch skeptisch.
»Also kennen Sie die da vermutlich.«
»Ja.«
»Alle?«
»Ja.«
Die Frau öffnete ihre große braune, an den Seiten abgegriffene Tasche und zog ein Papier heraus, das sie behutsam auseinanderfaltete.
»Monsieur le commissaire Adamsberg«, las sie eifrig. »Kennen Sie den?«
»Ja. Kommen Sie von weit her, um ihn zu sprechen?«
»Aus Ordebec«, erwiderte sie, als wenn dieses persönliche Eingeständnis sie etwas kostete.
»Sagt mir nichts.«
»Das ist in der Nähe von, sagen wir, Lisieux.«
Normandie, dachte Adamsberg, was ihr zögerndes Reden erklären mochte. Er hatte schon einmal eine Begegnung mit Normannen gehabt, regelrechten »Schweigern«, die zu zähmen er Tage gebraucht hatte. Als wenn ein paar Worte fallen zu lassen so viel bedeutete wie einen Louisdor rauszurücken, den der andere nicht mal unbedingt verdiente. Adamsberg setzte sich in Bewegung und forderte die Frau auf, ihn zu begleiten.
»Es gibt auch in Lisieux eine Polizei«, sagte er. »Und vielleicht sogar in Ordebec. Es gibt doch Gendarmen bei Ihnen, oder?«
»Sie würden mir nicht zuhören. Aber der Vikar von Lisieux, der den Pfarrer von Mesnil-Beauchamp kennt, hat gesagt, dass der Kommissar von hier mich anhören würde. Die Reise war teuer.«
»Geht es um etwas Ernstes?«
»Ja, sicher ist es ernst.«
»Um einen Mord?«, beharrte Adamsberg.
»Vielleicht ja. Das heißt, nein. Es geht um Leute, die erst sterben werden. Da muss ich die Polizei doch warnen, nicht wahr?«
»Leute, die sterben werden? Haben sie Drohungen erhalten?«
Dieser Mann beruhigte sie ein wenig. Paris erschreckte sie, und ihr Entschluss noch mehr. Klammheimlich von zu Hause wegzufahren, die Kinder anzulügen. Und wenn der Zug sie nicht rechtzeitig zurückbrachte? Und wenn sie den Bus verpasste? Dieser Polizist sprach so sanft, ein bisschen, als wenn er singen würde. Sicher nicht einer von hier. Nein, eher ein kleiner Mann aus dem Süden, mit seinem matten Teint und den gefurchten Zügen. Ihm hätte sie ihre Geschichte gern erzählt, aber der Vikar war in diesem Punkt sehr strikt gewesen. Es sollte der Kommissar Adamsberg sein und niemand anders. Und der Vikar war nicht irgendwer, er war ein Cousin des früheren Staatsanwalts von Rouen, der sich bei Polizisten sehr gut auskannte. Er hatte ihr den Namen von Adamsberg nur widerstrebend gegeben, ihr von ihrem Vorhaben abgeraten und war im Übrigen sicher, dass sie die Reise nicht machen würde. Aber sie konnte sich doch nicht einfach verkriechen, während die Ereignisse ihren Lauf nahmen. Wenn nun den Kindern etwas zustieße.
»Darüber kann ich nur mit diesem Kommissar reden.«
»Ich bin der Kommissar.«
Die kleine Frau war nahe daran, aus der Haut zu fahren, so schmächtig sie war.
»Und warum haben Sie das nicht gleich gesagt?«
»Ich weiß ja auch nicht, wer Sie sind.«
»Das würde nichts bringen. Man sagt seinen Namen, und dann plappert alle Welt ihn nach.«
»Und was macht das schon?«
»Ärger. Niemand darf etwas wissen.«
Intrigantin, dachte Adamsberg. Die vielleicht früher oder später an zwei dicken Klumpen Brotkrume im Hals ersticken würde. Eine Intrigantin jedoch, die eine bestimmte Sache heftig ängstigte. Und das ließ ihn nicht los. Leute, die sterben werden.
Sie waren umgekehrt und liefen zur Brigade zurück.
»Ich habe Ihnen ja nur helfen wollen. Ich hatte Sie schon eine ganze Weile da stehen sehen.«
»Und der Mann dahinten? Gehört der zu Ihnen? Hat der mich auch beobachtet?«
»Welcher Mann?«
»Dahinten, der mit den seltsamen Haaren, mit den orangefarbenen Strähnen, gehört der zu Ihnen?«
Adamsberg hob den Blick und sah in zwanzig Metern Entfernung Veyrenc im Torrahmen stehen. Er war nicht ins Gebäude hineingegangen, er wartete neben der Taube, die sich auch nicht fortbewegt hatte.
»Der«, sagte Adamsberg, »ist als Kind mit Messerstichen verletzt worden. Und über den Narben sind die Haare genau so nachgewachsen, rot. Ich rate Ihnen, niemals darauf anzuspielen.«
»Ich dachte mir nichts Böses dabei, ich kann mich nur nicht so gut ausdrücken. In Ordebec rede ich fast nie.«
»Das macht nichts.«
»Meine Kinder reden dagegen sehr viel.«
»So.«
Aber was hat diese Taube, verdammt?, dachte Adamsberg. Warum fliegt sie nicht weg?
Müde der Unentschlossenheit der kleinen Frau, ließ der Kommissar sie stehen und steuerte auf den reglosen Vogel zu, während Veyrenc mit seinem schweren Schritt an ihm vorbeiging. Sehr gut, sollte er sich doch um sie kümmern, wenn es denn überhaupt die Mühe lohnte. Er würde sehr gut damit klarkommen. Das gedrungene Gesicht von Veyrenc hatte etwas Überzeugendes, Glaubwürdiges, wobei ihm ein selten schönes Lächeln zu Hilfe kam, das die eine Seite seiner Oberlippe verführerisch nach oben zog. Ein eindeutiger Vorzug, den Adamsberg einst gehasst hatte und der sie in einen zerstörerischen Konflikt zueinander gebracht hatte.** Zurzeit waren beide darum bemüht, dessen restliche Spuren zu löschen. Während er die erstarrte Taube in seine hohlen Hände nahm, kam Veyrenc ohne alle Eile zu ihm zurück, gefolgt von der durchsichtigen kleinen Frau, die ein wenig schnell atmete. Im Grunde machte sie sich so unscheinbar, dass Adamsberg sie vielleicht gar nicht bemerkt hätte ohne die geblümte Bluse, die ihr einen Umriss gab.
»So eine Drecksgöre hat ihm die Beine zusammengebunden«, sagte er zu Veyrenc, während er den verschmutzten Vogel untersuchte.
»Sie befassen sich auch mit Tauben?«, fragte die Frau ohne eine Spur von Ironie. »Ich habe hier jede Menge Tauben gesehen, die machen viel Dreck.«
»Aber die hier«, meinte Adamsberg barsch, »ist nicht ›jede Menge‹, es ist einfach eine Taube, eine Taube für sich allein. Das ist der Unterschied.«
»Ja, natürlich«, sagte die Frau.
Verständnisvoll und letztendlich passiv. Vielleicht hatte er sich getäuscht, und sie würde nicht mit Brotkrume im Hals enden. Vielleicht war sie gar keine Intrigantin. Vielleicht hatte sie schlicht und einfach ein Problem.
»Sie lieben Tauben?«, fragte die Frau.
Adamsberg sah sie aus seinen verschwommenen Augen an.
»Nein«, sagte er. »Aber ich liebe auch keine kleinen Drecksgören, die ihnen die Füße zusammenbinden.«
»Ja, natürlich.«
»Ich weiß nicht, ob man dieses Spiel bei Ihnen kennt, aber in Paris gibt es das. Einen Vogel fangen, ihm beide Beine mit drei Zentimetern Schnur zusammenbinden. Dann kann die Taube nur noch mit ganz kleinen Hüpfern vorwärtskommen, und fliegen kann sie gar nicht mehr. Sie verendet langsam an Hunger und Durst. So geht das Spiel. Und ich verabscheue dieses Spiel und werde den Kerl finden, der sich daraus einen Spaß macht.«
Adamsberg ging durch das große Portal der Brigade und ließ die Frau und Veyrenc auf dem Bürgersteig zurück. Die Frau starrte unverwandt auf den Haarschopf des Lieutenant, der sehr dunkel war und von auffallend fuchsroten Strähnen durchzogen.
»Wird er sich wirklich damit befassen?«, fragte sie verdutzt. »Aber dafür ist es zu spät, wissen Sie. Ihr Kommissar hatte die Arme schon voller Flöhe. Der Beweis, dass die Taube nicht mehr die Kraft hat, für sich zu sorgen.«
Adamsberg vertraute den Vogel der Riesin in seiner Mannschaft an, Lieutenant Violette Retancourt, in blindem Vertrauen auf ihre Fähigkeiten, das Tier zu behandeln. Wenn Retancourt die Taube nicht rettete, würde kein anderer es vermögen. Die sehr große, füllige Frau hatte eine Grimasse gezogen, was kein gutes Zeichen war. Der Vogel war in einem üblen Zustand, die Haut an seinen Beinen war aufgeschlitzt durch seine erschöpfenden Versuche, sie aus der Schnur zu befreien, die bereits tief ins Fleisch geschnitten hatte. Sie war unterernährt und dehydriert, man würde sehen, was man tun könnte, hatte Retancourt geschlossen. Adamsberg nickte, er presste kurz die Lippen aufeinander wie jedes Mal, wenn er der Grausamkeit begegnete. Und dieses Stück Schnur gehörte dazu.
Veyrenc folgend, ging die kleine Frau mit instinktivem Respekt an der riesigen Polizistin vorbei. Die massige Frau war schon dabei, das Tier in ein feuchtes Tuch zu hüllen. Später, meinte sie zu Veyrenc, würde sie sich seine Beine vornehmen, um den Bindfaden herauszulösen. Von Violette Retancourts breiten Händen umschlossen, versuchte die Taube keinerlei Bewegung. Sie ließ alles über sich ergehen, wie jeder es getan hätte, ebenso ängstlich wie voll Bewunderung.
Die Frau nahm, nun schon etwas ruhiger, in Adamsbergs Büro Platz. Sie war so schmal, dass sie nur die Hälfte des Stuhls einnahm. Veyrenc postierte sich in einer Ecke und überschaute den Ort, der ihm vertraut gewesen war. Es blieben ihm noch dreieinhalb Stunden, um sich zu entscheiden. Eine Entscheidung, die er laut Adamsberg schon getroffen hatte, aber noch nicht kannte. Als er eben den großen Gemeinschaftssaal durchschritten hatte, war er dem feindseligen Blick von Commandant Danglard begegnet, der in den Aktenordnern wühlte. Nicht nur seine Verse mochte Danglard nicht, er hatte etwas gegen ihn selbst.
* Fred Vargas, Der verbotene Ort.
** Fred Vargas, Die dritte Jungfrau.
3
Die Frau hatte am Ende eingewilligt, ihren Namen zu nennen, und Adamsberg notierte ihn auf irgendeinem Blatt, eine Nachlässigkeit, die sie beunruhigte. Vielleicht hatte der Kommissar ja gar nicht die Absicht, sich mit ihr zu befassen.
»Valentine Vendermot, mit einem ›o‹ und einem ›t‹«, wiederholte er, denn er hatte so seine Schwierigkeiten mit neuen Wörtern und mehr noch mit Eigennamen. »Und Sie kommen aus Ardebec.«
»Ordebec. Im Calvados.«
»Sie sagten, Sie haben Kinder?«
»Vier. Drei Jungen und ein Mädchen. Ich bin Witwe.«
»Was ist vorgefallen?«
Wieder griff die Frau zu ihrer großen Tasche und zog eine Lokalzeitung heraus. Sie faltete sie leicht zitternd auseinander und legte sie auf den Tisch.
»Um diesen Mann geht es. Er ist verschwunden.«
»Wie ist sein Name?«
»Michel Herbier.«
»Ein Freund von Ihnen? Ein Verwandter?«
»O nein. So ziemlich das Gegenteil.«
»Das heißt?«
Adamsberg wartete geduldig auf die Antwort, die schwierig zu formulieren schien.
»Ich verabscheue ihn.«
»Ah, sehr gut«, sagte er und nahm sich die Zeitung.
Während Adamsberg sich auf den kurzen Artikel konzentrierte, betrachtete die Frau mit besorgten Blicken die Wände, besah sich die rechte, dann die linke Wand, ohne dass Adamsberg den Grund dieser Inspektion verstand. Irgendetwas machte ihr schon wieder Angst. Angst vor allem. Angst vor der Stadt, Angst vor den anderen, Angst vor dem Was-werden-die-Leute-sagen, Angst vor ihm. Wie er auch noch nicht verstanden hatte, warum sie bis hierher gekommen war und ihm von diesem Michel Herbier erzählte, wenn sie ihn hasste. Der Mann, Rentner, besessener Jäger, hatte mit seinem Mofa das Anwesen verlassen und war seitdem verschwunden. Nach einer Woche Abwesenheit waren die Gendarmen zu einer Sicherheitskontrolle bei ihm eingedrungen. Der Inhalt seiner beiden Gefriertruhen, die vollgestopft gewesen waren mit Wildbret aller Art, lag gänzlich über den Boden verteilt. Das war alles.
»Da kann ich mich nicht einmischen«, sagte Adamsberg entschuldigend, indem er ihr die Zeitung zurückgab. »Wenn dieser Mann verschwunden ist, verstehen Sie, dann ist dafür zwangsläufig die örtliche Gendarmerie zuständig. Und was auch immer Sie wissen, müssen Sie denen dort sagen.«
»Das ist unmöglich, Herr Kommissar.«
»Sie verstehen sich nicht gut mit der örtlichen Gendarmerie?«
»So ist es. Darum hat der Vikar mir Ihren Namen genannt. Darum habe ich auch diese Reise gemacht.«
»Um mir … was zu sagen, Madame Vendermot?«
Die Frau strich ihre geblümte Bluse glatt und senkte den Kopf. Das Sprechen fiel ihr leichter, wenn man sie nicht ansah.
»Was mit ihm passiert ist. Oder passieren wird. Er ist tot, oder aber er wird sterben, wenn man nichts unternimmt.«
»Allem Anschein nach ist der Mann einfach weggefahren, denn sein Mofa steht nicht mehr da. Weiß man, ob er irgendwelche Sachen mitgenommen hat?«
»Nichts außer einem seiner Gewehre. Er hat viele Gewehre.«
»Dann wird er nach einiger Zeit wiederkommen, Madame Vendermot. Sie wissen sicher, dass wir nicht berechtigt sind, einen erwachsenen Mann zu suchen, nur weil er für ein paar Tage verschwindet.«
»Er kommt nicht zurück, Kommissar. Das Mofa hat nichts zu bedeuten. Es ist weg, damit ihn keiner sucht.«
»Sagen Sie das, weil man ihn bedroht hat?«
»Ja.«
»Hat er einen Feind?«
»Heilige Muttergottes, den schrecklichsten aller Feinde, Kommissar.«
»Kennen Sie seinen Namen?«
»O Gott, den darf man nicht aussprechen.«
Adamsberg seufzte bekümmert, mehr ihret- als seinetwegen.
»Und Sie meinen, dieser Michel Herbier ist geflohen?«
»Nein, er weiß es ja nicht. Er ist bestimmt schon tot. Er war ergriffen worden, verstehen Sie.«
Adamsberg stand auf und lief einige Augenblicke von einer Wand zur anderen, die Hände in den Taschen vergraben.
»Madame Vendermot, ich will Ihnen ja gern zuhören, ich will sogar gern die Gendarmerie in Ordebec benachrichtigen. Aber ich kann nichts machen, solange ich nichts begreife. Entschuldigen Sie mich mal eine Sekunde.«
Er verließ sein Büro und ging zu Commandant Danglard hinüber, der noch immer sehr verdrossen über seinen Akten saß. Neben einigen Milliarden anderer Informationen hatte Danglard in seinem Gehirn fast alle Namen von Chefs und Unter-Chefs der Gendarmerien und Kommissariate Frankreichs gespeichert.
»Der Capitaine der Gendarmerie von Ordebec, sagt Ihnen der was, Danglard?«
»Ordebec im Calvados?«
»Ja.«
»Das ist Émeri, Louis Nicolas Émeri. Louis Nicolas in Anlehnung an seinen Vorfahren Louis Nicolas Davout, Marschall des Kaiserreichs, Befehlshaber des 3. Corps von Napoleons Grande Armée. Schlachten bei Ulm, Austerlitz, Preußisch Eylau, Wagram, Herzog von Auerstedt und Fürst von Eckmühl, nach dem Namen einer seiner berühmten Schlachten.«
»Danglard, es ist der Mensch von heute, der mich interessiert, der Bulle von Ordebec.«
»Ja, genau. Seine Herkunft zählt nämlich viel, er lässt niemanden darüber im Unklaren. Darum kann er mitunter etwas hochfahrend, stolz, martialisch auftreten. Bis auf dieses napoleonische Erbe aber ist er ein recht sympathischer Mann, sehr besonnen als Bulle, vorsichtig, vielleicht allzu vorsichtig. Um die vierzig. Hat sich in seinen früheren Dienststellen, in der Banlieue von Lyon, glaube ich, nicht sonderlich hervorgetan. Er will seine Ruhe haben in Ordebec. Es ist friedlich dort.«
Adamsberg kam in sein Büro zurück, wo die Frau in ihrer eingehenden Betrachtung der Wände fortgefahren war.
»Es ist nicht leicht, Kommissar, das wird mir jetzt klar. Weil es normalerweise nämlich verboten ist, darüber zu reden, verstehen Sie. Das kann schreckliches Ungemach heraufbeschwören. Sagen Sie, Ihre Wandregale, sind die wenigstens richtig angeschraubt? Weil, Sie haben schwere Schriftstücke nach oben gestellt und leichte nach unten. Das könnte durchaus mal auf die Leute runterstürzen. Man muss die schweren Sachen immer nach unten stellen.«
Angst vor den Bullen, Angst vor umfallenden Bücherwänden.
»Dieser Michel Herbier, warum verabscheuen Sie ihn?«
»Alle Welt verabscheut ihn, Kommissar. Er ist ein schrecklich brutaler Kerl, er war schon immer so. Niemand redet mit ihm.«
»Das könnte erklären, warum er Ordebec verlassen hat.«
Adamsberg nahm sich noch einmal die Zeitung.
»Er lebt allein«, sagte er, »er ist in Rente, vierundsechzig Jahre alt. Warum sollte er nicht woanders ein neues Leben beginnen? Hat er irgendwo Angehörige?«
»Er war mal verheiratet, früher. Er ist Witwer.«
»Seit wie vielen Jahren?«
»Oh. Über fünfzehn Jahre.«
»Begegnen Sie ihm von Zeit zu Zeit?«
»Ich sehe ihn nie. Da er ein bisschen außerhalb von Ordebec wohnt, ist es leicht, ihm aus dem Weg zu gehen. Und das ist allen recht so.«
»Aber dennoch haben sich Nachbarn Sorgen um ihn gemacht.«
»Ja, die Hébrards. Das sind rechtschaffene Leute. Sie haben ihn gegen sechs Uhr abends fortfahren sehen. Sie wohnen jenseits der kleinen Landstraße, verstehen Sie. Während er, er lebt fünfzig Meter weiter, schon fast im Bigard-Wäldchen drin, bei der alten Mülldeponie. Es ist feucht wie sonst was da.«
»Wieso haben die sich Sorgen gemacht, als sie ihn mit dem Mofa haben wegfahren sehen?«
»Weil er ihnen, wenn er eine Weile weg ist, für gewöhnlich den Briefkastenschlüssel dalässt. Aber diesmal nicht. Und sie haben ihn nicht zurückkommen hören. Und es war eine Menge Post da, sie ragte schon aus dem Kasten heraus. Also heißt das, Herbier ist nur für kurze Zeit weggefahren und durch irgendetwas daran gehindert worden zurückzukehren. Die Gendarmen sagen, sie haben ihn auch in keinem Krankenhaus gefunden.«
»Als sie sich das Haus angesehen haben, lag der Inhalt der Gefriertruhen über den ganzen Raum verstreut.«
»Ja.«
»Wozu hat er dieses ganze Fleisch? Hält er Hunde?«
»Er ist Jäger, also packt er sein Wildbret in Gefrierschränke. Er tötet viele Tiere, und er gibt nichts ab.« Die Frau erschauerte ein wenig. »Brigadier Blériot – der, der ist sehr nett zu mir, nicht wie der Capitaine Émeri – hat mir die Szene beschrieben. Es war grauenvoll, hat er gesagt. Auf dem Boden lag die eine Hälfte einer Bache, aber mit dem ganzen Kopf, mehrere Keulen von Hirschkühen, Häsinnen, Frischlinge, Rebhühner. Das alles einfach so hingeschmissen, Kommissar. Als die Gendarmen reinkamen, faulte das schon seit Tagen. Bei dieser Hitze ist das kreuzgefährlich, all diese Fäulnis.«
Angst vor Bücherwänden und Angst vor Mikroben. Adamsberg warf einen Blick auf die beiden großen Geweihstangen, die, von Staub bedeckt, noch immer auf dem Fußboden seines Büros lagen. Das fürstliche Geschenk just eines Normannen.
»Häsinnen, Hirschkühe? Ist ein guter Beobachter, Ihr Brigadier. Jagt er auch?«
»O nein. Wir sagen zwangsläufig ›Hirschkuh‹ oder ›Häsin‹, weil wir ja wissen, wie er ist, Herbier. Er ist ein widerlicher Jäger, ein Verbrecher. Er tötet nur Weibchen und Jungtiere, und ganze Würfe. Er schießt sogar auf trächtige Weibchen.«
»Woher wissen Sie das?«
»Alle Welt weiß das. Einmal ist Herbier verurteilt worden, weil er eine Bache mit ihren Kleinen im Gefolge getötet hatte. Auch Rehkitze. Was für ein Jammer. Aber da er das in der Nacht macht, kriegt Émeri ihn nie zu fassen. Fest steht jedenfalls, dass seit Langem kein Jäger mehr mit ihm auf die Jagd gehen will. Selbst die Schlächter unter ihnen, die auf alles schießen, was sich bewegt, wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aus der Jagdliga Ordebequer Flur ist er ausgeschlossen worden.«
»Demnach hat er Dutzende Feinde, Madame Vendermot.«
»Also, es ist eher so, dass niemand mit ihm verkehrt.«
»Meinen Sie, dass Jäger ihn umbringen würden? Ist es das? Oder auch Gegner der Jagd?«
»O nein, Kommissar. Den hat was ganz anderes ergriffen.«
Nachdem sie einen Augenblick lang recht mitteilsam gewesen war, zögerte die Frau von Neuem. Sie hatte immer noch Angst, aber Bücherwände schienen sie nicht mehr zu beunruhigen. Es war eine hartnäckige, tiefinnerliche Furcht, die Adamsbergs Aufmerksamkeit noch immer beschäftigte, während der Fall Herbier die Reise aus der Normandie nicht erfordert hätte.
»Wenn Sie nichts wissen«, fuhr er in müdem Ton fort, »oder wenn es Ihnen untersagt ist zu reden, kann ich Ihnen nicht helfen.«
Commandant Danglard war im Türrahmen aufgetaucht und machte ihm Zeichen höchster Dringlichkeit. Es gab Nachricht von dem achtjährigen Mädchen, das in den Wald von Versailles geflohen war, nachdem es eine Flasche Obstsaft auf dem Kopf seines Großonkels zerschlagen hatte. Der Mann hatte gerade noch das Telefon erreichen können, bevor er ohnmächtig zusammenbrach. Adamsberg gab Danglard wie der Frau zu verstehen, dass er zum Ende käme. Die Sommerferien hatten begonnen, in drei Tagen würde sich die Brigade um ein Drittel ihres Personals verkleinern, die laufenden Akten mussten abgearbeitet werden. Die Frau verstand, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb. In Paris nehmen sich die Leute nicht so viel Zeit, das hatte ihr schon der Vikar gesagt, selbst wenn dieser kleine Kommissar freundlich und geduldig mit ihr gewesen war.
»Lina, meine Tochter«, sagte sie darum hastig, »hat ihn gesehen. Herbier. Sie hat ihn zwei Wochen und zwei Tage vor seinem Verschwinden gesehen. Sie hat es ihrer Chefin erzählt, und am Ende hat ganz Ordebec es gewusst.«
Danglard war zu seinen Akten zurückgekehrt, ein Balken des Unmuts furchte seine breite Stirn. Er hatte Veyrenc in Adamsbergs Büro gesehen. Was hatte er da zu suchen? Würde er unterschreiben? Sich weiter verpflichten? Heute Abend sollte die Entscheidung fallen. Danglard blieb am Kopiergerät stehen und streichelte den dicken Kater, der sich dort fläzte, in seinem Fell ein wenig Trost suchend. Die Gründe seiner Antipathie gegenüber Veyrenc mochte er sich nicht eingestehen. Eine dumpfe und hartnäckige, nahezu weibliche Eifersucht, das zwingende Bedürfnis, ihn von Adamsberg fernzuhalten.
»Wir müssen uns beeilen, Madame Vendermot. Ihre Tochter hat ihn gesehen, und irgendwas hat sie auf den Gedanken gebracht, er würde ermordet werden?«
»Ja. Er schrie. Und noch drei andere waren mit ihm. Es war in der Nacht.«
»Gab es eine Schlägerei? Wegen der Hirschkühe und der Rebhühner? Während einer Versammlung? Bei einem Essen unter Jägern?«
»O nein.«
»Kommen Sie morgen wieder oder später noch einmal«, sagte Adamsberg schließlich, während er zur Tür ging. »Kommen Sie wieder, wenn Sie reden können.«
Danglard erwartete den Kommissar, mit verdrossener Miene auf einer Ecke seines Schreibtischs sitzend.
»Haben wir das Mädchen?«, fragte Adamsberg.
»Die Jungs haben sie aus einem Baum heruntergeholt. Sie war ganz nach oben geklettert, wie ein junger Jaguar. Sie hält eine Rennmaus in den Händen, die will sie nicht loslassen. Die Rennmaus scheint okay zu sein.«
»Eine Rennmaus, Danglard?«
»Ein kleines Nagetier. Die Kinder sind verrückt danach.«
»Und die Kleine? In welcher Verfassung ist sie?«
»Ungefähr wie Ihre Taube. Ausgehungert, durstig und todmüde. Sie wird versorgt. Eine der Krankenschwestern weigert sich, ihr Zimmer zu betreten, wegen der Rennmaus, die sich unters Bett geflüchtet hat.«
»Hat sie eine Erklärung für ihre Tat?«
»Nein.«
Danglard antwortete reserviert, er kaute auf seinen Sorgen herum. Der Tag ließ sich nicht sehr gesprächig an.
»Weiß sie, dass ihr Großonkel noch mal davongekommen ist?«
»Ja. Sie schien erleichtert und zugleich enttäuscht. Sie lebte ganz allein da drin mit ihm seit wer weiß wie lange, sie hat noch nie einen Fuß in die Schule gesetzt. Wir sind überhaupt nicht mehr sicher, ob er ein Großonkel ist.«
»Gut, wir übergeben die Fortsetzung an Versailles. Aber sagen Sie dem Lieutenant, der die Sache übernimmt, er soll die Rennmaus der Kleinen nicht töten. Man soll sie in einen Käfig tun und mit Nahrung versorgen.«
»Ist das so dringend?«
»Gewiss, Danglard, vielleicht ist die Maus alles, was das Kind hat. Einen Moment.«
Adamsberg eilte zum Büro von Retancourt, die dabei war, die Beine der Taube mit Wasser zu benetzen.
»Haben Sie sie desinfiziert, Lieutenant?«
»Immer langsam«, erwiderte Retancourt, »ich musste sie erst rehydrieren.«
»Sehr gut, und werfen Sie die Schnur nicht weg, ich will Proben davon nehmen lassen. Justin hat den Techniker schon bestellt, er ist auf dem Weg.«
»Sie hat auf mich draufgeschissen«, bemerkte Retancourt seelenruhig. »Was will sie, diese kleine Frau?«, fragte sie und deutete auf sein Büro.
»Irgendetwas sagen, was sie nicht sagen will. Die Unschlüssigkeit in Person. Sie wird von allein gehen, oder wir schmeißen sie bei Büroschluss raus.«
Retancourt zuckte ein wenig verächtlich die Schultern, Unschlüssigkeit war ein Phänomen, das ihrer Handlungsweise fremd war. Von daher besaß sie eine Antriebsdynamik, welche die der siebenundzwanzig anderen Mitglieder der Brigade bei Weitem übertraf.
»Und Veyrenc? Ist der auch immer noch unschlüssig?«
»Veyrenc hat sich seit Langem entschieden. Bulle oder Lehrer, was würden Sie machen? Unterrichten ist eine Tugend, die verbittert. Bullenarbeit ist ein Laster, das überheblich macht. Und da es leichter ist, eine Tugend aufzugeben als ein Laster, hat er keine Wahl. Ich seh mal nach dem sogenannten Großonkel im Krankenhaus von Versailles.«
»Was machen wir mit der Taube? Bei mir zu Hause kann ich sie nicht behalten, mein Bruder ist allergisch gegen Federn.«
»Ihr Bruder lebt bei Ihnen?«
»Vorübergehend. Er hat seinen Job verloren, er hat eine Kiste mit Bolzen in der Garage geklaut, und ein paar Ölkännchen.«
»Können Sie ihn heute Abend bei mir vorbeibringen? Den Vogel, meine ich.«
»Kann ich«, brummte Retancourt.
»Passen Sie auf, im Garten stromern Katzen herum.«
Die Hand der kleinen Frau legte sich schüchtern auf seine Schulter. Adamsberg wandte sich um.
»Ja?«
»In jener Nacht«, sagte sie langsam, »hat Lina das Wütende Heer vorüberreiten sehen.«
»Wen?«
»Das Wütende Heer«, wiederholte die Frau mit leiser Stimme. »Und Herbier war unter ihnen. Und er schrie. Und noch drei andere.«
»Ist das ein Verein? Irgendwas, das mit der Jagd zu tun hat?«
Madame Vendermot sah Adamsberg ungläubig an.
»Das Wütende Heer«, sagte sie wieder sehr leise. »Die Wilde Jagd. Sie wissen nicht?«
»Nein«, sagte Adamsberg und hielt ihrem erstaunten Blick stand. »Kommen Sie ein andermal wieder, dann erklären Sie es mir.«
»Wie, Sie kennen nicht mal ihren Namen? Die Mesnie Hellequin?«, flüsterte sie.
»Nein, tut mir leid«, wiederholte Adamsberg und ging mit ihr zu seinem Büro zurück. »Veyrenc, das Verwegene Heer, kennen Sie die Truppe?«, fragte er, während er seine Schlüssel und sein Mobiltelefon einsteckte.
»Wütende«, korrigierte die Frau.
»Ja. Die Tochter von Madame Vendermot hat den Verschollenen mit ihm gesehen.«
»Und noch ein paar andere«, beharrte die Frau. »Jean Glayeux und Michel Mortembot. Aber den Vierten hat meine Tochter nicht erkannt.«
Ein Ausdruck heftiger Überraschung glitt über Veyrenc’ Gesicht, dann lächelte er leicht, die Oberlippe lüpfend. Wie ein Mensch, dem man ein ganz unerwartetes Geschenk macht.
»Ihre Tochter hat das Heer tatsächlich gesehen?«, fragte er.
»Ja, sicher.«
»Und wo?«
»Da, wo es bei uns vorüberzieht. Auf dem Weg von Bonneval, im Wald von Alance. Da ist es immer durchgeritten.«
»Wohnt sie dort gegenüber?«
»Nein, wir wohnen mehr als drei Kilometer weit weg.«
»Ist sie hingegangen, um es zu sehen?«
»Nein, das schon gar nicht. Lina ist ein sehr vernünftiges Mädchen, sehr besonnen. Sie war eben da, Punkt.«
»In der Nacht?«
»Sie kommt immer nachts da durch.«
Adamsberg zog die kleine Frau mit sich aus dem Büro und bat sie, am folgenden Tag wiederzukommen oder ihn demnächst noch einmal anzurufen, wenn alles in ihrem Kopf ein wenig klarer wäre. Veyrenc, auf einem Stift herumkauend, hielt ihn diskret zurück.
»Jean-Baptiste«, fragte er, »hast du wirklich nie davon gehört? Von dem Wütenden Heer?«
Adamsberg schüttelte den Kopf, wobei er sich mit den Fingern rasch die Haare kämmte.
»Dann frag mal Danglard«, insistierte Veyrenc. »Das wird ihn sehr interessieren.«
»Warum?«
»Weil es, soviel ich weiß, die Ankündigung einer Erschütterung ist. Einer verdammt heftigen Erschütterung vielleicht.«
Wieder lächelte Veyrenc kaum merklich, und als hätte das plötzliche Auftauchen dieses Wütenden Heeres ihn auf einmal überzeugt, unterschrieb er.
4
Als Adamsberg nach Hause kam, viel später als gedacht – der Großonkel war eine harte Nuss gewesen –, stand sein Nachbar, der alte Spanier Lucio, in der Abendwärme und pisste geräuschvoll an den Baum im kleinen Garten.
»Hallo, Hombre«, sagte der Alte, ohne sich zu unterbrechen. »Einer von deinen Lieutenants wartet auf dich. Eine ziemlich stämmige, gute Frau, hoch und breit wie ein Turm. Dein Junge hat ihr aufgemacht.«
»Das ist keine stämmige, gute Frau, Lucio, das ist eine Göttin, eine vielseitige Göttin.«
»Ah, die ist das?«, sagte Lucio und zog seine Hose zurecht. »Von der du die ganze Zeit sprichst?«
»Ja, die Göttin. Also kann sie auch nicht wie alle Welt aussehen. Weißt du, was das ist? Das Verwegene Heer? Hast du diesen Begriff schon mal gehört?«
»Nein, Hombre.«
Lieutenant Retancourt und Adamsbergs Sohn Zerk – er hieß in Wirklichkeit Armel, aber der Kommissar hatte sich in den nur sieben Wochen, seitdem er ihn kannte, noch nicht daran gewöhnt – standen beide in der Küche, mit Zigarette im Mundwinkel, über einen mit Watte ausgelegten Korb gebeugt. Sie wandten nicht den Kopf, als Adamsberg eintrat.
»Hast du’s nun kapiert oder nicht?«, sagte Retancourt barsch zu dem jungen Mann. »Du befeuchtest kleine Stückchen Zwieback, nicht groß, und führst sie ihr ganz behutsam in den Schnabel ein. Danach ein paar Tropfen Wasser mit der Pipette, nicht zu viel am Anfang. Dann einen Tropfen aus diesem Fläschchen. Das ist ein Stärkungsmittel.«
»Sie lebt noch?«, erkundigte sich Adamsberg, er fühlte sich seltsam fremd in seiner eigenen Küche, wie sie da von der großen Frau und diesem unbekannten Sohn von achtundzwanzig Jahren eingenommen war.
Retancourt richtete sich auf und legte ihre Hände flach auf die Hüften.
»Es ist nicht sicher, ob sie die Nacht übersteht. Fazit, ich habe über eine Stunde gebraucht, die Schnur von ihren Beinen zu lösen, sie hatte sich bis zum Knochen eingeschnitten, sie muss tagelang daran herumgezerrt haben. Aber er ist nicht gebrochen. Es ist alles desinfiziert, der Verband muss jeden Morgen gewechselt werden. Der Mull ist da drin«, sagte sie und schlug auf eine kleine Schachtel auf dem Tisch. »Sie hat ein Flohmittel bekommen, das müsste ihr auch von daher Erleichterung verschaffen.«
»Danke, Retancourt. Hat der von der Spurensicherung die Schnur mitgenommen?«
»Hat er. Was nicht ganz einfach war, da das Labor nicht für die Analyse von Taubenfesseln bezahlt wird. Es ist übrigens ein Täuberich. Hat Voisenet gesagt.«
Lieutenant Voisenet hatte seine Berufung zum Zoologen verfehlt, auf gebieterischen Befehl eines Vaters, der ihn ohne jede Diskussion in die Polizei gesteckt hatte. Voisenet war auf Fische spezialisiert, Meeres- und vor allem Flussfische, und auf seinem Schreibtisch stapelten sich die Zeitschriften für Ichthyologie. Aber er war auch sehr bewandert auf vielen anderen Gebieten der Fauna, von Insekten bis zu Fledermäusen, auf dem Umweg über das Gnu, und dieses Wissen lenkte ihn zum Teil von seinen dienstlichen Pflichten ab. Der Divisionnaire, der von dieser Entartung erfahren hatte, hatte ihm eine Abmahnung erteilt wie zuvor schon dem Lieutenant Mercadet, der an Hypersomnie litt. Doch wer in dieser Brigade, fragte sich Adamsberg, hatte nicht seine Macke? Es sei denn Retancourt, aber deren Fähigkeiten und Energien wichen ebenfalls etwas von der Norm ab.
Nachdem die Polizistin gegangen war, stand Zerk mit hängenden Armen da, den Blick noch immer auf die Tür gerichtet.
»Sie hat dich beeindruckt, was?«, meinte Adamsberg. »Sie beeindruckt jeden beim ersten Mal. Und alle folgenden Male auch.«
»Sie ist sehr schön«, sagte Zerk.
Adamsberg sah seinen Sohn erstaunt an, denn Schönheit war nun gewiss nicht das vorherrschende Merkmal von Violette Retancourt. Ebenso wenig Anmut und Feingefühl, oder Liebenswürdigkeit. Sie war in allen Punkten das Gegenteil zum zarten und zerbrechlichen Liebreiz, der sich mit ihrem Vornamen, dem Veilchen, verband. Obwohl ihr Gesicht fein gezeichnet war, war es doch eingerahmt von breiten Wangen und mächtigen Kieferknochen, die auf einem Stiernacken ruhten.
»Wie du meinst«, sagte Adamsberg zustimmend, denn er hatte keine Lust, über den Geschmack eines jungen Mannes zu streiten, den er noch nicht kannte.
Wie er sich auch über seine Intelligenz noch keine feste Meinung gebildet hatte. Besaß er eine oder nicht? Oder ein wenig? Eines beruhigte den Kommissar: dass die meisten Leute sich auch über seine, Adamsbergs Intelligenz noch immer nicht im Klaren waren, nicht mal er selbst. Er stellte sich keine Fragen darüber, warum also sollte er sich über die Intelligenz von Zerk den Kopf zerbrechen? Veyrenc hatte ihm versichert, dass der Junge begabt sei, doch Adamsberg hatte noch nicht bemerkt, wofür.
»Die Verwegene Armee, sagt dir das was?«, fragte Adamsberg, während er den Korb mit der Taube vorsichtig auf die Anrichte stellte.
»Die was?«, fragte Zerk und machte sich daran, den Tisch zu decken, die Gabeln rechts und die Messer links vom Teller, genau wie sein Vater.
»Ach, lass es. Wir werden Danglard danach fragen. Das gehört zu den Dingen, die ich deinem Bruder schon mit sieben Monaten beigebracht habe. Die ich auch dir beigebracht hätte, wenn ich dich in dem Alter gekannt hätte. Es gibt drei Regeln zu beachten, Zerk, und damit bist du aus dem Schneider: Wenn man eine Sache nicht bis zum Ende durchstehen kann, muss man Veyrenc fragen. Wenn einem etwas Schwieriges nicht gelingt, muss man Retancourt fragen. Und wenn man etwas nicht weiß, muss man Danglard fragen. Diese drei Dinge musst du verinnerlichen. Aber heute Abend wird Danglard ziemlich sauer sein, ich weiß nicht, ob wir da viel aus ihm rauskriegen. Veyrenc kehrt in die Brigade zurück, und das wird ihm nicht schmecken. Danglard ist ein Luxusgeschöpf und wie jeder seltene Gegenstand zerbrechlich.«
Adamsberg rief seinen dienstältesten Stellvertreter an, während Zerk das Abendessen servierte. Gedünsteten Thunfisch mit Zucchini und Tomaten, dazu Reis, zum Nachtisch Früchte. Zerk hatte darum gebeten, eine Zeitlang bei seinem neuen Vater wohnen zu dürfen, und die zwischen ihnen geschlossene Übereinkunft sah vor, dass er für das Abendessen sorgte. Was leicht umzusetzen war, denn Adamsberg war nahezu gleichgültig gegenüber dem, was er aß, er konnte ewig den gleichen Teller Pasta hinunterschlingen, wie er auch ständig das Gleiche anzog, Jacke und Hose aus schwarzem Leinen, wie immer das Wetter war.
»Danglard weiß wirklich alles?«, fragte der junge Mann und runzelte die Brauen, die ebenso buschig waren wie die seines Vaters, bei dem sie eine Art urwüchsiges Vordach über seinem verschwommenen Blick bildeten.
»Nein, es gibt viele Dinge, die er nicht weiß. Er weiß nicht, wie man eine Frau findet, obwohl er seit zwei Monaten eine neue Freundin hat, was schon ein außergewöhnliches Ereignis ist. Er weiß nicht, wo man Wasser suchen muss, aber Weißwein findet er ziemlich schnell; er weiß seine Ängste nicht zu beherrschen noch die Menge seiner Fragen zu vergessen, die sich zu einem ungeheuren Haufen auftürmen, den er unablässig durchforscht wie ein Biber seinen Bau. Er versteht nicht zu rennen, er versteht nicht zu beobachten, wie der Regen fällt oder der Fluss fließt, er versteht es nicht, über die Sorgen des Lebens hinwegzusehen, ja, er denkt sie sich schon im Vorhinein aus, damit sie ihn nicht überraschen. Dagegen weiß er alles, was auf den ersten Blick nicht von Nutzen ist. Alle Bibliotheken dieser Welt haben Eingang gefunden in Danglards Kopf, und noch immer ist da eine Menge Platz drin. Das ist etwas Kolossales, Unerhörtes, etwas, das ich dir nicht beschreiben kann.«
»Und wenn es auf den ersten Blick nicht von Nutzen ist?«
»Dann zwangsläufig auf den zweiten oder fünften Blick.«
»Ach so«, sagte Zerk, offensichtlich zufrieden mit der Antwort. »Ich selbst weiß nicht, was ich weiß. Was denkst du, was ich weiß?«
»Dasselbe wie ich.«
»Das heißt?«
»Ich weiß nicht, Zerk.«
Adamsberg hob eine Hand zum Zeichen, dass er Danglard endlich erreicht hatte.
»Danglard? Schläft alles bei Ihnen? Können Sie auf einen Sprung vorbeikommen?«
»Wenn es um die Taubenpflege geht, dann muss ich passen. Das Tier ist voller Flöhe, und ich habe eine schlechte Erinnerung an Flöhe. Ihren Kopf unterm Mikroskop mag ich auch nicht noch mal sehen.«
Zerk sah auf die beiden Uhren seines Vaters. 21 Uhr. Violette hatte befohlen, die Taube jede Stunde zu nähren und ihr zu trinken zu geben. Er weichte Zwiebackstückchen ein, füllte die Pipette mit Wasser, gab einen Tropfen von dem Stärkungsmittel hinzu und machte sich an seine Aufgabe. Das Tier hielt die Augen geschlossen, nahm aber die Nahrung an, die der junge Mann ihm in den Schnabel füllte. Zerk hob sanft den Körper der Taube an, wie Violette es ihm gezeigt hatte. Diese Frau war ein Schock für ihn gewesen. Er hätte nie geglaubt, dass es ein derartiges Geschöpf geben könnte. Er sah ihre großen Hände vor sich, wie sie geschickt mit dem Vogel umgingen, ihre kurzen blonden, zum Tisch hin fallenden Haare, die sich in ihrem breiten Nacken ringelten, der von einem zarten weißen Flaum überzogen war.
»Um die Taube kümmert sich Zerk. Und Flöhe hat sie keine mehr. Retancourt hat das Problem erledigt.«
»Also was dann?«
»Da ist eine Sache, die mir keine Ruhe lässt, Danglard. Die kleine Frau mit der geblümten Bluse, die vorhin bei uns war, haben Sie die bemerkt?«
»Wenn man so will, ja. Ein spezieller Fall von Unbeständigkeit, von physischer Vergänglichkeit. Sie würde wegfliegen, wenn man sie anpusten würde, wie die Achänen vom Löwenzahn.«
»Die Achänen, Danglard?«
»Die Samenkörner des Löwenzahns, die von ihren flaumigen Flugschirmen getragen werden. Haben Sie niemals als Kind da draufgepustet?«
»Na sicher. Alle haben wir auf Pusteblumen geblasen. Aber ich wusste nicht, dass die Dinger Achänen heißen.«
»Ja.«
»Doch abgesehen von ihrem flaumigen Fallschirm, Danglard, war die kleine Frau wie gelähmt vor Schrecken.«
»Habe ich nicht bemerkt.«
»Doch, Danglard. Schrecken in Reinkultur, Schrecken, wie aus tiefster Seele gekommen.«
»Hat sie Ihnen gesagt, warum?«
»Es ist ihr scheinbar verboten, darüber zu reden. Bei Todesstrafe, nehme ich an. Aber sie hat mir mit leiser Stimme einen Hinweis gegeben. Ihre Tochter hat das Verwegene Heer vorüberrasen sehen. Wissen Sie, was sie damit meint?«
»Nein.«
Adamsberg war grausam enttäuscht, nahezu gedemütigt, als hätte er vor seinem Sohn soeben versagt, sein Versprechen nicht eingelöst. Er begegnete Zerks gespanntem Blick und gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen, dass die Beweisführung noch nicht beendet sei.
»Veyrenc scheint zu wissen, worum es sich handelt«, fuhr Adamsberg fort, »er hat mir geraten, Sie zu konsultieren.«
»Ach ja?«, sagte Danglard in etwas lebhafterem Ton, die Erwähnung Veyrenc’ schien ihn in Unruhe zu versetzen wie der Anflug einer Hornisse. »Was genau hat er denn gehört?«
»Dass ihre Tochter in einer Nacht das Verwegene Heer gesehen hat. Und dass diese Tochter – sie heißt Lina – noch einen Jäger und drei andere Kerle in der Bande erkannt hat. Der Jäger ist seit über einer Woche verschwunden, sie meint, dass er tot ist.«
»Wo? Wo hat sie das alles gesehen?«
»Auf einem Weg dort in ihrer Nähe. In der Gegend von Ordebec.«