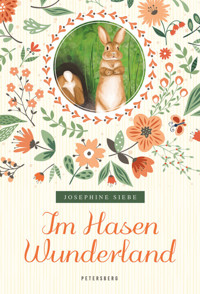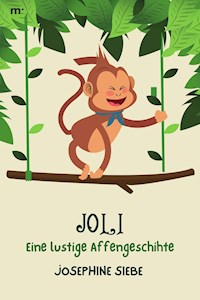0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Josephine Siebes Buch 'Die Oberheudorfer in der Stadt' ist eine faszinierende Darstellung des Lebens einer ländlichen Gemeinde, die plötzlich in eine städtische Umgebung versetzt wird. Siebes literarischer Stil zeichnet sich durch seine feine Beobachtungsgabe und seine authentischen Dialoge aus, die dem Leser ein tieferes Verständnis für die Protagonisten vermitteln. Das Buch spielt in der Zeit des Industrialisierung und beleuchtet die Konflikte und Herausforderungen, mit denen die ländlichen Bewohner konfrontiert sind, wenn sie sich an das Stadtleben anpassen müssen. Siebes Werk ist ein wichtiges Zeugnis für die sozialen Veränderungen jener Zeit und bietet eine einzigartige Perspektive auf das Leben in dieser Übergangsperiode.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Die Oberheudorfer in der Stadt
Inhaltsverzeichnis
Auf dem Johannesplan.
Auf den Stufen, die zu der altersgrauen Stadtkirche von Feldburg emporführten, saßen drei Kinder: zwei Buben und ein Mädel. Es war just um die Zeit, da es die Blumen schrecklich langweilig finden, immer warm und wohlbehütet im braunen Erdbettchen zu liegen, und lieber hinaus wollen, um die Sonne zu sehen und den blauen Himmel. Auch die drei Kinder ließen sich die Frühlingssonne behaglich auf die Nasen scheinen. Mit untergeschlagenen Armen und weit vorgestreckten Füßen saßen die drei da und schauten unverwandt nach einem kleinen Haus hinüber, das in einem Winkel lag. An dem Haus war eigentlich nicht viel zu sehen. Es war das unscheinbarste und kleinste am Johannesplan – so wurde der Kirchplatz genannt. Ein bissel schüchtern und schief stand es in seinem Eckchen, zwei vornehme Nachbarn zur Seite. Links wurde es von dem Schulhof des Gymnasiums begrenzt, zur rechten Seite stand ein prächtiges, altertümliches Haus. Recht vornehm, ja beinahe hochmütig sah das aus; seine Fenster waren fest verschlossen und verhüllt, und über dem breiten Tor trug es ein großes steinernes Wappen.
»Es ist noch immer zu,« sagte das eine Mädel und warf einen flüchtigen Blick auf die verhängten Fenster des großen Hauses. Die Kleine seufzte, und da keiner der Buben etwas sagte, begann sie wieder: »Ich möchte nur wissen, wann er kommt!«
»Wer?« fragte der eine Junge kurz, »der Professor oder der Junge aus Oberheudorf?«
»Natürlich der Junge!« rief das Mädel, verwundert, daß der Gefährte überhaupt fragen konnte.
Der, ein stämmiger, hellblonder Junge, dem eine kleine, lustige Himmelfahrtsnase keck im runden Gesicht stand, brummte etwas mürrisch: »Du bist ganz verdreht mit deinem Oberheudorfer Jungen, Füchslein. Wer weiß, was du gehört hast!«
»Ich habe schon recht gehört; Fräulein Wunderlich hat es meiner Mutter erzählt, sie bekämen einen Jungen aus Oberheudorf in Pension, für den der Graf Dachhausen alles bezahle. Freilich, das Warten ist langweilig.«
Die Kleine stand auf und rekelte sich. Sie war ein feines, hübsches Ding mit einem Paar rotblonder Zöpfe und braunen, lachenden Augen. Um der roten Haare willen nannten ihr Bruder Ulrich und ihr Freund Jobst sie »das Füchslein«; der Neckname kränkte sie aber nicht, ja sie war schon so daran gewöhnt, daß sie fast erstaunt war, wenn sie einmal jemand mit ihrem Taufnamen Marianne ansprach.
»Sei nicht so ungeduldig!« knurrte Ulli und sah gelassen weiter nach dem Häuschen hinüber. Einmal würde ja dort die Türe aufgehen, und er, Ulrich Sonntag, hatte das Warten gelernt. So rasch und flink in Wort und Tat das Füchslein war, so langsam und bedächtig war ihr Bruder Ulli. Dem spazierte jedes Wort immer fein sacht aus dem Munde heraus, und die Schwester sagte manchmal ungeduldig: »Du sagst aber auch erst zu Mittag guten Morgen, so lange dauert es bei dir!«
»Ist besser, als vor Eifer mit der Nase in die Suppenschüssel fallen,« gab dann wohl der Bruder zurück. Da lachte die Schwester, und die beiden waren wieder die allerbesten Freunde; langes Bösesein kannten sie nicht.
»Jetzt wird die Türe aufgemacht,« schrie Marianne Sonntag plötzlich. »Vater Wunderlich ist's, der sagt uns, ob der Junge wirklich kommt.« Sie schnellte auf und raste über den Platz nach dem kleinen Haus hinüber, aus dem jetzt ein alter Herr trat. Jobst rannte der Freundin nach, Ulrich aber blieb sitzen, er dachte gelassen: »Sie werden schon herüber kommen.«
Sie kamen auch wirklich, denn Herr Matthias Wunderlich wollte in die Kirche gehen. Das Füchslein hing an seinem Arm und schwatzte: »Vater Wunderlich, ist das wahr, kommt ein Junge aus Oberheudorf zu dir, und ist das der, von dem mein Onkel Doktor sagt, er wäre ein kleiner Held, weil er einmal im Winter bei Gewitter–––«
»Aber Füchslein,« rief Jobst lachend, »bei einem Schneesturm war es doch.«
»Ach ja, das meine ich doch auch,« sagte Marianne verlegen. Sie redete nämlich mitunter wirklich so geschwind, daß etwas anderes herauskam, als sie sagen wollte.
Der Organist hatte es aber doch verstanden, und just am Fuße der Treppe, so daß Ulli die Antwort hören konnte, erwiderte er freundlich: »Ich weiß schon, was du meinst, Mädel. Ja, das ist der Junge, der einmal, um Medizin für seine kranke Pflegemutter zu holen, den weiten Weg von Oberheudorf bis hierher gelaufen ist; er wäre ja damals beinahe im Schnee umgekommen!«
»Und was will er hier, warum kommt er her?« rief das Füchslein und hielt den alten Mann fest, der gerade den riesigen Schlüssel in das Schloß der Kirchtüre stecken wollte.
»Lernen soll er hier, auf das Gymnasium gehen.«
»Ein Junge aus 'nem Dorf auf das Gymnasium?« schrie Jobst und sah so hochmütig drein, als wäre Gymnasiastsein die höchste Würde.
»Warum nicht, wenn er gut lernt?« Vater Wunderlich schaute Jobst von Hellfeld mit seinen klaren, guten Augen ernst an. »Dieser Friede, der zu mir kommt, ist ein armer Waisenjunge, und wenn man den auf das Gymnasium schickt, muß er doch schon ein besonders fleißiger Bube sein!«
»Ich bin schrecklich neugierig auf ihn,« versicherte das Füchslein eifrig, »o so neugierig! Wann kommt er denn, und wie heißt er weiter, und warum kommt er gerade zu dir, Vater Wunderlich, und wie sieht er aus?«
»Wie er aussieht, wirst du ja sehen. Zu mir kommt er, weil der Lehrer in Oberheudorf mich kennt; der bat mich auch, den Jungen wenigstens auf ein halbes Jahr zu nehmen, bis er sich etwas an die Stadt gewöhnt hat.«
»Wenn – – wenn – – er sich aber draußen nicht die Schuhe abstreicht?« fragte Füchslein ganz ängstlich.
Fräulein Wunderlich war nämlich als sehr ordnungsliebend bekannt, und fast jedes Kind, das in das Haus kam, hatte schon tüchtige Schelte bekommen wegen unsauberer Schuhe, nasser Regenschirme und dergleichen. Einen Schmutztaps auf den weißgescheuerten Treppen konnte das Fräulein nicht vertragen. Und dabei kamen viele Kinder in das Haus, denn der Organist Wunderlich war ein sehr gesuchter Musiklehrer.
»Dann wird sie wohl schelten,« sagte der alte Mann und seufzte ein klein wenig bei des Füchsleins ängstlicher Frage. »Aber nun laß mich los, Kind, ich muß in die Kirche gehen, meine Orgel verlangt nach mir.«
»Ach bitte, bitte,« flehte Marianne und hielt den Organisten ganz fest, »sage mir noch, liebster, bester Vater Wunderlich, wird wirklich über die Oberheudorfer Kinder ein Buch geschrieben?«
Der alte Herr lachte: »Ja, man sagt so, Kind. Die Oberheudorfer meinen, ihre Kinder machten so viele dumme und lustige Streiche, daß man gleich ein paar Bücher davon schreiben könnte. Und wahr ist's ja: wie mein künftiger Pflegesohn zu seiner Pflegemutter gekommen ist, und daß man ihn hierher schickt auf das Gymnasium, das sind lauter lustige und auch ein bißchen ernsthafte Geschichten.«
»Ach, ich verhungere schon vor Neugier auf den Jungen,« rief das Füchslein, »wäre er doch erst da!«
»Abwarten und Tee trinken, sagte meine Mutter schon.« Vater Wunderlich hatte nun wirklich die Kirchentüre aufgeschlossen. Er befreite sich von Mariannes Händchen, nickte den Kindern freundlich zu und trat in die Kirche. Sonst schlüpften die drei ihm gerne nach und lauschten still auf einer Bank den schönen Klängen der Orgel; heute waren sie, besonders das Füchslein, zu ungeduldig. »Ich muß essen,« sagte das Mädel seufzend; »wenn ich warten muß, fährt's mir allemal in den Magen.«
Die Buben waren damit einverstanden, ihr Vesperbrot zu verzehren. Hunger hatten sie immer, und ob der von der Neugierde oder von der Ungeduld kam, war ihnen gleichgültig, Hunger ist Hunger.
Während alle drei schmausten, redete das Füchslein wieder von dem Oberheudorfer Jungen. In dem Hause der Sonntags – es war ein altes, wohlhabendes Kaufmannshaus – diente ein Mädchen, das aus Berenbach bei Oberheudorf stammte. Diese Katerliese – sie hieß Katharina Luise und wurde von den Kindern einfach Katerliese genannt – hatte viel von dem freundlichen Dorf erzählt, von den Bergen, Wäldern und Tälern der Heimat; ihrer Meinung nach gab es nichts Schöneres auf der Welt als Berenbach und Oberheudorf. Sie pflegte zu sagen: »Die Oberheudorfer sind was Besonderes; was wo anders eine Dummheit ist, wird bei ihnen eine lustige Geschichte.«
»Katerliese sagt,« begann Marianne gerade wieder zwischen Kauen und Schlucken, »in Oberheudorf––«
»Nun sei schon damit still,« schrie Jobst von Hellfeld plötzlich, »du redest immer nur von Oberheudorf, und wie es meinen Kaninchen geht, danach fragst du nicht.«
Das Füchslein lachte, schlang den Arm um den Freund und sagte neckend: »Tu doch nicht so, bist ja auch neugierig; aber erzähl', ist der neue Stall schon fertig?«
Während die Kinder draußen auf der Kirchentreppe im Sonnenschein saßen und von den Kaninchen, Ullis Schildkröten, Oberheudorf und der Schule, die am Mittwoch beginnen sollte, plauderten, saß drinnen Herr Wunderlich an seiner Orgel und spielte leise; nur mit halben Gedanken war er beim Spiel. Dem freundlichen alten Manne war das Herz ein bißchen schwer. Als sein Verwandter, der Lehrer von Oberheudorf, ihn gefragt, ob er wohl für einige Zeit einen Buben in sein Haus aufnehmen wollte, hatte er gleich zugesagt. Was er von diesem Friede hörte, gefiel ihm sehr; er dachte, der würde ein recht guter, kleiner Hausgenosse sein. Ein braver, fleißiger Junge sollte dieser Friede sein, ein armes Waisenkind, dem sie im Dorf alle herzlich die Freistelle am Gymnasium in Feldburg gönnten, ihm und seiner braven Pflegemutter. So gern Herr Wunderlich ja gesagt hatte, so ungern tat es nachher seine Schwester; die seufzte von früh bis abends: »Der Junge wird uns eine rechte Last sein.«
Hörte sie jetzt von einer Bubendummheit, dann sagte sie gewiß: »So was wird der Friede auch anstellen!« Kamen mit Lärm und Geschrei die Gymnasiasten über den Johannesplan, dann seufzte sie: »Bald wird in unserem Haus auch solcher Lärm sein!«
Das Fräulein war eigentlich nicht böse, nur sehr heftig und leicht erzürnt, auch wollte sie immer recht behalten. Weil sie nun von Anfang an gesagt hatte, ein Bube passe nicht in ihr stilles Haus, darum sagte sie das jetzt täglich, früh, mittags und abends. »Hoffentlich geht es gut aus,« seufzte Herr Wunderlich an seiner Orgel. »Ich wollte beinahe, der Junge bliebe in Oberheudorf.«
Traumfriedes Abschied.
Just um die gleiche Zeit, da die drei Kinder auf der Kirchentreppe von Feldburg von dem Oberheudorfer Jungen sprachen, der zu Vater Wunderlich kommen sollte, ging dieser Bube in seinem Heimatort von Haus zu Haus, um Abschied zu nehmen. Traumfriede nannte man den schlanken, blonden Jungen im kleinen Dorf zum Unterschied von ein paar gleichnamigen Genossen, dem dicken Friede und dem blauen Friede. An diesem Tage war der Traumfriede aber gar kein Träumer, er war vielmehr ganz wach und munter und sah jeden Menschen, jedes Haus, jeden Baum und Strauch an, als müßte er sich die Abbilder davon fest, fest in sein Herz einprägen. Zum Träumen ließen ihm aber auch seine Freunde und Freundinnen keine Zeit; ein ganzer Trupp lief mit ihm, und mitunter tat sich da und dort ein Fenster auf, und jemand sagte brummend: »Nä, die Kinder sind heute aber auch zu toll, sie tun ja gerade, als wäre Jahrmarkt, so einen Lärm machen sie.«
Die Kinder von Oberheudorf scherten sich kein bißchen um die ärgerlichen Zurufe und Verbote; sie meinten heute ein Recht zu haben, sehr laut zu sein. Es war doch keine Kleinigkeit, wenn auf einmal ein Dorfbube, dazu noch ein armer Waisenjunge, plötzlich in die Stadt ziehen sollte, um dort ein Gymnasiast zu werden. Schon das Wort klang so feierlich. Die meisten Kinder konnten es gar nicht richtig aussprechen, und Anton Friedlich hatte es flugs umgeändert und sagte: »Kimm na'm Ast.« Und merkwürdigerweise merkten sich diesen Namen alle Buben und Mädel ausgezeichnet. Also ein »Kimm na'm Ast« sollte Traumfriede werden und später ein Student, – und da sollen seine Kameraden nicht schreien und laut schwatzen am letzten Tag? Na, das wäre doch wirklich etwas viel verlangt gewesen! Es gab auch vor jedem Haus einen kleinen Aufstand. Während der Bube hineinging und Abschied nahm, redeten die Kinder laut von der Stadt, und ob Traumfriede drinnen im Bauernhaus wohl etwas geschenkt bekommen würde. Denn fürs Schenken – sie mußten aber die Beschenkten sein – waren die Oberheudorfer Kinder alle sehr eingenommen.
Sie standen alle zusammen, die ungefähr in Friedes Alter waren. Schulzens Jakob, seine Schwester Röse, Annchen Amsee, Anton Friedlich, Schnipfelbauers Fritz und Krämers Trude. Natürlich fehlten weder der dicke noch der blaue Friede, die beiden mußten doch ihren Namensvetter begleiten. Und Heine Peterle war auch da, der erst recht. Mit einem so wütenden Gesicht ging der einher, als hätte er einen Krug voll Essig getrunken. »Nä, in die Stadt,« murrte er immerzu, »zu dumm, da ging ich nich rein!« Er versicherte dabei aber doch dem Traumfriede, er würde ihn besuchen, ganz gewiß.
Heine Peterle dachte noch immer voll Entsetzen an den einzigen Tag zurück, den er einmal in der Stadt verlebt hatte. Zu dumm waren doch die Leute in der Stadt und gleich immer so grob! Nein, da war es doch in Oberheudorf viel, viel schöner, und ordentlich mitleidig schaute er den Traumfriede an, der gerade wieder aus einem Hause kam. Der Friede fühlte sich aber just gar nicht bemitleidenswert, sondern meinte, ihm gehe es recht gut auf der Welt. Überall bekam er freundliche Worte zu hören, wohl auch eine kleine Abschiedsgabe, und jeder sagte: »Aber gelt, wenn du heimkommst, siehst du bei mir ein, na, und vielleicht besuchen wir dich mal in der Stadt.«
Ihn in der Stadt zu besuchen versprachen ihm auch alle seine Freunde und Freundinnen einmütig, Schulzens Jakob sagte sogar: »Kann sein, ich komme schon nächste Woche.«
»Wenn's nämlich der Vater erlaubt,« fuhr seine Schwester Röse dazwischen, »der hat aber gesagt, mit der dummen Stadtfahrerei wär's nichts.«
»Ha, meiner hat g'sagt, ich därf, wenn ich nur mal'n Einser bring',« schrie Anton Friedlich so stolz, als trüge er die Einser schockweis in der Hosentasche herum.
»Dann wirst du wohl am Nimmermehrstag in die Stadt fahren,« kicherte Annchen Amsee, und die andern schrieen und lachten: »Du kommst aber fix hin!«
Anton Friedlich war nämlich ein ausgemachter Faulpelz, und seine Einser hatten meist recht hübsche Querbalken und wurden Vierer genannt. Der Bube schrie aber doch ganz patzig: »Pah, werd' schon sehen, und vielleicht werd' ich auch noch mal'n Kimm na'm Ast.«
So unter Geschwätz und Geschrei, Necken und Lachen hatte Traumfriede seine Abschiedsbesuche gemacht, und die Zeit, da die Bäuerinnen die Abendsuppe auftischten, war gekommen. Friede nahm am Dorfbrunnen Abschied von seinen Gefährten; ein wenig kurz und eilig ging es dabei zu, denn Friede war das Herz schwer, und er konnte nicht viel sagen. Die andern aber hatten sich alle vorgenommen, morgen vor Tau und Tag aufzustehen und dem Freund noch einmal Lebewohl zu sagen. Kaspar auf dem Berge, der Wirt zur himmelblauen Ente, wollte am nächsten Morgen um vier Uhr die Stadtfahrt antreten und Friede mitnehmen samt seinem recht bescheidenen Köfferlein.
Als Traumfriede sich dem Häuslein der Muhme Lenelies, seiner Pflegemutter, näherte, sah er am Zaun dort Waldbauers Mariandel stehen. Das Mädel war vorangelaufen, um mit seinem guten Kameraden noch ein Weilchen zu schwatzen, und eifrig kam es ihm entgegen und erzählte, die Muhme habe Besuch, und mit dem Abendbrot sei es noch nicht so weit. Da liefen die Kinder den kleinen Nußberg hinauf, der über dem windschiefen Häuslein der Muhme anstieg, und oben setzten sie sich unter einen Haselbusch, der erst winzige, feine Blättchen hatte, und sprachen von Friedes künftigem Leben.
»Und Pfingsten kommst du wieder in die Ferien heim,« sagte Mariandel, froh, daß Pfingsten so bald schon auf Ostern folgen sollte.
Doch Friede schüttelte den Kopf: »Muhme Lenelies hat gesagt, so bald heimkommen gibt kein Geschick; vor den Sommerferien wird's nichts.«
»Oh,« schrie Mariandel entsetzt, »meine Mutter meint, du würdest wohl oft auf Sonntag kommen.«
»Die Muhme will's nicht, und der Herr Lehrer sagt auch, es wäre besser, ich lebte mich erst ordentlich in der Stadt ein, nur – – nur – – wenn ich's mal gar nicht aushalten könnte vor Heimweh, dann dürfte ich kommen, aber das tue ich nicht – – weil's doch feig wär.«
Mariandel schwieg betrübt, und die Kinder saßen still beisammen. Da tat sich auf einmal unten die Türe auf, und Muhme Lenelies trat heraus mit ihrem Gast: der Schulze war es selbst. Er war gekommen, um mit der alten Frau noch allerlei über ihren Pflegesohn zu sprechen, und als er jetzt aus dem Hause ging, sagte er – und der Wind trug die Worte zu den Kindern auf dem Nußhügel empor –: »Nun vermahne Sie den Buben nur noch ordentlich scharf, Muhme, damit er unserm Dorf keine Schande macht in der Stadt und kein eingebildeter Zierbengel wird oder gar dumme Streiche macht. Eine tüchtige Predigt zum Abschied ist allemal gut, himmelangst muß es so'nem Bengel werden!«
Friede wurde puterrot vor Entrüstung, und dem weichherzigen Mariandel kamen gleich die Tränen; es flüsterte: »Aber du bist doch brav und hast nichts getan!«
»Sei still,« tuschelte Friede, denn Muhme Lenelies sprach unten, und in diesem Augenblick kam es dem Buben gar nicht in den Sinn, daß er eigentlich lauschte; es war ihm plötzlich so schwer und bang ums Herz geworden. Würde die Muhme auch denken, daß es nötig sei, ihn hart zu vermahnen?
»Von so'ner Predigt halte ich nicht viel. Seht, so ein Kinderherz ist wie ein Garten im Frühling, man sät und pflanzt hinein und muß dann halt geduldig warten, ob alles blühen und reifen will. Man gießt immer achtsam, zieht ein Unkräutlein aus, aber viel hilft nicht immer viel, und wenn man den Garten überschwemmt, geht der Samen erst recht nicht auf. Alles mit Maßen, Schulze, und alles zu seiner Zeit. Ich habe an meinem Friede getan, was ich konnte, aber ihm heute den letzten Abend noch mit ellenlangen Ermahnungen verderben, das will ich lieber lassen; vergißt er mich und meine Worte, dann vergißt er auch die lange Predigt.«
»Muhme Lenelies,« schrie Friede plötzlich oben unterm Nußstrauch und raste den Abhang hinab, »ich vergeß dich nicht, ich vergeß dich nie, und ich werde dir gewiß keine Schande machen.« Da hing er schon am Hals der alten Frau, und alles Abschiedsleid, das er bisher tapfer unterdrückt hatte, brach hervor; er weinte bitterlich und vergaß ganz, daß Buben immer meinen, ein paar Tränen zur rechten Stunde wären eine Schande.
Über den Kopf des weinenden Jungen hinweg, den sie sacht streichelte, sah die Muhme mit ihren klugen, freundlichen Augen still den Schulzen an. Der nickte, schüttelte den Kopf und sagte endlich: »Weiß der Himmel, nä, Ihr seid doch ein ausnehmend kluges Weibsbild, Muhme. Hm, ja, na lebt wohl! Gib mir die Hand, Friede, und heule nicht, und das sage ich dir, wenn du mal vergißt, was du der Muhme verdankst, dann schlag' ich dir alle Knochen entzwei.«
Damit ging der Schulze seinem Hause zu, und Friede hatte nun doch seine Abschiedspredigt erhalten. Sie kränkte ihn aber nicht und trübte nicht den stillen Frieden dieses letzten Abends. Die Muhme und ihr Pflegesohn sprachen fröhlich von den Tagen, die kommen sollten, und von denen, die vergangen waren. Waldbauers Mariandel hatte dableiben dürfen, und auf ihr Flehen erzählte Muhme Lenelies selbst die Geschichte, wie Friede einmal durch den Schornstein in ihren Suppentopf gefallen war. »Da biste mir gleich ins Herz gefallen, mein Junge,« schloß die alte Frau ihre Erzählung. »So, und nun bring das Mariandel heim, und dann gehst du zu Bett; morgen um vier fährt Kaspar auf dem Berge schon los, da heißt es früh aufstehen.«
Ich werde sicher nicht schlafen, dachte Friede, als er zu Bett ging. Dann schlief er aber doch wie ein Murmeltier und mußte sich erst besinnen, was eigentlich für ein Tag sei, als die Muhme ihn weckte. Er war sogar noch ein bißchen verschlafen, als er im grauen Morgendämmern – denn die Sonne war noch gar nicht aufgegangen – mit Muhme Lenelies vor der himmelblauen Ente anlangte. Dort schirrte gerade der Knecht die Pferde an, und eben trat auch der Wirt aus dem Haus und rief freundlich: »Na, da ist ja unser Städter! Nun man aufgesessen, eins, zwei, drei, und keinen langen Abschied.«
Dafür war Muhme Lenelies auch nicht, sie umarmte noch einmal ihren Pflegesohn und sagte schlicht: »Zieh mit Gott,« und dann rollte der Wagen die Dorfstraße entlang. Die Muhme aber drehte sich um und kehrte rasch in ihr Häuschen zurück; es brauchte keiner zu sehen, wie bitterschwer ihr doch der Abschied wurde.