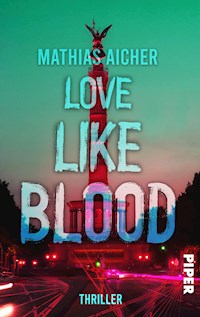1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Spannungsvoll
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Bestsellerautorin, eine ausverkaufte Lesung, ein klaustrophobischer Albtraum ohne Ende, ein Mordfall von 1988, ein Mörder, der nie verurteilt wurde, ein dunkles Geheimnis, mit dem Potential, ein ganzes Dorf in den Abgrund zu reißen… »Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass man in knapp vierzig Minuten sein Heimatdorf in Schutt und Asche legen wird? Wenn man weiß, dass danach nichts mehr so sein wird, wie es war?« Die in Berlin lebende Bestsellerautorin Johanna Krämer veranstaltet in ihrem Heimatort Woltersweiler im Saarland eine Lesung. Im Kaisersaal, der mit über 300 Personen ausverkauft ist. Niemand ahnt, dass es keine ›normale‹ Lesung werden wird, sondern für alle Anwesenden ein Horrortrip in die Abgründe der Vergangenheit. In Johannas Gepäck: Die Lösung eines Mordfalls von 1988. Damals wurde Johannas beste Freundin Nicola ermordet. Und ihr Bruder hat sich als Haupttatverdächtiger in der U-Haft das Leben genommen. Durch Johannas Recherchen in Woltersweiler, über die sie einen Kriminalroman namens PHANTOM geschrieben hat, den sie an dem Abend komplett lesen wird, ist sie dem wahren Mörder auf die Spur gekommen. Der bei der Lesung auch anwesend ist… Am Ende der Nacht, die sich für alle Beteiligten zu einem nicht enden wollenden Albtraum entwickelt und jeden Einzelnen an seine psychischen und physischen Grenzen – und darüber hinaus – bringt, kommt es zum Showdown zwischen Johanna und dem wahren Mörder. »Ein Krimi, der Gänsehaut verursacht, aber trotzdem nicht zu brutal ist. Sehr gut zu lesen und in jedem Fall spannend.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Sehr, sehr spannend ging es hier zu. Für mich ein absolut gelungenes Buch und eine klare Kauf- und Leseempfehlung meinerseits.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Thriller gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Offenbarung der Johanna« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2020 Piper Verlag GmbH, München
Redaktion: Franz Leipold
Covergestaltung: Traumstoff Buchdesign traumstoff.at
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Hinweis
Widmung
Zitate
Kaisersaal
Kaisersaal
TEIL 1: STRANGER IN A STRANGE LAND
1
Kaisersaal
2
Kaisersaal
TEIL 2: RENEGADE
3
Kaisersaal
4
Kaisersaal
5
Kaisersaal
6
7
8
Kaisersaal
TEIL 3: I REMEMBER NOW
9
10
11
12
Kaisersaal
13
TEIL 4: METAL HEART
–
Kaisersaal
TEIL 5: LIL’ DEVIL
14
15
16
17
18
Kaisersaal
TEIL 6: ASK ME YESTERDAY
DREI WOCHEN SPÄTER
19
OUTRO
Parental Advisory: Explicit content!
Hinweis
Alle Personen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
Für Aleister, Püppi, Momo, Lucie und meine saarländischen Freunde.
You know who you are.
Das Wort stellt die Wirklichkeit nicht dar.Das Wort ist die Wirklichkeit.
– Philip K. Dick, Zeit aus den Fugen –
If we keep our prideThough paradise is lostWe will pay the priceBut we will not count the cost
– Rush: Bravado –
Woltersweiler, Saarland
KaisersaalSamstag, 18:18 Uhr
Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass man in knapp vierzig Minuten sein Heimatdorf in Schutt und Asche legen wird? Wenn man weiß, dass danach nichts mehr so sein wird, wie es war?
Wie fühlt man sich, wenn man weiß, dass am Ende der Nacht nichts bleibt? Außer verbrannter Erde, Blut und Tränen.
Beschissen fühlt man sich, einfach nur beschissen.
Der Backstage-Raum des Kaisersaals ist ein knapp 20 qm großer, in hellen Farben gestrichener, fensterloser Raum, der von zwei Stehlampen erhellt wird. In einer Ecke ein Kühlschrank, gefüllt mit Bier, Weißwein, Wasser, Cola, Orangensaft. Mir schräg gegenüber drei Stufen: der Aufgang zur Bühne. An den Wänden gerahmte Plakate von vergangenen Veranstaltungen. Die Coverbands Prozac und Majkallica. Der Entertainer Horst Weck. Ein Galadinner mit dem Pianisten Frederick Unold. Der über die Grenzen des Saarlands hinaus bekannte Comedian Heinz Becker. Das 25-jährige Jubiläum des Musikantenmuseums Woltersweiler mit der Showband GooGs.
Und natürlich das Plakat, das meine heutige Lesung ankündigt.
Ich sitze rauchend auf dem schwarzen Ledersofa. Vor mir ein Couchtisch, auf dem ein DIN-A4-Blatt mit meiner vorbereiteten Rede liegt, daneben die ausgedruckten 256 Seiten meines neuen Manuskripts.
Ich gieße mir ein Glas Médoc ein. Ein Cru Bourgeois AOC 1993. Aus dem Weinkeller meines Vaters. Die Flasche kostet auf eBay um die 50 Euro. Ein Wein für besondere Anlässe. Ich lasse das Glas kreisen, inhaliere den süßen schweren Duft nach Erde und Holz und frage mich nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten, warum ich mir das alles antue. Niemand hat mich dazu gezwungen, weder mein Verlag noch mein Agent, es war ganz allein meine Entscheidung. Es geht nicht um Geld – die Einnahmen der Lesung, abzüglich aller Kosten, werde ich einem Tierheim in der Region spenden – und schon gar nicht um Aufmerksamkeit oder Ruhm; von beidem hatte ich mehr als genug. Das, was heute Abend passieren wird, dient nur einem Zweck: der Wahrheit Genüge zu tun. Und danach werde ich hoffentlich meinen Frieden machen.
Mit Woltersweiler.
Mit dem, was 1988 passiert ist.
Mit meinem Vater.
Und vor allem mit Jakob, meinem Bruder.
Während ich am Wein nippe, nehme ich wie in Trance die Musik aus dem Kaisersaal wahr. Im Moment sind die Stereophonics dran. Danach folgen Steven Wilson, Tangerine Dream, Sigur Ros und Dream The Electric Sheep. Die Playlist habe ich extra für heute Abend zusammengestellt und Klemens, dem Ton- und Lichttechniker des Kaisersaals, per E-Mail geschickt. Sie dauert exakt 60 Minuten und läuft seit 18 Uhr. Der letzte Song kurz vor 19 Uhr wird »Come hell or waters high« von Judie Tzuke sein.
Ich drücke die Kippe im Aschenbecher aus, als es klopft.
»Ja?«
Die Tür öffnet sich einen Spaltbreit, und Katarina, meine blutjunge und wunderhübsche Assistentin, steckt ihren schwarzen Lockenkopf herein. »Hanna? Hast du kurz …?«
»Was gibt’s?«
»Dieser …«, sie sieht auf ihr Tablet, »…Willi Stenger, unser Ansprechpartner heute Abend für alle Sachen, die den Kaisersaal betreffen …« Katarina realisiert, dass ich trotz des Rauchverbots geraucht habe, und wirkt kurz irritiert, spart sich aber einen Kommentar; sie will den Star des Abends ja nicht verärgern. Dabei ist der eigentliche Star des Abends jemand anderes – aber das weiß nur ich.
»Er meint, es gebe Stress am Eingang«, fährt sie fort. »Mit ’nem Typ, den du wohl auch kennst.« Sie sieht erneut auf ihr Tablet. »Egon Soboletzki. Und der meinte, dass er dich sprechen will. Persönlich und sofort. Er ist wohl nicht so ganz mit deinen … äh … Sicherheitsmaßnahmen am Eingang einverstanden.«
Mein Spiel, meine Regeln. Und die besagen, dass die Besucher und ihre Taschen am Eingang durchsucht werden. Und Handys abgegeben werden müssen. Auch Alkohol ist nicht erlaubt. Klar, dass jemand wie Soboletzki Stress macht, wenn man von ihm verlangt, sich durchsuchen zu lassen und Handy und Alk abzugeben.
»Kein Problem. Ich kümmere mich darum.«
»Das musst du nicht. Irgendwie kriegen wir das hin«, erwidert Katarina. »Ich wollte nur, dass du weißt …«
»Ich mach das schon«, unterbreche ich sie.
Katarina zieht eine Augenbraue hoch, was bei ihr immer sehr sexy aussieht. »Okay, du bist der Boss«, erwidert sie, wobei sie das »ay« von okay extrem in die Länge zieht. Dann schließt sie die Tür, und ich bin wieder alleine. Der Gedanke, den Kaisersaal zu durchqueren und von alten Schulkameraden, Würdenträgern des Dorfes oder – noch schlimmer – Fans angesprochen zu werden, stresst mich. Doch ich habe keine Wahl. Soboletzki ist eine tickende Zeitbombe, die entschärft werden muss.
Ich öffne die Tür einen Spalt und spähe in den Saal. Die in drei Meter Höhe befindlichen Fenster sind mit schwarzen Stoffbahnen abgehängt, das Licht der drei riesigen Kronleuchter ist gedimmt, fast schon schummrig. Alles ist komplett bestuhlt und schon zur Hälfte besetzt. Der Kaisersaal, ein wunderschöner, renovierter Veranstaltungsort aus dem 19. Jahrhundert mit Natursteinwänden und einer Holzdecke im Wabenstil, bietet Platz für knapp 400 Gäste. Und genau so viele werden heute Abend auch anwesend sein, die Lesung ist seit Wochen ausverkauft.
Die Location habe ich aus drei Gründen ausgewählt: Es gibt nur einen Ausgang. Die Fenster der Toiletten sind vergittert, und die Türen der beiden Notausgänge abschließbar.
Die Schlüssel dafür habe ich.
Im Publikum entdecke ich Birgit Görgen, die Bürgermeisterin von Woltersweiler. Korpulent. Randlose Brille. Kurze glatte Haare. Und sie trägt wie üblich ein Kostüm, das ihr mindestens zwei Nummern zu klein ist. Sie ist seit 2012 im Amt, hat sich souverän mit über 54 Prozent gegen ihre Gegenkandidatin durchgesetzt. In der Schule wurde sie nur Schmodder-Biggi genannt, da sie damals nicht wusste, dass man eine laufende Nase auch putzen kann. Ich denke, inzwischen weiß sie, wie es funktioniert. Sie ist in ein angeregtes Gespräch mit Lothar Meyer vertieft, dem glatzköpfigen Vereinsvorsitzenden und Mäzen des SV Woltersweiler, und beugt sich dabei über ihren Mann Roland, der neben ihr sitzt, um sich angemessen mit Meyer austauschen zu können. Roland wirkt genervt und bietet seiner Frau an, mit ihm den Platz zu tauschen, was sich Schmodder-Biggi nicht zweimal sagen lässt.
Ich nehme einen letzten Schluck Médoc, stelle das Glas auf den Couchtisch und atme tief durch. Als ich die Tür des Backstage-Raums hinter mir schließe, lächelt mir Katarina aufmunternd zu. Ich mache mich auf den mir endlos erscheinenden Weg zum Ausgang. Versuche, mich unsichtbar zu machen.
Erfolglos.
Alle starren mich an wie ein Alien. Manche lächeln, nicken mir verhalten zu, tuscheln miteinander und sehen mir hinterher. Ich weiß, dass sie mir hinterhersehen, ich kann ihre Blicke in meinem Rücken spüren. Dennoch spricht mich keiner an, auch wenn auffallend viele Anwesende diverse Jules-Wunderlich-Romane dabeihaben, die sie wahrscheinlich unterschrieben haben wollen. Von einer Signierstunde vor oder nach der Lesung war aber nie die Rede.
Was mir auffällt: Keiner der Gäste scheint einen meiner beiden letzten Romane, in denen Jules nicht vorkommt, dabeizuhaben.
Erbse, mein Caterer, und sein Team füllen am bereits eröffneten Buffet an der Längsseite des Saals Getränke nach. Als er mich entdeckt, wandern seine Augenbrauen in die Höhe.
»Chefin mal in schick«, frotzelt er. »Det ick ditt noch erlebn darf.«
Er meint meine neuen Jeans, die Pumps, die frisch gebügelte weiße Bluse und die brandneue braune Lederjacke. Nicht gerade mein Standard-Outfit.
»Ich hasse es«, grummele ich. »Und das weißt du.«
»Weeß ick, steht dir trotzdem.«
»Alles in Ordnung bei euch?«
»Allet schick, allet im Griff, allet entspannt«, antwortet er. »Mach dir keen Kopp.«
»Mach ich mir nicht. Jedenfalls nicht wegen des Buffets.«
»Du rockst dit, hundertpro«, sagt Erbse lächelnd.
Genau wie meine Security-Leute habe ich ihn und seine Crew aus Berlin kommen lassen. Bei so einem Ereignis will ich nicht von lokalen Teams abhängig sein. Heute Abend muss alles nach Plan laufen.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie mein alter Schulkamerad Manfred Haag, der Dorfarzt von Woltersweiler, seinen Platz einnimmt. Bei ihm seine Frau Anita. Immer noch genau so sexy und charismatisch wie früher. Alle – nicht nur die Jungs – waren damals hoffnungslos in Anita verknallt. Doch nur einer bekam sie: Manfred. Die beiden sind seit 1988 zusammen. Er war seinerzeit der erfolgreiche und beliebte Mittelstürmer des SV Woltersweiler, sie die Tochter eines Lehrerpaares. Kurz vor Vertragsabschluss mit einem Regionalligaverein erlitt Manfred Ende der 1980er-Jahre eine schwere Knieverletzung, die seine Karriere beendete; daraufhin studierte er nach dem Abitur Medizin. Anita, heute Lehrerin an der Grundschule von Woltersweiler, war immer an seiner Seite.
Bevor die Haags mich entdecken können, verabschiede ich mich von Erbse.
»Wird schon schiefgehen«, versuche ich mich an einem Lächeln und gehe weiter in Richtung der beiden – noch – offenen Flügeltüren, hinter denen sich der Garderobenbereich befindet; daran schließt sich der eigentliche Eingang an, bei dem Soboletzki Stress macht.
Plötzlich tippt mir jemand auf die Schulter. Ich drehe mich erschrocken um.
Schmodder-Biggi, die Bürgermeisterin.
»Hanna, entschuldige, aber ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen.«
»Sorry, Biggi, aber ich …«
»Entspann dich, dauert keine zwei Minuten«, duldet sie keinen Widerspruch. Spätestens jetzt wird mir bewusst, dass es ein Fehler war, den Backstage-Raum vor der Lesung zu verlassen.
Birgit blickt über die Schulter. »Arnie?«
Sie winkt ihrem Assistenten zu, der zu uns kommt. In seinem Schlepptau Heike Beyer, die Ministerpräsidentin des Saarlands. Bei ihr ein bulliger Leibwächter im Anzug.
»Frau Beyer, darf ich vorstellen: Johanna Krämer, die berühmteste Tochter unseres Dorfes.«
»Frau Krämer. Es ist mir eine Ehre, heute Abend hier zu sein«, sagt Heike Beyer. Ich schüttele Hände mit ihr. Sie sieht gut aus. Modische Kurzhaarfrisur. Bezauberndes Lächeln. »Das ist ihre erste Lesung überhaupt. Und das in Woltersweiler, ihrem Heimatort. Was für ein Ereignis für Woltersweiler und das Saarland«, erklärt Birgit.
Dass ich mir ausgerechnet Woltersweiler, das Kaff, in dem ich aufgewachsen bin, und nicht Berlin, Frankfurt oder München als Ort für meine erste Lesung ausgesucht habe, war nicht nur für Birgit und die Ministerpräsidentin eine Sensation. Ich habe meinen Geburtsort 1988 verlassen und nicht vorgehabt, jemals wieder zurückzukommen. Und schon gar nicht, um eine Lesung abzuhalten. Denn wie allgemein bekannt ist, hasse ich Menschenmassen und weigere mich hartnäckig, öffentlich zu lesen und das Entertainer-Äffchen zu spielen. Ich bin Schriftstellerin, kein Rockstar oder Comedian. Bei meinem ersten Jules-Wunderlich-Roman Underdog gab es richtig Stress mit meinem Agenten und dem Verlag, da ich für das Buch keinerlei Interviews geben und schon gar nicht auf Lesereise gehen wollte. Aber letztlich konnte ich mich durchsetzen. Und der Roman wurde überraschenderweise auch ohne Lesungen und Interviews ein Bestseller. Im Nachhinein war es aus Sicht des Verlags sogar die richtige Entscheidung, mich nicht ins Rampenlicht zu zerren, denn dadurch umgab mich eine Aura des Geheimnisvollen und Mysteriösen. Und das allein aufgrund meiner Weigerung, mich nicht in der Öffentlichkeit zum Idioten zu machen. Was für ein Schwachsinn! An mir ist nichts geheimnisvoll und schon gar nicht mysteriös. Ich denke mir Geschichten aus, das ist alles. Der Rest ist Marketing, Image und PR-Quatsch, allerdings zu meinem Vorteil. Denn ich lebe seit mittlerweile über zehn Jahren vom Schreiben. Vier Kriminalromane mit meiner Protagonistin Juliana »Jules« Wunderlich, der durchgeknallten, »etwas anderen« Kommissarin mit den Modelmaßen, die alle Bestseller wurden, und zwei, na ja, eher nicht so erfolgreiche Bücher ohne Jules, die vom Publikum ignoriert und vom Feuilleton zerrissen wurden. Klar, dass alle nach einem fünften Jules-Wunderlich-Roman schreien.
»… bin sehr gespannt, was uns heute Abend erwarten wird«, dringen die Worte der Ministerpräsidentin wieder an mein Ohr. Ich lächle. Nicke mechanisch.
»Hanna und ich waren ja zusammen in der Grundschule«, mischt sich Birgit ein. »Weißt du noch, Hanna, wie Frau Scherer dich …«
»Ich muss noch was erledigen, bevor es losgeht«, unterbreche ich. »Sorry.«
»Kein Ding, wir wollten dich nicht aufhalten«, erwidert Biggi angefressen.
»Viel Erfolg«, wünscht mir die Ministerpräsidentin. Ich nicke ihr knapp zu und eile weiter. Checke mein Handy. 18:37 Uhr.
Als ich endlich im Garderobenbereich ankomme, kann ich Soboletzki schon brüllen hören: »… mir scheißegal, was du davon hältst, du Clown! Ich lass mich nicht durchsuchen! Geht das in dein verficktes Spastihirn rein, du Penner?«
Ich drängele mich zwischen den Gästen nach draußen. Die tief stehende Sonne lässt mich blinzeln und ist ein Schock nach dem Halbdunkel, das im Saal herrscht. Soboletzki, eine halb volle Bierflasche in der Hand und schon sichtlich angetrunken, steht Herry, dem Chef meiner Security, gegenüber.
»Ich will die Kuh sprechen! Jetzt! Hast du das kapiert, du Affe?«
Herry hat die Arme vor der breiten Brust verschränkt und lässt sich keine Reaktion anmerken. Wenn Soboletzki wüsste, dass er gerade Herry Beer beschimpft, auch bekannt als »Der Bär«, den Präsidenten des legendären, berühmt berüchtigten Berliner Motorradclubs »Demons«, würde er sich wahrscheinlich in seiner Wortwahl zügeln. Und Sicherheitsabstand halten. Oder auch nicht. Soboletzki war schon immer eine total durchgeknallte Scheißhausratte ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf sich selbst und andere. Herry ist heute Abend Chef meiner Security. Zum Glück für Soboletzki, denn in seinem Job als Security-Mann und Türsteher ist Herry einfach nur souverän. Niemand kann ihn provozieren, nichts bringt ihn aus der Fassung. Genau deshalb habe ich ihn und drei seiner Clubmitglieder – Mike, Lusche und Tier – für heute Abend engagiert. Wäre Herry heute als Privatperson oder in seiner Funktion als Präsident der »Demons« unterwegs, läge Soboletzki schon längst mit ausgekugelter Schulter oder gebrochenem Kiefer am Boden. Oder mit beidem.
»Hier ist die Kuh, Soboletzki«, mache ich auf mich aufmerksam, wobei ich versuche, cool und entspannt zu bleiben, was mir angesichts der Tatsache, dass mir noch knapp zwanzig Minuten bis zur Lesung bleiben, ziemlich schwerfällt. »Wie kann sie dir behilflich sein?«
Soboletzki sieht überrascht von Herry zu mir und ist kurz sprachlos. Aber wirklich nur kurz. »Was soll’n der Scheiß, Krämer?«, blafft er. »Was wird das hier? Die Kaiserkrönung oder was? Ich lass mich nicht durchsuchen! Und mein Handy geb ich auch nicht ab. Und mein Bier schon gar nicht. Ich glaub, es hackt!«
Ich blicke kurz zu Herry. Zusammen mit Mike durchsucht er die Taschen weiterer Besucher. Lusche und Tier halten in einiger Entfernung ein TV-Team sowie mehrere Fotografen und Pressevertreter auf Abstand. Die Besucher am Eingang geben sich sichtlich Mühe, Soboletzki, mich und die brenzlige Situation zu ignorieren, was ihnen natürlich nicht gelingt.
»Tja, dann kommst du nicht rein«, sage ich so sachlich wie möglich und sehe zu meinen alten Schulkameraden, den Webers. Ralf und seine Frau Susanne. Die Clintons des Saarlands. Die Aufsteiger. Die Macher. Und Soboletzki von Anfang an immer an ihrer Seite. Wobei er nicht so wirklich der Macher ist, eher der Schläger und Troublemaker. Leicht unterbemittelt und leicht reizbar. Schnell mit den Fäusten, eher langsam im Denken. Offiziell Assistent der Webers, inoffiziell eher ihr Bodyguard. Der Mann fürs Grobe. Das dritte Rad am Wagen. Aber den Webers gegenüber immer loyal und treu.
Ich nicke Ralf und Susanne zu. Beide nicken knapp zurück. Und beiden ist Soboletzkis Auftritt sichtlich unangenehm. Susanne sieht blendend aus. Eine 45-Jährige mit der Figur und der Haut einer 30-Jährigen. Enges schwarzes Kleid, Pumps. Glatte, schulterlange braune Haare. Stylische schwarze Nerdbrille. Bezauberndes Lächeln. Sofern sie mal lächelt. Die perfekte First Lady des Saarlands. Aber nur falls Ralf, der Heike Beyers größter Konkurrent bei den bevorstehenden Landtagswahlen ist, gewinnen sollte. Aktuell deuten aber alle Umfragewerte darauf hin.
»Das ist doch pure Schikane«, meckert Soboletzki weiter. »Wer denkst du, wer du bist, Stotter-Fotze? Die Königin von Deutschland?«
Ich starre Soboletzki an. Im Bruchteil einer Nanosekunde kippt alles. Mein Herz klopft wild im Hals, ich spüre kalten Schweiß im Nacken. Das alles fühlt sich falsch an. Komplett falsch. Ich habe das Gefühl, als wäre es 1984. Als wäre ich wieder das unsichere, schüchterne, pubertierende Mädchen mit ein paar Pfunden zu viel auf den Hüften, das Angst vor Konfrontationen und Konflikten hat und am liebsten wegrennen würde. Dahin, wo es keine Demütigungen, keine verletzenden Sprüche der Schulkameraden, keine Erniedrigungen und keine Albträume gibt. Dahin, wo man keine Außenseiterin ist.
»Wäre es okay für dich, wenn ich …«, erwidere ich und spüre, wie Panik mich befällt und meine Kehle zuschnürt. Ich weiß, ich werde den Satz nicht fehlerfrei beenden. Egal, wie viel Mühe ich mir gebe. Ich werde es nicht schaffen.
»… wenn ich d-d-d-dich durchs-s-s-u-u-u …«
Soboletzki lacht. Laut und kehlig. »Was wolltest du sagen? Ob es okay wäre, wenn du mich durchs-s-s-u-u-uhuhuuhuuu …«
»Wenn ich dich durchsuche!«, presse ich mit letzter Kraft zwischen den Lippen hervor. Der kalte Schweiß rinnt mir inzwischen in Strömen über den Rücken.
»Na, das wird ja ’ne lustige Lesung«, lacht Soboletzki. Ralf zieht ihn weg von mir. »Hör zu, Hanna«, sagt er, »vielleicht kann man ja eine Ausnahme machen.« Er klopft mir jovial auf die Schulter, ignoriert mein Stottern, ignoriert die peinliche Situation. Lächelt dieses Lächeln, für das man ihm am Liebsten eins in die Fresse hauen würde. »Ich bürge für Egon, er ist sauber. Er wird nicht durchsucht, gibt aber sein Handy ab und kann dann rein, okay?«
Ralf Weber, Spitzenkandidat seiner Partei für die anstehende Landtagswahl und das Amt des Ministerpräsidenten. Prototyp des aalglatten, souveränen Politikers. Kurzes blondes Haar, schwarze Prada-Brille, perfekt sitzende enge Jeans, brandneue, hippe Adidas-Turnschuhe, die Ärmel des dunkelblauen Hemdes bis zu den Ellbogen hochgekrempelt, das Jackett lässig über dem Unterarm gelegt. Ein trinkfester, bodenständiger Mann des Volkes, der auf Dorffesten Wahlkampf macht, gleichzeitig aber auch weiß, wie man seine Ellbogen einsetzt und sich bei Parteifreunden und -feinden Respekt verschafft. Und in seinem Gesicht immer dieses arrogant-spöttische »Ihr-könnt-mich-alle-mal, ich-bin-eh-der-Beste«-Lächeln. Optisch erinnert er frappierend an den Ex-Verteidigungsminister Guttenberg, mit dem er auch immer wieder verglichen wurde. Bis zu dem Tag, an dem Guttenberg über seine eigenen Füße bzw. über diverse Skandale stolperte und Ralf es sich verbat, jemals wieder mit »diesem Amateur« – Zitat Ralf Weber – verglichen zu werden. Seinen damals extrem breiten und prollig wirkenden saarländischen Akzent hat er inzwischen vollständig abgelegt. Und jetzt rettet mich dieser schnöselige Politprofi vor der Demütigung, stotternd antworten zu müssen, indem er mir eine Frage stellt, auf die ich nur nicken oder den Kopf schütteln muss.
Ich nicke.
Natürlich nicke ich. Die Vorstellung, einen randalierenden, betrunkenen Soboletzki während der Lesung draußen vor der Tür zu haben, ist keine Option.
»Super, Hanna. Danke!« Ralf tätschelt kurz meinen Rücken, legt dann Soboletzki einen Arm auf die Schulter. »Komm schon, Alter, trink dein Bier aus, gib dein Handy ab und lass uns alle einen netten Abend haben.«
Soboletzki zögert. Susanne greift seinen Arm und zieht ihn zu sich ran. Zischt ihm etwas ins Ohr. Soboletzki starrt sie an. Susanne hält seinem Blick stand. Ein Blick, der keinen Widerspruch duldet. Den hatte sie schon damals im Repertoire. Soboletzki trinkt sein Bier aus, zieht sein Handy aus der Hosentasche und drückt es wortlos Herry in die Hand. »Geht dir jetzt einer ab, Stotter-Fotze?«, blafft Soboletzki, drückt mir seine leere Bierflasche vor die Brust und stampft in den Kaisersaal. Herry legt das Handy zu anderen Handys in eine Plastikbox. Daneben eine weitere Box mit Flachmännern, Taschenmessern, Bierdosen und -flaschen.
»Du weißt ja, wie er ist. Er meint es nicht so«, sagt Susanne entschuldigend.
»Schon klar«, murmele ich, ohne zu stottern – kurze Sätze kriege ich immer irgendwie hin –, und gebe Herry die leere Bierflasche von Soboletzki. Dann wende ich mich eilig ab und gehe zurück in den Kaisersaal. Versuche, meine Panik in den Griff zu bekommen. In meinem Kopf aber nur ein Gedanke, der ganz und gar nicht dazu angetan ist, meine Panik unter Kontrolle zu bringen: Was zum Teufel war das? Wie konnte es passieren, dass das Trauma meiner Kindheit plötzlich wieder präsent ist? Ich habe seit dreißig Jahren nicht mehr gestottert, wieso ausgerechnet heute Abend, bei meiner ersten Lesung? Das Trauma, wegen dem ich mich immer geweigert hatte, öffentlich zu lesen. Das Trauma, von dem ich niemandem erzählen konnte. Ist das Stottern vielleicht nie wirklich weg gewesen und hat die ganze Zeit nur auf einen schwachen Moment gewartet, eine Stresssituation wie die mit Soboletzki, um gnadenlos zuzuschlagen?
Mein Mund ist trocken, mein Puls auf Hundertachtzig und meine Bluse inklusive BH klatschnass. Ich muss mich umziehen. Und mich runterfahren, sonst wird das nichts mit der Lesung. Und ich brauche einen Whisky. Dringend.
Auf dem Weg zurück zum Backstage-Raum entdecke ich meinen Onkel Stefan. Er hat eine Aktentasche auf seinem Schoß und manövriert gerade mithilfe seiner Frau Burgunda, meiner Tante, seinen Rollstuhl an den Rand der ersten Reihe, direkt vor der Bühne. Als er mich sieht, zeigt er mir lächelnd seinen in die Luft gereckten Daumen. Ich lächle bemüht zurück, als ich am Rande des Saals einen kahlköpfigen Mann entdecke. Hackfresse. Vollbart. Speckiger Overall. Kariertes Holzfällerhemd. Cowboystiefel. Cowboyhut. Er lehnt an der Wand, hat die Arme vor der Brust verschränkt und observiert mit glasigem, stumpfem Blick die Gäste.
Adalbert »Adi« Schulz.
Er ist dieses Jahr fünfundfünfzig geworden, lebt alleine auf dem ihm vererbten Messie-Hof seiner Eltern am Rand des Dorfes, hat keine Frau, keine Kinder, keine Verwandten, keinen Schulabschluss. Und den IQ eines 10-Jährigen. Das in Verbindung mit seiner extremen Gewaltbereitschaft war schon damals eine hochexplosive Mischung. Ich hatte gehofft, diesen Scheißkerl nie wiedersehen zu müssen. Er war der Einzige, von dem ich jemals eine aufs Maul bekommen habe. Alle haben von ihm damals aufs Maul bekommen. Ob Mädchen, Junge – scheißegal. Gegen Adi ist Soboletzki ein Waisenknabe. Adi ist wegen mehrfacher Körperverletzung vorbestraft, säuft den ganzen Tag und macht dann Stress. Meistens im Sportheim, manchmal auch im »Raben«, einer Kneipe in der Nähe des Kaisersaals, oder auf dem Spielplatz. Es gibt Gerüchte, er stehe auf Minderjährige. Geschlecht egal. Aber niemand im Dorf hat die Eier, diese Gerüchte öffentlich zu äußern und ihn damit zu konfrontieren. Weil: Adi ist unberechenbar und zu allem fähig.
Das Eingangsriff von »Flight« von »Dream the electric sheep« reißt mich aus meinen Gedanken. »Flight« ist der vorletzte Song meiner Playlist. Ich habe noch knapp sechs Minuten.
Ich sehe aus den Augenwinkeln, wie Ralf und Susanne die Ministerpräsidentin kreuzen – und sie komplett ignorieren.
Ich eile in Richtung Backstage, vor dem Katarina mit ihrem Tablet steht. Bei ihr Maren Müller-Kaufmann, eine alte Schulkameradin von mir, deren Name aber nicht in Katarinas Liste steht. Aus verständlichen Gründen. Sie war schon damals einfach nur PITA: Pain in the ass. Und ist es heute noch. In ihrer Hand ein Exemplar von »Underdog«.
Als ich auftauche, versucht sie mich aufzuhalten. »Hanna, warte! Ich bin’s, Maren. Erinnerst du dich? Wir haben damals zusammen bei Frau Nowak …«
»Keine Zeit«, versuche ich sie abzuwimmeln.
»Kannst du nicht schnell …?« Sie hält mir »Underdog« hin. »Ich liebe Jules. Sie ist so … anders.«
So wie du nie sein wirst, schießt es mir durch den Kopf.
»Für Maren. Mit einem Herzchen, bitte.«
»Später. Sorry.«
Ihre Mundwinkel sacken in Lichtgeschwindigkeit nach unten. »Ist es wirklich zu viel verlangt, einer alten Schulkameradin schnell eine Unterschrift zu geben? Du bist echt so eine arrogante Diva, unglaublich, das gibt’s ja gar nicht!«
»Johanna wird Ihnen das Buch nach der Lesung signieren, versprochen«, versucht Katarina, die Situation zu entspannen.
»Johanna kann mich mal!«, faucht Maren.
»Da stehen noch einige andere vor Ihnen auf der ›Johanna-kann-mich-mal‹-Liste«, erwidert Katarina sachlich. »Also bitte hintanstellen.«
Maren wirft Katarina einen tödlichen Blick zu, dreht sich um und stakst auf ihren High Heels davon. Katarina grinst mich an. Ich versuche mich an einem Lächeln, scheitere grandios und verschwinde im Backstage. Ziehe die Tür hinter mir zu. Schäle mich aus der durchgeschwitzten Lederjacke und werfe sie aufs Sofa. Greife mir meinen zerfledderten Rucksack, der mich schon ewig begleitet. Darin: eine Flasche Whisky. Tomatin. 1988. Viel zu teuer, um ihn einfach runterzustürzen, doch das ist mir im Moment egal. Ich schraube mit zitternden Händen den Verschluss der Flasche ab und gebe mir die Dröhnung. Verschlucke mich. Huste. Glaube kurz, mich übergeben zu müssen. Schnappe nach Luft. Nehme dennoch einen weiteren Schluck und lasse die Flasche wieder in meinem Rucksack verschwinden. Reiße mir die mir am Körper klebende Bluse vom Leib, ebenso den BH. Krame ein Handtuch aus meinem Rucksack und rubbele mich damit ab. Mir ist kotzübel. Ich durchwühle die Vordertasche des Rucksacks nach meinem Deo, finde und benutze es. Will mir meine Wechselbluse und den Ersatz-BH rausnehmen und halte plötzlich ein dunkelblaues T-Shirt in der Hand. Bedruckt mit einem verblassten roten Y auf gelben Grund.
Das YPS-Logo.
Das Shirt meines Bruders Jakob. Sein damaliges Lieblingsshirt. Mir war nicht bewusst, dass ich es eingepackt hatte. Größe L. Damals nicht meine Größe, aber inzwischen könnte es passen. Ohne lange zu überlegen, ziehe ich es an. Es passt. Ich beschließe spontan, meine High Heels gegen meine geliebten Turnschuhe zu tauschen und auf die neue Lederjacke zu verzichten. Keine Ahnung, was mich zu der Annahme verleitet hat, ich müsste heute Abend irgendwelchen Erwartungen gerecht werden und schick aussehen. Zumal ich mit meiner Lesung heute Abend sowieso sämtliche Erwartungen zerstören werde.
Aus den Boxen des Kaisersaals erklingt das Piano-Intro von »Come hell or waters high« von »Judie Tzuke«.
Der letzte Song meiner Playlist.
Ich schließe die Augen.
Wenn ich gläubig wäre, würde ich jetzt beten.
Beten, dass ich nicht stottere.
Beten, dass alles so läuft wie geplant.
Beten, dass die Wahrheit stärker ist als die Lüge.
Aber ich bin nicht gläubig. Jedenfalls nicht im Sinne der katholischen Kirche. Obwohl wir beide im gleichen Business tätig sind: Geschichten erfinden.
Ich greife mir den Rucksack mit dem Whisky, das Blatt mit meiner Rede und das ausgedruckte Manuskript und betrete die Bühne. Der Vorhang ist noch zugezogen. Ein Tisch. Ein Stuhl. Ein Mikrofon. Eine Leselampe. Ein einzelner roter Scheinwerferspot. Ein Aschenbecher. Ein leeres Glas. Eine Flasche Mineralwasser. Rechts von mir eine Leinwand, davor ein Diaprojektor. Klemens, der Tontechniker, sitzt unsichtbar fürs Publikum im hinteren Bereich der Bühne an seinem Mischpult, direkt neben dem Aufgang vom Backstage-Raum. Er trinkt ein Bier und schaufelt Kartoffelsalat und Wiener Würstchen in sich rein. Als er mich sieht, wirkt er irgendwie ertappt.
»Frau Krämer. Sorry. Ich hab mir ein Bier aus dem Kühlschrank …«
»Dafür ist der Kühlschrank da«, unterbreche ich. »Alles im Griff?«
Er nickt mit vollem Mund. Ich packe meine Unterlagen auf den Tisch. Lehne meinen Rucksack gegen eins der Tischbeine und stelle die Flasche Tomatin auf den Tisch. Setze mich. Rücke mir den Stuhl, das Mikro und die Leselampe zurecht. Gieße mir ein Glas Whisky ein und nehme einen Schluck. Sehe auf mein Handy. 18:58 Uhr. Herry und die Jungs müssten in diesem Moment gerade die Eingangstür schließen. Wer jetzt nicht im Saal ist, kommt nicht mehr rein.
Jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Come hell or waters high.
Ich schalte mein Handy stumm, lege es auf den Tisch neben die Kippen, das Feuerzeug und den Aschenbecher. Wische mir mit dem Ärmel von Jakobs Shirt den Schweiß aus der Stirn. Schließe kurz die Augen. Ich bin bereit. Lasset die Spiele beginnen.
Woltersweiler, Saarland
KaisersaalSamstag, 19:00 Uhr
Ich sehe über die Schulter zu Klemens.
»Soll ich ausblenden?«, fragt er mit vollem Mund, immer noch seine Wiener mampfend. Ich nicke. Er blendet den Song langsam aus. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis der letzte Akkord verklungen ist.
Dann: Stille.
Immer wieder kurzzeitig unterbrochen von Räuspern und Husten im Publikum.
Ich atme tief durch. Ich bin jetzt allein, nur auf mich gestellt, kann mich nicht verstecken. Nicht hinter dem Mikro, nicht hinter meinen Worten. Heute Abend bin ich nackt, ungeschützt, angreifbar, verletzbar, dem Publikum auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Ich muss mich offenbaren und meine Deckung aufgeben. Muss alles offenlegen, muss mich offenlegen. Es gibt keinen anderen Weg, um mein Ziel zu erreichen. Vielleicht werde ich am Ende der Nacht für meinen Mut belohnt, vielleicht auch nicht, es gibt keine Garantie.
Für nichts.
Niemals.
Ich sehe erneut zu Klemens, nicke ihm knapp zu. Er trinkt sein Bier aus, ehe er das Licht der Kronleuchter im Saal auf die kleinste Stufe dimmt.
»Sind Sie soweit?«, fragt er.
Nein, bin ich nicht. Adrenalin strömt immer noch durch meinen Körper, meine Hände zittern, mein Herz rast. Und nein, das ist kein Lampenfieber, das ist pure Panik. Kann ich sicher sein, dass meine Stimme nicht versagt und ich nicht stottere? Nein, kann ich nicht. Alles ist möglich. Aber das werde ich erst wissen, wenn ich zu lesen beginne. Der erste Satz ist der wichtigste. Kriege ich den ohne stottern hin, kriege ich auch den Rest hin.
Hoffe ich.
Was wäre die Alternative? Tja, einfach den Vorhang geschlossen lassen und gehen. Durch den Notausgang, dessen Schlüssel ich ja habe. Mich in mein Mazda-MX5-Cabrio setzen, das am Hinterausgang des Kaisersaals parkt, und direkt zurück nach Berlin fahren. Als wäre ich nie da gewesen.
Ein Gespenst.
Ein Schatten.
Ein Phantom.
Als wäre alles, was im letzten Jahr hier in Woltersweiler passiert ist, nur ein Traum gewesen.
»Frau Krämer?«
Ich zucke erschrocken zusammen.
»Soll ich jetzt?«, fragt Klemens. »Den Vorhang meine ich …«
Ich sehe ihn an, sehe gleichzeitig durch ihn hindurch. Er legt den Kopf schief, weiß nicht, was er davon halten soll.
Scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch. Stottergefahr hin oder her. Die Zeit des Haderns und Zweifelns ist vorbei, jetzt ist die Zeit des Handelns.
Ich nicke Klemens zu. Er betätigt einen Schalter direkt an der Wand hinter seinem Arbeitsplatz. Wie in Zeitlupe gleitet der Vorhang zur Seite.
Ohrenbetäubender Applaus.
Ich nehme einen Schluck Whisky, sehe ins Publikum, zu den Protagonisten meines Romans, den ich gleich lesen werden: Manfred und Anita Haag. Birgit Görgen. Mein Onkel Stefan und meine Tante Burgunda. Egon Soboletzki, Ralf und Susanne Weber. Maren Müller-Kaufmann. Christine und Thomas Allenbach, die Inhaber des »Ochsen«. Günther und Emma Lehberger, die Eltern von Nikki.
Und: Adi.
Ich konzentriere mich auf das Blatt mit meiner Rede. Der Rede, an der ich über eine Woche gefeilt habe, auch wenn sie nur zwei Seiten lang ist.
Der Applaus scheint nicht enden zu wollen, was mich stresst.
Ich nehme einen weiteren Schluck Whisky und konzentriere mich. Wie geplant, gibt es keine Anmoderation, keine Höflichkeits- und Begrüßungsfloskeln, einfach nur der Sprung ins kalte Wasser.
»Die Gerüchte stimmen …«, sage ich langsam und akzentuiert ins Mikrofon.
Ohne zu stottern.
Der Applaus bricht abrupt ab. Nicht einmal ein Räuspern ist jetzt noch zu hören.
»Ich habe im letzten Jahr während meines Aufenthalts in Woltersweiler einen neuen Roman geschrieben.«
Gemurmel. Vereinzeltes Klatschen.
»Und zwar den fünften Jules-Wunderlich-Roman.«
Applaus brandet auf, teilweise sogar Jubel. Nicht wirklich überraschend. Ich habe immer deutlich gemacht, dass es keinen fünften Roman mit der doch recht durchgeknallten Kommissarin aus Frankfurt geben wird. Und das, obwohl sie mir seit vielen Jahren ans Herz gewachsen ist und meinen Lebensunterhalt finanziert. Aber ich war sie einfach leid, hatte das Gefühl, sie sei auserzählt. Tja, das war sie offensichtlich nicht.
»Der Roman heißt Phantom«, fahre ich fort, wobei ich mich strikt an das halte, was ich geschrieben habe. Keine Improvisationen, keine Experimente. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung mit öffentlichen Auftritten. Meine Worte auf Papier sind heute Abend mein Rettungsanker. Und je mehr ich einfach vom Blatt ablese und je weniger ich über das Thema »Stottern« nachdenke, desto sicherer fühle ich mich.
»In dem Roman kommt Juliana – Jules – zurück in ihr Heimatdorf«, fahre ich fort, »einen kleinen Ort im Saarland, wo sie ihren Vater zu Grabe trägt; danach hat sie vor, das ihr vererbte Haus zu verkaufen. Das Haus, in dem sie mit ihren Eltern und ihrem Bruder Jakob aufgewachsen ist.«
Als ich den Namen Jakob erwähne, geht ein Raunen durch den Saal.
»Doch Jules verkauft das Haus nicht. Stattdessen bleibt sie in ihrem Heimatdorf, denn sie ist auf etwas gestoßen, das alles ändert. Nicht nur für sie, sondern für das ganze Dorf.«
Alle verstehen jetzt, dass Jules’ Geschichte meine Geschichte ist. Auch ich bin vor knapp einem Jahr nach jahrzehntelanger Abwesenheit nach Woltersweiler zurückgekommen, um meinen Vater zu Grabe zu tragen und das mir vererbte Haus zu verkaufen. Und wie Jules bin auch ich geblieben. Über ein Jahr.
Ich sehe kurz hoch, versuche Reaktionen im Publikum auszumachen, versuche abzuschätzen, wie die Stimmung ist. Manche der Besucher tuscheln, haben die Köpfe zusammengesteckt, andere wirken geschockt, wieder andere überrascht.
Ich nippe am Whisky und stecke mir trotz des strikten Rauchverbots eine Kippe an, bevor ich fortfahre. »In dem Roman geht es um die Ereignisse in Woltersweiler vom 28. Mai 1988. Ihr erinnert euch, was damals passiert ist …?«
Alle erinnern sich.
Natürlich tun sie das.
Der 28. Mai 1988 ist im kollektiven Gedächtnis von Woltersweiler eingebrannt.
»Ich werde heute Abend den neuen Roman lesen. Nicht in Auszügen, sondern komplett. Über 200 Seiten. Es wird also eine lange Nacht. Aber für das leibliche Wohl ist gesorgt, wie ihr ja bereits feststellen konntet.«
Gemurmel im Publikum, Getuschel, Unmutsbekundungen.
»Alkohol ist aus nahe liegenden Gründen nicht im Angebot. Das Risiko, dass Einzelne aufgrund ihres übermäßigen Konsums eventuell die contenance verlieren, war mir dann doch zu groß. Und an Kandidaten, die für ihren übermäßigen Alkoholkonsum und den damit verbundenen Verlust der contenance bekannt sind, mangelt es heute Abend ja wahrlich nicht.«
Vereinzelte Lacher. Doch der Großteil des Publikums schweigt eisig. Keine Zwischenrufe, keine Unmutsbekundungen mehr.
Die kommen nach meinen nächsten Sätzen, ganz sicher.
»Falls jemand während der Lesung gehen will, weil ihm das alles zu lange dauert: Das ist leider nicht möglich. Alle werden bis zum Ende bleiben und sich anhören, was ich zu erzählen habe.«
Wie erwartet, melden sich jetzt die Zwischenrufer zu Wort. Gemeinsamer Tenor: Das sei eine Frechheit, was ich mir einbilden würde, ich sei wohl komplett verrückt geworden usw.
»Jungs?«, sage ich ins Mikrofon und sehe zum Eingang. Alle Köpfe drehen sich in diese Richtung. Herry und seine Leute kommen von draußen rein. Sie tragen inzwischen ihre schwarzen Kutten, auf deren Rücken das aufgenähte Logo der »Demons« prangt: ein grinsender Totenkopf, flankiert von zwei Pistolen. An ihren Hüften Schlagstöcke. Herry macht die Flügeltüren hinter sich zu und schließt sie ab. Steckt den Schlüssel ein. Stellt sich zusammen mit seinen Jungs vor die Türen. Dann ziehen alle wortlos ihre Schlagstöcke und klatschen diese demonstrativ einige Male in ihre offenen Handflächen.
»Das sind Herry, Mike, Lusche und Tier. Mitglieder der ›Demons‹, einer Bikergang aus Berlin«, erkläre ich. »Sie sind auf meinen Wunsch hin extra heute Abend nach Woltersweiler gekommen. Ich kenne sie von Recherchen zu meinem dritten Jules-Wunderlich-Roman, erschienen unter dem Titel Loner. Und deshalb weiß ich auch, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Aber wenn es einer von euch darauf anlegen will: nur zu. Ich übernehme jedoch keine Verantwortung für die Konsequenzen.«
Beiläufig zeigt Lusche dem Publikum, dass er unter seiner Lederjacke ein Schulterholster trägt. Darin: eine Knarre.
Langsam aber sicher scheint allen zu dämmern, dass heute Abend kein good clean family entertainment auf dem Programm steht. Heute Abend geht es ans Eingemachte. Heute Abend wird es hässlich. Heute Abend wird es wehtun.
Allen.
»Es kommt niemand raus und niemand rein. Eure Handys liegen im Garderobenbereich, ihr könnt sie nach der Lesung wieder an euch nehmen. Aber in den nächsten Stunden wird hier niemand eine SMS schreiben, etwas twittern oder auf Facebook posten. Die Welt bleibt draußen. Genauso wie die Vertreter der Presse. Wir sind unter uns.«
Die meisten der Besucher stecken die Köpfe zusammen und tuscheln aufgeregt. Auch Ralf, Susanne, Soboletzki und die Haags.
»Das ist Freiheitsberaubung! Eine Geiselnahme!« Birgit Görgen ist aufgesprungen und gestikuliert aufgebracht in meine Richtung.
Ich verlasse spontan den sicheren Pfad meiner vorbereiteten Rede, habe aber inzwischen das Gefühl, für die eine oder andere Improvisation bereit zu sein.
»Es ist mir scheißegal, wie du das nennst, Biggi. Keiner kommt hier raus, bis ich den Roman zu Ende gelesen habe.«
Birgit brüllt weiter. »Bist du völlig verrückt geworden, Hanna? Das kannst du nicht bringen! Damit machst du dich …«
»Setz dich, Biggi«, unterbreche ich eisig. »Jetzt. Oder du machst Bekanntschaft mit Herry und seinen Jungs.«
Sie zögert, sieht kurz über die Schulter zu den vier »Demons«. Dann wird sie von ihrem Mann gewaltsam auf ihren Platz zurückgezerrt. »Das wird juristische Konsequenzen haben!«, ruft sie noch in meine Richtung, bevor ihr Mann Roland ihre Hand nimmt und sie damit zum Schweigen bringt.
Ich lese weiter. »Wie bereits erwähnt, geht es in dem Roman um die Ereignisse vom Mai 1988. Genauer gesagt, um den Mord an der damals 18-jährigen Nicola Lehberger.«
Günther und Emma Lehberger, die Eltern von Nikki, sitzen in der zweiten Reihe, direkt hinter meinem Onkel und meiner Tante. Sie wirken angespannt, wissen nicht, was sie heute Abend erwartet. Auch wenn ich zu ihnen Kontakt aufgenommen hatte und sie mir Einsicht in die Tagebücher ihrer Tochter erlaubt hatten. Sie hatten sich nichts dabei gedacht, fühlten sich sogar geschmeichelt, dass sich eine Bestseller-Autorin für das Leben – und Sterben – ihrer Tochter interessierte. Niemand im Dorf hat meine Recherchen im letzten Jahr ernst genommen. Niemand hat geahnt, was ich vorhatte. Alle dachten, ich sei nichts weiter als eine weltfremde, dem Alkohol zugeneigte Autorin, die sich mal wieder eine Geschichte ausdenkt.
Dass ich auf der Suche nach der Wahrheit war, war keinem bewusst.
»Nach fast einem Jahr Recherchearbeit weiß ich jetzt, dass mein Bruder Jakob, der damals als Täter verurteilt wurde, unschuldig war«, fahre ich fort.
Raunen im Saal.
»Ihr erinnert euch doch an Jakob? Wie wurde er damals von euch genannt? De Mongo?«
Totenstille im Publikum.
»Jakob hat Nikki nicht umgebracht. Der wahre Mörder befindet sich seit 1988 auf freiem Fuß, er wurde nie wegen seines Verbrechens angeklagt. Er dachte all die Jahre, er würde damit durchkommen. Falsch gedacht. Denn ich weiß inzwischen, wer er ist.«
Ich lasse bewusst eine Pause, damit der nächste Satz besser wirkt.
»Und er ist heute Abend anwesend. Mitten unter uns.«
Mit einem Schlag steigt der Lautstärkepegel des Gemurmels im Publikum.
»Deshalb die Vorsichtsmaßnahmen am Eingang, das Schließen der Türen und die Anwesenheit meiner Security. Der Mörder soll heute Abend keine Chance haben, sich zu verstecken oder wegzulaufen. Heute Abend muss er sich für das, was er getan hat, verantworten.«
Alle im Publikum halten den Atem an.
Ich lege das Blatt mit meiner Rede zur Seite. Drücke die Kippe aus. Nehme einen Schluck Whisky. Ziehe das Manuskript in den Lichtkegel der Leselampe und beginne zu lesen.
JOHANNA KRÄMER
PHANTOM
Juliana Wunderlichs 5. Fall
Kriminalroman
Für Jakob.
Nach einer wahren Begebenheit.
TEIL 1: STRANGER IN A STRANGE LAND
1
Dunkelgraue Wolken hingen wie ein Leichentuch über dem Friedhof von Woltersweiler. Es sah nach Regen aus. Demnächst würde die recht überschaubare Trauergemeinde von ihren in weiser Voraussicht mitgebrachten Regenschirmen Gebrauch machen müssen. Anwesend waren neben Jules, ihrer Tante Burgunda und ihrem Onkel Stefan nur eine Handvoll ehemaliger Kollegen von Jules‘ Vater von Bosch, der Vereinsvorsitzende des SV Woltersweiler, ehemalige Schulkameraden mit ihren Frauen sowie die dorfbekannten gelangweilten Rentner mit zu viel Freizeit, die jeder Beerdigung beiwohnten.
Der Sarg wurde in das Grab hinabgelassen, und Jules fühlte … nichts.
Keine Trauer, keine Leere, kein Gefühl des Verlusts.
Nichts.
Ihr schoss eine Textzeile durch den Kopf, sie hätte aber nicht sagen können, um welchen Song es sich handelte.
… let the rain wash away our sins …
Um meine Sünden wegzuwaschen, müsste es schon eine neue Sintflut geben, dachte sie und musste bei dem Gedanken leise kichern. Sie bemerkte, dass Burgunda, eine kleine, rundliche Frau Anfang 70 mit kurzen, dunkelbraun gefärbten Haaren und einer Brille, die nicht nur entfernt an John Lennon erinnerte, ihr einen missbilligenden Blick zuwarf. Sie stand neben dem Rollstuhl ihres Manns Stefan auf der anderen Seite des Grabes.
Jules’ Mundwinkel wanderten nach unten; sie senkte den Blick und setzte eine Trauermiene auf. Jules Wunderlichs Version einer Trauermiene. Dennoch schien diese ihre Wirkung nicht zu verfehlen, denn ihre Tante wandte den Blick von ihr ab und starrte wieder gedankenverloren und mitgenommen auf das Grab.
»… hat uns die fürchterliche Nachricht von Werners Tod getroffen und in tiefe Trauer versetzt.« Der Pfarrer machte eine Pause und sah Jules direkt an. »Wir sind bestürzt, Juliana, dass dein Vater so plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist.«
Juliana.
Wann hatte sie das letzte Mal jemand Juliana genannt? Ihr Onkel und ihre Tante. Vor zwei Tagen. Bei ihrer Ankunft in Woltersweiler, diesem in Formaldehyd konservierten Organismus, der weder lebte noch tot war. Ein konserviertes Dorf, wie es Tausende in Deutschland gab. Dörfer in Aspik. Aus der Zeit gefallene Dörfer. Anachronistische Dörfer. Dörfer der Vergangenheit. Dörfer ohne Gegenwart und ohne Zukunft.
Jules nickte dem Pfarrer zu. Wenigstens ansatzweise betroffen, wie sie hoffte. Aber eigentlich war es ihr scheißegal, ob sie betroffen wirkte oder nicht. Alles, was sie wollte, war, die Beerdigung so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.
»Es ist schwer zu fassen«, fuhr der Pfarrer fort, dessen Namen sie vergessen hatte. »Noch vor wenigen Monaten schien Werner vor Kraft und Elan strotzend und voller Zufriedenheit zu sein und …«
Die Worte des Pfarrers verloren sich in der Ferne. Wie Jules’ Gedanken. Gedanken an das, was vor zwei Monaten in Frankfurt in einem Hinterhof im Bahnhofsviertel passiert war. Gedanken an die Nacht, in der alles aus dem Ruder gelaufen war. Die Nacht, die sie den Job gekostet hatte. Ob nur vorübergehend oder auf Dauer – das war noch nicht abzusehen. Die Entscheidung darüber lag nicht in ihrer Hand. Seit dieser Nacht lebte sie in einem Vakuum und wusste nicht, ob sie jemals wieder als Kommissarin der Mordkommission würde arbeiten dürfen.
»… werden ihn schmerzlich vermissen. Den Menschen Werner und sein besonderes Engagement. Wir werden sein Angedenken immer in liebevoller Erinnerung behalten.«
Sie sah nach links, wo sich die Gräber ihrer Mutter Maria, Burgundas Schwester, und ihres Bruders Jakob befanden.
Burgunda begann zu schluchzen. Dann kamen die Tränen. Sie schien sich gar nicht mehr beruhigen zu können.
Wind kam auf. Jules legte den Kopf in den Nacken. Die Wolken über dem Friedhof waren inzwischen tiefschwarz. Es war nur noch eine Frage von Minuten, bis es regnen würde.
Mach hin, Pfaffe, dachte sie. Ich habe Hunger, mir ist kalt, und ich brauch ’nen Drink. Dringend.
***
Sie saß mit ihrem Onkel und ihrer Tante an einem Tisch in der hintersten Ecke der Gastwirtschaft »Zum Ochsen«, die um diese Zeit und bei dem Wetter kaum besucht war. Auf Jules’ Wunsch fand das Essen nach der Beerdigung ohne weitere Freunde und Bekannte ihres Vaters statt, was bei Stefan und Burgunda verständlicherweise nicht gerade auf Begeisterung gestoßen war. Aber sie mussten zähneknirschend zustimmen, denn als Tochter hatte Jules das Sagen. Und Jules hatte nun mal keine Lust auf Menschen, die sie nicht kannte. Eigentlich hatte sie nie Lust auf Menschen, selbst wenn sie diese kannte.
Ihr Onkel trank Radler, seine Frau ein Hefeweizen und Jules einen Rotwein. Alle drei studierten die Karte. Gut bürgerliche Küche. Natürlich auch mit typisch saarländischen Gerichten: Dibbelabbes. Eierschmeer. Verheiratete. Lyonerkuchen und Lyoner-Fleischsalat. Stubberte. Hoorische. Der »Ochsen« war eine von drei verbliebenen Gaststätten in Woltersweiler. Aktuell gab es nur noch einen Pizza-Lieferservice, betrieben von Albanern, die sich als Italiener ausgaben, und einen Griechen, dessen Inhaber und Angestellte aus Kroatien stammten. Ende der 1980er-Jahre florierte die Kneipen- und Restaurantszene Woltersweilers noch, doch seit Mitte der 90er-Jahre war es steil bergab gegangen. Nicht nur mit dem Umsatz der Gastronomie, sondern mit ganz Woltersweiler. Massig Arbeitslose durch die Insolvenz des größten Arbeitgebers im Umkreis, des Autozulieferers »Klein KG«. Die Jungen fanden keine Arbeit mehr und zogen weg, was Geburtenrückgänge und leer stehende Häuser, Häuser ohne Wert, zur Folge hatte. Die Alten blieben, wurden immer weniger und hatten immer weniger Geld. Eine Abwärtsspirale, typisch für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland, nicht nur im Saarland. Alles hatte sich verändert. Nur der »Ochsen« hatte überlebt. Seit Jahrzehnten im Familienbesitz und schon eine Woltersweiler Institution, als Jules noch ein Kind war. Mit Thomas Allenstein und dessen Frau Christine, den Betreibern, die die Gaststätte vor ein paar Jahren von Thomas’ Eltern übernommen hatten, hatte sie die Schulbank der Grundschule gedrückt.
Ihr Onkel nahm einen Schluck von seinem Radler und sah Jules an. »Und? Wie geht es jetzt weiter? Was hast du vor?«
Jules zuckte mit den Schultern.
»Heißt das, du weißt es noch nicht?«, hakte Stefan Wunderlich irritiert nach.
»Alles gut«, sagte Jules. »War ein Scherz. Das Haus wird wie geplant verkauft, und dann bin ich wieder weg.«
Um was genau zu tun?, dachte sie. Sie war suspendiert. Sie konnte nichts tun. Außer warten.
»Werner ist nicht einmal eine Stunde unter der Erde, und du machst schon wieder Scherze?«, zischte ihre Tante.
»War ja kein Scherz über meinen Vater«, erwiderte Jules sachlich und blätterte in der Speisekarte. »Was nehmt ihr? Ich denke, ich gönne mir zur Feier des Tages einen Schweinebraten.«
»Früher mochtest du immer Dibbelabbes«, bemerkte Stefan.
»Früher ist vorbei«, erwiderte Jules und klappte die Karte zu.
»Wir haben übrigens zwei Interessenten für das Haus. Bis jetzt haben sie es aber nur von außen gesehen«, sagte ihr Onkel.
»Für wie viel hast du es inseriert?«
»215.000.«
»Nur?«
Ihr Onkel zuckte mit den Schultern. »Die fetten Jahre hier in der Gegend sind vorbei. Schon lange.«
»Ich sag Bescheid, wann sie reinkönnen«, murmelte Jules. »Erst mal muss ich mir einen Überblick verschaffen.«
»Das hast du immer noch nicht?« Burgunda schien von Jules’ Versäumnis persönlich beleidigt zu sein »Du bist doch schon seit zwei Tagen hier.«
»Kam nicht dazu«, sagte Jules und schüttete sich den letzten Tropfen aus ihrem Glas in die Kehle, als Thomas Allenstein, der Besitzer und Koch des »Ochsen«, mit einem Tablett mit Schnäpsen an ihren Tisch kam.
»Obstler. Selbstgebrannt. Gehen aufs Haus.«
Er stieß mit dem kläglichen Rest der Familie Wunderlich an.
Jules und Thomas kippten ihr Glas auf Ex.
»Noch mal mein Beileid«, sagte Thomas.
Jules nickte knapp.
»Ich hätte dich vorhin fast nicht erkannt. Du hast dich echt total verändert.«
Du dich auch, Thomas, dachte Jules. Aber nicht gerade zum Besseren. Geschätzte vierzig Kilo Übergewicht und lichtes bis kein Haar, das er dennoch so frisierte, als hätte er Haare, gereichten keinem Mann Mitte 40 zum Vorteil.
»Steht dir aber echt gut die Frisur«, sagte Thomas. »Und die Farbe.«
Für Jules war es die gefühlte sechste oder siebte Neuerfindung ihrer selbst. Optisch war sie aktuell die Jules-Wunderlich-Version von Claire Underwood, der Frau des Präsidenten aus der Netflix-Serie »House of Cards«: Knallblond gefärbte Haare, angedeuteter Undercut, Seitenscheitel, ausrasierter Nacken. Und innerlich? Wohl eher Daenerys Targaryen, die mother of dragons aus »Game of Thrones«. In der Jules-Wunderlich-Version. Ohne Drachen.
»Danke.« Sie reichte Thomas die Speisekarte. »Ich nehme noch einen Rotwein, ein Mineralwasser und den Schweinebraten.« Sie sah ihren Onkel und ihre Tante an.
»Zweimal Stubberte«, murmelte Burgunda, ohne Jules anzusehen, trank ihren Schnaps aus und stellte das leere Glas zurück auf Thomas’ Tablett. »Und noch mal drei Obstler.«
Ende der Leseprobe