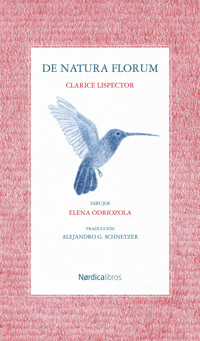18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein verstörender, intensiver Text, der Kafkas Verwandlung wie eine nette Familiengeschichte aussehen lässt.« DER SPIEGEL
G.H., eine vermögende Bildhauerin aus Rio, betritt das Zimmer ihres schwarzen Dienstmädchens, das ihr gekündigt hat. Der Raum ist überraschend aufgeräumt, nur einige Zeichnungen an der Wand stören die perfekte Ordnung. G.H. fühlt sich provoziert, öffnet den Kleiderschrank des Dienstmädchens und zerquetscht beim Schließen eine Kakerlake. Damit setzt sie eine Reihe von abgründigen, verstörenden Überlegungen über Leben, Tod, Weiblichkeit und Erlösung in Gang, die noch in der Rückschau des folgenden Tages ihre menschliche Existenz ins Wanken bringen.Clarice Lispectors Roman Die Passion
nach G.H. ist eines der aufregendsten, beunruhigendsten Werke der Weltliteratur und gilt als lateinamerikanisches Pendant zu Franz Kafka. Erstmals seit über vierzig Jahren neu übersetzt – durch Luis Ruby, der Lispector kennt wie kaum ein zweiter –, erstrahlt der Roman in ungewohnter Vielschichtigkeit und Radikalität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
»SPRECHE ICH HIER VOM TOD?
NEIN, VOM LEBEN.
DAS IST KEIN ZUSTAND VON GLÜCK,
ES IST EIN ZUSTAND VON BERÜHRUNG.«
Clarice Lispectors Roman Die Passion nach G. H. ist eines der aufregendsten, beunruhigendsten Werke der Weltliteratur und gilt als lateinamerikanisches Pendant zu Franz Kafka. Erstmals seit über vierzig Jahren neu übersetzt – durch Luis Ruby, der Lispector kennt wie kaum ein zweiter –, erstrahlt der Roman in ungewohnter Vielschichtigkeit und Radikalität.
»Ein verstörender, intensiver Text, der Kafkas Verwandlung wie eine nette Familiengeschichte aussehen lässt.« DER SPIEGEL
www.penguin-verlag.de
CLARICE LISPECTOR
DIE PASSION NACH G. H.
ROMAN
Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Luis Ruby
Die Originalausgabe erschien 1964
unter dem Titel A Paixão Segundo G. H.
bei Editôra do Autor, Rio de Janeiro.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © by Paulo Gurgel Valente
© A PAIXÃO SEGUNDO G. H., 1964
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025
Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Lektorat: Corinna Santa Cruz
Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka
Umschlagabbildung: © Shutterstock.com/Audy39
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-32803-0V002
www.penguin-verlag.de
An mögliche Leser
Dieses Buch ist wie andere Bücher auch. Aber ich wäre froh, wenn es von Menschen gelesen würde, deren Seele bereits geformt ist. Solchen, die wissen, dass die Annäherung, an was auch immer, schrittweise und mühselig erfolgt – und sogar durch das Gegenteil dessen hindurchführt, dem man sich annähern will. Solchen Menschen also, die als Einzige ganz allmählich begreifen werden, dass dieses Buch niemandem etwas wegnimmt. Mir zum Beispiel hat die Figur G. H. mit der Zeit eine Freude gegeben, die schwierig ist; aber man nennt sie Freude.
C. L.
»A complete life may be one ending in so full identification with the non-self that there is no self to die.«
Bernard Berenson
– – – – – – ich bin am Suchen, am Suchen. Ich versuche zu verstehen. Versuche, jemandem zu geben, was ich erlebt habe, und weiß nicht, wem, aber ich will nicht behalten, was ich erlebt habe. Ich weiß nicht, was ich aus dem Erlebten machen soll, ich habe Angst vor dieser tiefen Unorganisiertheit. Ich traue dem nicht, was mir geschehen ist. Ist mir etwas geschehen, das ich nicht zu leben wusste und deshalb als etwas anderes gelebt habe? Das würde ich gerne Unorganisiertheit nennen und hätte dabei die Sicherheit, mich vorzuwagen, weil ich wüsste, wohin ich anschließend zurückkehren könnte: zu der Organisiertheit davor. Das nenne ich lieber Unorganisiertheit, denn ich will mich in dem, was ich erlebt habe, nicht bestätigen – in der Bestätigung meiner selbst würde ich die Welt verlieren, wie ich sie hatte, und ich weiß, für eine andere fehlen mir die Mittel.
Sollte ich mich bestätigen und mich als wahr betrachten, bin ich verloren, denn ich wüsste dann nicht, worin ich meine neue Art zu sein einfassen könnte – sollte ich mit meinen bruchstückhaften Visionen fortfahren, so wird die ganze Welt sich ändern müssen, damit ich darin Platz finde.
Ich habe etwas verloren, das für mich essenziell war und das nun nicht mehr ist. Es ist für mich nicht nötig, als hätte ich ein drittes Bein verloren, das mich bis dahin am Gehen hinderte, aus mir jedoch einen stabilen Dreifuß machte. Dieses dritte Bein habe ich verloren. Und wurde wieder zu einem Menschen, der ich nie gewesen bin. Ich bekam wieder, was ich nie gehabt hatte: lediglich zwei Beine. Ich weiß, dass ich nur mit zwei Beinen überhaupt gehen kann. Aber die nutzlose Abwesenheit des dritten fehlt mir und erschreckt mich, gerade dieses machte aus mir etwas, das ich selbst finden konnte, und zwar ohne mich auch nur suchen zu müssen.
Bin ich unorganisiert, weil ich verloren habe, was ich nicht brauchte? In meiner neuen Feigheit – die Feigheit ist das Neueste, was mir je geschehen ist, sie ist mein größtes Abenteuer, meine Feigheit ist ein so weites Feld, dass nur großer Mut mich dazu bringt, sie anzunehmen –, in meiner neuen Feigheit, die so ist, als würde man morgens im Haus eines Fremden erwachen, weiß ich nicht, ob ich den Mut haben werde, einfach so hinzugehen. Es ist schwierig, sich zu verlieren. Es ist so schwierig, dass ich mir wahrscheinlich ganz schnell eine Art ausdenken werde, mich zu finden, selbst wenn mich finden erneut die Lüge wäre, von der ich lebe. Bis jetzt hieß mich finden, schon eine Vorstellung davon zu haben, was eine Person ist, und mich darin einzufassen: In dieser organisierten Person wurde ich Fleisch und spürte nichts von der großen Mühe beim Bauen, die Leben war. Meine Vorstellung davon, was eine Person ist, stammte von meinem dritten Bein, demjenigen, das mich im Boden verwurzelte. Ja, und jetzt? bin ich künftig freier?
Nein. Ich weiß, dass ich in diesem Moment noch nicht frei fühlen kann, dass ich schon wieder denke, weil mein Ziel ist zu finden – und dass ich zur Sicherheit genau dann von Finden sprechen werde, wenn ich auf eine Art Ausgang stoße. Warum habe ich nicht den Mut, lediglich eine Art Eingang zu finden? Oh, ich bin eingetreten, ich weiß schon. Aber dann bin ich erschrocken, weil ich nicht weiß, wohin dieser Eingang führt. Und nie zuvor hatte ich mich mitreißen lassen, wenn ich nicht wusste, wohin.
Doch gestern ging mir über Stunden und Stunden mein menschliches Gefüge verloren. Wenn ich den Mut dazu habe, werde ich zulassen, dass ich verloren bleibe. Aber ich habe Angst vor dem, was neu ist, und ich habe Angst zu leben, was ich nicht verstehe – ich will stets die Sicherheit, wenigstens zu denken, dass ich verstehe, ich bin nicht fähig, mich der Orientierungslosigkeit hinzugeben. Wie erklärt sich bloß, dass meine größte Angst genau dazu in Beziehung steht: zu sein? und doch gibt es keinen anderen Weg. Wie erklärt sich, dass meine größte Angst gerade die ist, das Leben hinzuleben, wie es sich ergibt? wie erklärt sich bloß, dass ich es nicht ertrage, zu sehen, nur weil das Leben nicht ist, was ich dachte, sondern ein anderes – als hätte ich vorher gewusst, was es war! Warum bloß ist Sehen so unorganisiert?
Und eine Enttäuschung. Aber Enttäuschung wovon? wenn ich doch, ohne auch nur zu fühlen, meine gerade aufgebaute Ordnung wohl kaum ertrug? Vielleicht ist Enttäuschung ja die Angst, keinem System mehr anzugehören. Allerdings sollte man so sagen: Er ist gerade sehr glücklich, weil er endlich enttäuscht wurde. Was ich vorher war, das war nicht gut für mich. Doch eben von diesem Nicht-Gut aus hatte ich das Beste organisiert: die Hoffnung. Aus meinem eigenen Übel hatte ich ein Gut für später geschaffen. Ist die Angst jetzt, dass meine neue Art keinen Sinn ergeben könnte? Aber warum lasse ich mich nicht von dem leiten, was geschehen mag? Ich werde das heilige Risiko des Zufalls auf mich nehmen müssen. Und das Schicksal ersetzen durch die Wahrscheinlichkeit.
Doch in der Kindheit, waren da die Entdeckungen wohl wie in einem Labor, in dem man findet, was immer man findet? Habe ich dann als Erwachsener Angst bekommen und mir das dritte Bein wachsen lassen? Aber ob ich als Erwachsener den kindlichen Mut haben werde, mich zu verlieren? sich verlieren bedeutet, fortlaufend zu finden und keine Ahnung zu haben, was man aus dem machen soll, das man findet. Zwei Beine, die gehen, nun ohne das dritte, das festhält. Und ich will festgehalten werden. Ich weiß nicht, was ich mit der furchteinflößenden Freiheit anfangen soll, die mich zerstören kann. Aber solange ich festgehalten wurde, war ich da froh? oder gab es, und gab es dieses Listige und Unruhige in meiner glücklichen Routine als Gefangene? oder es gab, und es gab dieses Pochende, und ich war schon so daran gewöhnt, dass ich dachte, das Pochen heiße, eine Person zu sein. Ist das so? auch, auch.
Ich bekomme ja einen solchen Schreck, wenn ich merke, dass ich über Stunden meine menschliche Ausbildung verloren habe. Ich weiß nicht, ob ich eine andere bekommen werde, um die verlorene zu ersetzen. Ich weiß, ich werde aufpassen müssen, um nicht klammheimlich ein neues drittes Bein zu verwenden, das bei mir so leicht nachwächst wie Gras, und dieses schützende Bein dann als »Wahrheit« zu bezeichnen.
Aber ich weiß eben auch nicht, welche Form ich dem geben soll, was mir geschehen ist. Und ohne eine Form zu geben, existiert für mich nichts. Und – und wenn die Wirklichkeit tatsächlich ist, dass nichts existiert hat?! wer weiß, ob mir gar nichts geschehen ist? Ich kann nur begreifen, was mir geschieht, aber es geschieht nur, was ich begreife – was weiß ich über den Rest? der Rest hat nicht existiert. Womöglich hat gar nichts existiert! Womöglich ist mir nur eines geschehen, eine langsame und große Auflösung? Und mein Kampf gegen diese Zergliederung ist nun der: zu versuchen, ihr jetzt eine Form zu geben? Eine Form umreißt das Chaos, eine Form gibt der gestaltlosen Substanz einen Aufbau – die Vision endlosen Fleisches ist die Vision der Wahnsinnigen, aber wenn ich das Fleisch in Stücke schneide und sie auf die Tage und Hungerzeiten verteile – dann ist es schließlich nicht mehr Verlust und Wahnsinn: Dann ist es am Ende wieder das vermenschlichte Leben.
Das vermenschlichte Leben. Ich hatte das Leben zu sehr vermenschlicht.
Aber wie gehe ich jetzt weiter vor? Muss ich die ganze Vision behalten, selbst wenn das bedeuten sollte, eine Wahrheit zu haben, die unbegreiflich ist? oder gebe ich dem Nichts eine Form, und das wird dann meine Art, die eigene Zergliederung einzugliedern? Aber ich bin so wenig darauf vorbereitet, zu verstehen. Sooft ich es früher versucht habe, verschafften mir meine Grenzen ein körperliches Unbehagen, bei mir prallt jeder Ansatz eines Gedankens sogleich gegen die Stirn. Schon früh war ich gezwungen, klaglos zu erkennen, dass meine geringe Intelligenz gegen Hindernisse prallte, und da machte ich auf dem Weg kehrt. Ich wusste, dass mir vorherbestimmt war, wenig zu denken, und wenn ich den Verstand gebrauchte, zwängte mich das in meine Haut. Wie also soll ich jetzt in mir das Denken eröffnen? und dabei würde mich vielleicht nur das Denken retten, ich habe Angst vor der Passion.
Da ich den morgigen Tag retten muss, da ich eine Form haben muss, weil ich nicht die Kraft spüre, unorganisiert zu bleiben, da ich unweigerlich darauf angewiesen sein werde, das monströse Fleisch in seiner Endlosigkeit zu erfassen und es in Stücke zu schneiden, die das Maß meines Mundes und das Maß des Blicks meiner Augen in sich aufzunehmen vermögen, da ich mich unweigerlich dem Bedürfnis nach Form fügen werde, das sich aus meiner Furcht speist, ohne Grenzen zu sein – wünsche ich mir wenigstens den Mut, zuzulassen, dass sich diese Form von alleine formt wie eine Kruste, die aus sich selbst heraus hart wird, der kosmische Nebel aus Feuer, das auf der Erde auskühlt. Und ich wünsche mir den großen Mut, der Versuchung zu widerstehen, eine Form zu erfinden.
Die Anstrengung, die ich gleich unternehmen werde, um einen Sinn an die Oberfläche steigen zu lassen, welchen Sinn auch immer, diese Anstrengung würde erleichtert, wenn ich mir vorstellte, jemandem zu schreiben.
Aber ich zögere, etwas so in Worte zu fassen, dass mich dieser imaginäre Jemand verstehen kann, zögere mit dem Versuch, einen Sinn »herzustellen«, mit derselben zahmen Verrücktheit, die noch bis gestern meine gesunde Art war, in ein System zu passen. Werde ich den Mut haben müssen, ein ungeschütztes Herz zu benutzen und fortlaufend ins Nichts und zum Niemand zu sprechen? so wie ein Kind ins Nichts denkt. Und das Risiko eingehen, vom Zufall zermalmt zu werden.
Ich verstehe nicht, was ich gesehen habe. Und ich weiß noch nicht einmal, ob ich gesehen habe, da sich meine Augen am Ende nicht mehr vom Gesehenen unterschieden. Nur durch ein unerwartetes Zittern von Linien, nur durch eine Anomalie in der ununterbrochenen Fortführung meiner Zivilisation erfuhr ich für einen Sekundenbruchteil den belebenden Tod. Den feinen Tod, der mir erlaubt hat, das verbotene Gewebe des Lebens zu betasten. Es ist verboten, den Namen des Lebens auszusprechen. Und ich hätte das beinahe getan. Beinahe hätte ich es nicht geschafft, mich von seinem Gewebe zu befreien, und das käme in mir der Zerstörung meiner Epoche gleich.
Vielleicht ist das, was mir geschehen ist, ein Begreifen – und um wahrhaftig zu sein, muss ich unter seinem Niveau bleiben, muss ich es weiterhin nicht verstehen. Jedes plötzliche Begreifen hat viel von einem akuten Nichtbegreifen.
Nein. Jedes plötzliche Begreifen ist letztlich die Offenbarung eines akuten Nichtbegreifens. Jeder Moment des Findens ist ein sich selbst Verlieren. Vielleicht ist mir ja ein Begreifen geschehen, das so umfassend ist wie eine Unwissenheit, und ich bin daraus so unberührt und unschuldig hervorgegangen wie davor. Kein Verstehen von mir wird diesem Begreifen je gewachsen sein, denn zu leben ist nun einmal das Niveau, das ich erreichen kann – meine einzige Entwicklungsstufe ist zu leben. Doch jetzt, jetzt weiß ich von einem Geheimnis. Das ich schon im Begriff bin zu vergessen, ah, ich spüre, wie ich es schon vergesse …
Um es erneut zu wissen, müsste ich jetzt wiedersterben. Und dieses Wissen wird vielleicht zum Mord an meiner menschlichen Seele. Und ich will nicht, ich will nicht. Was mich noch retten könnte, wäre, mich einer neuen Unwissenheit zu überlassen, das wäre möglich. Denn zur selben Zeit, da ich darum kämpfe zu wissen, ist meine neue Unwissenheit, also das Vergessen, zu etwas Heiligem geworden. Ich bin die Vestalin eines Geheimnisses, von dem ich nicht mehr weiß, was es war. Und diene der vergessenen Gefahr. Ich habe erfahren, was zu verstehen mir nicht möglich war, mein Mund wurde versiegelt, und mir blieben nur die unbegreiflichen Bruchstücke eines Rituals. Auch wenn ich zum ersten Mal spüren mag, dass mein Vergessen endlich auf einer Höhe mit der Welt ist. Ah, und ich will noch nicht einmal, dass mir erklärt wird, was, um erklärt zu werden, aus sich selbst herauskommen müsste. Ich will nicht, dass mir erklärt wird, was abermals einer menschlichen Bestätigung bedürfte, um gedeutet zu werden.
Leben und Tod gehörten mir, und ich war monströs. Mein Mut war der einer Schlafwandlerin, die einfach losgeht. Während der Stunden des Verlusts brachte ich den Mut auf, nichts in Worte zu fassen oder zu organisieren. Und vor allem nichts vorauszusehen. Bisher fehlte mir der Mut, mich vom Unbekannten leiten zu lassen, auf das Unbekannte zu: Meine Voraussichten prägten vorab, was ich sehen würde. Das waren nicht die Vor-Sichten des Sehens: Sie hatten bereits das Ausmaß von Sorgen. Meine Voraussichten versperrten mir die Welt.
Bis ich für einige Stunden aufgab. Und, bei Gott, bekam, was ich lieber nicht bekommen hätte. Ich wanderte nicht ein Flusstal entlang – ich hatte immer gedacht, zu finden wäre so fruchtbar und feucht wie Flusstäler. Ich rechnete nicht mit diesem großen Sich-Verfehlen.
Muss ich das Opfer des Vergessens erbringen, um weiterhin menschlich zu sein? Von jetzt an werde ich im gewöhnlichen Gesicht einiger Menschen zu erkennen wissen, dass – dass sie vergessen haben. Und sie wissen noch nicht einmal, dass sie vergessen haben, was sie vergessen haben.
Ich habe gesehen. Ich weiß das, weil ich dem Gesehenen nicht meinen Sinn gegeben habe. Ich weiß, dass ich gesehen habe – weil ich nicht verstehe. Ich weiß, dass ich gesehen habe – weil es nichts nützt. Hör zu, ich werde sprechen müssen, ich weiß nämlich nicht, was ich daraus machen soll, dass ich gelebt habe. Schlimmer noch: Ich will nicht, was ich gesehen habe. Was ich gesehen habe, sprengt mein tägliches Leben. Entschuldige, dass ich dir das gebe, ich hätte gern etwas Besseres gesehen. Nimm, was ich gesehen habe, befrei mich von meiner nutzlosen Vision und von meiner nutzlosen Sünde.
Ich bin so erschrocken, ich werde erst akzeptieren können, dass ich mich verloren habe, wenn ich mir vorstelle, dass mir jemand die Hand reicht.
Jemandem die Hand zu reichen, war schon immer meine Erwartung an die Freude. Häufig vor dem Einschlafen – bei diesem kleinen Kampf darum, nicht das Bewusstsein zu verlieren und in die größere Welt einzutreten –, häufig, bevor ich den Mut habe, auf die Größe des Schlafs zuzugehen, tue ich so, als reichte mir jemand die Hand, und dann gehe ich, gehe auf die gewaltige Abwesenheit von Form zu, die der Schlaf ist. Und wenn ich selbst so keinen Mut habe, dann träume ich.
Dem Schlaf entgegenzugehen, ist der Art so ähnlich, wie ich jetzt meiner Freiheit entgegenzugehen habe. Mich dem hinzugeben, was ich nicht verstehe, wird heißen, mich an den Saum des Nichts zu stellen. Einfach nur gehen, und zwar wie eine Blinde, verloren auf einem Feld. Dieses übernatürliche Ding, das Leben ist. Das Leben, das ich gezähmt hatte, um es vertraut werden zu lassen. Dieses mutige Ding, das darin bestehen wird, mich hinzugeben, und das so ist, wie der geisterhaften Hand des Gottes die Hand zu reichen und in dieses Ding ohne Form einzutreten, das ein Paradies ist. Ein Paradies, das ich nicht will!
Solange ich schreibe und spreche, werde ich so tun müssen, als hielte mir jemand dabei die Hand.
Oh, wenigstens am Anfang, nur am Anfang. Sobald ich darauf verzichten kann, werde ich alleine gehen. Einstweilen brauche ich das, deine Hand zu halten – selbst wenn es mir nicht gelingen sollte, dein Gesicht zu erfinden und deine Augen und deinen Mund. Doch auch abgetrennt erschreckt diese Hand mich nicht. Sie zu erfinden, kommt einer derartigen Vorstellung von Liebe gleich, als wäre die Hand tatsächlich mit einem Körper verbunden, und wenn ich ihn nicht sehe, dann nur wegen meiner Unfähigkeit, noch mehr zu lieben. Ich bin nicht weit genug, um mir einen ganzen Menschen vorzustellen, weil ich selbst kein ganzer Mensch bin. Und wie mir ein Gesicht vorstellen, wenn ich nicht weiß, welchen Ausdruck ich dafür brauche? Sobald ich auf deine warme Hand verzichten kann, werde ich alleine gehen und mit Entsetzen. Für das Entsetzen werde ich verantwortlich sein, bis die Verwandlung sich vollzieht und das Entsetzen in Klarheit umschlägt. Keine Klarheit aus einem Wunsch nach Schönheit und Moral, wie ich sie mir früher ganz unwissentlich vornahm; sondern die natürliche Klarheit dessen, was existiert, und ebendiese natürliche Klarheit erschreckt mich. Auch wenn ich weiß, dass das Entsetzen – das Entsetzen ich bin im Angesicht der Dinge.
Einstweilen erfinde ich deine Anwesenheit, so wie ich eines Tages nicht werde riskieren können, allein zu sterben, zu sterben ist höchst riskant, ich werde nicht in der Lage sein, zum Tod überzugehen und den ersten Fuß in meine erste Abwesenheit zu setzen – auch in dieser letzten und derart ersten Stunde werde ich deine unbekannte Anwesenheit erfinden und mit dir zu sterben beginnen, bis ich alleine lernen kann, nicht zu existieren, und dann lasse ich dich frei. Einstweilen halte ich dich fest, und dein unbekanntes und warmes Leben ist jetzt meine einzige innige Organisation, ich, die ich in diesem Augenblick ohne deine Hand ein Gefühl von Haltlosigkeit hätte in der gewaltigen Ausdehnung, die ich entdeckt habe. Der Ausdehnung der Wahrheit?
Aber die Wahrheit hat für mich eben nie Sinn ergeben. Die Wahrheit ergibt für mich keinen Sinn! Und gerade deshalb fürchtete und fürchte ich sie. Schutzlos, wie ich bin, übergebe ich dir alles – damit du daraus etwas Fröhliches machst. Werde ich dich erschrecken und dich verlieren, indem ich mit dir spreche? aber wenn ich nicht spreche, verliere ich mich, und könnte auch dich verlieren.
Die Wahrheit ergibt keinen Sinn, die Größe der Welt lässt mich schrumpfen. Das, was ich wahrscheinlich erbeten und schließlich bekommen habe, hat mich allerdings so bedürftig zurückgelassen wie ein Kind, das alleine über die Erde wandert. So bedürftig, dass nur die Liebe des gesamten Universums mich trösten und mehren könnte, nur eine derartige Liebe, dass selbst die befruchtete Eizelle der Dinge in Schwingung geriete von dem, was ich eine Liebe nenne. Wie ich sie in Wahrheit nur nenne, ohne ihren Namen zu kennen.
Ob es wohl die Liebe war, was ich gesehen habe? Aber was für eine Liebe ist das, so blind wie die einer befruchteten Eizelle? war es das? dieses Entsetzen, war das Liebe? Liebe, so neutral, dass – nein, ich will mich noch nicht sprechen, jetzt zu sprechen, hieße, einen Sinn zu überstürzen, wie wenn jemand hastig erstarrt in der lähmenden Gewissheit eines dritten Beins. Oder schiebe ich den Anfang des Sprechens nur hinaus? warum sage ich nichts und spiele nur auf Zeit? Aus Angst. Ich brauche Mut, um den Versuch zu wagen, zu konkretisieren, was ich spüre. Es ist, als hätte ich eine Münze und wüsste nicht, in welchem Land sie gültig ist.
Ich werde Mut brauchen, um das zu tun, was ich tun werde: sagen. Und die riesige Überraschung zu riskieren, die ich verspüren werde, wenn das Gesagte so arm ist. Kaum sage ich es, werde ich schon hinzufügen müssen: Das ist es nicht, das ist es nicht! Aber man darf auch keine Angst haben, sich lächerlich zu machen, schon immer war mir weniger lieber als mehr, auch aus Angst vor der Lächerlichkeit: Es gibt eben auch die Pein der Scham. Ich schiebe es auf, mich zu sprechen. Aus Angst?
Und weil ich nicht ein Wort zu sagen habe.
Ich habe nicht ein Wort zu sagen. Warum halte ich dann nicht den Mund? Aber wenn ich das Wort nicht herbeizwinge, wird mich die Stummheit für immer überspülen. Das Wort und die Form werden das Brett sein, auf dem ich dahintreibe, über einer riesigen Dünung aus Stummheit.
Und wenn ich es aufschiebe anzufangen, dann auch, weil mich niemand führt. Die Erzählung anderer Reisender bietet mir wenige Tatsachen bezüglich der Reise: Alle Informationen sind schrecklich unvollständig.
Ich spüre, dass allmählich eine erste Freiheit von mir Besitz ergreift … Denn bis heute hatte ich noch nie so wenig Bedenken, geschmacklos zu wirken: Ich schrieb »eine riesige Dünung aus Stummheit«, das hätte ich früher nicht getan, denn ich habe seit jeher Respekt vor der Schönheit und der ihr eigenen Mäßigung. Ich sprach von »einer riesigen Dünung aus Stummheit«, mein Herz neigt sich in Demut, und ich nehme das Gesagte an. Habe ich am Ende ein ganzes System des guten Geschmacks verloren? Aber ist das hier mein einziger Gewinn? Wie eingesperrt musste ich gelebt haben, um mich schon allein deswegen freier zu fühlen, weil ich mich nicht vor ästhetischen Mängeln scheue … Ich ahne noch nicht, was ich darüber hinaus gewonnen haben werde. Womöglich merke ich es nach und nach. Einstweilen habe ich das erste schüchterne Vergnügen, das in der Feststellung besteht, dass ich die Angst vor dem Hässlichen verloren habe. Und dieser Verlust ist so gut. Er ist köstlich.
Ich will wissen, was ich beim Verlieren noch gewonnen habe. Einstweilen weiß ich es nicht: Nur, indem ich mich wiederbelebe, werde ich tatsächlich leben.
Aber wie mich wiederbeleben? Wenn ich doch kein Wort zu sagen habe, das natürlich wäre. Ob ich das Wort wohl erst machen muss, als würde damit erschaffen, was mir geschehen ist?
Ich werde erschaffen, was mir geschehen ist. Nur weil das Leben nicht berichtet werden kann. Das Leben kann nicht gelebt werden. Wenn ich erschaffe, muss ich vom Leben ausgehen. Und ohne zu lügen. Erschaffen ja, lügen nein. Erschaffen ist nicht Fantasie, es ist, das große Risiko einzugehen, die Wirklichkeit zu haben. Verstehen ist ein Erschaffen, meine einzige Möglichkeit dazu. Ich werde mit Mühe Telegrafenzeichen übersetzen müssen – das Unbekannte in eine Sprache übersetzen, die ich nicht kenne, und das, ohne auch nur zu verstehen, wozu die Zeichen gut sind. Ich werde in dieser schlafwandlerischen Sprache sprechen, die, wenn ich wach wäre, nicht Sprache wäre.
Bis ich die Wahrheit dessen erschaffe, was mir geschehen ist. Ah, das wird eher eine Kalligrafie als ein Schriftstück, denn ich ziele eher auf eine Nachbildung als auf einen Ausdruck. Ich verspüre immer weniger das Bedürfnis, mich auszudrücken. Auch das habe ich verloren? Nein, schon als ich Skulpturen machte, versuchte ich lediglich nachzubilden, und lediglich mit den Händen.
Ob ich mich dann in der Stummheit der Zeichen verliere? Ja, denn ich weiß, wie ich bin: Ich war noch nie fähig zu sehen, ohne sogleich mehr als das Sehen zu brauchen. Ich weiß, ich werde entsetzt sein wie ein Mensch, der blind wäre und endlich die Augen öffnete und schaute – aber auf was? auf ein Dreieck, stumm und unverständlich. Könnte sich dieser Mensch für nicht mehr blind halten, nur weil er ein unverständliches Dreieck sieht? Ich frage mich: Wenn ich mit einer Lupe ins Dunkel blicke, sehe ich dann mehr als das Dunkel? Die Lupe durchdringt die Dunkelheit nicht, sie offenbart sie lediglich noch mehr. Und wenn ich die Helligkeit durch eine Lupe betrachte, werde ich schockartig nur die größere Helligkeit sehen. Ich habe etwas erblickt, bin aber so blind wie zuvor, fiel doch mein Blick auf ein unbegreifliches Dreieck. Es sei denn, ich verwandle mich ebenfalls in ein Dreieck, und das erkennt dann im unbegreiflichen Dreieck die Quelle und Wiederholung meiner selbst.
Ich schiebe hier etwas vor mir her. Ich weiß, dass alles, was ich hier rede, nur dem Aufschieben dient – dem Aufschieben des Moments, in dem ich anfangen muss zu sagen, im Wissen, dass mir nichts mehr zu sagen bleibt. Ich schiebe mein Schweigen vor mir her. Habe ich mein ganzes Leben lang das Schweigen aufgeschoben? aber jetzt, aus Geringschätzung des Wortes, kann ich vielleicht endlich zu sprechen beginnen.
Die Zeichen des Telegrafen. Die Welt, stachelig von Antennen, und ich, die ich die Zeichen auffange. Mir bleibt nur die lautliche Transkription. Vor dreitausend Jahren drehte ich durch, und von mir blieben nur die Bruchstücke von Lauten. Nun bin ich noch blinder als zuvor. Ja, ich habe gesehen. Ich habe gesehen, und ich erschrak über die grobe Wahrheit einer Welt, deren größtes Entsetzen darin besteht, dass sie so lebendig ist, und um zuzugeben, dass ich genauso lebendig bin wie sie – und meine schlimmste Entdeckung ist, dass ich genauso lebendig bin wie sie –, muss ich mein Bewusstsein äußeren Lebens so weit erhöhen, dass es einem Verbrechen gegen mein persönliches Leben gleichkommt.
Für meine tiefe Moral von früher – meine Moral war der Wunsch zu verstehen, und da ich das nicht tat, räumte ich eben auf, erst gestern, und jetzt habe ich entdeckt, dass ich schon immer zutiefst moralisch gewesen bin: Bisher gestand ich nur den Zweck ein –, für meine tiefe Moral von früher ist meine Entdeckung, dass ich auf so rohe Weise lebendig bin wie dieses rohe Licht, das ich gestern erlernt habe, für jene Moral in mir ist die harte Herrlichkeit, lebendig zu sein, das Entsetzen. Lebte ich früher von einer vermenschlichten Welt, aber das rein Lebendige hat die Moral zum Einsturz gebracht, die ich hatte?
Denn eine gänzlich lebendige Welt hat die Kraft einer Hölle.
DENN EINE GÄNZLICH LEBENDIGE WELT hat die Kraft einer Hölle.
Gestern Vormittag – als ich aus dem Wohnzimmer in die Kammer des Hausmädchens ging – ließ nichts mich vermuten, dass ich nur noch einen Schritt von der Entdeckung eines Reichs entfernt war. Einen Schritt von mir. Mein ursprünglichster Kampf um das ursprünglichste Leben stand bevor, mit der ruhigen, allesverschlingenden Wildheit von Tieren in der Wüste. Ich würde in mir dem Leben auf einer so ersten Stufe begegnen, dass es ans Unbelebte grenzte. Doch keine meiner Gesten wies darauf hin, dass ich existieren sollte, mit vor Durst trockenen Lippen.
Erst später sollte mir ein Satz von früher wieder einfallen, der mir vor Jahren dummerweise im Gedächtnis geblieben war, der schlichte Untertitel eines Zeitschriftenartikels, den ich am Ende gar nicht gelesen hatte: »Verloren in der sengenden Hölle einer Schlucht, kämpft eine Frau verzweifelt um ihr Leben.« Nichts ließ mich vermuten, worauf ich zusteuerte. Aber ich war eben noch nie fähig, wahrzunehmen, wie sich Dinge anbahnten; sooft sie einen Gipfelpunkt erreichten, empfand ich das zu meiner Überraschung als Bruch, Explosion der Augenblicke, mit Datum, und nicht wie die Fortsetzung von etwas Ununterbrochenem.
Bevor ich an jenem Vormittag das Zimmer betrat, was war ich da? Ich war, was die anderen mich schon immer hatten sein sehen, und so kannte auch ich mich. Ich weiß nicht zu sagen, was ich war. Aber ich will mich wenigstens erinnern: Womit war ich gerade beschäftigt?
Es war fast zehn Uhr vormittags, und seit langer Zeit hatte meine Wohnung mir nicht mehr so gehört. Am Vortag hatte das Hausmädchen gekündigt. Der Umstand, dass niemand redete oder herumlief und Ereignisse auslösen konnte, tauchte dieses Zuhause, in dem ich halb im Luxus lebe, in eine stille Weite. So blieb ich länger als gewohnt am Frühstückstisch – wie schwierig es geworden ist, zu wissen, wie ich war. Und doch muss ich diese Anstrengung unternehmen, mir wenigstens eine Form davor zu geben, um verstehen zu können, was geschah, als ich diese Form verlor.
Ich blieb länger am Frühstückstisch, rollte Kügelchen aus Brotkrume – war es das? Ich muss es wissen, muss wissen, was ich war! Ich war dies: Ich rollte zerstreut Kügelchen aus Brotkrume, und meine letzte, ruhige Liebesverbindung hatte sich freundschaftlich aufgelöst, noch eine zärtliche Geste, und ich gewann den leicht faden, glücklichen Geschmack der Freiheit wieder. Verortet mich das? Ich bin ein angenehmer Mensch, habe aufrichtige Freundschaften, und das Bewusstsein davon bewirkt, dass ich mir selbst mit freundschaftlichem Wohlwollen begegne, unbeschadet einer gewissen Selbstironie, allerdings ohne mich zu quälen.