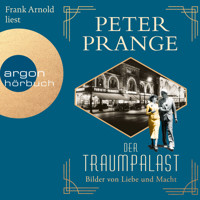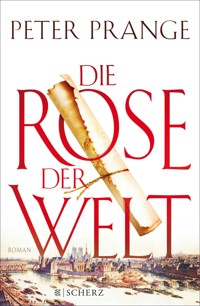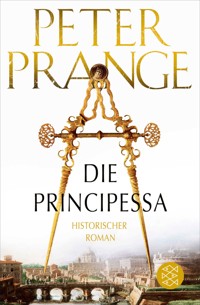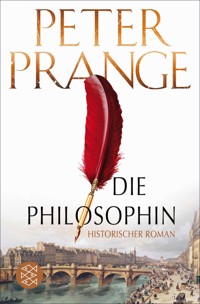
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der berühmte Bestsellererfolg von Peter Prange. Paris, 1747. Die junge Sophie begegnet Denis Diderot, dem Philosophen, der ein hochgefährliches Buch plant: eine Enzyklopädie mit dem ganzen Wissen der Menschheit – Sprengstoff für die schwankende Monarchie. Bald erkennt Sophie, dass es dabei um mehr geht als um ein Buch. Es geht um ihr eigenes Leben, ihr Recht auf Freiheit, auf Liebe und Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
PETERPRANGE
Die Philosophin
Historischer Roman
Über dieses Buch
Paris ist Mitte des 18. Jahrhunderts Schauplatz einer Auseinandersetzung, die die Welt verändern wird. Gegen die Macht der Kirche und der Krone reklamieren die Philosophen ein Paradies auf Erden, in dem Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit regieren. Ihr Bezugspunkt ist die Enzyklopädie, das größte Buchprojekt aller Zeiten.
Als Bedienstete im Literatencafé ›Procope‹ lernt Sophie den Herausgeber dieses gefährlichen Buches kennen: Denis Diderot. Er ist ein Mann, der für den Traum von einer besseren Welt zu sterben bereit ist. Sie ist von den neuen Ideen fasziniert, aber auch verängstigt. Geprägt von einem furchtbaren Erlebnis in ihrer Kindheit, glaubt sie, dass es Frauen wie ihr nicht zusteht, lesen und schreiben zu können - und jemand wie sie darf auch nicht lieben.
Hin- und hergerissen zwischen Gefühl und Verstand führt ihr Weg sie durch alle Schichten der Gesellschaft. Als sie zur Vorleserin der Marquise de Pompadour aufsteigt, begegnet sie am Hof von Versailles dem obersten Zensor Frankreichs. In ihm findet sie einen unerwarteten Verbündeten im Kampf für Diderots Enzyklopädie - ohne zu ahnen, dass sie mit diesem Mann längst in einer geheimnisvollen, tragischen Beziehung steht.
Weitere Titel des Autors:
›Der Traumpalast. Im Bann der Bilder‹, ›Unsere wunderbaren Jahre‹ ›Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben‹, ›Eine Familie in Deutschland. Am Ende die Hoffnung‹, ›Das Bernstein-Amulett‹, ›Himmelsdiebe‹, ›Die Rose der Welt‹, ›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹, ›Die Philosophin‹, ›Die Principessa‹, ›Die Gärten der Frauen‹, ›Die Götter der Dona Gracia‹, ›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: bürosüd°, München
Coverabbildung: bridgemanart, Berlin (Stadt) und Getty Images (Feder)
Erschienen bei FISCHER E-Books
Der Roman erschien erstmals 2003 im Droemer Knaur Verlag.
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403028-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
PROLOG DER SCHEITERHAUFEN 1740
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
ERSTES BUCH DER STACHEL IM FLEISCHE 1747
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
ZWEITES BUCH VOM BAUM DER ERKENNTNIS 1749
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
DRITTES BUCH DIE VERBOTENE FRUCHT 1751–1752
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
VIERTES BUCH DIE VERTREIBUNG 1757–1759
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
FÜNFTES BUCH DORNEN UND DISTELN 1760–1766
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
INTERIM DER HEILIGE BERG 1772
1. Kapitel
EPILOG DAS SCHAFOTT 1794/Jahr II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Karte
Dichtung und Wahrheit
Dank
Für Roman Hocke
erstens, weil er mich erfunden hat, zweitens, weil er niemals locker lässt, drittens, weil es nicht immer Rom sein muss.
»Alle Menschen sind sich einig in dem Wunsch nach Glück. Die Natur hat uns allen ein Gesetz für unser eigenes Glück gegeben. Alles, was kein Glück ist, ist uns fremd; einzig das Glück hat eine unverkennbare Macht über unser Herz.«
Enzyklopädie, Artikel »Glück«
Inhalt
Prolog
Der Scheiterhaufen 1740
11
1. Buch
Der Stachel im Fleische 1747
45
2. Buch
Vom Baum der Erkenntnis 1749
139
3. Buch
Die verbotene Frucht 1751–1752
239
4. Buch Die Vertreibung 1757–1759
315
5. Buch
Dornen und Disteln 1760–1766
403
Interim Der heilige Berg 1772
521
Epilog Das Schafott 1794 / Jahr II
531
Dichtung und Wahrheit
547
Danke
557
PROLOGDER SCHEITERHAUFEN1740
1
»Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae …«
Sophie schloss die Augen, während sie mit bloßen Füßen auf dem gestampften Lehmboden ihrer Schlafkammer kniete, um mit der ganzen Inbrunst ihres elfjährigen Herzens zu beten. Dabei ließ gerade dieses Herz ihr keine Ruhe – es pochte so heftig, als wollte es ihr zur Brust herausspringen. Das lateinische Glaubensbekenntnis gehörte zu den Aufgaben, die der Pfarrer die Kommunionkinder des Dorfes heute abfragen würde, bevor sie zum ersten Mal in ihrem Leben an den Tisch des Herrn treten durften. Obwohl Sophie das Credo an diesem Morgen schon ein Dutzend Mal gebetet hatte, sagte sie es deshalb noch einmal auf. Das Sakrament der heiligen Kommunion war nach den Sakramenten der Taufe und der Beichte das dritte Tor auf dem langen, langen Weg zum Himmelreich, und das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche war der Schlüssel, um dieses Tor in ihrem Herzen aufzuschließen.
»… visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum …«
Sophie verstand zwar kein einziges Wort des Gebets, doch war sie sich seines Sinnes so gewiss wie der Tatsache, dass der Herrgott im Himmel sie liebte. Während sie durch den Irrgarten der lateinischen Verse schnurrte, fühlte sie sich, wie wenn sie durch das Buchsbaumlabyrinth lief, das Baron de Laterre im Schlosspark angelegt hatte. Man schien ganz und gar darin verloren, ohne Hoffnung, je ans Ende zu gelangen, doch wenn man einfach drauflos sauste, schaffte man es irgendwie doch. Jeder Vers war eine neue Gasse, jedes Versende eine Biegung des Labyrinths, und plötzlich stand man frei auf einer sonnenüberfluteten Lichtung. Als würde man durch das Himmelstor ins Paradies eintreten.
»… Et expectio resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.«
»Meinst du nicht, du hast genug geübt? Höchste Zeit, dich anzuziehen!«
Sophie schlug die Augen auf. Vor ihr stand ihre Mutter Madeleine. Über dem Arm trug sie eine weiße, bauschige Wolke – Sophies Kommunionkleid.
»Ich hab solche Angst«, sagte Sophie, während sie ihr grobleinenes Nachthemd auszog. »Mir ist richtig schlecht.«
»Das kommt nur, weil du nichts im Magen hast«, erwiderte Madeleine und streifte ihr das Kleid über den nackten Leib. Sie hatte es aus einem Gardinenrest genäht, den ihr der Baron für Sophie geschenkt hatte. »Du hast seit der Beichte gestern nichts mehr gegessen.«
»Was ist, wenn ich irgendeine Sünde vergessen habe?« Sophie zögerte, bevor sie weitersprach. »Darf ich dann den Heiland überhaupt in meine Seele lassen? Die muss doch ganz und gar sauber sein.«
»Was für Sünden hast du denn begangen?« Ihre Mutter lachte und schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube, deine Seele ist so blitzblank wie der Himmel draußen.«
Sophie spürte, wie der Gardinenstoff an ihren Brustspitzen kratzte, die seit ein paar Wochen merkwürdig spannten. »Die Leute sagen«, erwiderte sie leise, »ich bin in sündiger Liebe gezeugt. Hätte ich das nicht auch beichten müssen?«
»Wer hat das behauptet?«, fragte Madeleine, und an der heftigen Art, wie sie die Knöpfe zumachte, spürte Sophie, dass ihre Mutter ganz und gar anderer Meinung war.
»Der Pfarrer, Abbé Morel.«
»So, sagt er das? Obwohl du ihm die ganze Arbeit abnimmst? Ohne dich könnte er die anderen Kinder gar nicht unterrichten.«
»Und er sagt auch, dass Papa in der Hölle ist. Weil er nicht mit dir verheiratet war. Wenn Männer und Frauen Kinder bekommen, ohne verheiratet zu sein, dann, sagt Monsieur l’Abbé, ist das wie bei den Katzen.«
»Unsinn«, entschied Madeleine und schloss den letzten Knopf an Sophies Kleid. »Das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass die Eltern sich lieb haben, so wie dein Papa und ich. Die Liebe ist das Einzige, was zählt.«
»Außer dem Lesen!«, protestierte Sophie.
»Außer dem Lesen!« Madeleine lachte. »Und alles andere ist dummes Gerede – hör nicht darauf!« Sie küsste Sophie auf die Stirn und sah sie zärtlich an. »Wie hübsch du bist. Da, schau selbst!«
Sie gab ihr einen Klaps, und Sophie trat vor die Spiegelscherbe, die neben dem kleinen Marienaltar an der weiß gekalkten Wand hing. Als sie sich sah, bekam sie einen freudigen Schreck. Aus der Scherbe blickte ihr ein Mädchen mit roten Haaren entgegen, die in großen Locken auf ein so wunderschönes Kleid herabfielen, wie es sonst nur die Prinzessinnen und Feen auf den Bildern in Märchenbüchern trugen.
»Wenn dein Papa im Himmel dich jetzt sieht«, sagte ihre Mutter, »kann er dich von den Engeln dort oben gar nicht unterscheiden.«
Ob er sie wirklich sah? Sophie wünschte es sich so sehr, dass sie sich auf die Lippen biss. Obwohl ihr Vater vor drei Jahren in der Fremde gestorben war, an einem hitzigen Fieber, das im Süden des Landes grassierte, erinnerte sie sich so genau an ihn, dass sie nur die Augen zu schließen brauchte, um ihn vor sich zu sehen: ein großer bärtiger Mann mit einem Schlapphut auf dem Kopf und einer Kiepe auf dem Rücken, der mit seiner hellen Stimme alle Tierlaute nachmachen konnte, vom Pferdewiehern bis zum Gezwitscher unbekannter Vögel, die es nur in Afrika gab. Dorval war sein Name, und die Leute nannten ihn einen Hausierer, doch für Sophie war er ein Bote aus einer anderen Welt gewesen, einer Welt voller Geheimnisse und Wunder.
Jedes Jahr war er zur Kirchweih in ihr Dorf gekommen, über und über beladen mit Messern und Scheren, Töpfen und Tiegeln, Kurzwaren und Bürsten – vor allem aber mit Büchern. Drei Wochen, von Christi Himmelfahrt bis Fronleichnam, lebten sie dann in ihrem kleinen strohgedeckten Haus am Dorfrand wie eine richtige Familie zusammen, bis Dorval mit seinen Schätzen weiterzog, und diese drei Wochen waren für Sophie stets die schönste Zeit im Jahr gewesen. Jede Minute verbrachte sie in seiner Nähe, lauschte seinen Geschichten von fernen Orten und gefahrvollen Abenteuern, von der schönen Melusine oder Oger dem Riesen, blätterte mit ihm in den dicken, prachtvoll ausgemalten Büchern, von denen aus seiner Kiepe immer wieder neue zum Vorschein kamen, Fibeln, Herbarien, Traktate, die scheinbar auf alle Fragen des Lebens eine Antwort wussten: wie man Warzen oder den Schluckauf kurierte, die Schrecken des Jüngsten Gerichts bannte oder die bösen Mächte des Traums überwand. Von Dorval hatte Sophie die roten Haare und die Sommersprossen geerbt, die ihre Stupsnase und Wangen zu Tausenden übersäten, sodass ihre grünen Augen noch heller zu leuchten schienen als die ihrer Mutter. Vor allem aber hatte sie von Dorval etwas bekommen, was sie allen anderen Kindern im Dorf voraus hatte, eine Fähigkeit, die, wie ihre Mutter sagte, wertvoller war als sämtliche Schätze der Welt: die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben.
Plötzlich fiel Sophie etwas ein, und im selben Augenblick war ihre Festtagsstimmung dahin.
»Der Mann gestern Abend«, sagte sie leise.
»Was für ein Mann?«, fragte ihre Mutter erschrocken.
»Der Mann mit dem Federhut. Ich habe gehört, was er zu dir gesagt hat.«
»Du hast uns belauscht?« Madeleine zog ein Gesicht wie manchmal Sophie, wenn sie bei etwas Verbotenem ertappt wurde.
»Ich konnte nicht schlafen.« Sophie stockte. »Wird er – mein neuer Papa?«
»Aber nein, mein Herz, bestimmt nicht!« Madeleine kniete sich vor sie hin und schaute ihr fest in die Augen. »Wie kannst du nur so etwas Dummes glauben?«
»Aber was hat der Mann von dir gewollt? Er hat versucht, dich zu küssen!«
»Mach dir keine Sorgen! Männer sind manchmal so.«
»Und er wird wirklich nicht mein Vater?«, fragte Sophie, wobei sie vor Aufregung am ganzen Leib zitterte.
»Versprochen! Ich hab ihn zum Teufel geschickt. – Aber was ist mit dir? Du bist ja völlig durcheinander! Ich glaube, es ist besser, wenn ich dir etwas gebe, sonst wird dir in der Kirche noch schlecht.« Madeleine nahm eines der vielen Fläschchen vom Regal, die neben dem dicken Kräuterbuch standen, und tröpfelte daraus einen schwarzen Trank auf einen Holzlöffel.
»Da, nimm das!«, sagte sie und reichte ihr den Löffel. »Damit du dich wieder beruhigst.« Sophie zögerte. »Ist das keine Sünde? Vor der Kommunion?«
»Nein, mein Herz, das ist keine Sünde«, sagte Madeleine, während sie ihr vorsichtig den Trank einflößte, damit nichts auf ihr weißes Kleid tropfte. »Das ist Medizin, und die ist vor der Kommunion erlaubt. Du willst doch die Prüfung bestehen, oder?«
2
Die Glocken läuteten schon von Ferne, als Madeleine und Sophie Hand in Hand den Feldweg nach Beaulieu entlangliefen, ein Dorf von dreihundert Seelen. Ein blauer Himmel spannte sich über die Weinberge und Wiesen, die sich unter einem grünen Schleier auszubreiten schienen, und die warme Erde unter Sophies Holzpantinen verströmte wieder jene süßen, wohlvertrauten Düfte, die schon jetzt den Sommer ahnen ließen. Glitzernd im Sonnenschein wälzten sich die Fluten der Loire durchs Tal, Ginster und Flieder säumten die Ufer des Flusses, und das Schloss des Barons de Laterre, auf dem Sophies Mutter als Näherin arbeitete, erhob sich mit seinen zinnenbewehrten Türmen vor den Bergen so machtvoll über das Land, als wolle es alles Leben, das sich darauf regte, unter seinen Schutz nehmen.
»Ist das nicht ein Tag, um glücklich zu sein?«, fragte Madeleine und drückte Sophies Hand.
»Meinst du?«, fragte Sophie zurück. Sie spürte immer noch ein leises Grummeln im Magen, trotz der Medizin. Außerdem lag ihr noch eine Frage auf der Seele, die sie ihrer Mutter unbedingt stellen musste, bevor sie die Kirche erreichten. Doch wusste sie nicht, wie sie es anfangen sollte. Darum erwiderte sie nur: »Monsieur l’Abbé hat gesagt, die Menschen sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein.«
»Wer soll das dem Abbé glauben?« Madeleine lachte. »An einem solchen Tag?«
Sophie blieb stehen und schaute ihre Mutter an. Obwohl Madeleine das hässliche Schandlinnen trug, das sie immer in der Kirche tragen musste, strahlten ihre grünen Augen, als könne nichts auf der Welt ihr etwas anhaben, und an ihrem Hals flatterte das bunte Seidentuch, das Dorval ihr bei seinem letzten Besuch geschenkt hatte. Also fasste Sophie sich ein Herz.
»Mama …«, sagte sie zögernd.
»Ja, mein Schatz?«
»Führst du mich heute zur Kommunion, wenn ich die Prüfung bestehe? So wie die anderen Eltern ihre Kinder auch?« Ihre Mutter strich ihr über das Haar. Plötzlich war die Fröhlichkeit aus ihrem Gesicht verschwunden.
»Ach, Sophie, du weißt doch, dass das nicht geht. Abbé Morel hat mich von den Sakramenten ausgeschlossen.«
»Bitte, ich wünsche es mir so sehr. Ich möchte nicht als Einzige allein zur Kommunionbank gehen.«
»Der Pfarrer wird mich aber davonjagen, und dann ist es viel schlimmer.«
»Père Jaubert darf auch nicht zur Kommunion, und Abbé Morel hat ihm Ostern trotzdem die Hostie gegeben.«
»Père Jaubert ist der Küster, da drückt der Pfarrer ein Auge zu.«
»Père Jaubert hat auf den Friedhof gepinkelt, und das ist viel schlimmer als nicht verheiratet sein.«
»Ach Sophie, ich bin doch bei dir in der Kirche. Denk einfach daran, dass ich hinter dir stehe und alles sehe, was du tust.«
»Das ist nicht dasselbe.« Sophie musste die aufsteigenden Tränen unterdrücken. »Bitte, Mama. Wenn du nicht mitkommst, dann will ich auch nicht zur Kommunion.«
Madeleine erwiderte ihren Blick. Dann gab sie sich einen Ruck und sagte:
»Du meinst, wir sollten es wenigstens versuchen?«
Sophie nickte, so heftig sie konnte. Mit einem Lächeln griff Madeleine nach ihrer Hand.
»Na gut. Dann nehmen wir uns also an Père Jaubert ein Beispiel.«
Als sie wenige Minuten später die Kirche betraten, war das kleine Gotteshaus bereits zum Bersten voll. Überall zappelten aufgeregte Kinder an den Händen ihrer Eltern. Mit einem Anflug von Stolz stellte Sophie fest, dass sie als einziges Mädchen ein weißes Kleid trug. Neben den anderen Kindern, die in ihren braunen und grauen Kitteln wie kleine erwachsene Bauern wirkten, sah sie wirklich aus wie ein Engel.
Sie tauchte die Fingerspitzen ins Weihwasserbecken und schlug das Kreuzzeichen. Doch als sie mit ihrer Mutter durch das Kirchenschiff nach vorne ging, erhob sich ein Gezischel, als hätte jemand ein Geheck Vipern zwischen den Bänken ausgesetzt.
»Dass die sich traut, sich hier blicken zu lassen!«
»Schau nur, das bunte Tuch! So eine eitle Person!«
»Und wie sie ihre Tochter herausgeputzt hat!«
In der dritten Bank war noch Platz. Als Madeleine und Sophie sich mit einem Knicks vor dem Altar verneigten, rückten ihre Nachbarn so weit zur Seite, als hätten sie Angst, sich anzustecken. Sophie fühlte sich plötzlich ganz schwach.
»Dominus vobiscum!«
»Et cum spiritu tuo!«
Zum Glück fing in diesem Augenblick das Hochamt an. Die Gemeinde erhob sich, und gefolgt von vier Messdienern nahm Abbé Morel in seinem alten, zerschlissenen Ornat am Altar seinen Platz ein. Während er mit hoher Fistelstimme das Kyrie sang, zischte jemand hinter Sophie:
»Rotes Haar und Sommersprossen …«
Wütend schaute sie sich um. Joseph Mercier, der Sohn eines Tagelöhners, grinste sie mit platzrundem Frechgesicht an. Er war der dümmste Junge im ganzen Dorf, niemand wusste das besser als Sophie. Im Auftrag des Pfarrers, der selber kaum mehr als seinen eigenen Namen schreiben konnte, leitete sie dreimal in der Woche den Unterricht der Dorfkinder und versuchte, ihnen mit Hilfe des Marienkalenders das Lesen beizubringen. Joseph konnte kein A von einem O unterscheiden. Die Stimme von Abbé Morel rief sie zurück.
»Wie lautet das Gebet des Herrn? Marie Poignard!«
Die Prüfung der Kommunionkinder begann. Ein rotwangiges Mädchen stolperte aus der Bank und sagte stockend das Vaterunser auf. Im Chorgestühl entdeckte Sophie Baron de Laterre, der mit amüsiertem Gesicht Maries Gestammel verfolgte. Als der Baron Sophie sah, nickte er ihr freundlich zu. Sie erwiderte seinen Gruß – da tauchte für einen Moment hinter dem Baron eine rote bauschige Feder auf. War dort der junge Mann, der gestern Abend bei ihrer Mutter gewesen war? Sophie reckte sich, um sein Gesicht zu erkennen.
»Sophie Volland, ich habe dich etwas gefragt!«
Sophie zuckte zusammen. Abbé Morel blickte sie mit seinen kleinen, grauen Augen böse an. Sein Gesicht war so faltig und fleckig wie das eines Salamanders.
»Credo in unum Deum …«
Wie auf Kommando rasselte sie das Glaubensbekenntnis herunter, doch sie war noch nicht beim dritten Vers angekommen, als Abbé Morel sie unterbrach.
»Du sollst auf meine Frage antworten! Wodurch unterscheidet sich der Leib des Herrn von gewöhnlicher Speise?«
Sophie biss sich auf die Lippe. Auf jede Frage hatte sie sich vorbereitet, nur nicht auf diese. Abbé Morels Blick wurde immer böser. Sophie geriet in Panik. Wenn sie jetzt keine Antwort gab, war sie durchgefallen. Herrgott, was wollte der Pfarrer nur wissen?
So laut, dass es mehrere Reihen weit zu hören war, knurrte Sophies Magen. Plötzlich wusste sie die Antwort.
»Gewöhnliche Speise ist Nahrung für den Leib, das Brot des Herrn aber ist Seelenspeise – Brot des ewigen Lebens.«
»Bravo, Sophie!«, rief der Baron und nickte ihr abermals zu.
Abbé Morel entblößte mit einem säuerlichen Lächeln seine gelben Zähne und fuhr mit der Prüfung eines anderen Kindes fort. Sophie atmete auf. Doch so groß der Stein auch war, der ihr vom Herzen fiel, noch lag eine andere Hürde vor ihr, eine zweite Prüfung, die vielleicht noch schwerer war als die erste. Bei der heiligen Wandlung war sie darum so aufgeregt, dass es ihr fast den Magen umdrehte, als die Messdiener die Weihrauchfässchen schwenkten und der süße Duft ihr in die Nase stieg.
»Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser!«
Der Augenblick war da! Abbé Morel verkündete einzeln die Namen der Kinder, die an diesem Tag zum ersten Mal den Leib Christi empfangen sollten, und forderte ihre Eltern auf, sie an den Tisch des Herrn zu führen. Sophie griff nach der Hand ihrer Mutter. Sie war genauso feucht wie die ihre.
»Möge diese Speise euch stärken, wenn Gott und der Teufel um eure Seele ringen.«
Jetzt waren sie an der Reihe! Sophie musste die Zähne zusammenpressen, damit sie nicht aufeinander schlugen, als sie mit ihrer Mutter aus der Bank trat, und ihr Herz klopfte so heftig, dass das Blut in ihren Ohren rauschte wie die Loire bei Hochwasser. Seite an Seite gingen Mutter und Tochter zum Altar, genau so, wie Sophie es sich gewünscht hatte. Abbé Morel nahm eine Hostie aus dem Kelch, und Madeleine kniete nieder.
»Was? Die Hure wagt es?«
Ein Raunen erhob sich in der Kirche. Irritiert blickte der Pfarrer auf. Sophie sah sein Gesicht: Die buschigen Brauen gingen in die Höhe, der Kinnladen fiel herunter – erst jetzt wurde Abbé Morel gewahr, wer da vor ihm um das Brot des Herrn bat. Im selben Augenblick machte er einen Schritt zurück, als sähe er den Leibhaftigen vor sich.
Sophie sandte ein Stoßgebet zum Himmel: »Bitte, lieber Gott, hilf!«
Es war, als hielte die ganze Kirche den Atem an. Kein Laut, keine Regung, nur das Flattern eines Sperlings, der sich in das Gotteshaus verirrt hatte. Plötzlich ein Hüsteln in die Stille hinein, ein Hüsteln aus dem Chorgestühl. Abbé Morel schnellte herum. Der Baron war aufgestanden, mit ernster Miene nickte er dem Pfarrer zu. Der begriff nicht, erwiderte fragend den Blick.
»Zum Teufel, worauf warten Sie noch!«
Endlich begriff der Pfarrer, und das Wunder geschah: Abbé Morel drehte sich zu Madeleine um, und während er die Hostie in die Höhe hielt, knurrte er:
»Der Leib Christi!«
»Amen!«
Als Sophie sah, wie ihre Mutter die Hostie empfing, schossen ihr die Tränen in die Augen. Gott hatte ihr Gebet erhört! Überglücklich sank sie auf die Knie.
»Der Leib Christi!«
»Amen!«
Ihr Herz jubilierte, ihre Seele jauchzte, ein überirdischer Taumel packte sie, als sie die Augen schloss und die Lippen öffnete. Alles in ihr war Bereitschaft, sehnlichste Erwartung, den Leib des Herrn zu empfangen.
Da aber passierte das Unfassbare. Kaum berührte die Hostie ihre Zunge, krampfte sich Sophies Magen zusammen, ein heftiger, unwiderstehlicher Reiz, der ihre Gedärme erfasste, würgte in ihrem Schlund, höher und höher hinauf. Bevor sie die Hände zum Mund führen konnte, entleerte sich ihr Magen in einem fürchterlichen Schwall.
Ein Aufschrei erfüllte das Gotteshaus.
Als Sophie zu Bewusstsein kam, sah sie an ihrem weißen Kleid hinab. Der riesige Fleck, der ihren Schoß bedeckte, war schwarz wie kranke Galle.
3
»Die Näherin Madeleine Volland, gebürtig und wohnhaft im Kirchspiel Beaulieu, wird beschuldigt, gegen den Glauben und den gemeinen Nutzen des Staatswesens gehandelt zu haben, indem sie die schwarze Kunst an ihrer Tochter Sophie ausgeübt und diese durch Verabreichung eines magischen giftigen Tranks veranlasst hat, am Tage ihrer ersten heiligen Kommunion den Leib des Herrn zu erbrechen, in Gegenwart des amtierenden Pfarrers sowie der versammelten Gemeinde.«
Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt, als der königliche Landrichter die Anklage verlas. Sein altes, von den Jahren zerfurchtes Gesicht blieb während des Vortrags so teilnahmslos wie das Gesetz selbst, nur ab und zu verrutschte auf seinem Schädel die Perücke, deren Sitz er jedes Mal mit derselben, schon tausendmal wiederholten Bewegung seiner Linken korrigierte, ohne im Redefluss innezuhalten. Alle Augen waren auf die Angeklagte gerichtet, die erhobenen Hauptes, doch mit gefesselten Händen vor ihm stand, flankiert von zwei Bütteln.
Im Publikum saß ein junger Mann, der sich durch sein vornehmes Gewand auffallend von den übrigen Zuschauern im Saal unterschied, ein Gentilhomme von achtzehn Jahren, Spross einer der glänzendsten Familien Frankreichs und Mitglied mehrerer Akademien. Mit bitterer Genugtuung lauschte er der Rede des Richters, jedes Wort einzeln in sich aufnehmend wie ein Kranker die Tropfen einer Arznei, derer er zur Linderung übergroßer Schmerzen bedarf. Aufmerksam suchte er nach einer Regung im Gesicht der Angeklagten, doch vergebens: Diese Frau, die nicht das geringste Zeichen von Reue zu erkennen gab, hatte ihm das schlimmste Verbrechen zugefügt, das eine Frau einem Mann überhaupt antun konnte. Er war so angespannt, dass er fortwährend seinen Hut auf den Knien drehte, einen schwarzen, breitkrempigen Hut, der mit einem roten Federbusch verziert war.
Er selbst hatte Madeleine Volland beim Gericht von Roanne angezeigt, noch am selben Tag, da sich der unerhörte Vorfall in der Dorfkirche von Beaulieu ereignet hatte, um ihr das Unrecht zu vergelten, das er durch sie erlitten hatte. Dafür hatte er sogar mit seinem Gastgeber gebrochen, dem Baron de Laterre, der ihn beschworen hatte, auf die Klage zu verzichten. Doch als Jurist, der bei den hervorragendsten Gelehrten des Landes studiert hatte, wusste der junge Mann das Recht auf seiner Seite. Im Jahre 1682 hatte ein königliches Edikt »alle Taten von Magie oder Aberglauben« unter Strafe gestellt, desgleichen »das Sagen und Tun von Dingen, die nicht natürlich erklärt werden können«, und schließlich die Todesstrafe für Gotteslästerungen erlassen, die im Zusammenhang mit »eingebildeten magischen Wirkungen oder Täuschungen ähnlicher Art« begangen wurden. Diese Gesetze waren nach wie vor in Kraft.
Der Richter rückte seine Perücke zurecht und wandte sich an die Angeklagte.
»Madeleine Volland, bekennst du dich schuldig, die vorgetragenen Verbrechen begangen zu haben?«
»Ich bekenne mich schuldig zu leben. Sonst habe ich nichts verbrochen.«
Ein empörtes Gemurmel erhob sich im Saal, ein paar Zuschauer lachten. Der Richter klopfte mit einem Hammer auf den Tisch, um die Ruhe wiederherzustellen.
»Wo ist meine Tochter?«, fragte Madeleine in die Stille hinein.
Sie drehte sich um und schaute ins Publikum. Ruhig, ohne mit der Wimper zu zucken, fasste sie die Zuschauer ins Auge, einen nach dem andern, als hoffe sie, Sophie zwischen ihnen zu entdecken. Der junge Mann spürte, wie ihm der Mund austrocknete, während die Augen der Angeklagten sich immer mehr in seine Richtung bewegten, doch er war entschlossen, nicht zu weichen.
Plötzlich trafen sich ihre Blicke. Im gleichen Moment verengten sich Madeleines Augen zu zwei Schlitzen, und aus diesen Schlitzen blitzte ihm ein solcher Hass entgegen, als würde eine Schlange ihm ihr Gift ins Gesicht schleudern.
Leise stöhnte er auf. Wie sehr hatte er sich danach gesehnt, dass Madeleine ihn mit ihren grünen Augen anschaute, und was für eine Qual war es nun, da sie es tat! Er hatte diese Hexe geliebt, sich nach ihr verzehrt wie nach keiner anderen Frau je zuvor. Seit er sie das erste Mal gesehen hatte, im Schloss des Barons de Laterre, war es, als habe er keinen eigenen Willen mehr. Wenn er aufwachte, galt ihr sein erster Gedanke, wenn er einschlief, sah er ihr Gesicht vor sich. Er war bereit gewesen, alles für sie hinzugeben, sein Vermögen, seinen Titel, seine Ehre. Doch sie hatte ihn verschmäht, seine Liebe zurückgewiesen, und als er sie bestürmte, ihn zu erhören, als er ihr sein Herz zu Füßen legte, hatte sie ihn zum Teufel gewünscht. Noch in derselben Nacht, da sie den Fluch aussprach, hatte er in den Armen einer Dirne von Roanne voller Entsetzen erkannt, dass dies keine leeren Worte waren: Sie hatte ihn verhext, ihn vergiftet, genauso wie ihre Tochter Sophie.
Obwohl es ihn übermenschliche Anstrengung kostete, hielt er ihrem Blick stand. Die Stunde war gekommen, da sie für ihr Verbrechen büßen würde. Bei der Klageerhebung hatte er dem Gericht angeboten, persönlich ihre Schuld zu beweisen, und sich zur Strafe der Wiedervergeltung eingeschrieben für den Fall, dass ihm dies nicht gelänge. Doch er war sich seiner Sache sicher. Er hatte in Madeleines Behausung ein Buch gefunden, das keinen Zweifel an ihrer Schuld erlaubte, ein dickleibiges, in Schweinsleder gebundenes Werk, aus dem sie ihr böses Wissen bezogen hatte, ein Herbarium, das neben der Beschreibung von Kräutern und anderen Pflanzen Hunderte von Rezepturen enthielt: gegen Harnzwang und Geistersehen, gegen Würmerfraß und den bösen Blick. Dieses Buch, mit dem sie versucht hatte, sich über andere Menschen zu erheben, würde nun, da es neben der Bibel auf dem Richtertisch lag, ihr Schicksal besiegeln.
Als könne sie seine Gedanken erraten, wandte sie den Blick von ihm ab.
»Ich rufe den Kläger in den Zeugenstand!«
Der junge Gentilhomme erhob sich und trat vor den Richter.
»Aus persönlichen Gründen hat der Zeuge gebeten, Stillschweigen über seinen Namen zu bewahren. Da er dem Gericht als Mann von Stand und Geblüt bekannt ist, wird dem Wunsch entsprochen.«
Der Gerichtsdiener holte die Bibel, der Kläger hob die Hand zum Schwur, und mit dem Rücken zur Angeklagten, deren Blicke er in seinem Nacken spürte wie die Berührung von Eis, sprach er die Eidesformel.
Dann nahm die Gerechtigkeit ihren Lauf.
4
Dicke Regentropfen klatschten gegen die Fensterscheiben und rannen wie Tränen vor Sophies Gesicht herab. Die ganze Welt schien hinter einem grauen, undurchdringlichen Schleier aus Wasser und Nebel verborgen.
Noch war im Schloss alles still. Seit Sophie aufgewacht war, saß sie am Fenster der kleinen Kammer, die man ihr am Ende des Gesindeflurs angewiesen hatte, und schaute zu, wie der neue Tag anbrach. Triefend von Feuchtigkeit, traten nach und nach die Bäume und Büsche des Parks aus den nächtlichen Schatten hervor, und jenseits des noch schwarzen Buchsbaumlabyrinths, in dem Sophie so oft gespielt hatte, konnte sie an der Grenze zu den Wiesen in dem milchigen Nebel allmählich die Weiden erkennen, die dort einsam im Wasser standen und die Zweige kraftlos herabhängen ließen, als wären sie tot.
Wo war ihre Mutter? Baron de Laterre, der Sophie zu sich genommen hatte, war allen ihren Fragen ausgewichen, genauso wie Louise, die älteste Zofe auf dem Schloss, in deren Obhut der unverheiratete Baron Sophie zurückgelassen hatte, als er in aller Eile mit der Auskunft nach Paris aufgebrochen war, er wolle in der Hauptstadt dafür sorgen, dass Madeleine bald wieder frei sei.
Wie viele Stunden, wie viele Tage waren seitdem vergangen? Ohne Gefühl für die Zeit saß Sophie am Fenster, schaute hinaus in den Park und versuchte, den dunklen, verschlungenen Pfaden des Labyrinths nachzuspüren. Auf dem Schloss ging es ihr besser als je zuvor in ihrem Leben, sie hatte ein eigenes Federbett und dreimal am Tag konnte sie essen, so viel sie wollte, und doch hatte sie noch nie zuvor so sehr gelitten. Wie viel lieber wäre sie auf ihrem Strohsack als in den weichen Kissen aufgewacht, wie viel lieber hätte sie statt Braten und Kompott ihren täglichen Hirsebrei gegessen! Soweit sie zurückdenken konnte, war sie nie länger als einige wenige Stunden von ihrer Mutter getrennt gewesen. Madeleine hatte sie abends ins Bett gebracht und morgens geweckt, und jede Mahlzeit des Tages hatten sie gemeinsam eingenommen. Als die Büttel aus Roanne Madeleine verhaftet hatten, war es gewesen, als gehe sie auf einer schwindelnd hohen Brücke über einen Abgrund, und plötzlich lasse die Hand sie los, die sie bislang gehalten hatte.
Was hatte ihre Mutter Schlimmes getan? Sollte sie dafür büßen, dass sie zur Kommunion gegangen war, obwohl Abbé Morel sie von den Sakramenten ausgeschlossen hatte?
Die Unwissenheit lastete auf Sophies Seele wie das Gefühl einer übergroßen und zugleich unfassbaren Schuld. Anfangs war sie wütend gewesen, hatte laut protestiert, jeden im Schloss gefragt, wohin man ihre Mutter verschleppt habe. Doch genauso wie der Baron und Louise verschwiegen ihr auch die Diener und Lakaien, was mit Madeleine geschah, und wollte ihr doch jemand etwas verraten, kam eilig Louise herbei und verbot ihm den Mund.
Je länger das Schweigen anhielt, mit dem man Sophie vor der Wahrheit abschirmte wie vor einem bösen Feind, desto mehr wich ihre Wut einer unbestimmten, unwirklichen Angst. Sie spürte, irgendetwas Fürchterliches bahnte sich an, sie witterte eine fremde, lauernde Gefahr, ahnte sie in den verlegenen Blicken, die sie erhaschte, in den getuschelten Worten hinter ihrem Rücken. Sie begann, für ihre Mutter zu beten, zündete in der Kapelle Kerzen an, und fast jede Nacht träumte sie, sie würde zusammen mit Madeleine und ihrem Vater auf dem Schloss leben, als eine glückliche Familie. Wenn sie dann am Morgen aufwachte, war die Wirklichkeit kaum noch zu ertragen.
Sophie seufzte. Vor ihr, auf der anderen Seite der Scheibe, ließ sich ein Spatz auf dem Fensterbrett nieder und versuchte, mit lautem Schimpfen sein nasses Gefieder zu trocknen. Der Regen hatte nachgelassen, und der Himmel hatte sich inzwischen so weit aufgehellt, dass die dunklen Pfade des Buchsbaumlabyrinths im Park einzeln und deutlich hervortraten. Wie leicht war der Weg ins Freie von hier oben aus zu erkennen, und wie schwierig war es, wenn man in dem Labyrinth gefangen war.
»Komm, zieh deine Pantinen an!«
Sophie hatte nicht gehört, dass jemand den Raum betreten hatte. Louise stand in der Tür und nickte ihr zu.
»Abbé Morel kommt gleich, um dich abzuholen. Er geht mit dir ins Dorf.«
Bei den Worten der Zofe keimte Hoffnung in Sophie auf.
»Gehen wir zu meiner Mutter?«
Louise nickte. Zugleich aber schlug sie die Augen nieder.
5
Grauer, feuchter Qualm stieg über dem Dorfplatz von Beaulieu auf, wo unter der Leitung des Küsters Père Jaubert ein halbes Dutzend Arbeiter fluchend damit beschäftigt war, ein Feuer zu entfachen. Die ganze Nacht über hatte es in Strömen geregnet, ein nasser, für die Jahreszeit viel zu kalter Wind hatte schwere dunkle Wolken durch das Tal getrieben, und nun wollte das Holz nicht brennen: fünf Klafter Buche, das Klafter zu vierzig Livres, dazu einhundert Reisigbündel und drei Säcke Kohle.
»Was für eine Verschwendung!«, klagte Jacqueline Poignard, die Mutter der kleinen Marie. »Das Holz wird uns nächsten Winter im Backhaus fehlen.«
»Strafe muss sein«, erwiderte der Tagelöhner Mercier. »Das Weibsstück hat es gar zu toll getrieben.«
Obwohl die Arbeit an diesem Tag ruhte, war schon jedermann im Dorf auf den Beinen. Alle strömten zur Kirche, um ihre Seelen zu stärken, bevor das große Schauspiel begann. Der Brauch, Gotteslästerer auf diese Weise zu strafen, war zwar so alt wie die Menschheit selbst, doch war er in der gesamten Provinz seit Jahrzehnten nicht mehr zur Anwendung gelangt. Nur die Ältesten erinnerten sich noch daran wie an die Feiern zur Geburt oder Hochzeit einer hohen Standesperson. Seit drei Tagen strömten aus dem ganzen Tal Schaulustige herbei, begierig, ein Spektakel zu erleben, das man ihnen allzu lange vorenthalten hatte.
Ein neuer böiger Regenschauer ging auf die Weinberge und Wiesen nieder, als Abbé Morel sich nach der Frühmesse auf den Weg machte. Seine Galoschen quietschten im Morast, der Regen rann ihm vom Hut in den Nacken, und dennoch setzte er seine Schritte so langsam voreinander, als habe er gar nicht die Absicht, an sein Ziel zu gelangen.
Hatte Madeleine Volland solche Strafe verdient? Der alte Pfarrer wusste es nicht. Wie oft hatte er diese Frau ermahnt, nicht länger in der Sünde zu verharren. Dabei hätte sie den Hausierer Dorval nur zu heiraten brauchen oder auf den fleischlichen Umgang mit ihm zu verzichten, um Vergebung zu erlangen, doch sie hatte sich immer geweigert. Nicht mal nach dem Tod des Mannes, der sie außerhalb der Ehe geschwängert hatte, war sie zur Reue bereit gewesen, als wäre es ihr in der Seele zuwider, das Schandlinnen abzulegen und sich mit der Kirche zu versöhnen.
Um seine Ankunft auf dem Schloss hinauszuzögern, machte Abbé Morel einen Umweg am Gemeindeanger vorbei. Kein anderer Gang hatte ihn in seinem langen Leben so sehr bedrückt, und er hätte seinen rechten Daumen hergegeben, um ihn sich und dem Kind zu ersparen. Aber das war nicht in sein Ermessen gestellt. Das Gericht hatte angeordnet, dass Sophie der Vollstreckung des Urteils beiwohnen musste als nützliches Exemplum für ihre gefährdete Seele. Morels Auftrag war es, sie zu begleiten.
Wann sollte er dem Kind sagen, wohin ihr Weg sie führte? Oder war es besser, es bis zum letzten Augenblick in der Gnade der Unwissenheit zu belassen?
Mit durchnässter Soutane klopfte Abbé Morel an die Pforte des Schlosses. Baron de Laterre war noch am selben Tag, da sein Gast, der junge Gentilhomme, nach Roanne geeilt war, um Anzeige zu erheben, nach Paris aufgebrochen. Er wollte sich beim dortigen Parlament, in dessen Zuständigkeit der Prozess gegen Madeleine Volland fiel, zugunsten der Angeklagten verwenden.
Ein Funke Hoffnung glomm also noch im Herzen des alten Abbé, und solange es Gottes Wille war, würde er ihn am Leben erhalten.
6
Eine Menschenmenge, wie Sophie noch keine je gesehen hatte, drängte sich auf dem Dorfplatz, als sie mit Abbé Morel in Beaulieu eintraf. Inzwischen hatte es fast aufgehört zu regnen, nur noch ein paar einzelne Tropfen fielen vom Himmel, doch noch immer strich ein feuchter Wind über das Tal. In der Luft hing ein brandiger Geruch.
Unwillkürlich griff Sophie nach der Hand des Pfarrers.
»Was wollen die vielen Leute hier? Warum arbeiteten sie nicht?«
Abbé Morel räusperte sich. War jetzt der Zeitpunkt gekommen, dem Kind die Wahrheit zu sagen? Er räusperte sich erneut, doch als er Sophies fragenden Blick sah, erstarb die Wahrheit auf seiner Zunge.
»Wer weiß, vielleicht geschieht noch ein Wunder, und der Baron kehrt rechtzeitig aus Paris zurück, bevor es zu spät ist.«
Sophie wusste nicht, wovon der Pfarrer sprach. Doch die leise Zuversicht, die sie auf dem Weg hierher verspürt hatte, schwand bei seinen Worten dahin, und wieder stieg in ihr jene Ahnung unheimlicher Gefahr auf, die sie verfolgte, seit sie von ihrer Mutter getrennt war. Unsicher, als lauere irgendwo versteckt ein böses Tier, schaute sie sich um. Bei ihrem Anblick verstummten die Leute und traten beiseite, um ihr Platz zu machen.
Plötzlich sah Sophie ihre Mutter, am Ende der Menschengasse, nur einen Steinwurf entfernt.
»Mama …«
Der Ruf blieb ihr in der Kehle stecken. Was hatte man mit ihrer Mutter gemacht? In der Mitte des Platzes, umringt von Hunderten Menschen, die johlten und feixten wie beim Karneval, war ein Gerüst errichtet. Darauf stand Madeleine, an Händen und Beinen gefesselt wie eine Verbrecherin, angetan mit ihrem Schandlinnen. Sie hielt den kahl geschorenen Kopf gesenkt und wirkte so einsam und verloren inmitten der vielen Menschen, dass es Sophie das Herz zuschnürte.
Hinter dem Gerüst loderte ein riesiges Feuer in den grauen Regenhimmel auf, als würden die Flammen der Hölle am Firmament lecken.
»Mama!«
Der Schrei, der sich endlich Sophies Kehle entwand, übertönte allen Lärm auf dem Platz. Madeleine hob den Kopf, ein schwaches Leuchten ging über ihr Gesicht.
»Sophie!«
Sie ahnte den Ruf Madeleines mehr, als dass sie ihn hörte. Sie wollte zu ihrer Mutter, doch die Hand des Pfarrers hielt sie zurück. Das bunte Tuch an Madeleines Hals, Dorvals Geschenk, flatterte im Wind, als wolle es sie verspotten. Auf einmal verspürte Sophie nur noch Angst, blanke, entsetzliche Angst.
»Lassen Sie mich los!«, schrie sie. »Ich will zu meiner Mutter!«
Sie zerrte und zog mit all ihren Kräften, um sich von Abbé Morel frei zu machen, trat gegen sein Bein, wieder und wieder, riss an seiner Soutane, spuckte ihn an und biss in seine Hand. Doch der alte Pfarrer hielt ihren Arm so fest umschlossen wie ein Schraubstock, während der Landrichter in schwarzer Robe und grauer Perücke das nasse Holzgerüst bestieg.
Bei seinem Erscheinen verstummte die Menge. Plötzlich war es so still, dass man die wenigen Regentropfen auf die Bohlen fallen hörte. Auch Sophie hielt unwillkürlich inne, während der Richter ein Pergament entrollte und seine Stimme erhob, um das Urteil zu verlesen, das über ihre Mutter gefällt worden war.
»… hat die Näherin Volland in gemeiner und böser Absicht danach getrachtet, ihr eigen Kind elend zu machen, indem sie ihm einen verderblichen Trank beibrachte …«
Was hatte das zu bedeuten? In Sophies Kopf überschlugen sich die Gedanken. In ihrer Verwirrung verstand sie nur Fetzen von der Rede, aus der einzelne Worte hervorstachen wie struppige, dornige Zweige aus einem finsteren, undurchdringlichen Dickicht: Buhlschaft, schwarze Magie, Giftmischerei …
»… weshalb das Gericht zu dem Urteil gelangte, dass die Übeltäterin zur Strafe für ihre schwere Schuld und Gottlosigkeit den Tod erleiden soll …«
Wovon sprach dieser Mann? Unfähig, den Sinn der Rede zu begreifen, sah Sophie, wie der Richter die Pergamentrolle in den Tiefen seiner Robe verschwinden ließ und gleichzeitig einem riesengroßen Mann zunickte, der mit nacktem Oberkörper und verschränkten Armen etwas abseits auf dem Gerüst stand. Erst jetzt erkannte sie den Galgen, der über ihrer Mutter emporragte.
»Sie wird sterben, bevor die Flammen sie erreichen«, sagte Abbé Morel. »Sie muss nicht mehr leiden als nötig.«
Sophie wollte die Augen abwenden, doch sie konnte es nicht. Als stünde sie unter einem Bann, sah sie ohnmächtig mit an, wie der halb nackte Riese zu ihrer Mutter trat und ihr die Schlinge um den Hals legte. Als er die Schlinge festzog, traf sie noch einmal ihr Blick, Madeleines Lippen bewegten sich, und noch einmal rief sie ihrer Tochter etwas zu. Sophie verstand nur ein einziges Wort:
»… Glück …«
Im selben Augenblick verlor Madeleine den Boden unter den Füßen, ein Aufschrei ging über den Platz, und gleich darauf wurde sie von dem Seil in die Höhe gerissen. Für eine Sekunde baumelte sie in der Luft, dann plötzlich ein Ruck, und der Balken, von dem ihr Körper herabhing, schwenkte über das Feuer.
»Aaaaahhhhhh …«
Wie eine Erlösung erscholl der Ruf aus unzähligen Kehlen, als die Flammen die Kleider der Gehängten erfassten. Sophie schrie auf wie ein Tier, schrie und schrie und schrie, als würde sie nie wieder aufhören können zu schreien, schrie ihre Liebe hinaus, ihre Liebe und ihren Schmerz und ihre Verzweiflung. Doch gierig fraß das Feuer sich weiter, stetig und unbeirrbar, von den Gliedmaßen her auf die Mitte des Körpers zu, mit züngelnden, tänzelnden Flammen, überzog bald den ganzen Leib ihrer Mutter, aus dem schon alles Leben gewichen war. Mit verdrehtem Kopf, Arme und Beine in der Luft baumelnd, hatte Madeleine Volland ihren Widerstand für immer aufgegeben. Auf einmal fühlte Sophie sich wie gelähmt. Sie roch nicht den Geruch des Feuers, spürte nicht die Nässe in ihrem Gesicht, sah nur vor sich Dinge, die ihr Begreifen überstiegen. Passierte wirklich, was hier vor ihren Augen geschah? Eine graue Katze floh in weiten Sätzen von dem Gerüst, als würde sie von unsichtbaren Teufeln gehetzt. Und während die Katze zwischen den Menschen verschwand, regte sich in Sophie ein schwarzer, böser Gedanke: Es war ihre Schuld, was hier geschah.
»Komm«, sagte Abbé Morel, »gehen wir nach Hause.«
Doch Sophie rührte sich nicht von der Stelle. Sie wollte, musste bleiben, bis zum bitteren Ende, mit eigenen Augen sehen, wie die Überreste ihrer Mutter in den Flammen verbrannten, damit sie für immer das Unbegreifliche begriff, das sich hier ereignete. Tränen rannen aus ihren Augen, bildeten einen heißen, salzigen Strom auf ihren Wangen, um sich dort mit den Regentropfen zu vermischen, während sie nach der großen schweren Hand des Pfarrers griff, gegen die sie sich eben noch mit all ihren Kräften gewehrt hatte. Sie nahm diese Hand und klammerte sich an sie, als wäre dies ihre letzte Zuflucht auf Erden.
»Gott sei ihrer armen Seele gnädig!«, flüsterte Abbé Morel.
Während der Pfarrer dies sagte, riss irgendwo der Himmel auf, und durch eine Öffnung im Wolkendach, die man noch gar nicht sehen konnte, flutete ein langer schräger Sonnenstrahl auf den Richtplatz herab. Wenig später leuchtete das ewige Blau des Himmels zwischen zwei Wolkengebirgen hervor, rasch vergrößerte sich der Riss, als teile sich dort oben ein gewaltiger Vorhang, und während die Menschenmenge auf dem Platz sich allmählich zerstreute, spannte sich ein herrlicher Regenbogen über das Land. Wie ein Seufzer der Erde zog ein frischer Hauch durch das Tal. Das Schauspiel war vorbei, der Frevel der Näherin Volland gesühnt, und ihre Tochter Sophie durfte endlich die Stätte verlassen, mit gebrochenem Herzen und Gliedern so schwer wie Blei.
Als sich am Abend die Dämmerung über das Dorf legte, wie erschöpft von einem allzu langen Tag, traf ein eiliger Reiter auf dem Richtplatz ein. Es war Baron de Laterre, er kam direkt aus der Hauptstadt Paris. Er reckte den Arm in die Höhe und schwenkte in der Hand eine vom Parlamentspräsidenten unterzeichnete Verfügung, wonach das Urteil des Landgerichts Roanne, wie immer es ausfallen mochte, nicht zu vollstrecken sei.
Doch zu dieser späten Stunde lag der Dorfplatz von Beaulieu so verlassen da wie die Welt am Abend des Jüngsten Gerichts. Nur ein paar dunkle Gestalten suchten in der Asche nach verkohlten Gebeinen der Hingerichteten. Es hieß, solche Reliquien brächten Glück, und vielleicht konnte man sie ja verkaufen.
7
»Rotes Haar und Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen!«
»Komm, hör nicht auf sie!«
Abbé Morel nahm Sophies Hand und zog sie fort. Wie dankbar war sie, dass er sie vor den anderen Kindern schützte, die am Dorfrand hinter ihr her riefen. Immer hatte sie geglaubt, der Pfarrer könne sie nicht leiden, weil sie wusste, dass er nicht richtig lesen konnte. Aber sie hatte sich geirrt. Abbé Morel war ihr nicht böse, er war nur streng – er hatte für die Zulassung zur Erstkommunion ja auch das lateinische Glaubensbekenntnis verlangt, während in allen anderen Gemeinden das französische Vaterunser genügte. Jetzt war dieser strenge Mann wie ein Vater zu ihr, ihr Beschützer und Freund, der einzige Mensch, der außer Baron de Laterre noch zu ihr hielt. So fest sie konnte, drückte sie seine große schwere Hand und sah zu ihm auf. Sein Salamandergesicht bekam noch ein paar Runzeln mehr, als er ihr Lächeln erwiderte, und seine Lippen entblößten die gelben Zähne.
Ohne sich umzudrehen, ließen sie Beaulieu hinter sich, und entlang der Loire, über die ein wolkenloser Sommerhimmel wieder sein klares, tiefes Blau ausbreitete, entfernten sie sich immer weiter von dem Dorf, in dem Sophie geboren und aufgewachsen war. Auf dem Schloss konnte sie nicht länger wohnen; als sie vor zwei Tagen mit Blut zwischen den Schenkeln aufgewacht war, hatte die Zofe Louise zu ihr gesagt, nun sei sie eine Frau und man müsse eine andere Unterkunft für sie finden. Noch am selben Morgen hatten der Baron und der Pfarrer beschlossen, sie ins Kloster zu bringen. Dort sollte sie bleiben, bis sie selber für sich sorgen konnte.
»Wer war der Mann mit dem Federhut?«, fragte Sophie.
Sie hatten den Gemeindeanger erreicht. Abbé Morel blieb stehen und zog ein Schnäuztuch aus dem Ärmel seiner Soutane. Auf seiner Stirn stand der Schweiß in dicken Tropfen.
»Es ist besser, wenn du den Namen nicht weißt.«
»Der Mann war Gast auf dem Schloss – wo ist er jetzt?«
»Trachte nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, und so wird dir alles zufallen«, erwiderte der Abbé. Mit einem Seufzer wischte er sich den Schweiß von der Stirn. »Was ist das nur für eine unerträgliche Hitze!«
»Warum wollen Sie es mir nicht sagen?« Sophie schaute ihn an, doch im Gesicht des Abbés regte sich keine Falte, während er das Tuch wieder in seiner Soutane verschwinden ließ.
»Die Leute behaupten, ohne ihn würde meine Mutter noch leben. Stimmt das?«
»Alle Menschen sind Werkzeuge Gottes. Sein Wille geschehe!« Der Pfarrer strich ihr über das Haar. »Du sollst nicht so viel fragen«, fügte er sanft hinzu. »Lieber solltest du weinen und für die Seele deiner Mutter beten. Oder ist dein Herz etwa verhärtet?«
Sophie gab keine Antwort. Schweigend gingen sie weiter eine kleine Anhöhe hinauf. Der Weg war staubig, als hätte ihn nie ein Tropfen Regen benetzt. Sophie empfand die Landschaft wie ein Abbild ihrer Seele: eine ausgedörrte Ödnis, in der alle Tränen versiegt waren. War ihr Herz darum verhärtet? Wenn sie an die Hinrichtung dachte, sah sie immer nur die graue Katze vor sich, wie sie in weiten Sätzen vor dem Feuer floh. An das Bild ihrer Mutter auf dem Gerüst konnte sie sich nicht mehr erinnern. Es schien für immer aus ihrem Gedächtnis gelöscht.
»Es ist alles meine Schuld«, sagte sie leise. »Der Heiland wollte nicht in meiner Seele wohnen.«
»Nein, Sophie«, erwiderte Abbé Morel streng. »Deine Mutter ist an ihren eigenen Sünden zugrunde gegangen. Sie hat Gott versucht und sich mit den Mächten des Bösen eingelassen. Darum musste sie sterben.«
»Es war doch meine Schuld, dass sie mich zum Altar führte. Sie selber wollte ja gar nicht.«
»Du darfst so nicht sprechen! Oder glaubst du, Gott habe sich geirrt?«
»Nein, Abbé Morel«, sagte sie leise. »Aber was hat meine Mutter denn Schlimmes getan?«
»Deine Mutter hat in Sünde gelebt, Jahr um Jahr. Weil sie die Fleischesliebe der Gottesliebe vorzog und sich in Künsten versuchte, die einem Weib nach dem Willen des Himmels verwehrt sind. Nur darum ist alles so gekommen, und keine Macht auf Erden konnte etwas daran ändern.«
Sophie verstummte. Obwohl sich alles in ihr gegen die Worte des Pfarrers sträubte, wusste sie nicht, was sie erwidern sollte. Sie versuchte, an ihre Mutter zu denken, an das bunte Tuch, das sie nur zu besonderen Festtagen um ihren Hals trug und das immer so fröhlich im Wind wehte. Doch wieder sah sie nur die Katze vor sich. Die Leute auf dem Schloss hatten gesagt, die Katze sei ein Zeichen gewesen, ein Zeichen, dass ihre Mutter mit dem Bösen im Bund stand. Sollten sie wirklich Recht haben?
»Der Baron«, sagte sie schließlich, »hätte nur ein paar Stunden früher zurück sein müssen, und meine Mutter würde noch leben.«
»Eben das ist der Beweis, Sophie. Hätte die Vorsehung ein anderes Urteil gewollt als das Gericht, wäre der Baron früher zurückgekehrt. Nein, Gottes Wille ist stärker als jede irdische Macht.« Abbé Morel ließ ihre Hand los und sah sie an. »Darum hüte dich, in die Fußstapfen deiner Mutter zu treten! Halte dich von allem fern, was sie dich lehrte! – Aber schau nur, gleich sind wir da!«
Sie hatten die Anhöhe erreicht, und in der Ferne waren die dicken Mauern des Klosters zu sehen.
»Bitte, lassen Sie mich nicht allein!«, sagte Sophie und griff nach der Hand des Pfarrers.
»Hab keine Angst, im Kloster wirst du es gut haben. Die Nonnen werden alles tun, damit ein gottgefälliges Weib aus dir wird.« Er nahm ihre Hand und drückte sie. »Ich schließe dich in meine Gebete ein. Dann bin ich bei dir, auch wenn du mich nicht siehst.«
Sophie schluckte. »Versprechen Sie mir das?«
»Natürlich.« Der Pfarrer tätschelte mit seiner schweren Hand ihre Wange. »Aber nur, wenn du mir auch etwas versprichst.«
»Was, Monsieur l’Abbé?«
»Dass du nicht so wirst wie deine Mutter, weder in deinen Worten noch in deinen Werken. Bist du dazu bereit?«
Abbé Morel hob ihr Kinn und schaute sie so ernst und streng an, als würde der liebe Gott selbst sie durch die grauen Augen des Pfarrers anschauen. In diesem Augenblick begriff sie, dass die Liebe Gottes ein Geschenk war, das man sich stets aufs Neue verdienen musste. Und plötzlich war ihr so kalt, dass sie im hellen Sonnenschein fror, als wäre tiefer Winter.
»Ja«, flüsterte sie, und während sie dieses eine Wort sagte, mit dem sie ihr Versprechen besiegelte, wusste sie, dass es ihr Leben für immer verändern würde.
ERSTES BUCHDER STACHEL IM FLEISCHE1747
1
Wer Paris vom Glockenturm der Hauptkirche Notre-Dame aus erblickte, dem mochte die Stadt wie eine wohlgeformte Gipslandschaft erscheinen, ein ruhiges, graues Häusermeer, aus dem sich die Kirchen und Staatsgebäude wie majestätische Mahnmale erhoben, unverrückbare Felsen in der Brandung der Zeit.
Doch dieser Schein trog. Denn in Wahrheit war Paris ein riesiger Krake, der sich mit seinen Armen über das ganze französische Königreich ausbreitete. Tag für Tag wuchs dieser Krake an, wuchernd und wabernd, als gebe es keine Grenzen. Gierig verschlang er, was im Umkreis Hunderter Meilen geerntet und gekeltert wurde, zehrte Dörfer und Städte aus, verleibte seinem unersättlichen Organismus alle Gaben und Güter, allen Reichtum und Überfluss des Landes ein, um die unermessliche Anzahl von Menschen zu ernähren, die im Gedärm der Pariser Straßen und Gassen geboren wurden, sich vermehrten und starben im ewigen Kreislauf des Lebens: ein Schlund, in dem ganz Frankreich verschmolz, ein ruhelos zuckendes Labyrinth der Leidenschaften und Begierden.
Schon um ein Uhr in der Frühe erwachte die Stadt. Übernächtigten Heerscharen gleich kamen die Bauern auf ihren Karren aus den Vororten gezogen, um mit Unmengen von Fleisch, Gemüse und Obst, Eiern, Butter und Käse den Bauch des gefräßigen Kraken zu stopfen. Doch erst wenn im Morgengrauen die Bäcker ihre Geschäfte öffneten, füllten sich allmählich die Straßen. Handwerker und Arbeiter, Hausfrauen und Dienstmädchen, Büroschreiber und Handelsgehilfen bahnten sich, einer eiliger als der andere, ihren Weg durch den immer dichteren Verkehr der in alle Himmelsrichtungen rollenden Fuhrwerke und Droschken. Wenn sich nach der Frühmesse dann die Kirchen leerten, begegneten die Pfarrer und Betschwestern schon den Professoren und Studenten der Sorbonne, die mit wehenden Talaren und Büchern unter dem Arm zur Vorlesung hasteten, während die Kellner der Limonadenbuden auf ihren Tabletts heiße und kalte Getränke durch das Gewühl balancierten. Brachen gegen neun Uhr die Barbiere und Perückenmacher, gepudert vom Scheitel bis zur Sohle, die Kräuselschere in den Händen, zu ihren Hausbesuchen auf, quollen die Gassen und Plätze bereits von den Massen über, und die Stadt drohte an ihrer eigenen Geschäftigkeit zu ersticken, wenn eine Stunde später die Staatsdiener, Richter und Notare in schwarzen Schwärmen zum Châtelet und Justizpalast eilten, bevor schließlich die Bankiers, Makler und Spekulanten zur Börse strömten und die Müßiggänger zum Palais Royal.
Stand dann die Sonne im Zenit, schwebte über der ganzen Stadt zusammen mit dem ewigen Rauch, der in gelblichen Wolken aus den Schornsteinen quoll, um die Spitzen der Kirchtürme den Blicken zu entziehen, ein gewaltiges babylonisches Stimmengewirr, eine gleichförmige Kakophonie aus Worten und Widerworten, Flüchen und Schreien, Rufen und Lachen, mit denen sich die sechs mal hunderttausend Menschen ihren Platz in der Metropole erstritten oder einfach nur ihrer Seele Luft verschafften. Sie alle wollten leben, lieben und glücklich sein! Erst wenn sie am Abend die Arbeit niederlegten, senkte sich mit der Dämmerung das Geschrei und Gesumm wieder auf die Häuser herab und verlagerte sich von den Straßen und Plätzen in die Kneipen, Cabarets und Restaurants, vor allem aber in die Kaffeehäuser. In diesen Lokalen, die es erst seit wenigen Jahrzehnten in der Stadt gab, die jedoch immer mehr in Mode kamen, wurden Nachrichten und Meinungen gehandelt wie Waren und Wertpapiere an der Börse.
Das erste Pariser Etablissement dieser Art, wo weder Bier noch Wein oder andere benebelnde Getränke ausgeschenkt wurden, sondern ausschließlich solche, welche die Sinne schärften und die Gedanken stimulierten, befand sich in der Rue des Fossés Saint-Germain Numero 13, direkt gegenüber der alten Komödie. Ein Italiener aus Palermo, Francesco Procopio, hatte es 1686 eröffnet, nachdem er mit dem Straßenverkauf von Kaffee gescheitert war. Schwere Stühle mit rotem Lederbezug und dicke Balken über niedrigen, pastellgelben Wänden prägten das Bild des Lokals, in dem an wuchtigen Eichentischen die Gäste Zeitung lasen, Schach spielten oder sich die Köpfe heiß redeten. Hier hatte jeder Zutritt, der seine Zeche bezahlen konnte. Niemand galt mehr als der andere, keiner musste sich vor einem Höherstehenden erheben, vielmehr nahm jeder neue Gast den nächstbesten Platz ein, warf sich, den Dreispitz auf dem Kopf und die Pfeife im Mund, auf einen Stuhl, streckte die Beine aus und griff nach einem Journal oder mischte sich in das Gespräch seiner Tischnachbarn ein. Und während draußen in den Gassen die Laternen angezündet wurden – Hoheitszeichen des Königs, in dessen Glanz die Stadt auch bei Nacht erstrahlen sollte, und zugleich Wahrzeichen einer aufgeklärten Vernunft, die in derselben Stadt ihr Wesen trieb, um die Autorität der Herrschaft bohrend in Frage zu stellen –, destillierten all die Stimmungen und Launen, die bei Tage diffus in der Luft gelegen hatten, hier drinnen zu klaren Gedanken, wurden widerstreitende Hoffnungen, schwelende Ängste und aufkeimende Ansprüche auf den Begriff gebracht und gelangten zur Sprache.
In diesem Lokal, dem Café »Procope«, das bei der Polizei von Paris als Treffpunkt gefährlicher Freidenker und Aufrührer galt, hatte Sophie Volland, inzwischen achtzehn Jahre alt, eine Anstellung als Serviererin gefunden.
2
»Wie immer eine Tasse Schokolade, Monsieur Diderot?«
»Ja, mit viel Vanille und Zimt.«
»Ist das alles, oder haben Sie noch einen Wunsch?«
»Wenn du mich so freundlich fragst – ja, Mirzoza.«
»Monsieur Diderot, ich habe Ihnen schon ein Dutzend Mal gesagt, ich heiße Sophie!«
»Mag sein, Mirzoza. Aber ich weiß es besser. Du bist doch eine Märchenprinzessin!«
»Und warum arbeite ich dann hier?«
»Weil man dich auf einen falschen Namen getauft hat, Mirzoza.«
Sophie wusste nicht, ob sie lachen oder sich ärgern sollte. Dieser Diderot, ein Mann Anfang dreißig, der fast täglich ins »Procope« kam, gehörte zu den so genannten Philosophen, den Stammgästen des Lokals, die hier ihr zweites Zuhause hatten und den lieben langen Tag so heftig diskutierten, als müssten sie ganz Frankreich regieren. Als einfache Kellnerin hatte sie keine Ahnung, was die Philosophen für Männer waren oder was sie taten – einen richtigen Beruf schienen sie nicht zu haben –, doch immer, wenn sie an ihren Tischen bediente, fühlte sie sich noch jünger, als sie ohnehin war, und in ihrem Nacken kribbelte es wie ein ganzer Schwarm Mücken. Geradeso wie jetzt, als Diderot sie mit seinen unglaublich hellen blauen Augen anschaute, ein freches Grinsen auf den Lippen, und sein kleiner Kopf mit dem blonden Schopf auf den breiten Lastenträgerschultern ruckte wie ein Wetterhahn auf einem Kirchturm.
»Sie sagten, Sie hätten noch einen Wunsch?«, fragte sie, so streng sie konnte.
»Richtig!«, rief er, und sein Grinsen wurde noch eine Spur unverschämter. »Hast du heute Abend etwas vor?«
Ohne eine Antwort zu geben, kehrte Sophie ihm den Rücken zu und ging zum Büfett.
Was war nur mit den Männern? Schon in der Tabakschenke, in der sie früher gearbeitet hatte, einer verräucherten Höhle im Faubourg Saint-Marceau, hatten sie ihr nachgestellt, aber das waren nach Branntwein stinkende Kutscher, Soldaten oder Kloakenreiniger gewesen, und Sophie wusste, wie man mit ihnen umgehen musste. Doch hier? Wenn die gelehrten Herren im »Procope« solche Reden führten, dann lag es wahrscheinlich an den hitzigen Getränken, die sie in ungeheuren Mengen tranken – vor allem am Kaffee, der solches Herzrasen machte. Ihr Aussehen, dachte Sophie, könne der Grund jedenfalls nicht sein. Sie fand sich mit ihren struppigen roten Haaren, den tausend Sommersprossen und den grünen Augen alles andere als hübsch.
Am Büfett stellte sie das Geschirr bereit, um die Bestellungen auszuführen. Von hier konnte sie das ganze Lokal übersehen, während sie aus großen offenen Kannen der Reihe nach Tee, Kaffee und Schokolade in die Tassen füllte. Die Abendvorstellung im Theater gegenüber hatte gerade erst begonnen, sodass die Tische nur zur Hälfte besetzt waren, und doch herrschte in dem Saal ein Geschnatter wie auf dem Wochenmarkt. Zwei Jahre war Sophie inzwischen in Paris, doch sie staunte immer noch, wie schnell die Leute hier sprachen, doppelt so schnell wie in ihrer Heimat, und alle redeten auf einmal, als hätten sie Angst, ihre Sätze nicht zu Ende zu bringen, bevor die anderen ihnen ins Wort fielen. Ob sie hier wohl jemals das Glück fand, von dem sie träumte? Einen einfachen rechtschaffenen Mann, der sie ein bisschen lieb hatte und sie in den Hafen der Ehe führte?
Sophie stellte die Kanne mit der heißen Schokolade ab und brachte ihr Tablett an den Tisch.
»Bitte sehr, Monsieur Diderot. Mit viel Vanille und Zimt.«
»Danke, Mirzoza.« Er nahm die dampfende Tasse und führte sie an die Lippen. »Hast du inzwischen nachgedacht, wo wir zwei uns amüsieren? Im Ambigu-Comique geben sie Tartuffe. Oder magst du lieber tanzen?«
Während er mit einer Inbrunst seine Schokolade trank, als schlürfe er Nektar, blickte er sie über den Rand der Tasse an. Sophie spürte plötzlich wieder den Mückenschwarm in ihrem Nacken, und für eine Sekunde durchströmten ihren jungen Leib jene seltsamen Gefühle, die ihr manchmal im Kloster die Sinne verwirrt hatten, in langen Nächten sehnsuchtsvoller Einsamkeit.
»Nun?« Diderot stellte die Tasse ab, seine Oberlippe zierte jetzt ein feiner Schnurrbart. »Wann soll ich dich abholen?«
Sophie nahm das Ende ihrer Schürze und wischte ihm die Spuren der Schokolade aus dem Gesicht.