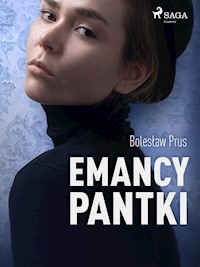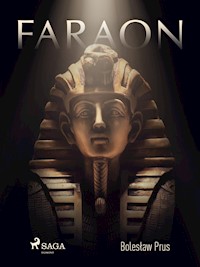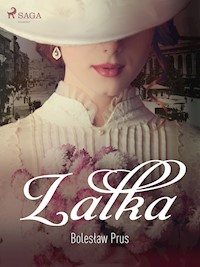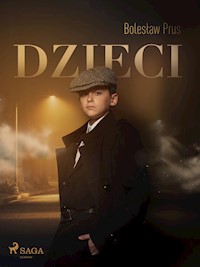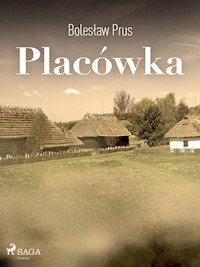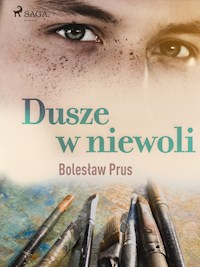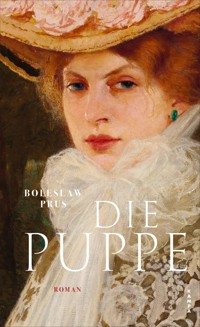
37,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stanislaw Wokulski hat es geschafft. Vermeintlich. Der aus einer verarmten Adelsfamilie stammende Kaufmann ist während des Russisch-Osmanischen Kriegs 1877/78 zu einem der wohlhabendsten Männer Warschaus aufgestiegen. Sein Vermögen soll einem höheren Zweck dienen: Wokulski ist unsterblich in Izabela Lecka verliebt, mit seinem Reichtum hofft er, den Standesunterschied zwischen sich und der kapriziösen Aristokratentochter wettzumachen. Doch die Angebetete hält ihn hin. Erst als der Parvenü immer einflussreicher wird, stimmt sie der Heirat zu. Als Wokulski merkt, dass sich Izabela trotzdem weiterhin Flirts hingibt, wirft er sich vor den Zug. Sein Selbstmordversuch misslingt, doch kurz darauf verlässt er Warschau … Mit »Die Puppe« hat Boleslaw Prus ein Meisterwerk geschaffen, zu nennen in einem Atemzug mit Tolstois »Anna Karenina« und Flauberts »Madame Bovary«. Dank seiner Beobachtungsgabe und der intimen Kenntnis verschiedenster Milieus gelang es ihm, ein ebenso facettenreiches wie widersprüchliches Panorama von Warschau im ausgehenden 19. Jahrhundert zu zeichnen. Prus erzählt von den Ambivalenzen des gesellschaftlichen Umbruchs - parabelhaft und voller psychologischem Feingefühl. Im deutschsprachigen Raum noch immer nahezu unbekannt, erscheint »Die Puppe« hier in einer Neuübersetzung von Lisa Palmes und Lothar Quinkenstein. Olga Tokarczuks viel beachteter Essay »Die Puppe und die Perle« ergänzt den Roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1618
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bolesław Prus
Die Puppe
Roman
Aus dem Polnischen von Lisa Palmes und Lothar QuinkensteinMit einem Essay von Olga Tokarczuk
Kampa
Band I
1Wie die Firma J. Mincel & S. Wokulski durch Flaschenglas aussieht
Zu Beginn des Jahres 1878, als die politische Welt mit dem Frieden von San Stefano befasst war, mit der Wahl des neuen Papstes und der Möglichkeit eines europäischen Krieges, interessierten sich einige Warschauer Kaufleute wie auch gebildete Bürger aus der Gegend um die Straße Krakowskie Przedmieście nicht weniger brennend für die Zukunft des Galanteriewarengeschäftes der Firma J. Mincel & S. Wokulski.
In einem renommierten Speiselokal, in dem zum abendlichen Imbiss die Inhaber von Weißwaren- und Weinhandlungen zusammenkamen, die Fabrikanten von Wagen und Hüten, seriöse Familienväter, die ihr ausreichendes Einkommen hatten, sowie Hausbesitzer, die keiner Beschäftigung nachgingen, wurde ebenso eifrig von Englands Bestrebungen aufzurüsten wie von der Firma J. Mincel & S. Wokulski gesprochen. Versunken in Schwaden von Zigarrenrauch und über Flaschen aus dunklem Glas gebeugt, ergingen sich die Bürger des Viertels hier über Sieg oder Niederlage Englands, dort über den Bankrott Wokulskis, und die einen nannten Bismarck ein Genie, die anderen Wokulski einen Wagehals; die einen gingen mit dem Präsidenten MacMahon ins Gericht, die anderen erklärten Wokulski für wahnsinnig, wenn nicht gar Schlimmeres.
Herr Deklewski, Wagenfabrikant, der Stand und Vermögen der beharrlichen Arbeit in ein und demselben Metier verdankte, und der Rat Węgrowicz, der seit zwanzig Jahren betreuendes Mitglied in ein und demselben Wohltätigkeitsverein war – sie kannten S. Wokulski am längsten, und sie waren es auch, die am lautesten seinen Ruin voraussagten. »Denn mit Ruin und Insolvenz muss es enden«, so Deklewski, »wenn ein Mensch es nicht versteht, bei einem Fach zu bleiben, und die günstigen Gaben des Schicksals nicht zu schätzen weiß.« Und nach jeder weiteren, nicht minder tiefschürfenden Sentenz seines Freundes fügte der Rat Węgrowicz hinzu: »Ein Wahnsinniger! Ein Wahnsinniger! Ein Wagehals! … Józio, bring noch ein Bier. Die wievielte Flasche ist das?«
»Die sechste, Herr Rat!«, erwiderte Józio. »Bin wie der Blitz zu Diensten! …«
»Die sechste schon? … Wie die Zeit vergeht! … Ein Wahnsinniger! Ein Wahnsinniger!«, brummelte der Rat Węgrowicz.
Die Gründe für die Schicksalsschläge, die S. Wokulski und sein Galanteriewarengeschäft zwangsläufig treffen mussten, standen den Menschen, die in dasselbe Lokal einkehrten wie der Rat Węgrowicz, sowie dem Besitzer des Lokals, den Gehilfen und den Burschen so klar vor Augen wie die Gasflämmchen, die den Laden erhellten. Sie lagen in seinem unsteten Charakter, seinem Hang zu Abenteuern, und nicht zuletzt in der jüngsten Kapriole dieses Menschen, der – mit dem sicheren Broterwerb in der Hand und der Möglichkeit, ebendieses Lokal zu besuchen – genau darauf verzichtet hatte, um sein Geschäft der göttlichen Vorsehung zu überlassen und mit der gesamten, von seiner Ehegattin ererbten Barschaft in den türkischen Krieg zu fahren, auf dass er es zu einem Vermögen brächte.
»Und vielleicht bringt er es wirklich zu etwas. Lieferungen für die Armee sind ein einträgliches Geschäft«, mischte Szprot sich ein, seines Zeichens Handelsagent, ein seltener Gast an diesem Ort.
»Zu nichts wird er es bringen«, erwiderte Deklewski, »und sein anständiges Geschäft geht zum Teufel dabei. An den Lieferungen für die Armee bereichern sich die Juden und die Deutschen; unsereiner hat kein Händchen dafür.«
»Wokulski vielleicht schon?«
»Ein Wahnsinniger! Ein Wahnsinniger«, brummelte der Rat. »Józio, bring noch ein Bier. Das wievielte? …«
»Die siebte Flasche, Herr Rat. Bin wie der Blitz zu Diensten!«
»Die siebte schon? … Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht.«
Der Handelsagent, der von Berufs wegen umfangreiche Kenntnis über die Kaufleute benötigte, brachte seine Flasche und sein Glas an den Tisch, an dem der Rat saß, und während er seinen Blick in dessen tränende Augen versenkte, fragte er mit gedämpfter Stimme:
»Verzeihen Sie, aber … warum nennen Sie Herrn Wokulski einen Wahnsinnigen? Wenn ich eine Zigarre anbieten darf? Ich kenne ihn ein wenig, und ich habe ihn immer für einen stolzen und zurückhaltenden Menschen angesehen. Zurückhaltung ist ein großer Vorzug bei einem Kaufmann, Stolz hingegen schadet nur. Aber dass Wokulski Anlass gäbe, an Wahnsinn zu denken, das habe ich nicht bemerkt.«
Ohne ein besonderes Zeichen der Dankbarkeit nahm der Rat die Zigarre entgegen. Sein gerötetes Gesicht, von grauen Haarbüscheln umrahmt, auf der Stirn, am Kinn, an den Wangen, ließ an einen in Silber gefassten Blutstein denken.
»Ich nenne ihn einen Wahnsinnigen«, entgegnete er, während er langsam die Zigarrenspitze abbiss und das Rauchwerk entzündete, »weil ich ihn seit Jahren kenne … Warten Sie … fünfzehn … siebzehn … achtzehn … 1860 ist es gewesen … Damals haben wir bei Hopfer gegessen. Sie kannten Hopfer?«
»Phh …«
»Und Wokulski war damals Ladengehilfe bei Hopfer, in seinen Zwanzigern.«
»Im Wein- und Delikatessenhandel?«
»Ja, und so wie Józio heute hat er mir damals das Bier serviert und Rindersteak à la Nelson.«
»Und aus dieser Branche ist er dann zu den Galanteriewaren gewechselt«, warf der Handelsagent ein.
»Warten Sie«, unterbrach ihn der Rat. »Gewechselt ja, aber nicht zu den Galanteriewaren, sondern auf die Präparandenanstalt, danach auf die Hochschule, verstehen Sie? … Ein Gelehrter wollte er sein.«
Der Agent wiegte den Kopf, um seinem Erstaunen Ausdruck zu verleihen.
»Donnerlüttchen«, sagte er. »Und wie kam er darauf?«
»Na, wie schon. Ganz einfach – Beziehungen zur Medizinischen Akademie, zur Schule der Schönen Künste … Alle hatten damals Flausen im Kopf, da wollte er nicht zurückstehen. Tagsüber hat er die Gäste am Buffet bedient und die Rechnungen geführt, abends hat er gelernt …«
»Da wird er miserabel genug bedient haben …«
»Wie andere auch«, sagte der Rat mit einer unwilligen Handbewegung. »Nur dass er dabei auch noch unfreundlich war, der Bengel, beim unschuldigsten Wort hat er gleich die Stirn gerunzelt wie ein Strauchdieb. Nur zu verständlich, dass wir ihn aufgezogen haben, wo es nur ging, und am meisten geärgert hat es ihn immer, wenn jemand ihn ›Herr Medicus‹ nannte. Einmal hat er einen Gast derart beschimpft, dass die beiden sich beinahe an die Gurgel gegangen wären.«
»Was dem Geschäft natürlich geschadet hat.«
»Ganz und gar nicht. Denn als in Warschau bekannt wurde, dass Hopfers Ladengehilfe die Präparandenanstalt besucht, drängten sich bei ihm die Scharen zum Frühstück. Es wimmelte nur so von Studenten.«
»Und ist er dann in die Präparandenanstalt gegangen?«
»Ja, ist er. Und die Prüfung für die Hochschule hat er auch bestanden. Aber was ich Ihnen sage wollte«, fuhr der Rat Węgrowicz fort und patschte dem Agenten aufs Knie, »anstatt ordentlich weiterzulernen, hat er die Schule nach nicht ganz einem Jahr an den Nagel gehängt …«
»Und was hat er dann gemacht?«
»Ja, da hat er … zusammen mit ein paar anderen hat er uns allen die Suppe eingebrockt, die wir bis heute auslöffeln. Und ihn selbst hat es mit einigen weiteren Hitzköpfen fast bis Irkutsk verschlagen.«
»Donnerlüttchen«, seufzte der Handelsagent.
»Und nicht genug damit … 1870 kehrte er mit einem bescheidenen Sümmchen nach Warschau zurück. Ein halbes Jahr lang suchte er Beschäftigung, wobei er einen großen Bogen um den Gewürzhandel machte, der ihm bis heute zuwider ist. Bis er schließlich dank der Protektion seines heutigen Stellvertreters Rzecki Zugang fand zum Geschäft der Minclowa, die damals eben Witwe geworden war … ein Jahr später heiratete er das Weib, das ein gutes Stück älter war als er.«
»Gar nicht so dumm«, warf der Handelsagent ein.
»Gewiss. Auf einen Sitz hatte er sich eine Existenz und die Werkstatt verschafft, in der er für den Rest seines Lebens würde arbeiten können. Aber er hatte auch sein Kreuz mit dem Frauenzimmer.«
»Die Weiber verstehen sich darauf …«
»Und wie!«, bemerkte der Rat. »Aber schauen Sie nur, was für eine glückliche Fügung: Vor eineinhalb Jahren hat das Weibsbild etwas Falsches gegessen und ist gestorben. Nach vierjährigen Qualen war Wokulski wieder frei wie ein Vogel und hatte obendrein ein einträgliches Geschäft und 30000 Rubel Vermögen, für das sich zwei Generationen der Mincels krummgelegt hatten.«
»Ein Glückspilz.«
»Nicht ganz«, verbesserte der Rat, »er wusste sein Glück nicht zu schätzen. Ein anderer hätte an seiner Stelle ein anständiges Fräulein geheiratet und ein Leben im Wohlstand geführt, ein Geschäft mit einem guten Ruf an einer perfekten Adresse – Ihnen muss ich das ja nicht erklären. Dieser Wahnsinnige aber wirft alles hin und fährt drauflos, um Kriegsgeschäfte zu machen. Millionen will er scheffeln, auf Teufel komm raus.«
»Vielleicht gelingt es ihm«, bemerkte der Agent.
»Ach«, schnaubte der Rat. »Józio, bring noch ein Bier. Glauben Sie, er findet in der Türkei eine, die noch reicher ist als die selige Minclowa? … Józio! …«
»Bin wie der Blitz zu Diensten … Die achte kommt …«
»Die achte?«, wiederholte der Rat. »Das kann nicht sein. Augenblick … Eben die sechste, dann die siebte …«, brummelte er, bedeckte das Gesicht mit der Hand. »Vielleicht doch die achte. Wie die Zeit vergeht! …«
Trotz aller düsteren Prophezeiungen der Menschen, die die Dinge mit nüchternem Blick betrachteten, erlebte das Galanteriewarengeschäft J. Mincel & S. Wokulski keinen Niedergang, vielmehr florierte es. Angelockt vom Gemunkel über den angeblich bevorstehenden Bankrott, stellte sich zahlreich die Kundschaft ein, und von dem Zeitpunkt an, da Wokulski Warschau verlassen hatte, äußerten russische Kaufleute Interesse an der Ware. Mehr und mehr Bestellungen gingen ein, im Ausland wurde ein Kredit gewährt, regelmäßig wurden die Schuldscheine beglichen, und so gut war das Geschäft besucht, dass die drei Gehilfen kaum hinterherkamen. Der eine war ein schwächlicher Blonder, der aussah, als sollte er in der nächsten Stunde an der Schwindsucht sterben; der zweite hatte hellbraunes Haar, ein Philosophenbärtchen und die Bewegungen eines Fürsten; der dritte wiederum, ein feiner Herr mit einem Schnurrbart, der das schöne Geschlecht um den Verstand brachte, duftete wie ein ganzes Chemielabor.
Doch weder die Neugier der Leute noch die physischen oder geistigen Vorzüge der Gehilfen noch die fraglose Reputation des Geschäftes hätten selbiges vor dem Niedergang bewahrt, wäre nicht ein vierzigjähriger Mitarbeiter gewesen, der auf alles ein sorgendes Auge hatte, der Freund und Vertreter Wokulskis, Herr Ignacy Rzecki.
2Das Regime des alten Gehilfen
Seit fünfundzwanzig Jahren wohnte Ignacy Rzecki in der Kammer neben dem Geschäft. Während dieser Zeit hatte der Laden Inhaber und Bodenbelag, Schränke und Fensterscheiben, Branche und Gehilfen gewechselt – Rzeckis Kammer aber war unverändert geblieben. Sie hatte dasselbe traurige Fenster, das, abgeschirmt durch dasselbe Gitter, auf denselben Hinterhof hinausging und zwischen dessen Stäben sich – möglich war es – seit einem Vierteljahrhundert dasselbe Spinnennetz spannte. Die Gardine jedenfalls – das war gewiss – zählte ein Vierteljahrhundert, einst war sie grün gewesen, inzwischen aber vor Sonnensehnsucht völlig ausgeblichen. Beim Fenster stand derselbe schwarze Tisch, beschlagen mit einem ursprünglich grünen, jetzt nur mehr fleckigen Stoff. Darauf ein wuchtiges schwarzes Tintenfass nebst wuchtiger schwarzer Streusandbüchse, befestigt auf demselben Untersatz, sowie ein Paar Messingleuchter für Talgkerzen, die niemand mehr entzündete, und eine stählerne Zange, mit der niemand mehr Dochte abknipste. Ein eisernes Bettgestell mit sehr dünner Matratze – darüber eine nie benutzte doppelläufige Flinte, darunter ein Gitarrenkasten, der entfernt einem Kindersarg ähnelte –, ein schmales leder-bezogenes Kanapee, zwei ebenfalls lederbezogene Stühle, eine große Blechschüssel und ein kleiner Schrank von dunkler Kirschholzfarbe stellten die ganze Möblierung der Kammer dar, die ihrer Länge und des düsteren Dämmerlichts wegen eher einem Grab glich denn einer Wohnung.
Ähnlich wie die Kammer waren auch Rzeckis Gewohnheiten seit einem Vierteljahrhundert gleich geblieben. Morgens erwachte er stets um sechs, horchte eine Weile, ob seine Uhr auf dem Stuhl neben dem Bett noch tickte, und betrachtete die beiden Zeiger, die eine gerade Linie bildeten. In aller Gemächlichkeit wollte er aufstehen, ohne Hast und Eile; da aber seine ausgekühlten Füße und kälteklammen Hände ihm noch nicht gehorchen wollten, riss er sich doch mit Gewalt hoch, sprang mit einem Satz in die Mitte der Kammer, warf seine Schlafmütze aufs Bett und lief zu der großen Schüssel beim Ofen, um sich von Kopf bis Fuß darin zu waschen, wiehernd und schnaubend wie ein betagter Vollblüter bei der Erinnerung an vergangene Pferderennen.
Während er sich wie jeden Tag mit rauen Handtüchern trocken rubbelte, schaute er wohlgefällig auf seine mageren Schenkel und die dicht behaarte Brust hinab und brummte: »Nun denn, es wird, es wird.« Im selben Moment sprang sein alter einäugiger Pudel Ir vom Kanapee, schüttelte sich kräftig, wohl um die Reste von Schlaf abzustreifen, und begann dann, an der Tür zu kratzen, hinter der jemand bereits emsig in den Samowar blies.
Rzecki ließ den Hund hinaus, während er sich weiterhin eilig ankleidete, sagte dem Diener Guten Tag, holte die Teekanne aus dem Schrank, knöpfte seine Manschetten falsch, lief in den Hof, um nach dem Wetter zu sehen, verbrannte sich am heißen Tee, kämmte sein Haar, ohne in den Spiegel zu schauen, und war um halb sieben ausgehfertig.
Nach einem prüfenden Griff, ob die Krawatte am Hals saß, Uhr und Portemonnaie sich in seinen Taschen befanden, nahm er einen großen Schlüssel aus dem Nachtschränkchen und schloss, leicht gebeugt, feierlich die mit Eisenblech beschlagene Hintertür des Geschäfts auf. Gemeinsam mit dem Diener betrat er die Ladenräume, entzündete einige Gasleuchten und las, während der Diener den Boden fegte, durch seinen Zwicker die Aufgaben für den heutigen Tag aus seinem Notizbuch ab. »Achthundert Rubel auf die Bank bringen, aha … Drei Alben, ein Dutzend Portemonnaies nach Lublin übersenden … Richtig! Nach Wien geht eine Anweisung über tausendzweihundert Gulden … Eine Lieferung von der Bahn in Empfang nehmen … Den Riemer ermahnen, die Koffer zurückzusenden … Kinkerlitzchen! … Einen Brief an Stach aufsetzen … Kinkerlitzchen.« Als er geendet hatte, entzündete er einige weitere Leuchten, bei deren Schein er die Waren in Vitrinen und Schränken inspizierte. »Kragenknöpfe, Nadeln, Portemonnaies … gut … Handschuhe, Fächer, Krawatten … jawohl … Stöcke, Schirme, Reisetaschen … Und hier – Alben, Necessaires … Ach, das saphirblaue ist gestern verkauft worden, natürlich! … Leuchter, Tintenfässer, Briefbeschwerer … Das Porzellan … Warum ist diese Vase umgedreht? … Gewiss ist sie … Nein – unbeschädigt … Echthaarpuppen, Kasperletheater, Karussell … Für morgen muss das Karussell in die Auslage kommen, den Springbrunnen mag schon niemand mehr sehen. Kinkerlitzchen! … Jetzt haben wir bald acht. Ich möchte wetten, Klejn kommt als Erster und Mraczewski als Letzter. Natürlich … Hat sich irgendeine Gouvernante angelacht, und schon kauft er ihr ein Necessaire auf Rechnung mit Rabatt … Versteht sich, versteht sich … Na, solange er nichts ohne Rabatt und ohne Rechnung kauft …« So vor sich hin murmelnd, ging Rzecki gebeugt im Laden auf und ab, die Hände in den Taschen, hinter ihm sein Pudel. Von Zeit zu Zeit blieb das Herrchen stehen und besah sich einen Gegenstand, dann ließ sich der Hund auf dem Boden nieder, kratzte sich mit der Hinterpfote die dichten Löckchen, und die im Regal aufgereihten Puppen – kleine, mittlere und große, blonde und braunhaarige – starrten sie mit leblosen Augen an.
Da knarrte die Tür, die vom Hausflur hereinführte, und auf der Schwelle erschien der Gehilfe Klejn, ein verhärmter junger Mann mit einem trüben Lächeln um die bläulichen Lippen.
»Ach, ich war mir doch sicher, dass Sie der Erste sein würden. Guten Tag«, sagte Rzecki. »Paweł! Lösch das Licht und sperr das Geschäft auf.«
Der Diener trabte gemächlich herbei und drehte das Gas ab. Kurz darauf knirschten die Riegel, klapperten die Stäbe, und der Tag trat in den Laden, der einzige Kunde, der den Kaufmann nie vergeblich warten lässt.
Rzecki setzte sich an den Schreibtisch beim Fenster, Klejn stellte sich auf seinen immer gleichen Platz beim Porzellan.
»Kommt der Chef nicht bald zurück, haben Sie noch keinen Brief erhalten?«, fragte Klejn.
»Ich erwarte ihn Mitte März, spätestens in einem Monat.«
»Wenn kein neuer Krieg ihn aufhält.«
»Stach… Herr Wokulski«, verbesserte sich Rzecki, »schreibt mir, dass es keinen Krieg geben wird.«
»Dennoch fallen die Kurse, und kürzlich habe ich gelesen, dass die englische Flotte die Dardanellen erreicht habe.«
»Das hat nichts zu bedeuten, es gibt keinen Krieg. Und davon abgesehen«, setzte Rzecki seufzend hinzu, »was interessiert uns schon ein Krieg, an dem Bonaparte nicht beteiligt ist.«
»Die Bonapartes haben ihre besten Tage bereits hinter sich.«
»Wahrhaftig?« – Rzecki lächelte ironisch. – »Und zu wessen Nutzen haben MacMahon und Ducrot im Januar einen Staatsstreich geplant? … Glauben Sie mir, Klejn, der Bonapartismus ist mächtig!«
»Es gibt etwas Mächtigeres.«
»Was denn?«, entrüstete sich Rzecki. »Eine Republik vielleicht, mit Gambetta? … Oder Bismarck?«
»Den Sozialismus«, flüsterte der schmächtige Gehilfe und duckte sich hinter das Porzellan.
Rzecki klemmte den Zwicker fester auf die Nase und richtete sich in seinem Sessel auf, bereit, jene neue, seinen Ansichten widersprechende Theorie mit einem Streich hinwegzufegen, doch vereitelte die Ankunft eines weiteren, bärtigen Gehilfen seine Pläne.
»Ja, habe die Ehre, der Herr Lisiecki!«, wandte er sich dem Ankömmling zu. »Ein kalter Tag heute, wie? Welche Uhrzeit haben wir noch gleich in der Stadt, meine Uhr geht wohl vor? Es ist doch nicht etwa schon viertel neun?«
»Das ist doch ein Witz! … Ihre Uhr geht morgens vor und abends nach«, erwiderte Lisiecki spitz und wischte sich den reifbedeckten Schnurrbart.
»Ich möchte wetten, Sie sind gestern beim Préférence-Spiel gewesen.«
»Darauf können Sie auch wetten. Sie glauben doch wohl nicht, mir genügt der Anblick dieser Galanteriewaren hier und Ihres grauen Haarschopfs für den ganzen Tag?«
»Nun, verehrter Herr, ich ziehe es vor, leicht ergraut denn kahl zu sein«, empörte sich Rzecki.
»Noch ein Witz!«, zischte Lisiecki. »Meine Kahlheit, wenn sie denn überhaupt jemand bemerkt, ist trauriges Familienerbe – Ihr graues Haar aber und Ihr mürrischer Charakter sind Früchte des Alters, das ich … wirklich zu gern ehren würde …«
Die erste Kundin betrat den Laden: eine Frau in Umhang und Kopftuch, die nach einem Spucknapf aus Messing verlangte. Rzecki verneigte sich sehr tief vor ihr, bot ihr einen Stuhl an, und Lisiecki verschwand hinter den Schränken, um gleich wieder zurückzukehren und der Kundin mit würdevoller Geste den gewünschten Gegenstand zu überreichen. Anschließend schrieb er den Preis des Spucknapfs auf ein Kärtchen, reichte es Rzecki über die Schulter nach hinten und begab sich mit der Miene eines Bankiers, der eben mehrere Tausend Rubel für einen wohltätigen Zweck gespendet hat, hinter die Vitrine. Der Streit um Grauschopf und Glatze war beigelegt.
Erst gegen neun kam – oder besser: stürzte – Mraczewski in den Laden, ein schöner junger Mann von Mitte zwanzig mit blondem Haar und Augen wie leuchtenden Sternen, korallenroten Lippen, gezwirbelten Schnurrbartspitzen wie vergiftete Stilette. Eine Duftwolke hinter sich herziehend, stürmte er herein und rief: »Mein Ehrenwort, dass es schon halb zehn sein muss! Ein Luftikus bin ich, ein Lump, kurz und gut – nichtswürdig, aber was kann ich dafür, wenn meine Mutter krank ist und ich einen Doktor suchen musste. Bei sechsen bin ich gewesen …«
»Bei denen, an die Sie Necessaires verteilen?«, fragte Lisiecki.
»Necessaires? … Nein. Unser Doktor nähme nicht einmal eine Nadel an. Ein rechtschaffener Mann … Nicht wahr, Herr Rzecki, es ist doch schon halb zehn? Meine Uhr ist stehen geblieben.«
»Es ist gleich neun«, erwiderte Rzecki mit besonderer Betonung.
»Erst neun? … Wer hätte das gedacht! Und dabei hatte ich mir vorgenommen, heute als Erster im Geschäft zu sein, früher noch als Klejn.«
»Um vor acht wieder gehen zu können«, warf Lisiecki ein.
Mraczewski heftete seine blauen Augen auf ihn, und höchste Verwunderung malte sich in seinem Blick. »Woher wissen Sie das?«, fragte er. »Mein Ehrenwort, dieser Mann hat den siebten Sinn! Gerade heute, Ehrenwort, muss ich vor sieben in der Stadt sein, und wenn ich stürbe, und wenn ich … um meine Entlassung bitten müsste …«
»Wenn Sie mir so kommen, Mraczewski«, erregte sich Rzecki, »dann sind Sie schon bis elf wieder frei, oder sogar in diesem Moment. Ein Graf ist an Ihnen verloren gegangen, kein Kaufmann, ich wundere mich, dass Sie nicht gleich in dieses Fach eingestiegen sind, in dem man seine Zeit verplempern kann, wie es einem beliebt, Pan Mraczewski. Also wirklich!«
»Nun, Sie sind doch in seinem Alter sicher auch den Röcken nachgejagt«, meinte Lisiecki beschwichtigend. »Wir wollen hier nicht die Moralapostel spielen.«
»Ich bin nie irgendwelchen Röcken nachgejagt!«, rief Rzecki empört aus und hieb mit der Faust auf den Tisch.
»Na, nun hat er sich einmal verplappert, dass er es sein Leben lang zu nichts gebracht hat«, raunte Lisiecki Klejn zu, der lächelte und zugleich seine Brauen weit hochzog.
Der nächste Kunde betrat den Laden und verlangte nach Überschuhen. Mraczewski ging auf ihn zu.
»Überschuhe wünschen Sie, verehrter Herr? Welche Größe tragen Sie, wenn man fragen darf? Aber das wissen Sie gewiss nicht mehr! Nicht jeder hat die Zeit, an seine Schuhgröße zu denken, das ist unsere Sache. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Überschuhe anpasse, verehrter Herr? … Wenn Sie hier auf dem Schemel Platz nehmen würden? Paweł! Hol ein Tuch, hilf dem Herrn aus seinen Überschuhen und säubere sie.«
Paweł eilte mit einem Tuch herbei, warf sich dem Kunden zu Füßen.
»Aber nicht doch, mein Herr, was tun Sie denn …!«, wehrte dieser verlegen ab.
»Nein, bitte, verehrter Herr«, beeilte Mraczewski sich zu sagen, »das ist unsere Pflicht. Mir scheint, diese hier könnten passen«, fuhr er fort und reichte dem Kunden ein Paar mit einem Faden zusammengebundene Überschuhe.
»Ausgezeichnet, sie stehen Ihnen ganz wunderbar; Sie haben so einen ebenmäßig geformten Fuß, verehrter Herr, dass es kaum möglich ist, sich in der Größe zu irren. Gewiss wünschen Sie auch Buchstaben; welche Buchstaben dürfen es sein?«
»L.P.«, brummte der Gast; er hatte das Gefühl, vom gewandten Wortfluss des zuvorkommenden Gehilfen fortgerissen zu werden.
»Lisiecki, Klejn, bitte seien Sie so gut und prägen Sie die Initialen ein. Möchten Sie Ihre alten Überschuhe einwickeln lassen? Paweł! Wisch die Überschuhe des Herrn noch einmal ab und wickle sie in Seidenpapier. Vielleicht möchten Sie keine überflüssige Last mit sich herumtragen? Paweł, wirf die Überschuhe zum Abfall … Das macht zwei Rubel, fünfzig Kopeken. Diese Überschuhe mit Ihren Initialen wird nun niemand mehr mit den seinen verwechseln, und so etwas ist ja eine unschöne Sache, anstelle des eigenen neuen Schuhwerks ein Paar löchrige Latschen vorzufinden. – Zwei Rubel, fünfzig Kopeken an die Kasse, mit diesem Kärtchen hier. Herr Kassierer, fünfzig Kopeken zurück an den verehrten Herrn.«
Ehe er sich’s versah, hatte man den Kunden in die neuen Überschuhe gesteckt, ihm das Restgeld herausgegeben und ihn unter tiefen Verbeugungen zur Tür geleitet. Draußen stand er noch eine Weile auf der Straße, starrte benommen auf die Schaufensterscheibe, durch die ihn Mraczewski mit einem zuckersüßen Lächeln und feurigen Blicken bedachte. Endlich winkte er ab und ging weiter, vielleicht mit dem Gedanken, dass Überschuhe ohne Initialen ihn in einem anderen Geschäft womöglich nur zehn Złoty gekostet hätten.
Rzecki wandte sich zu Lisiecki um, nickte anerkennend und zufrieden. Mraczewski vernahm die Bewegung aus dem Augenwinkel, er lief zu Lisiecki und sagte halblaut:
»Schauen Sie nur, sieht unser Alter nicht im Profil aus wie Napoleon III.? Die Nase … der Kinnbart … nach spanischer Façon …«
»Ein Napoleon mit Gallensteinen«, erwiderte Lisiecki.
Über diesen Scherz konnte Rzecki nur pikiert das Gesicht verziehen.
Mraczewski durfte dann übrigens am Abend vor sieben gehen und bekam wenige Tage später in Rzeckis privatem Notizbuch den folgenden Eintrag: »War in den Hugenotten, achte Sitzreihe, in Begleitung einer Dame namens Matylda …???«
Zum Trost hätte Mraczewski sich sagen können, dass seine beiden Kollegen ebenfalls Einträge in besagtem Notizbuch besaßen, außerdem der Kassierer, die Boten, ja sogar der Diener Paweł. Woher wusste Rzecki solche Einzelheiten aus dem Leben seiner Mitarbeiter? Dies bleibt ein Geheimnis, das er niemandem verriet.
Gegen ein Uhr mittags, wenn Ignacy Rzecki die Kasse an Lisiecki übergeben hatte, dem er trotz ihrer ständigen Zankereien noch am meisten traute, zog er sich in sein Zimmerchen zurück, um sein Mittagessen zu sich zu nehmen, das er sich aus dem Restaurant holte. Gleichzeitig mit ihm ging Klejn hinaus und kam um zwei ins Geschäft zurück; anschließend blieben er und Rzecki im Geschäft, während Lisiecki und Mraczewski essen gingen. Um drei waren dann alle wieder vor Ort. Um acht Uhr abends schloss das Geschäft; die Gehilfen entfernten sich jeder in seine Richtung, nur Rzecki blieb zurück. Er machte die Tagesabrechnung, überprüfte die Kasse, erstellte den Tätigkeitsplan für morgen und ließ den Tag Revue passieren: War auch alles getan worden, was zu tun gewesen war? Für jede vernachlässigte Angelegenheit büßte er, indem er stundenlang wach lag, heimgesucht von diffusen Albtraumfetzen, in denen ihm der Ruin des Geschäfts und der krachende Untergang der Napoleoniden vor Augen standen, während ihn zugleich die lähmende Gewissheit erfüllte, dass alle Hoffnungen, die er an das Leben hatte und gehabt hatte, nichts als Narreteien waren.
»Nichts wird mehr sein! Wir alle gehen rettungslos unter!«, seufzte er und wälzte sich schlaflos auf seinem harten Lager.
War der Tag gut verlaufen, war Rzecki von Zufriedenheit erfüllt. Dann las er vor dem Schlafen die Geschichte des Konsulats und Kaiserreichs oder Zeitungsausschnitte über den italienischen Krieg von 1859, oder aber, was seltener vorkam, er holte seine Gitarre unter dem Bett hervor und spielte den Rákóczi-Marsch, sang mit halblauter Tenorstimme von zweifelhafter Tonreinheit dazu. Anschließend träumte er von weiten ungarischen Ebenen, von dunkelblauen und weißen, in Wolken aus Pulverdampf gehüllten Frontlinien … Am nächsten Tag war er dann gedrückter Stimmung und klagte über Kopfweh.
Einer der angenehmsten Tage war für ihn der Sonntag; dann entwarf und erstellte er nämlich Pläne für die Schaufensterdekorationen der kommenden Woche. Seiner Auffassung nach sollten die Fenster nicht nur die Geschäftsbestände präsentieren, sondern vor allem auch die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich ziehen – sei es durch modernste Artikel, sei es durch eine hübsche Präsentation, sei es durch besondere Raffinesse. Das rechte Fenster war luxuriösen Galanteriewaren vorbehalten; hier stand meistens eine Bronze, eine Porzellanvase, war eine ganze Szenerie mit einem Frisiertischchen wie aus einem Damenboudoir aufgebaut, um das herum Alben, Kerzenleuchter, Portemonnaies, Fächer sowie Spazierstöcke, Sonnenschirme und unzählige weitere zierliche und elegante Dinge arrangiert waren. Die Mitte des linken Fensters wiederum, das mit Krawatten, Handschuhen, Überschuhen und Duftwässern ausgestattet war, nahm eine Ausstellung wechselnder, meist beweglicher Spielzeuge ein.
Bisweilen erwachte bei dieser einsamen Beschäftigung das Kind in dem alten Ladengehilfen. Dann holte er sämtliches Aufziehspielzeug hervor und baute es auf dem Tisch auf. Da war ein Bär, der eine Säule emporkletterte, ein krähender Hahn, eine rennende Maus, ein Zug, der über Schienen ratterte, zwei Zirkusclowns, die akrobatische Kunststücke auf einem galoppierenden Pferd vollführten, sowie mehrere Paare, die zu leiernder Musik Walzer tanzten. All diese Figuren zog Rzecki auf und setzte sie gleichzeitig in Bewegung. Und wenn dann der Hahn krähte und mit seinen steifen Flügeln schlug, wenn die starren Paare stockend tanzten und immer wieder innehielten, wenn die bleiernen Passagiere in dem Zug, der ohne Ziel seine Runden drehte, ihn verwundert anzusehen begannen – wenn also diese ganze Welt der Puppen im flackernden Gaslicht zu einem phantastischen Leben erwachte, schaute der alte Gehilfe mit aufgestützten Ellbogen zu, kicherte leise in sich hinein und brummte:
»Hihihi … Wohin des Wegs, ihr Reisenden? Warum verrenkst du dir den Hals, Akrobat? Wozu die Umarmungen, ihr Tänzer und Tänzerinnen? Gleich lassen eure Federn nach, und ihr wandert zurück in den Schrank. Dummes Zeug, nichts als dummes Zeug! Das euch, wenn ihr denken könntet, grandios erscheinen würde!«
Nach solchen und ähnlichen Monologen räumte er die Spielsachen eilig zusammen und ging gereizt im leeren Laden auf und ab, hinter ihm, wie stets, sein schmuddeliger Hund.
»Dummes Zeug der Handel … dummes Zeug die Politik … dummes Zeug die Türkeireise … dummes Zeug das ganze Leben, an dessen Anfang wir uns nicht erinnern und dessen Ende wir nicht kennen … Wo liegt die Wahrheit?«
Weil er diese Art Sätze schon einige Male laut und in aller Öffentlichkeit ausgesprochen hatte, hielt man ihn für einen Sonderling, und manch ernsthafte Dame mit Töchtern im heiratsfähigen Alter hatte schon gemahnt:
»Da seht ihr, wohin das Junggesellendasein einen Mann führt!«
Aus dem Haus ging Ignacy Rzecki selten und kurz, und gewöhnlich betrat er nur die Straßen, in denen seine Kollegen oder andere Angestellte des Geschäfts wohnten. Bei diesen Gelegenheiten zog er mit seinem dunkelgrünen pelzgefütterten Mantel oder dem altmodischen tabakbraunen Gehrock, den aschgrauen Hosen mit schwarzen Biesen und dem verschossenen Zylinder, vor allem aber mit seinem scheuen Benehmen alle Aufmerksamkeit auf sich. Das wusste Rzecki und begab sich daher zunehmend ungern auf Spaziergänge. Lieber legte er sich feiertags aufs Bett, schaute Stunde um Stunde durch sein vergittertes Fenster auf die graue Mauer des benachbarten Hauses, deren einzige Zier ein ebenfalls vergittertes Fenster war, in dem manchmal ein Töpfchen Butter stand oder ein Hasenleib hing. Doch je seltener er ausging, desto häufiger träumte er von einer weiten Reise, aufs Land oder ins Ausland gar.
Immer häufiger sah er im Traum grüne Felder und dunkle Wälder, durch die er streifen und in Erinnerungen an seine Jugend schwelgen würde. Allmählich erwachte in ihm eine dumpfe Sehnsucht nach jenen Landschaften, und so beschloss er, gleich nach Wokulskis Rückkehr für den ganzen Sommer zu verreisen.
»Einmal wenigstens, bevor ich sterbe – dann aber gleich für mehrere Monate«, sagte er seinen Kollegen, die seine Pläne aus Gründen, die ihm nicht ersichtlich waren, belächelten.
Freiwillig abgeschnitten von Natur und Menschen, gefangen im raschen, doch engen Strudel der Geschäftsinteressen, verspürte er das immer größere Bedürfnis nach einem Gedankenaustausch. Weil er aber den einen nicht traute, die anderen ihm nicht zuhörten und Wokulski wiederum nicht da war, sprach er mit sich selbst – und führte, unter strenger Geheimhaltung, ein Tagebuch.
3Das Tagebuch des alten Gehilfen
Mit Bedauern stelle ich seit einigen Jahren fest, dass es auf der Welt immer weniger gute Gehilfen und klug agierende Politiker gibt, passen sich doch alle der Mode an. Der einfache Gehilfe kleidet sich vierteljährlich in Hosen neuer Façon, immer ausgefallenere Hüte und Kragen, die jedes Mal anders getragen werden. In ähnlicher Manier wechseln die heutigen Politiker vierteljährlich ihren Glauben: Vorgestern glaubten sie an Bismarck, gestern an Gambetta, und heute an Beaconsfield, der bis vor Kurzem noch ein Itzig war. Offensichtlich ist schon in Vergessenheit geraten, dass man sich im Geschäft nicht mit modischen Kragen schmücken, sondern sie verkaufen soll, andernfalls fehlt es den Kunden an Ware und dem Geschäft an Kunden. Die Politik wiederum sollte sich nicht auf zufällige Glückspilze stützen, sondern auf große Dynastien. Metternich war so berühmt wie Bismarck, und Palmerston berühmter als Beaconsfield – und wer erinnert sich heute noch an sie? Indessen hat das Geschlecht der Bonapartes Europa erst mit Napoleon I., dann mit Napoleon III. erschüttert und nimmt heute – auch wenn mancher es als bankrott bezeichnen will – mithilfe seiner treuen Diener, MacMahon und Ducrot, Einfluss auf Frankreichs Schicksal. Ihr werdet schon sehen, was der kleine Napoleon IV. erst anstellen wird, der im Stillen die Kriegskunst bei den Engländern lernt!
Doch genug davon. In diesem meinem Geschreibsel soll es nicht um die Bonapartes gehen, sondern um mich selbst, damit man erfahre, auf welche Weise gute Gehilfen und, wenn auch nicht gelehrte, so doch vernünftige Politiker einst geformt wurden. Für dieses Geschäft braucht es keine Akademien, sondern ein Vorbild – zu Hause wie im Laden.
Mein Vater war in jungen Jahren Soldat, im Alter dann Bote bei der Kommission für Innere Angelegenheiten. Er hielt sich kerzengerade, hatte nicht allzu üppige Koteletten und einen gezwirbelten Schnurrbart, trug ein schwarzes Halstuch und einen silbernen Ring im Ohr.
Wir wohnten in der Altstadt bei einer Tante, die für Beamte Wäsche wusch und flickte. Im vierten Stock hatten wir zwei kleine Zimmer, in denen wenig Wohlstand, aber viel Fröhlichkeit herrschte, jedenfalls für mich. Das stattlichste Möbel in unserer Kammer war der Tisch, an dem Vater, wenn er aus dem Büro kam, Briefumschläge klebte; bei der Tante nahm ein Waschzuber den prominenten Platz ein. Ich erinnere mich, wie ich an schönen Tagen unten auf der Straße Drachen steigen ließ, bei Regenwetter blies ich in der Kammer Seifenblasen.
An den Wänden hingen bei der Tante ausschließlich Heiligenbilder, doch so zahlreich sie auch waren – sie reichten nicht an die Zahl der Napoleone heran, mit denen Vater sein Zimmer schmückte. Es gab dort einen Napoleon in Ägypten, einen zweiten bei Wagram, einen dritten bei Austerlitz, einen vierten bei Moskau, einen fünften am Krönungstag, einen sechsten in Apotheose. Als nun die Tante ihm, entrüstet über diese Menge an weltlichen Bildern, ein Messingkruzifix an die Wand hängte, kaufte mein Vater – um Napoleon nicht zu kränken, wie er sagte – eine bronzene Büste des Kaisers und brachte diese über seinem Bett an.
»Du wirst es schon sehen, du Ungläubiger«, lamentierte die Tante bisweilen, »dafür wird man dich in der Hölle teeren und federn!«
»Und wenn schon! … Der Kaiser lässt nicht zu, dass mir auch nur ein Haar gekrümmt wird«, entgegnete Vater.
Häufig kamen uns Vaters alte Kollegen besuchen: Herr Domański, ebenfalls Bote, jedoch bei der Finanzkommission, und Herr Raczek, der in der ulica Dunaj einen Gemüsestand betrieb. Einfache Leute waren die beiden – Domański war auch dem Anisschnaps nicht abgeneigt –, jedoch umsichtige Politiker. Alle, die Tante eingeschlossen, beharrten steif und fest darauf, dass dem Geschlecht der Bonapartes noch Großes bevorstehe, wobei es dieser Einschätzung keinen Abbruch tat, dass Napoleon I. in Unfreiheit gestorben war. Nach dem ersten Napoleon würde sich schon noch ein zweiter finden, und sollte es auch mit diesem ein schlimmes Ende nehmen, käme wieder ein nächster, bis sie schließlich einer nach dem anderen die Welt wieder in Ordnung bringen würde.
»Man muss stets bereit sein für den ersten Ruf«, sagte mein Vater.
»Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde«, fügte Domański hinzu.
Und Raczek, die Pfeife im Mund, spuckte zum Zeichen der Zustimmung in Tantes Zimmer kräftig aus.
»Nun spuck er mir noch in die Waschwanne, der Herr, dann werd ich’s ihm zeigen!«, rief die Tante.
»Zeigen können Sie’s mir schon, Gnädigste, aber ob ich hinschau …«, brummte Raczek und spie zum Kamin hin.
»Pfui Teufel … welche Rüpel, diese Grenadiere!«, ereiferte sich die Tante.
»Sie, Gnädigste, mochten ja immer die Ulanen lieber, ich weiß schon, ich weiß …«
Später sollten Raczek und meine Tante noch heiraten.
Auf dass ich bestens vorbereitet wäre, wenn die Stunde der Gerechtigkeit schließlich schlüge, übernahm es mein Vater selbst, mich zu unterrichten. Er brachte mir Lesen und Schreiben bei und wie man Briefumschläge klebt, vor allem aber das Exerzieren. Zum Exerzieren trieb er mich von frühester Kindheit an, als mir noch das Unterhemd hinten aus der Hose hing. Ich erinnere mich gut, wie er mir Kommandos gab: »Halbe Drehung nach rechts!« oder »Linke Schulter nach vorn – marsch!«, und mich dann am Schwanz, der aus meiner Kleidung baumelte, in die entsprechende Richtung zog.
Es war ein ausgesprochen gründlicher Unterricht.
Manchmal weckte Vater mich in der Nacht mit dem Kommandoruf: »An die Waffen!«, dabei gab er nichts auf das Gezeter und die Tränen der Tante und ließ den Satz folgen:
»Ignacy! Sei immer bereit, kleiner Schlingel, denn wir kennen weder den Tag noch die Stunde … Denk dran, die Bonapartes sind von Gott gesandt, um Ordnung auf der Welt zu schaffen; und solange keine Ordnung und keine Gerechtigkeit herrschen, so lange ist das Testament des Kaisers nicht vollstreckt.«
Ich kann nicht sagen, dass Vaters zwei Kollegen seinen unerschütterlichen Glauben an die Bonapartes und an die Gerechtigkeit teilten. Manchmal, wenn seine Schmerzen im Bein ihn plagten, fluchte Raczek ächzend:
»Ech! Weißt du, Alter, nun warten wir aber schon recht lang auf den neuen Napoleon. Ich werde langsam grau und meine Kräfte schwinden, und er ist immer noch nicht hier. Bald sitzen wir als Tattergreise vor der Kirchenpforte, und dann kann Napoleon bloß noch kommen, um mit uns Stundengebete zu singen.«
»Dann sucht er sich jüngere Leute.«
»Was für jüngere Leute! Die besten sind schon vor uns unter die Erde gekommen, und die jüngsten – die taugen alle nichts. Schon in unserem Alter gibt es manche, die haben noch nie was von Napoleon gehört!«
»Mein Junge hat von ihm gehört, und er wird es sich merken«, sagte mein Vater darauf und zwinkerte mir zu.
Domański wirkte noch hoffnungsloser.
»Die Welt wird immer schlechter«, meinte er kopfschüttelnd. »Die Kost wird immer teurer, das Logis frisst das ganze Gehalt, und was den Anisschnaps betrifft … auch damit wird Schindluder getrieben. Früher war man nach einem Gläschen schon lustig, heute ist man nach einem großen Glas noch so nüchtern, als hätte man reines Wasser getrunken. Da wartet selbst Napoleon vergeblich auf Gerechtigkeit!«
Darauf erwiderte mein Vater: »Die Gerechtigkeit wird kommen, zur Not auch ohne Napoleon. Aber es wird sich schon ein Napoleon finden.«
»Glaube ich nicht«, brummte Raczek.
»Und wenn doch, was dann?«, fragte Vater.
»Das erleben wir nicht mehr.«
»Ich erlebe es noch«, entgegnete mein Vater, »und Ignacy erst recht.«
Schon damals gruben sich mir meines Vaters Sätze tief ins Gedächtnis, einen geradezu prophetischen Charakter aber gaben ihnen einige Ereignisse, die erst später folgen sollten.
Etwa um 1840 begann es Vater schlechter zu gehen. Manchmal ging er mehrere Tage nicht ins Büro, schließlich war er ganz bettlägerig. Raczek kam ihn jeden Tag besuchen; einmal flüsterte er beim Anblick von Vaters mageren Händen und welken Wangen:
»He, Alter, mir scheint, wir werden Napoleons Ankunft nicht mehr erleben.«
Worauf Vater ruhig entgegnete:
»Ich sterbe nicht, bevor ich nicht von ihm gehört habe.«
Raczek nickte, und meine Tante wischte sich die Tränen ab, weil sie dachte, Vater phantasiere nur. Was hätte sie auch anderes denken sollen, wo doch der Tod schon an die Tür pochte und Vater noch immer Ausschau nach Napoleon hielt!
Es stand bereits sehr schlecht um ihn, ja er hatte sogar die Letzte Ölung schon empfangen, als wenige Tage später Raczek seltsam erregt zur Tür hereinstürzte, mitten in unserer Kammer stehen blieb und ausrief:
»Weißt du was, Alter – Napoleon ist da!«
»Wo ist er?«, rief die Tante.
»Schon in Frankreich.«
Vater wollte aufspringen, sank aber gleich wieder in die Kissen zurück. Er streckte nur die Hand nach mir aus und flüsterte, während er mich mit einem Blick ansah, den ich nie vergessen werde:
»Denk immer daran! Erinnere dich an alles …«
Und damit starb er.
Im späteren Leben konnte ich mich überzeugen, wie prophetisch die Ansichten meines Vaters gewesen waren. Alle erblickten wir den zweiten napoleonischen Stern, der Italien und Ungarn aufweckte und der, wie ich glaube, nicht endgültig erloschen ist, obwohl er bei Sedan vom Himmel fiel. Was sind dagegen schon Bismarck, Gambetta oder Beaconsfield! So lange wird Ungerechtigkeit die Welt regieren, wie kein neuer Napoleon heranwächst.
Wenige Monate nach Vaters Tod kamen Raczek, Domański und meine Tante Zuzanna zusammen, um zu beraten, was aus mir werden sollte. Domański wollte mich in seinem Büro anstellen und zum Beamten ausbilden, die Tante empfahl das Handwerk, Raczek wiederum die Gärtnerei. Doch wenn man mich fragte, worauf ich Lust hätte, sagte ich immer, ein Geschäft solle es sein.
»Wer weiß, vielleicht ist das wirklich das Beste«, bemerkte Raczek. »Und zu welchem Kaufmann möchtest du?«
»Zu dem in der ulica Podwale, der über der Tür einen Pallasch hat und im Fenster einen Kosaken.«
»Ich weiß, welches Geschäft er meint«, warf die Tante ein. »Zu Mincel will er.«
»Man könnte es versuchen«, meinte Domański. »Den Herrn Mincel kennen wir schließlich alle gut.«
Zum Zeichen seiner Zustimmung spuckte Raczek bis an den Kamin.
»Grundgütiger«, ächzte meine Tante, »bald fängt dieser Rüpel noch an, mich zu bespucken, jetzt, wo mein Bruder nicht mehr ist … Oh, ich armes alleinstehendes Frauenzimmer!«
»Keine große Sache!«, gab Raczek zurück. »Verheiraten Sie sich, Gnädigste, dann sind Sie nicht mehr allein.«
»Und wo finde ich einen Dummen, der mich nimmt?«
»Phh! Ich würde mich ja mit Ihnen vermählen, Gnädigste, denn ich habe niemanden, der mir den Rücken einreibt«, brummte Raczek, wobei er sich schwerfällig bückte, um die Asche aus der Pfeife zu klopfen.
Die Tante begann zu weinen, da ergriff Domański das Wort:
»Wozu hier große Umstände machen. Sie, Gnädigste, haben keinen Beschützer, er hat keine Haushälterin: Heiratet und nehmt Ignacy zu euch, dann habt ihr sogar ein Kind. Ein billiges Kind zudem, denn Mincel gibt ihm Kost und Logis und ihr nur die Kleidung.«
»Hm?«, fragte Raczek und sah meine Tante an.
»Gebt erst einmal den Jungen in die Lehre, und danach … wage ich es vielleicht«, erwiderte die Tante. »Ich hatte immer das Gefühl, dass es ein schlechtes Ende nimmt mit mir …«
»Dann auf zu Mincel!«, sagte Raczek, indem er sich von seinem Hocker erhob. »Dass Sie mich nur nicht enttäuschen, Gnädigste!« Er drohte ihr scherzhaft mit der Faust.
Domański und er gingen hinaus, nach etwa anderthalb Stunden kamen sie zurück, beide mit stark geröteten Gesichtern. Raczek bekam kaum noch Luft, und Domański hielt sich gerade noch auf den Beinen – angeblich, weil unsere Treppe so steil sei.
»Nun …?«, fragte die Tante.
»Den neuen Napoleon haben sie in den Pulverturm gesperrt!«, antwortete Domański.
»Nicht in den Pulverturm – in die Festung A-u… A-u…«, unterbrach ihn Raczek und warf seine Mütze auf den Tisch.
»Und was ist mit dem Jungen?«
»Morgen soll er zu Mincel kommen, mit Kleidung und Wäsche«, antwortete Domański. »Nicht in die Festung A-u…, sondern nach Ham… Ham… oder Cham… ach, was weiß denn ich …«
»Ihr habt wohl den Verstand verloren, ihr Saufnasen!«, rief die Tante wütend und packte Raczek am Arm.
»Nur keine Vertraulichkeiten, bitte!«, entrüstete sich Raczek. »Nach der Hochzeit – meinetwegen, aber jetzt … Also morgen zu Mincel, mit Kleidung und Wäsche … Ach, der unglückliche Napoleon!«
Die Tante schob erst Raczek, dann Domański aus der Tür, warf die Mütze hinterher.
»Macht, dass ihr fortkommt, Trunkenbolde!«
»Vivat Napoleon!«, rief Raczek, und Domański begann zu singen:
»Wanderer, wenn dein Blick auf diese Inschrift fällt,
nimm dir zu Herzen, was sie uns erzählt,
nimm dir zu Herzen, was sie uns erzählt …«
Seine Stimme wurde leiser, dumpfer, als würde sie in einem Brunnen versinken, dann verstummte sie auf der Treppe, drang aber von der Straße wieder zu uns herauf. Nun kam es draußen zu einem Tumult, und als ich aus dem Fenster schaute, sah ich, wie ein Polizist Raczek zum Rathaus führte.
Diese und ähnliche Ereignisse gingen meinem Einstieg in den Kaufmannsberuf voraus.
Mincels Geschäft kannte ich seit Langem; mein Vater und die Tante hatten mich häufig dorthin geschickt, Papier zu holen oder Seife. Jedes Mal lief ich voll freudiger Neugier hin, um die Spielzeuge in den Schaufenstern zu betrachten. Soweit ich mich erinnere, war da ein großer Kosak, der von allein Purzelbäume schlug und mit den Armen schlenkerte, und über der Tür hingen eine Trommel, ein Pallasch und ein ledernes Pferd mit echtem Schweif.
Drinnen wirkte das Geschäft wie ein großer Keller, dessen Ende ich wegen des Dämmerlichts in den hinteren Ecken nicht erkennen konnte. Ich weiß nur, dass man für Pfeffer, Kaffee und Lorbeerblätter nach links gehen musste, bis zu einem Tisch, hinter dem mächtige Schränke standen, die von der Decke bis zum Boden mit Schubladen bestückt waren. Papier wiederum, Tinte, Teller und Gläser wurden an einem Tisch auf der rechten Seite verkauft, wo Schränke mit Glasscheiben standen; für Seife und Stärke ging man bis ganz nach hinten, wo Fässer und Holzkisten zu sehen waren.
Selbst die Decke wurde noch genutzt. In langen Reihen hingen dort mit Senfkörnern und Farben gefüllte Blasen, eine gewaltige Lampe mit Schirm, die im Winter den ganzen Tag brannte, ein ganzes Netz voller Flaschenkorken, und schließlich – ein ausgestopftes Krokodil mit einer Länge von vielleicht anderthalb Ellen.
Inhaber des Geschäfts war Jan Mincel, ein alter Herr mit rotwangigem Gesicht und einem Büschel weißer Haare unterm Kinn. Zu jeder Tageszeit saß er, bekleidet mit einem Hausmantel aus Barchent, weißer Schürze und weißer Zipfelmütze, in einem lederbezogenen Sessel am Fenster. Vor ihm auf dem Tisch lag ein dickes Buch, in das er die Einnahmen notierte, und gleich über seinem Kopf hing ein Bündel Knuten, die in erster Linie zum Verkauf vorgesehen waren. Der alte Herr nahm das Geld entgegen, gab den Kunden den Rest heraus, machte Notizen in seinem Buch, nickte von Zeit zu Zeit kurz ein und behielt trotz dieser Vielzahl an Aufgaben den Handel im ganzen Geschäft genauestens im Auge. Er war es auch, der, zur Erheiterung der Passanten auf der Straße, hin und wieder an der Schnur des Kosaken zog, der dann im Schaufenster Purzelbäume schlug. Und er war es schließlich, der uns, was mir am wenigsten gefiel, für alle möglichen Vergehen mit einer der Knuten aus dem Bündel strafte.
Ich sage: uns, denn wir waren drei Kandidaten für die leibliche Züchtigung – ich und die beiden Neffen des Alten, Franc und Jan Mincel. Die Wachsamkeit des Prinzipals und seine Geschicklichkeit in der Handhabung der Knuten sollte ich gleich am dritten Tag meines Eintritts ins Geschäft am eigenen Leib zu spüren bekommen: Franc wog einer Frau für zehn Groszy Rosinen ab. Da ich sah, dass eine Rosine auf die Ladentheke gekullert war und der Alte die Augen gerade geschlossen hatte, hob ich sie unauffällig auf und aß sie. Eben wollte ich einen Kern aus meinem Mund nehmen, der mir zwischen den Zähnen saß, als ich etwas an meinem Rücken spürte, das sich anfühlte, als streifte mich ein glühendes Eisen. »Du Schelm!«, schrie der alte Mincel, und bevor ich recht wusste, wie mir geschah, hatte er mir noch mehrere Hiebe mit der Knute verpasst, vom Scheitel bis zur Sohle. Ich krümmte mich vor Schmerz, und von dem Tag an wagte ich es nie wieder, etwas aus dem Laden in den Mund zu stecken. Mandeln, Rosinen, ja selbst süße Hörnchen hätten mir nur wie Pfeffer geschmeckt. Nachdem er mich so gezüchtigt hatte, hängte der Alte die Knute wieder auf, trug die Rosinen in sein Buch ein und begann mit friedfertigster Miene an der Schnur des Kosaken zu ziehen. Und wie ich so sein lächelndes Gesicht und seine gütig blinzelnden Augen betrachtete, konnte ich kaum glauben, dass dieser freundliche Greis solche Kraft in den Armen besitzen sollte. Nun erst erkannte ich auch, dass der Kosak vom Innern des Geschäfts viel weniger lustig wirkte als von der Straße.
Unser Geschäft führte Kolonial- und Galanteriewaren sowie Seifen und Drogerieartikel. Die Kolonialwaren verkaufte Franc Mincel, ein Bursche von etwas über dreißig mit rötlichem Haarschopf und verschlafenem Gesichtsausdruck. Er war es, der die Knute seines Onkels am häufigsten zu spüren bekam; er rauchte Pfeife, stand morgens immer erst spät hinter der Ladentheke, stahl sich des Nachts aus dem Haus, vor allem aber wog er ungenau die Ware. Der jüngere hingegen, Jan Mincel, ein linkischer und ausgesprochen sanftmütiger Bursche, wurde manches Mal geschlagen, weil er farbiges Papier entwendete und darauf Briefe an junge Damen schrieb. Einzig August Katz, der bei den Seifen arbeitete, musste keine groben Züchtigungen über sich ergehen lassen. Er war ein kleiner magerer Bursche, der sich durch außerordentliche Pünktlichkeit auszeichnete. Frühmorgens erschien er zur Arbeit, schnitt Seife und wog Stärke ab wie ein Automat, aß, was er vorgesetzt bekam, wofür er sich in die dunkelste Ecke des Ladens kauerte, fast, als schämte er sich, menschliche Bedürfnisse zu zeigen. Um zehn Uhr abends verschwand er irgendwohin.
In dieser Umgebung verbrachte ich acht Jahre, deren jeder einzelne Tag allen anderen so ähnelte wie ein Tropfen herbstlichen Regens den anderen Herbstregentropfen. Morgens stand ich um fünf Uhr auf, wusch mich und fegte den Laden. Um sechs sperrte ich auf, öffnete die Fensterläden. Im selben Moment tauchte August Katz auf, legte seinen Mantel ab, band sich eine Schürze um und nahm schweigend seinen Platz zwischen dem Kernseifenfass und dem Turm aus gelben Seifenstücken ein. Danach eilte der alte Mincel durch die Hintertür herein, brummte: »Morgen!«, rückte seine Zipfelmütze zurecht, holte das dicke Buch aus der Schublade, nahm im Sessel Platz und zog ein paarmal an der Schnur des Kosaken. Erst nach ihm erschien Jan Mincel und stellte sich, nachdem er dem Onkel die Hand geküsst hatte, hinter seine Theke, auf der er im Sommer Fliegen fing und im Winter mit dem Finger oder der Faust irgendwelche Figuren zeichnete. Franc musste gewöhnlich geholt werden. Gähnend und mit verschlafenen Augen küsste er seinen Onkel flüchtig auf die Schulter und kratzte sich den ganzen Tag den Kopf auf eine Art, die entweder von großer Müdigkeit oder von großen Sorgen zeugen mochte. Es verging kaum ein Morgen, an dem der Onkel nicht bei seinem Anblick das Gesicht verzog und fragte: »Na, und wo hast du Schelm dich wieder herumgetrieben?«
Indessen erwachte auf der Straße das Leben, draußen kamen immer häufiger Passanten vorbei. Hier eine Dienstmagd, dort ein Holzfäller, eine Frau mit Haube, der Schusterjunge, ein Mann mit Eckenmütze zogen in beide Richtungen an den Schaufenstern vorüber wie Figuren in einem bewegten Panorama. Über die Mitte der Straße rollten Wagen, Fässer, Kutschen hin und her. Immer mehr Menschen wurden es, immer mehr Wagen, bis sich schließlich ein einziger großer Straßenstrom bildete, aus dem alle Augenblicke jemand ausscherte und zu uns kam:
»Pfeffer für einen Dreier.«
»Bitte ein Pfund Kaffee.«
»Bitte etwas Reis.«
»Ein halbes Pfund Seife.«
»Für einen Grosz Lorbeerblätter.«
Nach und nach füllte sich das Geschäft, meistenteils mit Dienstmägden und ärmlich gekleideten Frauen. Nun trug Franc Mincel ein besonders mürrisches Gesicht zur Schau: Er zog Schubladen auf und schloss sie wieder, wickelte Waren in Tüten aus dünnem grauem Seidenpapier, eilte die Leiter hinauf und hinab, wickelte wieder etwas ein. All das verrichtete er mit der vergrämten Miene eines Menschen, der sich mühsam ein Gähnen verkneifen muss. Schließlich versammelte sich eine solche Menge an Kunden, dass auch Jan Mincel und ich Franc beim Verkauf zur Hand gehen mussten.
Der Alte schrieb unentwegt in sein Buch, gab Wechselgeld heraus, rückte von Zeit zu Zeit seine weiße Zipfelmütze zurecht, wenn deren hellblaue Quaste ihm vor den Augen hing. Manchmal riss er an dem Kosaken, dann griff er wieder blitzschnell nach einer Knute und ließ sie auf einen seiner Neffen niedersausen. Kaum jemals verstand ich, warum genau er das tat – und die Neffen nannten mir nur ungern den jeweiligen Grund für seinen plötzlichen Zorn.
Gegen acht verebbte der Andrang der Kunden. Dann betrat eine dicke Dienstmagd mit einigen Bechern und einem Korb voller Semmeln das Geschäft – Franc drehte ihr den Rücken zu –, und hinter ihr folgte die Mutter unseres Prinzipals, eine magere alte Dame in gelbem Kleid mit einer riesigen Haube auf dem Kopf und einer Kanne Kaffee in den Händen. Nachdem sie das Gefäß auf dem Tisch abgestellt hatte, sagte die alte Dame mit knarrender Stimme:
»Gut’ Morgen, meine Kinder! Kaffee ist schon fertig …«
Damit begann sie, den Kaffee in die weißen Fayencebecher einzuschenken. Indessen ging der alte Mincel auf sie zu und küsste ihre Hand, wünschte:
»Gut’ Morgen, meine Mutter!« Dafür bekam er einen Becher Kaffee mit drei Semmeln. Nach ihm kamen Franc Mincel, Jan Mincel, August Katz und zum Schluss ich. Jeder küsste der Alten die trockene, mit bläulichen Äderchen gezeichnete Hand, jeder sagte:
»Gut’ Morgen, Großmutter!« Und erhielt dann seinen Becher Kaffee und dazu drei Semmeln.
Hatten wir eilig unseren Kaffee ausgetrunken, sammelte die Dienstmagd die benutzten Becher in den Korb, die alte Dame nahm ihre leere Kanne, und die beiden verschwanden.
Draußen vor dem Fenster rollten weiterhin Wagen vorüber und strömten Menschen in beide Richtungen, immer wieder löste sich jemand aus der Menge und kam zu uns in den Laden.
»Etwas Wäschestärke, bitte.«
»Mandeln für einen Zehner.«
»Lakritz für einen Grosz.«
»Kernseife …«
Gegen Mittag nahm der rege Betrieb an der Kolonialwarentheke ein wenig ab, dafür erschien häufiger Kundschaft bei Jan Mincel auf der rechten Seite des Geschäfts. Hier kaufte man Teller, Gläser, Bügeleisen, Kaffeemühlen, Puppen und bisweilen auch große saphirblaue oder karminrote Regenschirme.
Die Käufer, Frauen wie Männer, waren gut gekleidet, nahmen auf Stühlen Platz, ließen sich alles Mögliche vorführen, feilschten und wollten immer mehr und immer Neues sehen. Ich erinnere mich, dass ich, wenn ich auf der linken Seite des Geschäfts tätig war, stets alle Hände voll zu tun hatte, hin und her eilte, Waren herbeiholte und einwickelte, während auf der rechten Seite meine größte Sorge der Frage galt, was der Kunde eigentlich genau wünschte – und ob er es auch kaufen würde?
Letzten Endes aber verkaufte sich auch hier einiges, ja der tägliche Umsatz in der Galanteriewarenabteilung war um vieles höher als der in der Abteilung für Kolonialwaren oder Seifen.
Der alte Mincel war selbst an den Sonntagen im Geschäft. Morgens betete er, und gegen Mittag rief er mich zu sich, um mir in seinem eigentümlichen Polnisch eine Art Unterricht zu erteilen.
»Sag mir – was ist das? Co jest to? – Das ist eine Schublade – to jest szublada. Sieh nach, was in der szublada drinnen ist. Es ist Zimmet – to jest cynamon. Wofür braucht man Zimmet? Für Suppen, für Süßspeisen braucht man Zimmet. Was ist denn Zimmet? Es ist die Rinde von einem Baum. Wo lebt so ein Zimmetbaum? In Indien lebt der Zimmetbaum. Schau dir den Globus an – dort liegt Indien. Gib mir Zimmet für einen Zehner … Oh, du Spitzbub! … Warte nur, ich geb dir zehn mit der Knute, dann weißt du gleich, wie viel Zimmet du für zehn Groszy verkaufen kannst …«
So gingen wir jede Schublade im Geschäft und die Geschichte einer jeden Ware durch.
War Mincel dann noch nicht müde, diktierte er mir Rechenaufgaben, ließ mich die in den Geschäftsbüchern verzeichneten Erträge summieren oder geschäftliche Briefe schreiben. Mincel liebte die Ordnung, er konnte keinen Staub ertragen und wischte ihn noch von den winzigsten Gegenständen. Einzig die Knuten brauchte er, dank seiner sonntäglichen Vorträge in Buchhaltung, Geographie und Warenkunde, niemals abzustauben.
Im Laufe mehrerer Jahre gewöhnten wir uns so sehr aneinander, dass der alte Mincel mich nicht mehr missen wollte und ich mit der Zeit sogar seine Knute als etwas zu betrachten begann, das seinen festen Platz innerhalb der familiären Beziehungen besaß. Ich weiß noch, wie es mir unendlich leidtat, als ich einen teuren Samowar beschädigt hatte, und Mincel nicht zur Knute griff, sondern lediglich sagte:
»Sieh nur, was du getan hast, Ignacy, was hast du nur getan!«
Lieber wollte ich Hiebe mit allen Knuten bekommen, als noch einmal diese zittrige Stimme hören und diesen zutiefst betrübten Blick sehen zu müssen.
An Werktagen nahmen wir das Mittagessen im Geschäft zu uns, zuerst die beiden jungen Mincels und August Katz, danach ich, gemeinsam mit dem Prinzipal. An Feiertagen gingen wir alle nach oben und setzten uns zusammen an einen Tisch. Zu Heiligabend machte Mincel uns Geschenke, und seine Mutter stellte für alle unter größter Geheimhaltung einen Weihnachtsbaum auf. Und am ersten Tag des Monats bekamen wir unser Gehalt. Ich verdiente zehn Złoty. Bei der Gelegenheit musste auch jeder seine gesammelten Ersparnisse vorlegen: ich, Katz, die beiden Neffen und die Dienstboten.
Keine Ersparnisse anzulegen – oder besser gesagt: nicht jeden Tag ein paar Groszy zurückzulegen – war in Mincels Augen ein Vergehen, das einem Diebstahl gleichkam. In meiner Erinnerung gab es in unserem Geschäft einige Gehilfen und mehrere Lehrlinge, denen unser Inhaber nur deswegen kündigte, weil sie nichts zurückgelegt hatten. Der Tag, an dem er das herausfand, war jedes Mal der letzte Tag ihrer Anwesenheit. Da halfen keine Versprechungen, Schwüre, Handküsse, ja nicht einmal Kniefälle. Der Alte saß ungerührt in seinem Sessel, er würdigte die Bittsteller keines Blickes, wies mit dem Finger auf die Tür, wiederholte nur: Fort, fort …! Das Prinzip des Sparens war bei ihm eine geradezu krankhafte Marotte geworden.
Dieser grundgute Mensch hatte einen einzigen Makel – er verabscheute Napoleon. Zwar sagte er selbst nie etwas darüber, doch bekam er beim bloßen Klang des Namens Bonaparte einen regelrechten Wutanfall, sein Gesicht lief bläulich an, er spie aus und schrie: »Dieser Schelm! Spitzbub! Der elende Räuber!«
Als ich die schändlichen Beschimpfungen zum ersten Mal hörte, fiel ich fast in Ohnmacht. Ich wollte dem Alten schon etwas Grobes entgegnen und zu Herrn Raczek laufen, der damals bereits mit meiner Tante verheiratet war.
Da sah ich, wie Jan Mincel hinter vorgehaltener Hand etwas murmelte und Katz vielsagende Blicke zuwarf. Ich spitzte die Ohren – und das sagte Jan:
»Unsinn erzählt der Alte, nichts als Unsinn! Napoleon war ein Teufelskerl, und sei es nur, weil er diese Schwabenschufte in die Flucht geschlagen hat. Stimmt doch, Katz, ist es nicht so?«
August Katz kniff seine Augen zusammen und schnitt weiter Seife. Ich war überrascht, doch in diesem Moment schloss ich Jan Mincel und August Katz ins Herz. Mit der Zeit fand ich heraus, dass es in unserem kleinen Geschäft zwei große Parteien gab, von denen die eine – der alte Mincel und seine Mutter – die Deutschen verehrte, während die andere – die jungen Mincels und Katz – sie verabscheute. Soweit ich mich erinnere, war ich als Einziger neutral.
1846 erreichte uns die Nachricht von Louis Napoleons Flucht aus dem Gefängnis. Jenes Jahr war für mich von großer Bedeutung, erstens, weil ich zum Gehilfen wurde, und zweitens, weil unser Prinzipal, der alte Jan Mincel, verstarb, und zwar unter recht merkwürdigen Umständen.
In dem Jahr gingen die Umsätze in unserem Geschäft ein wenig zurück – zum Teil wegen allgemeiner Unruhen, zum Teil, weil der Prinzipal etwas zu häufig und etwas zu laut auf Louis Napoleon geschimpft hatte. Die Menschen kamen nicht mehr ganz so gern zu uns, ja es schlug uns sogar jemand – vielleicht war es Katz? – eine Fensterscheibe ein. Dennoch lockte dieser Zwischenfall die Kunden eher an, als sie abzuschrecken, und eine Woche lang machten wir Umsätze wie nie, die Nachbarn wurden neidisch. Als die Woche vergangen war, flaute der Andrang aber wieder ab, und bisweilen herrschte Leere im Laden.
Eines Abends, als der Prinzipal nicht da war – schon dies war ungewöhnlich –, landete abermals ein Stein im Geschäft. Erschrocken liefen die beiden Mincels hinauf, den Onkel zu holen, Katz rannte auf die Straße, um den Übeltäter zu suchen, da führten zwei Polizisten jemanden herein – und wer war das? … Niemand Geringeres als unser Prinzipal, den sie beschuldigten, die Scheibe nicht nur dieses, sondern auch letztes Mal selbst eingeschlagen zu haben! Vergeblich wehrte sich der alte Herr – man hatte nicht nur seinen Anschlag beobachtet, sondern auch einen Stein bei ihm gefunden … Der arme Kerl wurde ins Rathaus abgeführt.
Nach vielen Erklärungen und Rechtfertigungen verlief die Sache natürlich im Sande, doch hatte der Alte jegliche Lebenslust verloren und magerte zunehmend ab. Eines Tages setzte er sich in seinen Sessel beim Fenster und stand nicht mehr auf. Mit dem Kinn auf dem dicken Handelsbuch, die Schnur des Kosaken in der Hand, war er entschlafen.
Nach dem Tod ihres Onkels führten die Neffen das Geschäft in der ulica Podwale einige Jahre gemeinsam weiter; erst um 1850 teilten sie es sich so auf, dass Franc mit den Kolonialwaren vor Ort blieb und Jan mit den Galanteriewaren und den Seifen in die Krakowskie Przedmieście umzog, in das Lokal, in dem wir uns auch jetzt noch befinden. Wenige Jahre später heiratete Jan die schöne Małgorzata Pfeifer, und diese wiederum gab, als sie verwitwet war – möge er in Frieden ruhen –, ihre Hand Stanisław Wokulski, der auf diese Weise das seit zwei Generationen von den Mincels geführte Geschäft erbte.
Die Mutter unseres Prinzipals lebte noch lange; als ich 1853 aus dem Ausland zurückkehrte, fand ich sie bei bester Gesundheit. Immer kam sie morgens in den Laden herunter, immer sagte sie:
»Gut’ Morgen, meine Kinder! Kaffee ist schon fertig …«
Einzig ihre Stimme wurde von Jahr zu Jahr schwächer, bis sie schließlich für die Ewigkeit verstummte.
Zu meiner Zeit war der Prinzipal Vater und Lehrer für seine Praktikanten und der beflissenste Diener seines Geschäfts; seine Mutter oder seine Ehefrau war die Hausherrin, und sämtliche Familienmitglieder waren Mitarbeiter. Heute nimmt der Inhaber lediglich die Einkünfte aus dem Handel entgegen, er kennt die Geschäftsvorgänge meist nicht einmal, und seine größte Sorge ist, seine Kinder vor dem Kaufmannsberuf zu bewahren.
Ich spreche hier nicht von Stach Wokulski – er hat ehrliche Absichten –, ich denke nur, ganz allgemein, dass ein Kaufmann in seinem Geschäft sitzen und seine Mitarbeiter formen sollte, wenn er anständige Gehilfen haben will.
Andrássy soll sechzig Millionen Gulden für unvorhersehbare Ausgaben gefordert haben. Also bewaffnet sich nun auch Österreich, doch Stach schreibt mir: Es wird keinen Krieg geben. Weil er noch nie unbedacht dahergeredet hat, muss er wohl gut eingeweiht sein in die Politik, er ist doch jetzt nicht wegen seiner Liebe zum Handel in Bulgarien …
Ach, ich wüsste zu gern, was er vorhat. Zu gern wüsste ich das.
4Die Rückkehr
Es ist ein garstiger Sonntag im März; es geht gegen Mittag, doch die Warschauer Straßen sind nahezu leer. Die Menschen bleiben zu Hause oder sie stellen sich in Toreinfahrten unter oder sie suchen in hastender Eile, dem Schneeregen zu entkommen, der auf sie niederfährt. Kaum dass man eine Droschke rumpeln hört, fast alle Droschken stehen still. Die Kutscher verlassen ihre Plätze auf dem Bock, schlüpfen in den Schutz des Kutschkastens, und die Pferde, vom Regen nass und Flocken auf dem Fell, machen den Eindruck, als wollten sie sich unter der Deichsel verkriechen und sich mit den eigenen Ohren zudecken.