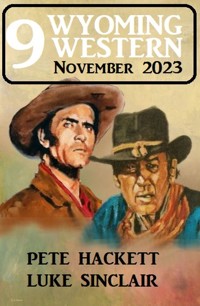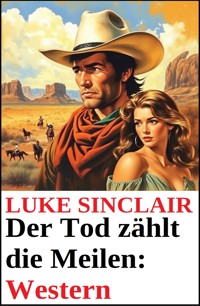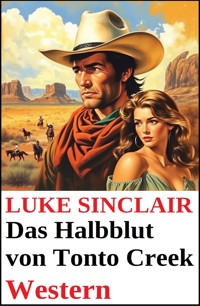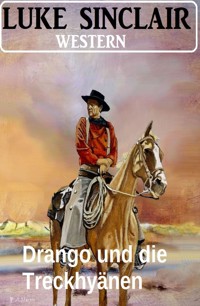Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Da saß ich nun in meiner Zelle und starrte durch das kleine, vergitterte Fenster nach draußen auf die mit Sonne und Staub übersäte Plaza, sah den Männern zu, die dabei waren, einen Galgen zu errichten — meinen Galgen, an dem man mich morgen früh am Halse aufhängen wollte, bis der Tod eintritt…! Könnt ihr euch vorstellen, wie einem dabei zumute ist? Das war wirklich ein Witz, denn es war das erste Mal in meinem Leben, dass man sich meinetwegen so viel Mühe machte. Und wenn es nicht ausgerechnet ein Galgen gewesen wäre, den sie da für mich bauten, dann wäre ich wohl irgendwie gerührt gewesen über so viel Mühe und Eifer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luke Sinclair
Die Rebellen-Lady: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Die Rebellen-Lady: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER EDWARD MARTIN
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Die Rebellen-Lady: Western
Luke Sinclair
Sie ritt mit Ben auf blutigem Trail
*
Da saß ich nun in meiner Zelle und starrte durch das kleine, vergitterte Fenster nach draußen auf die mit Sonne und Staub übersäte Plaza, sah den Männern zu, die dabei waren, einen Galgen zu errichten — meinen Galgen, an dem man mich morgen früh am Halse aufhängen wollte, bis der Tod eintritt…!
Könnt ihr euch vorstellen, wie einem dabei zumute ist? Das war wirklich ein Witz, denn es war das erste Mal in meinem Leben, dass man sich meinetwegen so viel Mühe machte. Und wenn es nicht ausgerechnet ein Galgen gewesen wäre, den sie da für mich bauten, dann wäre ich wohl irgendwie gerührt gewesen über so viel Mühe und Eifer.
Aber wenn ihr mich fragt, weshalb man mir nun plötzlich diese zweifelhafte Ehre erwies, so kann ich nur sagen, dass es eine ganz dumme Geschichte war, so einfach, dass man nicht einmal darüber lachen konnte, und das hatte gewiss nichts mit dem verdammten Ding zu tun, das die Männer da draußen zusammenhämmerten.
Das ganze Theater hatte vor etwa einer Woche begonnen, als ich auf meinem müden Gaul vom Oberlauf des Gila River herüber kam. Eigentlich hatte ich weiter nach Globe gewollt, und ich war nur über diese verdammte Mesa geritten, um nicht den großen Bogen mitzumachen, den der Fluss im Süden um die Gila Bend Mountains herum beschrieb. Es war ein Tag, der selbst die Felsen vor Hitze knistern ließ, und der Wind war so heiß und trocken, dass er die Haut vollkommen ausdörrte, so dass der Staub nur in ihren Falten hängen blieb. Nun, der Gila führte zum Glück noch Wasser, so dass ich nicht bis nach Moody Sprinq oder gar Webb Well hinaufreiten musste.
*
Ich hatte den Rand der Mesa ohnehin fast erreicht, als ich die Schüsse horte, die dünn und knatternd zu mir herauf klangen. Ich trieb den Grauen nur kurz an und ließ ihn noch vor dem steilen Felsabsturz wieder in leichten Trab fallen, um keinen Staub aufzu wirbeln. Denn wo geschossen wird, da hat man für gewöhnlich nicht gern Zuschauer.
Ich hielt an und spähte in das unter mir liegende Land. Der Wind wehte heiß und brausend aus der Tiefe herauf, und ein einsamer Bussard ließ sich von ihm an der gigantischen Felswand emportragen.
Das erste, was mein Blick einfing, war eine Concord-Kutsche, wie sie gewöhnlich auf den Overland Stage Lines eingesetzt wurde. Sie stand etwas schief und war von der Straße abgekommen und gegen einen Felsen geprallt. Zwei der Gespannpferde waren gestürzt und rührten sich nicht mehr, während die übrigen wiehernd und schnaubend an den Geschirren zerrten. Ein einzelner Reiter jagte den Weg zurück, der nach Gila Bend führte, von wo die Kutsche vermutlich gekommen war. Die drei anderen Reiter neben der Concord schossen hinter ihm her. Einer von ihnen machte Anstalten, ihn zu verfolgen, ließ aber sogleich wieder davon ab.
Ich konnte sehen, dass eine Gestalt, vermutlich der Fahrer, leblos in den Riemen des Gespanns hing und von den unruhigen Gäulen hin und her geschaukelt wurde. Von irgendwelchen Fahrgästen konnte ich von hier oben aus nichts erkennen, aber ich sah, wie die Männer etwas, das wie eine große Tasche oder wie eine Kiste aussah, aus dem Wagen holten und auf eines ihrer Pferde luden.
Es war mir sofort klar, was sich da unten abgespielt hatte, und dass ich nichts tun konnte, was den Lauf der Dinge irgendwie beeinflussen würde. Ich würde Stunden brauchen, um von der Mesa zu dieser Stelle hinunter zu kommen. Ich konnte nichts weiter tun, als nachzusehen, ob es vielleicht jemand gab, der dieses Massaker überlebt hatte.
Erst jetzt bemerkte ich einen weiteren Mann, der ein Stück abseits, halb unter seinem Pferd begraben lag. Er musste sich wohl bewegt haben, was meine Aufmerksamkeit geweckt hatte, aber auch die eines anderen.
Einer der Banditen lenkte sein Pferd zu ihm hin und feuerte zwei Kugeln auf den Wehrlosen ab. Dann ritten sie nach Norden in Richtung der Buckeye Mountains davon.
Es dauerte eine Weile, bis der Zorn in mir abklang. Ich selbst hatte auch schon Menschen getötet, aber nicht auf solch eine Art. Schließlich zog ich den Grauen nach links und suchte einen Weg, der mich nach unten brachte.
Es dauerte tatsächlich Stunden, obwohl der Weg mitunter so steil war, dass ich manchmal befürchtete, in einer Lawine aus Staub und Geröll am Fuße dieser Mesa zu zerschellen. Aber irgendwann hatte ich es geschafft. Ein paar Geier hoppelten krächzend wie zornige, hässliche Gnome davon, erklommen einen kleinen Hügel, von dem aus sie böse zu mir herüber glotzten. Fliegen summten über den Leichen und den Pferdekadavern. Der Blutgeruch machte den Grauen nervös, und er wollte nicht mehr weitergehen.
„Alter Ziegenbock!“, knurrte ich misslaunig und kletterte müde aus dem Sattel, ließ die Zügel herunterhängen und näherte mich zu Fuß der Kutsche. Ich hätte mir den Weg von der Mesa herunter sparen können, aber ich hatte ohnehin nicht vorgehabt, da oben zu bleiben.
In der Kutsche fand ich eine Frau und zwei Mexikaner. Die Frau hatte einen Bauchschuss und war vermutlich erst vor einer halben Stunde gestorben. Die Mexikaner hatten sich offensichtlich zur Wehr gesetzt, aber der Überfall musste zu unerwartet gekommen sein. Der Mann unter seinem Pferd war durch zwei Schüsse in den Kopf getötet worden.
Ich drehte mich um und feuerte einen Schuss auf die Geier ab, die sich unter Gekreisch und mit geräuschvollen Flügelschlägen entfernten.
Der entkommene Reiter würde die Kunde von diesem Überfall schnell nach Gila Bend bringen. Es bestand also kein Grund für mich, etwas in dieser Richtung zu unternehmen. Die Gäule, die noch immer in dem Gespann standen, äugten misstrauisch zu mir herüber. Ursprünglich hatte ich den Gedanken gehabt, sie loszuschneiden, aber ich ließ es bleiben. Die Leute aus Gila Bend würden sie vielleicht zum Abtransport der Toten brauchen. Außerdem vermochten sie wohl, die Geier für eine Weile fernzuhalten.
Die Fährte der drei Banditen war deutlich zu erkennen. Ich folgte ihr, ohne eigentlich recht zu wissen weshalb, denn eigentlich ging mich die Sache nichts an. Aber ich war nun mal der erste, der den Ort des Überfalls erreicht hatte.
Ein paar Meilen weiter nördlich hatten sie den Gila überquert und waren eine Strecke weit am anderen Ufer entlang geritten, um den Fluss danach von neuem zu überqueren. Ich konnte keinen Sinn in diesem Manöver sehen, zumal sie damit nicht versucht hatten, ihre Spuren zu verbergen. Sie waren dann plötzlich vom Fluss abgebogen und hatten die Richtung nach Webb Well eingeschlagen. Wenn ich mich beeilte, konnte ich diese Wasserstelle noch vor Einbruch der Dunkelheit erreichen. Aber schon nach der Hälfte des Weges bemerkte ich, dass ich es mit ganz gerissenen Halunken zu tun hatte. Die Fährte wurde schwächer und bog ganz plötzlich scharf nach Süden ab. Die Burschen hatten sich ausgerechnet, wann ihnen ein Aufgebot aus Gila Bend folgen könnte. Die Verfolger würden annehmen, sie seien nach Webb Well geritten und würden vermutlich ihren Ritt auch nach Einbruch der Dunkelheit dorthin fortsetzen, um den Vorsprung aufzuholen und die Fährte dann dort wieder aufzunehmen. Aber bei Webb Well würden sie keine Spuren finden, da die drei Banditen inzwischen nach Moody Spring abgebogen waren. Auf diese Weise würde ein Aufgebot mindestens einen ganzen Tag verlieren. Doch sie hatten nicht damit gerechnet, dass ihnen jemand bereits nach wenigen Stunden folgen würde.
Die Dunkelheit überraschte mich natürlich lange bevor ich Moody Spring erreichen konnte, aber ich setzte jetzt meinen Weg fort. Es war nicht anzunehmen, dass sie den gleichen Trick noch einmal anwenden würden, denn wer beim ersten Mal darauf hereinfiel oder auch nicht, beim zweiten Male würde er es ganz gewiss nicht tun.
Der Mond war längst hoch am Himmel, als ich Moody Spring erreichte. Eine tödlich lauernde Stille lag über der Wasserstelle, und ich hielt mein Pferd an. Allzu große Stille hatte mich stets misstrauisch gemacht. Wasserstellen in der Wüste konnten Leben retten, aber sie hatten auch schon viele Leben gefordert, eben weil man dort hin muss, um zu überleben. Das wussten nicht nur Raubtiere, die an den Tränken auf Beute lauerten. Auch Indianer und andere Menschenjäger hatten Wasserstellen oft als Todesfallen benutzt. Die meisten Menschen vergessen alle Vorsicht, wenn der Durst sie zu einer Quelle treibt.
Ich glitt leise vom Pferd und zog das Gewehr aus dem Scabbard. Vorsichtig repetierte ich eine Patrone in den Lauf, wobei ich das Schloss der Waffe mit meiner Jacke bedeckte, um das Geräusch zu dämpfen. Den Hammer ließ ich halb gespannt, zog die Stiefel aus und ließ sie bei dem Grauen zurück.
Geduckt und geräuschlos schlich ich näher an die Wasserstelle heran, die in schroffe Kalksteinformationen eingebettet lag. Im Schatten eines Busches blieb ich hocken. Ich konnte den Platz von hier aus gut übersehen. In der Nähe des Wassers hielt sich jedenfalls niemand auf. Vermutlich waren die drei Kerle längst weitergezogen. Aber irgendein düsteres Gefühl warnte mich.
Der Mond spiegelte sich in dem schwarzen, leicht gekräuselten Wasser wie ein böse funkelndes Auge, und der laue Nachtwind wehte zu mir herauf. Er brachte einen schwachen Geruch von Rauch und Holzasche mit sich. Sie waren hier gewesen oder noch da, der Teufel mochte das wissen.
Ich versuchte, die Stelle auszumachen, wo das Feuer gebrannt hatte. Auf der anderen Seite des Wasserloches bei den Felsen musste es sein. Etwas Unheimliches bewegte sich in der Grabesstille, ohne dass ich etwas erkennen konnte. Dann bemerkte ich die Feuerstelle und daneben etwas Dunkles, das irgendwie nicht dahin gehörte. Aber im selben Moment zogen ein paar Wolkenfetzen vor die Dreiviertelscheibe des Mondes, und der Vorhang fiel auf der Bühne unter mir.
Dieser Ort war nicht geheuer, aber jetzt konnte ich mich bewegen, ohne gesehen zu werden. Ich lief zwischen den Felsen hindurch und den Hang hinunter. Der Wind strich über die heißen Felsen und tastete mit lautlosen Fingern meine Gestalt ab. Nur das leise Rascheln war zu hören, mit dem meine Hosenbeine durch die niederen Sträucher und das harte Gamma-Gras strichen.
Irgendetwas fiel in die erloschene Glut der Feuerstelle. Ein paar Funken glommen auf wie tanzende Irrlichter in der Finsternis und verlöschten wieder. Die Felsen schienen düster und drohend zusammenzurücken.
Ich umrundete das Wasserloch und näherte mich dem dunklen Etwas, das ich im schwachen Sternenschimmer ausmachen konnte. Es war eine Gestalt, aber sie bewegte sich nicht. Sie war vornüber gesunken und halb in die Asche des erloschenen Feuers gefallen.
Ich packte sie an der Schulter und zog sie zurück. Der Kopf des Mannes klappte unnatürlich weit nach hinten.
In diesem Moment gaben die Wolkenfetzen den Mond wieder frei, und ich sah das dunkel glänzende Blut, das die ganze Gestalt besudelt hatte. Jemand hatte ihn mit einem scharfen Messer den Hals halb durchtrennt.
Ich schaute mich rasch um. Das Wasser lag schwarz und schweigend in einem großen Kreis in der Mulde. Rechts von mir peitschte plötzlich ein Gewehr durch die bleierne Stille. Die Kugel klatschte gegen die Felsen. Ich hob den Kopf und grinste in das blasse Mondlicht. Sie hatten mich also schon bei Tageslicht auf ihrer Fährte bemerkt und hier auf mich gewartet.
Ich ließ den Toten los und lief schnell um das Wasser herum. Eine Kugel fauchte pfeifend in das Wasser. Dann war ich zwischen den Felsen und hielt inne, während eine weitere Kugel mich nur mit Sand und Steinsplittern überschüttete und davon jaulte. Ich hielt das Gewehr bereit, schoss aber nicht zurück, da ich von Munitionsverschwendung nichts hielt.
Jenseits der Felsen, die Moody Spring umschlossen, schnaubte ein Pferd, und Hufe trommelten dumpf auf sandigen Boden. Die Geräusche verklangen in der Nacht, und es war wieder so still wie zuvor.
Im Schatten der Felsen arbeitete ich mich leise den Hang hinauf. Ein böiger Wind strich über die Höhe und flüsterte mit Geisterstimmen im dürren Gras. Nach einigem Suchen fand ich die Stelle, wo ihre Gäule gestanden hatten, aber weder von diesen, noch von ihren Reitern war etwas zu sehen. Ihre Spuren verloren sich in den Schatten der Nacht zwischen Gestrüpp und Ungeheuern aus Stein, die starr und unbeweglich zu mir herüber glotzten.
Es hatte keinen Sinn, ihnen in der Nacht zu folgen, aber es war gut, zu wissen, dass sie nicht mehr da waren. Ich suchte das Gelände rund um die Wasserstelle ab, konnte aber kein weiteres lebendes Wesen mehr entdecken. Die Spuren hatten von drei Pferden hergeführt, soviel hatte ich in der Dunkelheit erkennen können, und da nicht damit zu rechnen war, dass der Tote zu Fuß hierhergekommen war, konnte es nur einer der drei Kerle gewesen sein. Vielleicht hatten sie begonnen, auf diese Weise ihr Geld aufzuteilen.
Ich füllte meine Wasserflasche, tränkte das Pferd und ritt dann etwa eine Meile vom Wasser weg, um mein Lager aufzuschlagen und bis zum Morgen noch etwas Schlaf zu finden.
*
Am Mittag hörte das Klopfen und Sägen draußen auf, und es wurde still auf der Plaza. Ich stieg auf den Schemel, um durch das Gitterfenster sehen zu können.
Die Männer waren mit ihrer Arbeit noch nicht fertig. Sie waren nur nach Hause gegangen, um ihr Mittagsmahl einzunehmen und dann schwitzend zu ihrer Arbeit zurückzukehren, angestachelt zur Eile von ihren keifenden Frauen, die mit perverser Begierde das Schauspiel am nächsten Morgen erwarteten.
Da hatte ich es doch besser als sie. Hier drinnen gab es keine keifenden Weiber, keine Arbeit in praller Sonne. Ich war für mich allein, hatte meine Ruhe und ein schönes Zimmer mit Blick auf den Galgen. Und zu allem Überdluss hatte ich auch noch ein reines Gewissen.
Ich warf mich fluchend auf das harte Lager und öffnete die Augen erst wieder, als Sheriff Ange die Tür aufschloss und mir das Essen brachte. Seine hagere Gestalt reichte fast bis zum oberen Türrahmen. In der einen Hand hielt er die dampfende Blechschüssel und in der anderen den Revolver.
Ich richtete mich auf.
„Bleib, wo du bist!“, warnte er, bückte sich und stellte, ohne mich aus den Augen zu lassen, die Schüssel mit Bohnen auf den Fußboden.
„Lass nicht aus Versehen deinen Ballermann hier“, sagte ich ironisch, „diese Bohnen sind mir schon richtig an’s Herz gewachsen.“
Er zog seine Oberlippe hoch und entblößte die Zähne, was wohl ein Grinsen sein sollte. „Diese Bohnen geben Kraft, und die wirst du morgen brauchen, schätze ich.“ Er richtete sich wieder auf. „Eigentlich wollte ich dich fragen, Ob du für’s Abendessen einen besonderen Wunsch hast, aber jetzt kenne ich ja deinen Geschmack. Diese Bohnen sind auch wirklich empfehlenswert.“
Während er bereits die Tür hinter sich zuwarf, sprang ich von meinem Lager hoch. Die Blechschüssel knallte gegen die Tür und schepperte auf den Boden. Die Bohnen rutschten zäh und ölig an dem harten Holz herunter.
Ich setzte mich wieder hin und fuhr mir mit den Fingern durch die Haare. Eine wirklich verdammte Geschichte, aber als ich an jenem Morgen bei Moody Spring die Spuren dieser drei Gäule aufgenommen hatte, wusste ich noch nicht, in was ich mich da eingelassen hatte.
Die Spuren der drei Gäule waren recht undeutlich. Offensichtlich hatten die Männer versucht, sie unkenntlich zu machen, was ihnen auf diesem Boden nicht ganz gelungen war. Sie waren wohl nicht davon überzeugt, dass ihre Kugeln mich außer Gefecht gesetzt hatten oder als Warnung genügten, mich von ihrer Fährte abzuhalten. Sie wussten nicht, wer ich war, und das machte sie unsicher und vorsichtig. Sie wechselten häufig die Richtung, aber ich konnte trotzdem ihre Route vorausahnen. Sie musste am Nordrand der Gila Bend Mountains verlaufen, dort war das Gelände günstig, um Verfolger abzuschütteln.
Als ich den Wollsey Peak links von mir liegen hatte, musste ich mir jedoch eingestehen, dass ich die Fährte verloren hatte. Ich folgte trotzdem weiter der eingeschlagenen Richtung, in der Hoffnung, sie wiederzufinden, aber ich legte Meile um Meile zurück, ohne den geringsten Erfolg zu haben. Ich beobachtete aufmerksam das Land, konnte aber nirgendwo die kleinste Staubwolke erkennen.
Vielleicht war es ihnen gelungen, ein gutes Versteck zu finden, in dem sie erst einmal abwarten konnten. Wer sich nicht bewegt, hinterlässt auch keine Spuren. Aber ich wusste es nicht, und es hatte keinen Sinn, weiter ziellos in ein Land vorzudringen, in dem es kaum Wasser, dafür aber herum streifende Apachenhorden gab, für die ein einzelner Reiter eine leichte Beute darstellte. Hinzu kam, dass mein Gaul auf dem harten Steinboden etwas unsicher im Tritt wurde. Etwas mit seinem rechten Vorderhuf musste nicht in Ordnung sein.
Ich glitt aus dem Sattel und fluchte leise vor mich hin, als ich den Huf untersuchte. Das Eisen war sehr stark abgelaufen, und ein Stück davon musste schon seit einiger Zeit fehlen. Der Gaul musste dringend neu beschlagen werden.
Mochte die beiden Kerle also der Teufel holen. Ich hatte getan, was ich konnte, und beschloss, mich nun wieder um meine eigenen Angelegenheiten zu kümmern.
Ich kehrte um, ritt aber vorsichtshalber nicht auf meiner eigenen Fährte zurück, sondern etwas weiter nördlich.
Ich war noch nicht sehr weit gekommen, als ich plötzlich schräg vor mir eine Staubwolke sichtete, die schon recht nahe war, weil mir eine Felsengruppe bis jetzt die Sicht versperrt hatte. Zuerst glaubte ich, jene beiden Halunken vor mir zu haben, an deren Versteck ich eventuell vorbeigeritten war. Aber als ich den Grauen anhielt und genauer hinsah, erkannte ich, dass es viel mehr Reiter waren und dass sie genau meiner Spur folgten, die ich vorhin hinterlassen hatte. Ich hatte keinerlei Versuche unternommen, meine Fährte auszulöschen, und so war sie recht gut zu lesen. Und mit einem Male wurden mir die verhängnisvollen Umstände klar, die mich in eine üble Lage bringen konnten.
Ich schaute meine eigene Fährte hinter mir an und konnte sogar vom Pferderücken aus deutlich das beschädigte Eisen erkennen.
Eine markante Fährte, der die Männer da drüben vom Ort des Überfalles aus bis hierher mühelos gefolgt waren. Wie sollte ich ihnen glaubhaft machen, dass ich mit diesem Schurkenstreich nichts zu tun hatte?
Auf jeden Fall war es besser, wenn ich ihnen nicht begegnete und diese Gegend so schnell wie möglich hinter mich brachte. Hier hatte ich allerdings keinerlei Deckung, deshalb trieb ich den Grauen auf eine scharfkantige Felsengruppe zu. Aber die Männer des Aufgebotes hatten mich ebenfalls schon gesehen, schwärmten aus und folgten mir.
Vielleicht hatte ich alles falsch gemacht, aber jetzt befand ich mich bereits auf der Flucht, und es gab keine Chance mehr, das rückgängig zu machen. Es hatte nun auch keinen Zweck mehr, dass ich mich dort zwischen den Felsen versteckte. Ich musste reiten. Aber ich brauchte keine halbe Meile, um einzusehen, dass ich es nicht schaffen würde. Das beschädigte Eisen klirrte hell auf dem harten Felsboden. Ich versuchte, auf sandigeren Boden zu gelangen, doch der Graue verlor stetig an Tempo. Ein Blick zurück machte zur Gewissheit, dass die Verfolger mich bald einholen mussten. Auch mein Fluchen half mir nicht weiter. Ich hielt an und rutschte aus dem Sattel.
Das verdammte Eisen war locker. Ich zog daran, bis mir die Finger schmerzten, aber ich brachte es nicht vom Huf weg. Resigniert richtete ich mich auf und schaute den Verfolgern entgegen.
Ich konnte natürlich kämpfen, aber wenn ich einige von ihnen dabei töten musste, dann gab es nichts mehr, was mich vor dem Galgen retten konnte.
Ich wartete, bis sie heran waren und im Halbkreis um mich herum anhielten. Staub wehte zu mir hin, und ich musste husten. Es gab nicht einen unter den neun Reitern, der nicht seine Waffe auf mich gerichtet hatte, und ich fand es irgendwie lächerlich.
„Waffen weg!“, befahl Sheriff Ange völlig überflüssigerweise, denn ich war bereits dabei, meinen Gurt abzuschnallen.