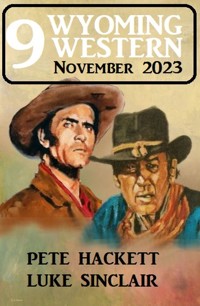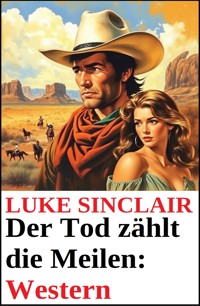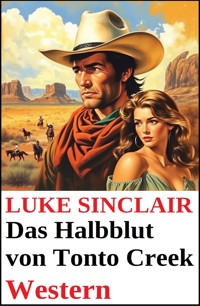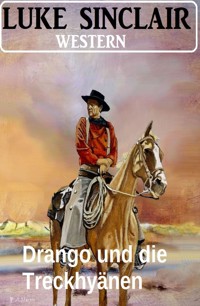Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Gringo kämpft für die Verzweifelten. Chaca! Ein Satan in Menschengestalt! Halb Apache, halb Mexikaner, verbreitete dieser Bastard Angst und Schrecken, wo immer er mit seiner wilden Horde über die mexikanischen Ortschaften herfiel. Frauen und Kinder bekreuzigten sich vor dem Schlafengehen und beteten, dass sie vor Chaca bewahrt blieben. „Wehe uns, wenn Chaca kommt!“, lief der Angstschrei durch die Reihen der Mexikaner. Und als Limes Fargo diesen Angstschrei vernahm, da konnte er nicht achtlos weiterreiten. „Hilf uns, Gringo...!“ Und Lemis Fargo nahm den Kampf für die Verzweifelten auf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Luke Sinclair
Wehe uns, wenn Chaca kommt: Western
Inhaltsverzeichnis
Copyright
Wehe uns, wenn Chaca kommt: Western
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Wehe uns, wenn Chaca kommt: Western
Luke Sinclair
Ein Gringo kämpft für die Verzweifelten.
Chaca! Ein Satan in Menschengestalt! Halb Apache, halb Mexikaner, verbreitete dieser Bastard Angst und Schrecken, wo immer er mit seiner wilden Horde über die mexikanischen Ortschaften herfiel. Frauen und Kinder bekreuzigten sich vor dem Schlafengehen und beteten, dass sie vor Chaca bewahrt blieben.
„Wehe uns, wenn Chaca kommt!“, lief der Angstschrei durch die Reihen der Mexikaner.
Und als Limes Fargo diesen Angstschrei vernahm, da konnte er nicht achtlos weiterreiten.
„Hilf uns, Gringo...!“
Und Lemis Fargo nahm den Kampf für die Verzweifelten auf.
*
Er hielt vorsichtig sein Pferd an, rollte die Zigarette zwischen den trockenen Lippen und kniff die Augen gegen den aufsteigenden Rauch zusammen. Es war verdächtig still in dem Hohlweg zwischen den rissigen Felsschroffen. Verfilztes Buschwerk aus Mesquite und Sage machten den Weg unübersichtlich und gefährlich. Jetzt, da er das Pferd angehalten hatte, war die Stille noch bedrückender. Das Tier spielte nervös mit den Ohren.
Ein kollerndes Pfeifen irgendwo in den Büschen ließ ihn fast zusammenzucken. Von der anderen Seite kam die Antwort.
Limes Fargo öffnete die Lippen und ließ die Zigarette achtlos herunterfallen. Jeder Nerv in seinem Körper spannte sich. Er drängte das Pferd hart an den Fels und zog behutsam das Gewehr aus dem Sattelschuh. Es war heiß und windstill, und er spürte, wie ihm der Schweiß aus den Poren quoll. Seine Blicke glitten wachsam umher, bereit, jede noch so kleine Bewegung einzufangen.
Wieder erklang jenes Zwitschern zweimal kurz hintereinander. Es war ganz in der Nähe.
Limes Fargo dachte an die Fährte, die bereits zweimal an diesem Tage seinen Weg gekreuzt hatte. Die Fährte zweier Reiter.
Es war kein Zufall, daran zweifelte er jetzt nicht mehr. Sie mussten ihn den ganzen Tag über beobachtet haben. In dem offenen Gelände hatten sie sich nicht an ihn herangewagt. Aber hier musste er auf der Hut sein.
Er hätte diesen Bergen ausweichen können, aber er hatte früh im Leben gelernt, dass man Gefahren dieser Art nicht beseitigen konnte, indem man ihnen aus dem Weg ging. Die Burschen wären ihm vermutlich weiter gefolgt, um ihn in der Nacht zu überraschen.
Das Gewehr in seinen Händen ruckte plötzlich hoch. Das Schnappen des Schlosses klang ungewöhnlich laut, als er die Waffe blitzschnell repetierte. Zwischen den Felsen hatte er eine undeutliche Bewegung wahrgenommen. Aber dann blies er erleichtert die Luft aus. Ein Präriehuhn huschte von einer Felszacke zur anderen und ließ ein kollerndes Pfeifen hören. Von irgendwo kam die Antwort.
Fargo lächelte schwach und legte das Gewehr quer über den Sattel. Dann drückte er die großen Sporen kaum merklich gegen das Fell des Pferdes und nahm mit der Linken die Zügel auf.
„Na los, mein Alter. Ich glaube, wir sind zu nervös.“
In den Jahren des Umherstreifens hatte er es sich angewöhnt, zu seinem Pferd zu sprechen. Viele Männer, die allein waren, taten das.
Der Rehbraune setzte sich in Bewegung. Er machte genau drei Schritte, bis der Schuss durch den engen Hohlweg donnerte. Die Kugel erwischte Fargo an der Schulter und riss ihn vom Pferd. Hart schlug er auf dem steinigen Boden auf und verlor sein Gewehr. Der Rehbraune wieherte schrill und rannte davon. Fargo wusste nicht, ob es Staub oder Nebel war, was plötzlich seine Sicht verschleierte. Irgendwo war das näher kommende Stampfen von Pferdehufen. Schüsse peitschten hell und scharf. Eine dumpfe Apathie drohte nach ihm zu greifen, aber der stechende Schmerz in seiner Schulter hielt ihn bei Sinnen. Ein eiserner Wille hämmerte ihm ein, nicht aufzugeben. Neben seinem Gesicht spritzte eine kleine Fontäne rötlichen Staubes hoch, und er hörte das hässliche Surren des breitgeschlagenen Bleigeschosses. Trotz der Schmerzen, die sich durch seinen Körper fraßen, rollte er sich auf den Rücken und riss den Revolver aus dem Holster. Ein lautes Wiehern klang auf, gefolgt von einem heiseren Röhren. Fargo feuerte auf die dunkle Gestalt, die schemenhaft durch den Nebel geisterte. Ein großer Hut, flatternde Haare, eine verzierte Jacke mit Bändern und Schnüren. Das alles wirbelte vor ihm hoch, wurde zu einem zuckenden Knäuel, das wie von einer Riesenfaust über die Kruppe des Pferdes und in den brodelnden Staub gefegt wurde.
Fargos halbwache Sinne registrierten einen zweiten Reiter. Ein Pferd war plötzlich dicht vor Fargo, es stampfte und rollte mit den Augen. Fargo erkannte den Reiter, der dem verängstigten Pferd brutal seinen Willen aufzwang. Das Tier wollte immer wieder ausbrechen, aber der Mexikaner riss erbarmungslos an den Zügeln. Fargo bemerkte den Revolver in der Faust des Mannes und hob die eigene Waffe. Er sah das Mündungsfeuer in der staubgeschwängerten Luft aufzucken. Ein Hammerschlag schien seinen Oberschenkel zu treffen, und ein heißer, stechender Schmerz raste durch sein Bein. Im Zusammenzucken riss er den Stecher seiner Waffe durch und jagte mit zusammengebissenen Zähnen Schuss auf Schuss hinaus.
Die Gestalt auf dem Pferd krümmte sich zusammen, der Revolver fiel irgendwo in den Staub. Das Tier warf wiehernd den Kopf hoch und raste los. Sein Reiter kippte rückwärts aus dem Sattel, blieb mit einem Stiefel im Steigbügel hängen und wurde mitgeschleift. Über den Lauf seiner Waffe hinweg starrte Fargo ihm nach, bis er hinter einer Wolke brodelnden Staubes verschwand. Dann erst sank sein Kopf nach hinten, und der Revolver entfiel seiner Hand. Mit einem Male schien ihn alle Kraft zu verlassen. Eine seltsame Schwäche breitete sich in ihm aus und schien jeden Gedanken zu lähmen.
Er wusste nicht, wie lange es gedauert hatte, bis sein Gehirn wieder klar funktionierte. Aber es konnte nicht sehr lange gewesen sein, denn die Sonne stand noch weit über dem Horizont. Er hob den Kopf an und spürte sogleich die bohrenden Schmerzen in der linken Schulter. Das Hemd war an dieser Stelle warm und klebrig. Er biss die Zähne zusammen und stützte sich auf den rechten Ellenbogen. Erneute Schmerzen im rechten Oberschenkel entlockten ihm ein schwaches Stöhnen. Er erinnerte sich, dass ihn dort eine Kugel getroffen hatte. Rasch blickte er umher. Die Pferde waren weg. Außer einem toten Mexikaner war nichts zu sehen. Der Fluch, den er auf den Lippen hatte, erstickte unter einem abermaligen Stöhnen, als er sich bewegte.
Verdammt, er lag hier wie ein angeschossenes Wild, das auf sein Ende wartet. Das rechte Hosenbein war dunkel und vom Blut getränkt. Er musste verbluten, wenn er hier liegenblieb, aber es würde auch kaum jemand kommen und ihm helfen. Wenn noch mehr von diesem Gesindel in der Nähe war, musste er die Schüsse gehört haben. Diese Männer würden kurzen Prozess mit ihm machen.
Es blieb ihm keine andere Möglichkeit, er musste versuchen, hier wegzukommen. Was hatte er schon zu verlieren? Sein Leben war ohnehin keinen verdammten Schuss Pulver mehr wert, wenn er hier liegenblieb.
Es gelang ihm, sich aufzusetzen und sich nach vorn zu beugen. Mit den Fingern tastete er das Bein ab und spürte die Ausschusswunde. Die Kugel hatte nur einen Teil des Muskels durchschlagen und einen verhältnismäßig kurzen Wundkanal hinterlassen.
Er löste das Halstuch und schlang es um den Oberschenkel. Mit den Zähnen und der rechten Hand zog er den Knoten so fest, wie es ihm seine Kräfte erlaubten, und schob den provisorischen Verband auf der Wunde zurecht. Aus der Schulterverletzung fühlte er erneut das Blut hervorbrechen. Er presste die Hand darauf und schaute sich um.
Alles war weg. Er hatte kein Wasser und keinen Proviant. Und hier gab es weit und breit keinen Ort, wo Menschen wohnten. Jedenfalls kannte er keinen solchen.
Neben ihm lag noch sein Revolver. Er lud die Trommel neu und steckte ihn ins Holster. Dann nahm er sein Gewehr und rutschte zu dem toten Mexikaner hinüber. Die Schmerzen trieben ihm die Tränen in die Augen, aber er hielt durch. Er musste es einfach, wenn er auch nur eine winzige Chance haben wollte.
Er riss dem Toten das Hemd vom Körper und schob die schmutzigen Fetzen unter seine Jacke, die er über der Brust zuknöpfte. Die Blutung an der Schulter musste eingedämmt werden, wenn er die nächsten Stunden überleben wollte. Er zog das Messer aus dem Stiefelschaft des Toten und schob es hinter seinen Gürtel. Dann lehnte er sich gegen einen Stein und überlegte, wohin er sich wenden sollte. Dort, woher er kam, war nichts als trockene, menschenleere Einöde. Er konnte es nicht einmal bis zum nächsten Wasserloch schaffen. Was ihn in anderer Richtung erwartete, war ungewiss, aber wenn es überhaupt eine Chance gab, dann konnte sie nur dort liegen.
Prüfend tastete er nach dem Stoffballen unter der Jacke. Er saß noch an derselben Stelle und drückte auf die Wunde. Wenn er Glück hatte und die Schulter nicht viel bewegte, würde der Blutverlust erträglich bleiben. Aber zuerst musste er versuchen, auf die Füße zu kommen.
Er stemmte das gesunde linke Bein auf den Boden, stützte sich auf sein Gewehr und stemmte sich hoch. Der Schmerz trieb ihm den Schweiß aus den Poren. Er schwankte ein wenig, aber er blieb aufrecht. Einen Moment stand er so da und presste die Zähne aufeinander. Dann humpelte er los. Er konnte das verletzte Bein bei jedem Schritt nur ganz flüchtig belasten, und jedes Mal zuckte es in seinem hageren Gesicht. Er wusste nicht, wie lange er das durchhalten konnte.
Hinter der nächsten Wegbiegung blieb er stehen. Auf einer freien Stelle wuchsen dürres Gras und trockenes, verästeltes Gebüsch. Hastig humpelte er darauf zu und ließ sich auf den Boden sinken. Mit dem Messer des Mexikaners schnitt er einen kräftigen Stock heraus, der weiter oben eine annähernd gleichmäßige Gabelung auf wies.
Es dauerte fast eine Stunde, bis er den Ast zu einer primitiven Krücke zurecht geschnitzt hatte.
Nach kurzer Ruhepause stemmte er sich hoch und klemmte die Astgabel unter seine rechte Achselhöhle. Sein Mund war nur noch ein blasser, dünner Strich, als er sich fortzubewegen begann. Aber mit der Krücke ging es bedeutend besser, als wenn er sich weiterhin auf das Gewehr gestützt hätte.
Als es zu dunkeln begann, hatte er nicht viel mehr als zwei Meilen hinter sich gebracht. Er erreichte einen schrägen Hang, auf dem spärliches, von der Sonne verbranntes Gras wuchs. Seine Schritte waren schleppend, und er konnte sich nur noch mit äußerster Willenskraft fortbewegen. Seine große, hagere Gestalt war schmutzig und verschwitzt, seine Lippen trocken und rissig. Er wusste nicht, wo er sich befand. Aber konnte ihm das nicht egal sein? Bald würde die Nacht über ihn hereinbrechen, und am Morgen würde er vielleicht nicht mehr am Leben sein.
Mühsam humpelte er weiter. Die Schmerzen bohrten dumpf und gefräßig. Sie waren überall, und er wusste kaum noch zu sagen, wo sie ihren Ursprung hatten.
Es würde kalt werden in der Nacht, und er hatte keine Decke. Das Gewehr, das er an einem Streifen Stoff über die Schulter gehängt hatte, war ihm hinderlich, aber er konnte es nicht wegwerfen. Ein Mann ohne Gewehr war noch weniger wert als einer, der schon halb tot war.
Plötzlich hob er den Kopf und lauschte. Der Tag war zu einem winzigen Rest rötlichen Lichtes zusammengeschmolzen, das von Westen her über die Felsen schimmerte.
Limes Fargo hatte sich nicht getäuscht, er hörte es ganz deutlich; etwas bewegte sich dort, wo der Grashang nach Westen abfiel. Er konnte nicht ausmachen, was es war. Er humpelte bis in den Schatten einer Felswand und lehnte sich mit dem Rücken gegen das raue Gestein.
Es kostete ihn einige Mühe, das Winchestergewehr von der Schulter zu holen, ohne dabei die Krücke fallen zu lassen. Er hielt die Mündung der Waffe gegen einen Stein gepresst und drückte mit der einen Hand, die er zur Verfügung hatte, den Repetierhebel nach vorn. Das Geräusch klang überlaut in der Stille. Er lehnte sich schweratmend gegen den Fels und wartete, das Gewehr schussbereit in der Rechten.
Wieder vernahm er diese scharrenden Geräusche. Von einem Pferd konnten sie kaum stammen. Vielleicht bewegte sich dort jemand zu Fuß. Er fühlte seine Kräfte schwinden. Lange konnte er so nicht regungslos verharren. Die Muskeln in seinem gesunden Bein verkrampften sich. Er verlagerte sein Gewicht mehr auf die Krücke, und beißende Schmerzen durchzogen sofort seine wundgescheuerte Achselhöhle, in der Schweiß und Schmutz brannten. Er stieß keuchend die Luft aus, unterdrückte dann aber jeden weiteren Laut, um sich nicht zu verraten.
Es wurde rasch dunkler, und er konnte kaum noch etwas erkennen. Dann bemerkte er eine Bewegung auf dem Kamm des Hanges und hob den Gewehrlauf. Aber er bemerkte sogleich, dass er zu schwach war für einen sicheren Schuss. Er konnte die Waffe mit einer Hand nicht ruhig halten. Der stählerne Lauf schwankte hin und her und blinkte matt im letzten Rest des Lichtes. Er presste die Zähne aufeinander und versuchte, seine Erschöpfung zu überwinden.
Doch dann ließ er plötzlich das Gewehr sinken und blies langsam die Luft aus. Er schwankte leicht hin und her und suchte mit seiner Stütze neuen Halt am Boden.
Die rundliche Gestalt eines Schafes bewegte sich über den Rücken des Hanges, ein zweites folgte und dann noch ein drittes. Fargo stand gegen den Wind, so dass sie ihn nicht wittern konnten. Er rührte sich nicht und starrte auf die Tiere, die sich im dämmerigen Licht des Abends bewegten. Wo sich Schafe aufhielten, da mussten auch Menschen sein. Aber solange er auch wartete, er konnte keinen entdecken. Hatten sich diese Tiere verirrt und waren in den Bergen verwildert? Die Fülle ihrer Pelze zeigte, dass sie längere Zeit nicht geschoren worden waren. Doch das wollte nichts beweisen.
Die Schafe zogen in einiger Entfernung langsam an ihm vorbei. Er musste ihnen folgen! Wenn er Glück hatte, dann konnte es für ihn die Rettung bedeuten.
Vorsichtig stieß er sich mit dem Rücken von der Wand ab und humpelte hinter ihnen her.
Plötzlich begannen die Schafe schneller zu laufen. Vermutlich hatten sie ihren Verfolger bemerkt oder sich vor etwas anderem erschreckt.
Limes Fargo war wie von Sinnen. Eine Art Panik erfasste ihn. Ungeachtet der Schmerzen, die ihn quälten, beschleunigte er seine Gangart, um die Tiere nicht aus den Augen zu verlieren.
Schon nach wenigen Schritten stolperte er. Die Krücke verfing sich in irgendwelchem Wurzelwerk, und er stürzte. Er hörte sein heiseres Stöhnen, als er auf den Boden schlug, kollerte über eine abschüssige Stelle und blieb in einer Mulde liegen, unfähig, sich noch einmal aufzurichten.
Er spürte, wie ihm der Schweiß aus allen Poren brach und das Blut warm aus seiner Schulterwunde quoll. Er riss den Mund auf und sog die kühle Luft ein, die der Abend brachte. Aber die höllischen Schmerzen ließen nur ein flaches Atmen zu. Das Gewehr hatte er beim Sturz verloren. Auch die Krücke war jetzt nicht mehr wichtig. Bis hierher war er gekommen. Und wenn er am Morgen noch genügend Blut in den Adern hatte, dann konnte er sich erneut darüber Gedanken machen, wie er von hier wegkam. Aber im Moment war nichts in ihm als gähnende Leere. Der letzte Rest von Energie in ihm schien erloschen. Und durch all sein Elend drangen die Schmerzen mit quälender Pein.
Seine Hand tastete unter die Jacke und schob den blutgetränkten Klumpen aus Stofffetzen höher. Fest krallten sich seine Finger hinein und pressten ihn auf die Wunde. So dämmerte er in einem Zustand dahin, der an der Grenze zwischen Bewusstsein und endlosem Dunkel hin und her pendelte.
*
Fargo war im Lauf der Nacht mehrmals wach geworden. Jetzt war ein grauer Morgen über das Land gezogen, der mit nasser Kälte seinen ausgelaugten Körper durchdrang. Er fühlte sich, als hätte er keinen Tropfen Blut mehr in den Adern. Sein erster Griff galt der verletzten Schulter. Die Stofffetzen waren auf der Wunde angetrocknet. Das war gut so. Auf diese Weise hatte er doch nicht allzu viel Blut verloren. Er schob seinen Körper in eine bessere Lage und schaute um sich. Sein rechtes Bein tat weh wie die Hölle. Er fuhr sich stöhnend mit der Hand über den Oberschenkel.
Langsam verging die Schwäche. Fargo richtete sich etwas hoch und schaute über das Land. Die Schafe waren weg, aber er gab die Hoffnung noch nicht ganz auf. Vielleicht gelang es ihm doch noch, auf Menschen zu stoßen. Oder hatte er das alles nur geträumt? Dieser Gedanke jagte einen Schauer des Erschreckens durch seinen Körper. Er griff sich mit der Hand an den Kopf, aber seine Stirn fühlte sich kalt an. Verdammt, er war doch gestern Abend bei Sinnen gewesen! Es musste ihm gelingen, ihre Fährte zu finden!
Sein Gewehr lag wenige Schritte entfernt an der Böschung, über die er am Abend hinabgestürzt war. Langsam schob er sich darauf zu, bis er es mit der Hand erreichen konnte. Seine Glieder waren noch steif und ungelenk von der Kälte der Nacht, aber die ersten Sonnenstrahlen tasteten sich bereits zaghaft über die zackigen Berge am Horizont.
Er nahm das Gewehr und rutschte wieder in die Mulde hinab. Es musste schon seit einer Weile hell sein, und er wollte keine Zeit mehr verlieren, ehe die Hitze des Tages kam und ihm vielleicht den Garaus machte.
Plötzlich schreckte er zusammen. Da kam jemand durch das niedrige Chapperal auf ihn zu.
Das Gewehr war noch gespannt. Er hob es hoch, ließ es aber sogleich wieder sinken und hielt den Kopf schief, so dass der Hutrand seine Augen beschattete.
Das da vor ihm war ein Mexikanerjunge von vielleicht sechs oder sieben Jahren.
Fargo ließ mit dem Daumen den Hahn der Waffe behutsam nach vorn gleiten und wartete, bis der Junge heran war. Dieser schien etwas zu suchen. Er trug eine ausgefranste helle Leinenhose und ein angeschmutztes Hemd aus dem gleichen Stoff. Aber für ein Mexikanerkind sah er dennoch verhältnismäßig sauber aus.
Der Junge blieb kurz stehen, als er den großen Mann reglos in der Mulde hocken sah, und kam dann näher.
„Hallo, niño“, sagte Fargo und nickte leicht mit dem Kopf.
„He, du. Hast du meine Schafe gesehen?“, fragte der Junge. Dann starrte er den fremden Gringo an.
„Du blutest ja. Hast du eine Schießerei mit Banditen gehabt?“
Fargo beherrschte die spanische Sprache gut genug, um den Jungen zu verstehen.
„Ja“, sagte er, „ich kann es wohl nicht verheimlichen.“
Der Junge hielt den Kopf schief.
„Die haben dich aber ganz schön fertiggemacht.“
„Es waren mindestens zwanzig“, schnitt Fargo auf. Der Kleine sah ihn ungläubig staunend an.
„Und du hast sie alle erwischt?“
Fargo machte ein säuerliches Gesicht.
„Nicht alle, ein paar haben sich davongemacht.“
„Wie viel hast du denn erwischt?“
„Du willst es aber genau wissen“, stöhnte Fargo. „Na mindestens fünfzehn.“
Der Junge riss die Augen auf.
„Au, fein“, stieß er hervor, „das muss ich Mama erzählen, sie wird sich mächtig darüber freuen. Vielleicht war Chaca auch dabei.“